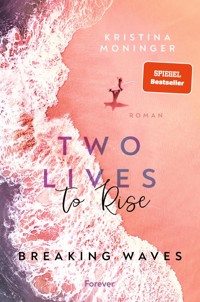9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anni war sich noch nie so sicher: In Lukas hat sie die Liebe ihres Lebens getroffen. Dabei wollte sie ihrem Nachmieter doch nur die Schlüssel für die Wohnung in die Hand drücken – und ganz bestimmt nicht ihr Herz. Doch vom ersten Moment an spürt sie eine einzigartige Verbindung zu Lukas. Neun magische Tage und Nächte verbringen sie zusammen – bis Anni einer Wahrheit auf den Grund kommt, die ihre Liebe unmöglich macht. Zehn Jahre später ist Anni eine andere geworden. Zusammen mit dem aufstrebenden Schriftsteller Ben und seiner Tochter lebt sie in einem kleinen Häuschen an der Elbmündung. Hier in Glückstadt scheint alles perfekt – bis Anni von der Vergangenheit eingeholt wird. Aber wie hätte sie ahnen können, dass Ben und Lukas sich begegnen? Und dass damit ein Teil ihres Lebens ans Licht kommt, den sie bisher auch vor Ben verheimlicht hat …?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kristina Moninger
Neun Tage Wunder
Roman
Über dieses Buch
Was tust du, wenn du nach neun magischen Tagen erfährst, dass eure Liebe keine Zukunft hat?
Anni war sich noch nie so sicher: In Lukas hat sie die Liebe ihres Lebens getroffen. Dabei wollte sie ihrem Nachmieter doch nur die Schlüssel für die Wohnung in die Hand drücken – und ganz bestimmt nicht ihr Herz. Doch vom ersten Moment an spürt sie eine einzigartige Verbindung zu Lukas. Neun magische Tage und Nächte verbringen sie zusammen – bis Anni einer Wahrheit auf den Grund kommt, die ihre Liebe unmöglich macht.
Zehn Jahre später ist Anni eine andere geworden. Zusammen mit dem aufstrebenden Schriftsteller Ben und seiner Tochter lebt sie in einem kleinen Häuschen an der Elbmündung. Hier in Glückstadt scheint alles perfekt – bis Anni von der Vergangenheit eingeholt wird. Aber wie hätte sie ahnen können, dass Ben und Lukas sich begegnen? Und dass damit ein Teil ihres Lebens ans Licht kommt, den sie bisher auch vor Ben verheimlicht hat …?
«Eine wunderschöne Liebesgeschichte – herrlich gefühlvoll, romantisch und fesselnd.» Meike Werkmeister, Spiegel-Bestsellerautorin
«Humorvoll und lebensklug macht Kristina Moninger Mut, sich selbst zu verzeihen. Ich habe das Buch wahnsinnig gern gelesen.» Nikola Hotel, Spiegel-Bestsellerautorin
Vita
Kristina Moninger wurde 1985 in Würzburg geboren und hat ihre Kindheit in einem kleinen Dorf auf dem Land verbracht. Dort lebt sie auch heute noch mit ihrem Mann und ihren Zwillingen. Nach einer kaufmännischen Ausbildung hat sie ein Übersetzerstudium abgeschlossen. Ihre größte Leidenschaft jedoch gehört dem Schreiben. Sie hat bereits sehr erfolgreich mehrere Romane veröffentlicht. Nach der Spiegel-Bestsellerreihe «Breaking Waves» kommt mit diesem Roman nun ihre neue große Liebesgeschichte.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2024 by Kristina Moninger
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01664-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Susi – endlich!
Eine Eintagsfliege lebt nur einen Tag. Aber sie lebt für diesen Tag.
Prolog
Ich wollte aufstehen und gehen. Oder zumindest etwas sagen.
«Es ist so schön, dich zu halten», flüsterte Lukas und drückte mich an sich. Er legte seine Hand an meine Wange. Und ich konnte mich nicht von ihm lösen, weil warme Arme und heiße Küsse so viel verführerischer waren als kalte Worte und eisige Erkenntnis.
Er blinzelte schläfrig, streckte seine langen Beine und löste seine Hand. Dann verknotete er seine Finger mit meinen, als wären wir unzertrennlich, als wäre das hier ein Anfang und nicht das Ende. Noch waren seine Augen geöffnet. Und die kleine Sorgenfalte, die eigentlich immer zwischen seinen Brauen lag, war kaum noch sichtbar. Bis vor wenigen Augenblicken hatte ich genauso empfunden – wie geglättet von Glück. Und doch hatte ich nicht eine einzelne Sekunde dieses absurd schönen Gefühls verdient.
Lukas hatte keine Ahnung, um wen er da seinen Arm legte, wessen Rücken er langsam, mit müden Fingern streichelte. Schlaftrunken murmelte er ein paar Worte, die ich nicht verstand.
Jetzt wurde sein Atem ruhiger, während mein Puls unheilvoll zu rasen begann.
Oh, mein geliebter Lukas. Wir hatten neun Tage und neun Nächte. All die Zeit schlugen unsere Herzen im Gleichtakt. Aber ich habe unsere Liebe kaputt gemacht, bevor sie begonnen hat. Und es gibt nichts, was ich tun kann, um das zu ändern. Ich dehne hier nur den Moment vor dem Aufprall so lange wie möglich aus. Meine Schuld wiegt schwerer als Liebe.
Kapitel 1Anni
HEUTE
Glückstadt, Kreis Steinburg. Dieses einfache gelbe Schild mit der schwarzen Schrift bringt mich immer noch jeden Tag zum Lächeln. Obwohl ich seit vier Jahren hier lebe und unzählige Male auf den Neuendeich abgebogen bin, verlieren weder der Weg an der Elbe entlang noch der Ortsname auf dem Schild den Glanz ihres Zaubers.
Anni hat ihr Glück in Glückstadt gefunden.
Wenn ich in unsere Straße fahre, kann ich das Haus nicht sofort sehen. Es liegt ein bisschen verborgen hinter der viel zu hoch gewachsenen Hecke und dem schmalen dreistöckigen Gebäude vorn an der Ecke, in dem früher die Touristeninfo beheimatet war. Sobald es aber erscheint, ist die blaue Tür immer das Erste, was ins Auge sticht. Dabei war sie rot, als ich eingezogen bin. Verwittert und nicht mehr abschließbar. Das Haus mit der Nummer 188a verdankt die blaue Tür mit den weißen Intarsien und den hanseatischen Motiven darauf Bens Kurzgeschichtensammlung. Das neue Dach haben wir ein Jahr später mit dem Vorschuss für seinen vierten Roman angezahlt. Und weil es reetgedeckt sein musste, ist sehr viel von diesem Buch dort hineingeflossen.
«Jemand zu Hause?», rufe ich, nachdem die blaue, schwere Tür hinter mir knarrend ins Schloss fällt, als wäre es ihr viel zu anstrengend, sich ständig unserem Rhythmus beugen zu müssen. «Ich wäre jetzt da!»
Ich hänge den Schlüssel an das Brett mit den kleinen Ankern und trippele mit den Füßen auf der Stelle. Keine zwei Sekunden später kommt ein Fellknäuel um die Ecke gesaust, jault, quietscht und donnert. Das Quietschen sind Fieps’ schlechte Zähne, die aufeinandermalmen, wenn er sich freut. Das Donnern der Schwanz, der an die Wände schlägt. Nach klassischen Gesichtspunkten ist Fieps kein schöner Hund. Er ist ein Mischling, ein wenig kleiner als ein Labrador, drahtig und muskulös. Und er hat die Fellfarbe einer Hyäne. Außerdem verdankt er seiner Husky-Oma zwei unterschiedliche Augenfarben, und sein linkes Hängeohr ist kürzer als das rechte, die Haut daran aufgrund einer Bissverletzung wie ein Blumenkohl gekräuselt. Wenn Symmetrie die Grundlage von Schönheit ist, dann hat Fieps also wirklich schlechte Karten. Aber sein Fell ist weich, seine Augen treu und lieb, und sein Charakter so ausgeglichen und freundlich, dass Kongruenz nur überbewertet sein kann. Seinen Namen verdankt er Bens Tochter Lena und der Tatsache, dass er nicht bellen, sondern eben nur jaulen und fiepsen kann.
Ich beuge mich vor und kraule ihn im Nacken, den er mir fordernd entgegenstreckt. Dabei wollte ich diesen Hund ursprünglich gar nicht haben. Aber jetzt liebe ich ihn. So ist das manchmal im Leben. Mit Menschen und Tieren. Das, was man überhaupt nicht wollte, kann man so sehr lieben, als müsste man das Nicht-Wollen dringend wettmachen.
Ich lehne mich mit der Hüfte an die Wand und seufze. Direkt vor mir prangt der Blutfleck auf dem Holz, der sich nicht hat entfernen lassen. Er stammt von Fieps. Von dem Morgen, an dem wir ihn ins Haus geschleppt haben, mehr tot als lebendig. Als klar war, dass ich an meinem Schwur, kein Tier im Haus zuzulassen, nicht länger festhalten konnte.
Nach der Krauleinheit lasse ich den kleinen Racker raus in den eingezäunten Bereich unseres Gartens und nehme anschließend die Treppe hoch ins Obergeschoss.
Gut, dass Ben und ich beide keine Riesen sind, denn wenn man über 1,90 Meter misst, hätte man hier oben schnell einen steifen Nacken. Der ausgebaute Dachboden ist dank der Rundgauben und der zartgrauen Wände freundlich und hell. Die frei liegenden Dachbalken haben wir in wochenlanger Arbeit abgeschliffen und neu geölt. Wenn ich mit der Hand über die marmorierte Fläche streiche, kann ich dieses Gefühl, das ich hier erstmals gespürt habe, mühelos hervorrufen: ein Gefühl von Heimat und Verbundenheit.
Dieses Haus auf der Warft hat Geschichte geschrieben, schreibt noch immer daran und hört hoffentlich so schnell nicht auf damit. Jedes Mal, wenn ich den Blick schweifen lasse, sehe ich die Kerben. All die kleinen und großen Dramen unseres Lebens hier. Die Stelle über dem Holzrahmen der Tür, die vom Flur ins Gästebad führt, an der Ben sich verbohrt hat, weil er zu verbohrt ist, um zuzugeben, dass handwerkliche Tätigkeiten nicht in seinen Fähigkeitsbereich fallen. Dann ist da die Wand im Wohnzimmer, die wir ständig streichen müssen, weil seine Schwester Maren es nicht lassen kann, Handstände zu üben und dabei Fußspuren zu hinterlassen.
Ich ziehe Rock und Jacke meines Kostüms aus, das nach Bens Aussage im Kleiderschrank immer aussieht wie eine alte Eiche in einem Palmengarten, weil ich sonst lässigere Sachen trage. Und tatsächlich: Immer wenn ich hier unterm Dach stehe und raus auf den Deich und den Leuchtturm sehe, dann fühlt sich meine Arbeitskleidung zu eng und spießig an.
Ben glaubt nicht an die Macht eines Outfits. Er ist, anders als ich, nicht der Ansicht, dass Kleider Leute machen, sondern dass Leute sich viel zu viel aus Kleidern machen. Er trägt am liebsten dunkelgraue Troyer-Pullis, im Sommer alte Band-T-Shirts von Nirvana, Bad Religion oder im schlimmsten Fall von Iron Maiden.
Hastig schlüpfe ich in eine ausgebleichte Mom-Jeans und ein helles, figurbetontes Oberteil, das ich mit einer orange-pinken Strickjacke kombiniere. Da klingelt es schon an der Tür. Das muss Lena sein, Bens Tochter. Ich höre das kurze Hupen, das Lenas Mutter als ausreichenden Gruß betrachtet, wenn sie ihre Tochter abliefert. Die Clara-Schumann-Grundschule, die Lena in Hamburg besucht, hat morgen geschlossen. Und wegen des Geburtstags der Namenspatronin kommt Bens Tochter schon früher in der Woche zu uns raus. Was uns an diesem Donnerstag die Gelegenheit gibt, später noch nach Hamburg zu fahren. Denn Ben hat heute ein Treffen mit seinem Lektor dort, und wir werden nach längerer Zeit mal wieder gemeinsam in der Stadt essen gehen.
Ich lächele beim Gedanken an den kleinen Wirbelwind. Lena wird die nächsten vier Tage bei uns verbringen. Noch jemand, der mir tief und unwiderruflich ins Herz hineingewachsen ist.
Zwei Stunden und vier Runden Rummikub später machen Lena und ich uns auf den Weg.
Beim Einsteigen betrachte ich mich flüchtig im Klappspiegel der Sonnenblende. Die Locken, die ich heute Morgen mit dem Glätteisen in meine schulterlangen, braunen Haare gezaubert habe, halten noch.
«Wollen wir los?», frage ich und drehe mich halb zu Lena auf der Rückbank um.
Als Antwort drückt sie ihre Füße gegen meinen Sitz. Ich könnte wetten, dass sie ihre grünen Sneakers mit der Glitzeraufschrift für diesen Zweck ausgezogen hat, sodass sie mit den Füßen weiter hochwandern kann, bis sie mir damit ein paar Härchen einzwickt. Sie macht es nicht absichtlich, es ist eher eine Art innerer Zwang, die Füße ständig in Bewegung zu halten. Wie Maren, ihre Tante und Bens Schwester, die auch nie stillhalten kann. Ich könnte etwas sagen, weil es mich stört. Aber ich sage lieber nichts. Wäre Lena meine Tochter, hätte ich ihr das mit den Füßen am Sitz vermutlich längst verboten. Aber weil Lena eine Mutter hat, die ihr alles Mögliche verbietet, spiele ich die liebe Stiefmutter. Ein bisschen, weil ich Lena sehr gern habe – und ein bisschen auch deshalb, weil ich trotz all der gemeinsamen Zeit immer noch nicht so genau weiß, was ich darf und was nicht. Mir fehlen die ersten Jahre mit ihr, in denen man angeblich lernt, auf seine Instinkte als Mutter zu hören.
«Kommt Tante Maren auch?», will Lena wissen. Aber sie wartet die Antwort gar nicht ab. «Kann ich Kaugummi?»
«Nein», antworte ich.
«Was jetzt? Maren oder Kaugummi?»
«Maren ist zurzeit doch in diesem Kloster in Bayern», sage ich, bin mir aber selbst nicht ganz sicher, ob das stimmt. Es könnte auch gut sein, dass sie morgen ein Foto vom Ballermann postet und das mit der Askese schon wieder völlig vergessen hat. Bei Bens Schwester, unserer Teilzeitmitbewohnerin, weiß man nie so genau.
«Kaugummi? Kann ich?»
Ben würde sie jetzt zwingen, einen vernünftigen Satz zu formulieren. Oder sie fragen, was «Kann ich Kaugummi?» bedeutet. Kann ich Kaugummi kaufen? Kann ich Kaugummi an die Scheibe kleben? Kann ich Kaugummi runterschlucken?
Aber ich bin ja nicht Ben. Ich bin weder Schriftsteller noch Vater, also sage ich einfach: «Ja.»
Und muss dann grinsen, als Lena auf ihrem Sitz so weit nach unten rutscht, dass sie mir ihren Zeh ins Gesicht strecken kann und mich kurz damit an der Wange anstupst. «Bist die Beste.»
«Auf jeden Fall die beste Kaugummi-kau-Erlauberin aller Zeiten», stimme ich zu.
Ich starte den silbernen VW, der eigentlich der Kanzlei gehört, für die ich arbeite, und setze an den großen blauen Kübeln zurück, in denen die Reste der diesjährigen Geranien vor sich hin herbsteln. Es wird wirklich Zeit, endlich ein paar Kürbisse zu besorgen.
Als ich eine gute Stunde später vor dem Phantom in Hamburg den letzten freien Parkplatz ergattere, fragt Lena: «Was ist eigentlich ein Phantom?» Sie kann hoch zu dem hell erleuchteten Schriftzug sehen. Draußen dämmert es bereits.
Beinahe lautlos manövriere ich das E-Auto in die Parklücke und drehe mich zu ihr um.
«Ein Phantom ist etwas, was man sich einbildet … Jemand, der nicht da ist. Oder jemand, der da ist, den man aber nicht sieht.»
«Ah», sagt Lena und nimmt dankenswerterweise endlich die Füße vom Sitz, um sich ihre Schuhe wieder anzuziehen. Dass ein neunjähriges Mädchen schon solche Stinkefüße haben kann, ist mir unbegreiflich. «Dann ist Nils so etwas wie ein Phantom», fügt sie hinzu.
«Wer ist Nils?»
Lena schaut nicht hoch, während sie mit ächzenden Geräuschen in ihre Sneakers schlüpft. «Na, der Junge aus meiner Klasse, der hinter mir gesessen hat und der letztes Jahr weggezogen ist und jetzt auf eine Waldschule geht.»
«Waldorfschule?»
Sie nickt lässig. «Manchmal drehe ich mich noch um und will was zu ihm sagen, dabei sitzt da jetzt doch Boye.»
Ich lächele, obwohl sich etwas in meinem Bauch schmerzhaft zusammenzieht. Es muss der Hunger sein, denn ich habe mittags nur ein halbes Fischbrötchen gegessen. Donnerstags ist nämlich Christas Nordseetag, und das heißt, unsere Assistentin setzt sich um halb zwölf auf ihr firmengesponsertes Lastenfahrrad und holt für unser kleines Team Fischbrötchen beim «plietschen Heinz». Ich mag Fisch, aber das, was der patente Heinz da zwischen zwei latschige Weizenbrötchenhälften klatscht und mit Mayonnaise überzieht, hat mit Kulinarik so wenig gemein wie mein Abschluss in Strafrecht mit meinen täglichen Aufgaben in der Kanzlei. Unser Chef, Dr. Bjarne Willenburg, allerdings verdrückt die Brötchen mit dem gierigen Blick eines ausgehungerten Seehundes, bis ihm die Mayonnaise überall im üppigen Schnurrbart klebt.
«Los! Los!» Lena springt aus dem Wagen. «Papa ist bestimmt schon da.»
«Ja, bestimmt», sage ich und lächele.
«Hast du eigentlich noch Seepferdchen im Bauch, wenn du ihn siehst?»
«Seepferdchen? Du meinst Schmetterlinge?»
«Nein, Seepferdchen sind viel cooler! Wir haben in Bio gelernt, dass die Männchen da die Kinder auf die Welt bringen.»
Ich muss nicht lange überlegen. «Klar, eine ganze Herde Seepferdchen hab ich im Bauch, wenn ich deinen Papa anschaue.»
Lena grinst zufrieden.
Ben sitzt hinter den Plastikblumen, die den Eingang des Phantom vom Restaurantbereich trennen. Er fällt mir sofort ins Auge. Vor seiner Nase schwebt die Speisekarte. Bestimmt schaut er schon geschlagene zehn Minuten hinein, und ich könnte wetten, dass ein kleiner Block vor ihm liegt, auf dem er notiert hat, was er sich zusammenbasteln will. Ben ist der Albtraum jedes Kellners, er bestellt nämlich grundsätzlich alle Gerichte um. Er gehört zu jener Fraktion, die sich eine Pizza Napoli bestellt, um die Kapern dann durch extra Oliven zu ersetzen und statt der Sardellen Ananas zu ordern. Sodass daraus fast schon eine Pizza Hawaii wird. Allerdings mit extra Käse und Knoblauch.
Ich bin das Gegenteil und weiß bereits, bevor ich sitze, was ich essen werde. Aber wir sind ein gutes Team, denn was Ben an Zeit braucht, um sich zu entscheiden, hab ich schon vorher eingespart.
«Guten Abend, die Damen», sagt er, grinst, aber nicht so breit wie sonst.
Ich lasse mich neben ihm auf die Bank fallen, Lena nimmt den Stuhl uns gegenüber.
«Sind da heute ein paar neue dazugekommen?», frage ich und greife in Bens etwas zu langen Bart. In den letzten Jahren haben sich immer mal wieder ein paar graue Strähnchen in seinen Bart und seine Haare gestohlen. Es steht ihm sehr gut.
«Niemals», erwidert er, hält meine Finger fest und küsst sie.
Ich fasse mit der anderen Hand an seine Stirn und reibe über die Falte, die sich zwischen seinen Augen gebildet hat. «Aber die ist zwei Zentimeter tiefer als gestern, was ist los?»
«Mmmpf», macht er. «Schwieriges Gespräch mit Richard.»
Ich richte mich auf. «Wegen des neuen Manuskripts?»
«Das wird ein Bestseller», erklärt Lena. «Sonst haben die, die das machen, alle keine Ahnung.»
Er sieht sie herausfordernd an. «So wie deine Klassenlehrerin, die immer sagt, dass du bessere Noten haben könntest, wenn du lernen würdest, dass man Wörter am Satzanfang groß schreibt?»
Es klingt nicht böse, ist auch nicht so gemeint, aber die Tatsache, dass Lena in Sachen Schreibfähigkeiten eher nach ihrer Mutter Claire kommt, macht Ben fertig. Lena zieht einen Schmollmund.
«Also, was ist mit dem Manuskript?», frage ich.
Ben macht eine abwehrende Handbewegung. «Ah, das ist wirklich ein unlösbares Problem.»
Ich streiche ihm durch die strubbeligen, haselnussbraunen Haare, die auch zu lang geworden sind. Bens unlösbare Schreibprobleme sind immer sehr dramatischer Natur. Er kann schon mal tagelang vergessen, sich zu rasieren, weil ihm kein passender Name für seinen Protagonisten einfallen will.
«Was würde Angela Merkel tun?», frage ich. Es ist ein Ritual, das wir weiter pflegen, auch wenn die Zeiten der ehemaligen Kanzlerin längst vorbei sind.
«Sich pensionieren lassen und mit Joachim auf eine einsame Hallig ziehen, ohne Internetanschluss und Telefon», seufzt Ben umgehend.
«So schlimm also?»
Er nickt und verzieht das Gesicht.
«Dann lass uns erst das Bestellungsproblem lösen», schlage ich vor und deute auf die Kellnerin, die an den Tisch getreten ist und mich einigermaßen erstaunt aus zusammengekniffenen Augen mustert.
«Ich bringe Ihnen gleich auch eine Karte, wollen Sie zuerst etwas zu trinken?», fragt sie freundlich.
Ich winke ab. «Für mich die Dragon Rolls, die Monkey Kings, die Maki mit Thunfisch-Tatar und einmal Edamame. Und einen Eistee bitte.»
«Sie haben die Karte doch noch gar nicht …», beginnt die Kellnerin irritiert.
«Sie weiß immer genau, was sie will», wirft Ben ein. «Sie studiert die Karte, bevor sie überhaupt das Restaurant betritt.»
Ich trete ihn spielerisch unter dem Tisch, aber er tut so, als würde er es nicht bemerken. Also wende ich mich an die Kellnerin: «Und er stellt die Karte neu zusammen, wenn er schon mindestens eine halbe Stunde im Restaurant sitzt.»
«Äh ja …», sagt die Frau, sichtlich überfordert.
«Die sind immer so», erklärt Lena. «Aber sie haben sich lieb dabei.»
Nach einer gefühlten Ewigkeit, die ich geduldig ertrage, hat auch Ben sich entschieden und gibt seine Bestellung auf. Lena nimmt sowieso immer das Gleiche: Juicy Lucy, wegen des Namens und der Erdbeeren. Und als einziges Kind auf Erden ordert sie freiwillig Kamillentee.
Nachdem die Kellnerin in Richtung Küche verschwunden ist, greift Ben in seinen Rucksack und fummelt endlos lange darin herum. Ich habe ihm schon drei Aktentaschen gekauft und eine Männerhandtasche, aber er weigert sich, sie zu tragen, und besteht auf seinen alten Fahrradrucksack, in dem alles knittert und unschöne Ecken bekommt. Was eigentlich so überhaupt nicht zu ihm passt.
«Da», sagt er schließlich und reicht mir ein weißes Kuvert. «Ludwig heiratet seine Sissi.»
Ich ziehe die Augenbrauen hoch und öffne dann die Lasche des Umschlags. Darin befindet sich eine schlichte, elfenbeinfarbene Einladungskarte. «Auch wir wollen Steuern sparen …», lese ich vor. Darunter steht ein Datum, das keine sechs Wochen vom heutigen Tag entfernt liegt.
Ben schaut mich an. Ich schaue ihn an. Wir denken dasselbe.
«Kauf dir schon mal einen Anzug», erkläre ich und verkneife mir ein Grinsen. «Einen Smoking am besten.»
«Ich geh da nicht hin», sagt er und verschränkt so bockig die Arme vor der Brust, dass Lena kichert und die Geste nachahmt.
Ich nicke. Wissend, dass er doch einknicken wird. Wer seine Eltern mit zwanzig beide innerhalb weniger Wochen an den scheiß Krebs verloren hat, der klammert sich an den Rest seiner Familie. Auch wenn das nur einer der Gründe ist, warum wir am Ende doch auf alle Veranstaltungen gehen, zu denen Bens Bruder uns einlädt. Das Problem mit der lieben Familie kenne ich nur zu gut. Es gibt keinen vernünftigen Grund, zu meinem Vater Kontakt zu halten, und trotzdem telefoniere ich hin und wieder mit ihm. Nur um anschließend erneut festzustellen, dass sich nach meinem Umzug in den Norden nichts geändert hat.
«Du liebst deinen Bruder, du wirst hingehen», sage ich vorsichtig.
«Ich liebe dich», erwidert Ben und brummt weiter vor sich hin.
Also starte ich einen weiteren Versuch. «Wir könnten die Party crashen. Wie wäre es, wenn wir in Gummistiefeln und Badehose erscheinen. Und Lena, du könntest dein Monster-High-Kostüm anziehen!»
Sie nickt begeistert. Bens Haltung entspannt sich ein wenig, und er grinst. Ben hat einen Mund, der sich beim Lachen tatsächlich über die gesamte Breite seines Gesichts zieht. Auch das ist umwerfend
Lena fängt an, von einer neuen Mitschülerin zu erzählen, die aus der 4c zu ihr in die 4a gewechselt ist, und bis das Essen kommt, hat Ben, seinem Gesichtsausdruck nach, das ambivalente Verhältnis zu seinem Bruder wieder verdrängt.
Nach einer großen Portion Juicy Lucy sieht Lena auf, legt ihre Schummel-Stäbchen – die sie so nennt, weil die Hölzchen zusammengeklippt bleiben – auf den Tisch und fragt laut: «Seit wann gibt es eigentlich Sushi? So lange, wie ich auf der Welt bin?»
Ben lacht. «Da warst du noch flüssig, als Sushi erfunden wurde, und Anni und ich vermutlich auch.»
«Wieso flüssig?», fragt Lena.
Ich schaue Ben mit hochgezogenen Augenbrauen vielsagend an.
Der schiebt sich schnell eine Double Shrimp Roll in den Mund und zuckt mit den Achseln, während aus seinem Mund nur noch unverständliche Laute kommen.
«Wieso flüssig?» Lena wendet sich jetzt an mich. Unter dem Tisch bekomme ich ihren Fuß ab. Sie ist schon wieder ohne Schuhe. Wie sie es geschafft hat, die unbemerkt abzustreifen, ist mir ein Rätsel.
«Du solltest ihr das erklären», sage ich seelenruhig zu Ben.
Sein Mund ist leer, und er muss nun doch irgendwie reagieren. Er verhält sich so seltsam kindisch bei allem, was darauf hindeutet, dass seine Tochter in wenigen Jahren kein Kind mehr sein wird.
Ich hebe entschuldigend die Hände. «Du bist ihr Vater.»
«Und du bist ihre Anni», erwidert er. Sein Blick ist ruhig wie seine Stimme, aber beide gehen tief in mein Herz. Es tut gut, dass er nicht etwas so Plakatives sagt wie «Du bist ihre Stiefmutter». Denn als solche verstehe ich mich nicht. Ich bin ihre Anni – das ist einer der schönsten Sätze meines Lebens. Und ich möchte niemand so gern sein wie Lenas Anni. Stinkefüße hin oder her.
«Ihr werdet mir nicht sagen, was das mit dem ‹flüssig› bedeutet, oder?», holt mich Lena aus meinen Gedanken.
«Nein», sagen Ben und ich unisono.
«Dann frage ich Laila, die erklärt mir alles. Sie hat mir auch erklärt, was ein Arschkriecher ist.» Lena reckt ihr kleines Kinn.
«Sie hat dir aber bestimmt auch gesagt, dass du das Wort nicht benutzen sollst», erwidere ich und versuche, Ben telepathisch zu beruhigen.
Aber Lena nickt schon eifrig. «Sie meint, ich soll stattdessen lieber Schleimscheißer sagen, das klingt ekliger.»
Ich unterdrücke ein Lachen, nehme ein Sashimi von Bens Teller und halte es ihm vor den Mund. «Iss, bevor du ausflippst.»
«Ich werde ein ernstes Wort mit Laila reden müssen», sagt er. «Nicht, dass du mich bald einen verdödelten, piefigen, ollen Töffel nennst.»
Lena kichert, wie immer, wenn in Ben das Nordlicht durchkommt, und widmet sich dann glücklicherweise wieder ihrem Teller.
«Wie war denn eigentlich dein Tag?», will Ben wissen und sieht mich an. «Was gibt es Neues in der Kanzlei?»
«Nichts Besonderes», erwidere ich und berichte ein wenig von dem Fall, den Bjarne gerade betreut und den er – entgegen seinen sonstigen Vorlieben – tatsächlich vor Gericht verhandeln will, statt einen Vergleich zu erzielen. «Verkehrsrecht», erkläre ich. «Damit fühlt er sich sicher. Da blüht er richtig auf.»
«Wir sollten Bjarne und Christa mal zu uns einladen. Ich finde sie spannend», sagt Ben und widmet sich dann etwas zu auffällig den letzten Teilchen auf seinem Teller.
Ich lasse meine Stäbchen sinken, mitsamt der Dragon Roll dazwischen. «Seit wann findest du meinen Chef und seine Sekretärin so spannend, dass du einen Abend mit ihnen verbringen willst? Ich zitiere dich: Geh du mal alleine mit deinen Rechtsverdrehern schnacken.»
Ben zuckt mit den Achseln, sieht mich aber nicht direkt an. «Sie ist seit dreißig Jahren heimlich in ihren Chef verliebt – das ist schon spannend.»
«Nein, das ist dämlich», entgegne ich und mustere ihn eingehend. Sein Manuskriptproblem scheint ernster zu sein als gedacht, wenn er sich zur Inspiration Bjarne und Christa einladen will. «Sie könnte seit dreißig Jahren mit ihm glücklich sein, wenn sie sich einfach mal getraut hätte, ihm die Wahrheit zu sagen. Stell dir nur vor, Lena hätte uns nicht verkuppelt? Dann wärst du jetzt mit Natascha verheiratet, der Musiklehrerin, und dein Leben wäre so langweilig wie ein Intermezzo von Richard Strauss.»
Ben verzieht das Gesicht, als hätte ich ihm vorgeschlagen, statt Sushi lebende Nacktschnecken zu verschlingen.
«Aber Christa zeigt sie Bjarne doch, ihre Verliebtheit», widerspricht er dann, einen Mundwinkel nach oben gezogen. «Sie backt ihm Kuchen, sie kauft für ihn ein, kontrolliert seinen Blutzuckerspiegel …»
Wir müssen beide lachen. Christa und Bjarne sind nicht nur für Ben und mich ein Quell dauerhafter Erheiterung, auch unsere Freunde Laila und Markus haben sich dem Fanclub verschrieben. Und seit drei Jahren schließen wir regelmäßig Wetten darauf ab, wann es denn endlich so weit sein könnte, dass die beiden verhinderten Liebenden zueinanderfinden. Bei jedem unserer Treffen, auf jeder Feier muss ich von Christas verzweifelten Versuchen berichten, Bjarne für sich zu gewinnen.
Ben zuckt mit den Schultern. «Christa gehört nun mal der Fraktion Ich kümmer mich, deshalb lieb ich dich an.»
«Du meinst also», sage ich und streiche Ben liebevoll über die Stoppelwange, «Liebe geht noch immer durch den Magen?»
Jetzt seufzt er unerwartet laut und tief. «Wenn ich wirklich Ahnung von der Liebe hätte, dann hätte ich jetzt kein Problem mit meinem Buch. Lass uns über was anderes reden.»
Ich lehne mich zurück und fahre mir über den Bauch, der spannt. Ich bereue das enge Oberteil. «Darüber, dass ich einfach ein zu gutes Jahr hatte?»
«Wieso ein zu gutes Jahr?», will Lena wissen.
«Wie ein Baum», erkläre ich und mache eine Handbewegung in Richtung der großen Plastikpflanzen, auch wenn sie kein Vergleich sind zu den Bäumen in unserem Garten. «In guten Jahren, in denen ein Baum viel Nahrung bekommt und die Bedingungen optimal sind, wächst ein breiterer Ring als in schlechten Jahren.» Ich mache einen Kreis um meine Körpermitte, als hätte sie einen Jupiterring dazubekommen.
Ben grinst. «Ein gutes Jahr also?»
«Vielleicht das beste! Und wer weiß, was noch kommt. Wir sind ja noch nicht fertig.»
«Wir könnten noch vor dem Prinzregenten im Oktober heiraten.» Es kommt leise aus seinem Mund, gefolgt von einem Lachen, das nicht ganz echt klingt. Ben weiß, dass das mit dem Heiraten nichts für mich ist. Ich hab zu oft gesehen, wie es schiefgegangen ist. Bei meinen Eltern. Bei meiner ältesten Schwester Silke. Ich glaube einfach, es klappt besser, wenn man keinen Stempel auf etwas drückt. Das ist eine ungeschriebene Tatsache und gilt nicht nur für Ehen. Sondern auch für Gerichtsurteile, Ausreisedokumente und Mietverträge.
«Auf keinen Fall darfst du deinem Bruder die Schau stehlen! Außerdem müsste ich dann meinen Vater einladen. Unmöglich! Stell dir mal vor, der große Herr Dr. jur. Rabenstein unter all den brotlosen Künstlern …»
Das ist maßlos übertrieben. Ich weiß das, und Ben weiß es auch. Ben ist ein erfolgreicher Schriftsteller, und sein Bruder Julian, von uns spöttisch Prinz Ludwig genannt, ist zwar ein humorloser Typ, aber ein angesehener Drehbuchautor. Wenn man einen Film sieht, in dem niemand lacht, dann hat ihn ganz bestimmt mein Schwager geschrieben. Er hält sich für eine Art deutschen Coppola und würde sicherlich super mit meinem Vater harmonieren. Aber Ben wird ohnehin nie verstehen, warum ich so wenig Kontakt wie möglich nach München pflege. Denn er hält im Gegensatz zu mir alles fest, was es in seinem Leben gibt. Ich dagegen lasse los, wenn es sein muss.
Ich klopfe mir auf die Oberschenkel. «Ich gehe jetzt mal auf Toilette, und wenn ich zurückkomme, will ich alles über das Gespräch mit deinem Lektor wissen.» Ich schüttele den Kopf. «Bjarne und Christa einladen … Also, wenn das deine neue Art von Recherche für Krimis ist, dann solltest du vielleicht doch besser anfangen, Liebesromane zu schreiben.» Ich schnaube belustigt und rutsche dann aus der Bank.
Auf dem Weg zur Toilette drehe ich mich noch einmal um. Ich sehe Lenas kurze, dunkelbraune Haare, die sie wie eine Raverfrisur aus den 90ern mit bunten Haargummis nach oben gebunden hat. Ben tupft mit der Serviette an ihrem Mund herum. Das Wasabi klebt an der anderen Wange, denke ich und schmunzele. Was für ein Glück, mit den beiden in Glückstadt zu leben.
Der hastig getrunkene Eistee drückt unangenehm auf meine Blase, während ich auf eine freie Toilette warte. Ich trippele ein wenig vor dem breiten Spiegel herum, was der Dame vor mir in der Kabine verraten soll, dass es dringend ist. Was manche Frauen auf dem Klo nur machen? Wieso dauert das bei ihnen so lange und geht bei Männern so schnell? Wie kann man freiwillig so viel Zeit in einer öffentlichen Toilette verbringen wollen?
Endlich kommt eine Dame mittleren Alters mit einer Handtasche von der Größe und Farbe einer Zehn-Liter-Gießkanne aus der Kabine. Ich schiebe mich an ihr vorbei und schließe die Tür von innen ab, da fällt mir das Plakat ins Auge. Zuerst denke ich noch amüsiert: Aha, daher weht der Wind, die Frau hat erst noch ausgiebig die Anzeige studieren müssen. Aber als ich mich erleichtert habe, nach oben sehe und noch einen Blick auf das Veranstaltungsplakat werfe, stockt mir der Atem. Der Mann darauf … Ich verschlucke mich beim Luftholen, huste und lege reflexartig die Hand auf meinen Mund. Vor mir hängt ein DIN-A4-Poster, Glanzdruck, befestigt mit vier zu langen Klebestreifen und noch nicht einmal ganz gerade. Es ist so aus meiner Welt gefallen, dass mir schwindelig wird.
«Lukas?», hauche ich halblaut, als könnte mir der Mann auf dem Plakat antworten. Als würde er hier in dieser Toilettenkabine lebendig werden. Ein Hologramm, das mir antwortet. «Was willst du denn hier?»
Plötzlich ist dieser Ein-Quadratmeter-Raum meine persönliche Kapsel in die Vergangenheit.
«Lukas …», sage ich noch einmal leise, diesmal ohne Fragezeichen. Und erst dann betrachte ich das Foto des Mannes genauer: Er hat den Kopf leicht in den Nacken gelegt, sodass sein Adamsapfel zu sehen ist und die kantigen, maskulinen Gesichtszüge betont werden. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, mehr Schatten als Licht. Aber vielleicht gerade deswegen unverkennbar der Mann, dem ich den Ausblick auf die Platanen überlassen habe – und mein Herz. Mit der Erinnerung kommt auch das übel schmeckende Gefühl der Schuld zurück. Denn dort auf dem Plakat ist nicht nur der Mann, den ich einmal so sehr geliebt habe, sondern von dort schreit mir auch die Vergangenheit entgegen: Sieh nur, was du für ein Mensch warst. Schau, was du angerichtet hast.
Sofort senke ich den Blick. Schaue an meiner quietschbunten Strickjacke hinunter, auf die weißen Sneakers, die Lena mit Regenbogen und Einhörnern bemalt hat. Einhörner, die mehr nach Fieps aussehen als nach Pferd mit Horn. Und dann schaue ich wieder hoch, direkt in Lukas’ Gesicht. Zum ersten Mal seit zehn Jahren sehe ich ihn wieder. Zehn Jahre, in denen er sich verändert hat, aber noch immer unverkennbar der etwas zu ernste, geheimnisvolle Lukas ist, den ich einmal so sehr geliebt habe. Ich war der Frühling, er der Herbst. Nie hat das optisch mehr gestimmt als heute.
«Lesereise» lautet der Text über dem Foto, darunter ein paar Daten und Städte. Köln, Hannover, Berlin, Kiel, Hamburg, Lüneburg. Offensichtlich hat Lukas ein Sachbuch geschrieben, eine Art Bildband mit Text, der von fremden Kulturen und den Vorurteilen diesen gegenüber handelt. Das Buch heißt «Klischee ist auch nur eine Nische». Das Cover zeigt eine Weltkarte in Cartoon-Optik, und die Konturen der Länder sind bei genauerem Hinsehen alles Abbildungen kultureller Stereotypen. Spanien schwimmt in Paella, die Umrisse von Deutschland erinnern an ein Handtuch über einem Liegestuhl, und der afrikanische Kontinent ist ein dunkelhäutiger Löwe, der hungrig das Maul aufreißt. Unwillkürlich bin ich so nahe an das Plakat herangetreten, dass ich all diese Feinheiten erkennen kann.
«Entschuldigung», wispere ich. Es tut mir so leid.
Meine Nase berührt jetzt fast Lukas’ Konterfei. Hastig zucke ich zurück, stoße mit meinen Schuhen gegen die Klobürste, erschrecke maßlos über das kratzende Geräusch auf dem Boden – und schließe kurz die Augen.
Als ich sie wieder öffne, sind die Schriftzüge auf dem Plakat verschwommen, als hätten sie sich aufgelöst. Obwohl meine Hose längst wieder da sitzt, wo sie sitzen soll, fühle ich mich nackt. Weil mein Herz ganz plötzlich nicht mehr sitzt, wo es sitzen soll. Wo ich dachte, es festgenäht zu haben.
Meine Hände zittern. Ich will, dass das aufhört. Jetzt sofort. Ich bin Anni aus Glückstadt, und ich verbringe keine Ewigkeiten in Toiletten. Ich bin auch nicht mehr dieser Mensch von damals. Ich bin heute … ein guter Mensch. Oder? Ich habe meinen Fehler von damals nicht wiederholt, ich werde nie wieder einen solchen Fehler machen.
Draußen scharren die nächsten Gäste mit den Füßen, während ich hier stehe und ein Plakat anstarre, als wäre es eine Offenbarung. Aber das ist es nicht, es ist vielmehr mein persönliches Armageddon.
Lukas.
Ich kann ihn nicht mehr ansehen. Nicht einmal in Schwarz-Weiß mit abgewandtem Blick. Hier drinnen kollidiert gerade eine Welt mit der anderen. Die Vergangenheit mit der Gegenwart. Und der Aufprall ist so heftig, dass mein Verstand ein Schleudertrauma erleidet. Plötzlich ist mir, als würde es hier nach Äpfeln riechen statt nach einem Raumduft mit Vanillearoma. Ich sehe tanzende Sommersprossen und höre eine Stimme, die meine Ohren streichelt und dabei doch längst verklungen ist.
Das Plakat muss weg! Damit dieses gallige Gefühl der Reue nicht weiter mein Inneres versäuert. Doch gleichzeitig kann ich nicht aufhören, es anzusehen.
Als sich draußen vor der Tür jemand räuspert, greift meine zitternde Hand wie ferngesteuert nach den Rändern des Posters, will die Klebestreifen entfernen und das Ding abnehmen, es falten und in der Handtasche verstauen, um es später an meiner eigenen Badtür aufzuhängen – oder im Kamin zu verheizen. Beide so gegensätzlichen Wünsche haben die gleiche, starke Zugkraft. Irgendetwas muss ich tun.
Meine Finger rutschen ab, und es geht ein Riss durch das Papier. Genau zwischen den Wortteilen Lese- und -reise hindurch, sauber und richtig getrennt.
Das würde Ben gefallen, denke ich und kneife fest die Augen zusammen. Da ist sie, die Kollision. Ben hat mit diesem Plakat nichts zu tun. Ich werde ihm nie davon erzählen. Er und Lukas sind zwei sauber voneinander getrennte Wörter. Zwei Welten. Leben. Lieben.
Wieder räuspert sich jemand. Warum hat dieser Laden auch nur eine einzige Toilette? Kann man nicht einmal in Ruhe … Wo ist meine Handtasche? Ich drehe mich um die eigene Achse, aber sie ist nirgendwo. Nicht an dem Haken an der linken Wand, nicht auf dem Boden. Die Frau mit der gießkannengrünen Riesenhandtasche huscht durch meinen Kopf, dann das Bild meiner eigenen Tasche, die bei Lena und Ben an einer Stuhllehne baumelt. Draußen, in einer anderen Welt. Meine Jeans hat nur Fake-Taschen. Wohin also mit dem Plakat?
Hastig löse ich die restlichen Klebestreifen und treffe eine Entscheidung. Ich reiße das Papier nach und nach in winzige kleine Stücke. Reiße mir selbst am Herzen herum. An der Stelle, die sich mit meinem Gewissen überschneidet. Es überlagert. Und dann werfe ich einen Schnipsel nach dem anderen ins Klo und spüle Lukas, seine Lesereise, seine Klischees und diesen unverhofften, unverlangten Zwischenstopp in der Vergangenheit hinunter.
Es ist so ziemlich das Dämlichste, was ich je getan habe. Nein, das stimmt nicht. Das Dämlichste war, Lukas zu verraten.
Kapitel 2Anni
DAMALS – noch neun Tage
Nur ein halb gefüllter Karton war noch übrig, es wären aber eher vier vonnöten gewesen. Nicht, weil ich so viele Sachen hatte, sondern weil es mir einfach nicht gelingen wollte, anständig zu packen. Ich hatte alle Umzugskisten sorgfältig begonnen einzuräumen, bis ich jedes Mal bei etwa der Hälfte die Geduld verlor und entnervt Bücher, Klamotten, Dekokram und Bettzeug oben auflegte oder seitlich Stifte, Teepackungen und Sommerschuhe hineinstopfte. Und jetzt, am Ende der Packerei fand ich in den leer geräumten Schubladen und Schränken immer noch Sachen, die ich übersehen hatte. Wollhandschuhe, die sich zwischen zwei Regalen verkeilt hatten, eine ungeöffnete Dose Soßenpulver, eine Lichterkette, die seit vergangenem Weihnachten zum Staubsammeln hinter die Couch geschlüpft war, und eine Geschenkbox von Rituals, an die ich mich beim besten Willen nicht erinnern konnte, an der aber unmissverständlich ein Anhänger mit meinem Namen baumelte. Wenn Ordnung das halbe Leben war, dann musste ich wohl oder übel auf fünfzig Prozent irdischen Daseins verzichten. In der Kanzlei fiel es mir weniger schwer, eine Struktur beizubehalten – oder aber ich strengte mich unter dem kritischen Blick meines Vaters instinktiv mehr an.
Ich trat leicht frustriert gegen den halb vollen Karton, nahm dann den Brotkorb aus Bast, den ich nie benutzt hatte, und quetschte ihn zwischen einen marineblauen Blazer und ein gerahmtes Bild von Silke, Marga und mir, das auf dem Münchner Weihnachtsmarkt vor drei Jahren aufgenommen worden war. Entschlossen, keine weiteren kostbaren Nervenzellen auf den Umzug zu verschwenden, drehte ich mich von dem Durcheinander weg und schaute aus dem Fenster. Der Anblick der Platanenallee war so viel schöner als der meiner in Kisten gepackten, kalt wirkenden Studentenbude. Es fiel mir schwerer als gedacht, Abschied zu nehmen, und ich konnte seit Tagen das Gefühl nicht abschütteln, mit dieser kleinen Wohnung noch nicht fertig zu sein.
Als ich zu Beginn des Jurastudiums aus dem Dachgeschoss meines Elternhauses aus- und hier eingezogen war, hatte ich pure Erleichterung gespürt. Jetzt fühlte ich mich seltsam traurig. Und das, obwohl eine große, helle Neubauwohnung auf mich wartete. Mit viel Platz, um Sachen zu verstauen, mit einer besseren Verkehrsanbindung, eigenem Gym im verglasten fünften Stock und sogar einem Stellplatz in der Tiefgarage.
Vielleicht lag es am Ausblick, der hier einfach unbeschreiblich schön war. Oder daran, dass sich diese Wohnung immer wie mein erstes eigenes Zuhause angefühlt hatte. Eines, das besser zu mir passte als das «Immobilienträumchen» in der Maxvorstadt, das als Belohnung für das bestandene Zweite Staatsexamen auf mich und meine Chaoskisten wartete.
Die Platanenbäume der Straßenallee verloren schon erste Blätter und strahlten pure Sentimentalität aus. Es war das Wetter, die Jahreszeit, der Moment, um sich einzuigeln – nicht, um neu anzufangen.
«Du wirst mir fehlen», murmelte ich.
«Ach ja?», sagte eine tiefe, dunkle Stimme hinter mir. «Wir kennen uns doch noch gar nicht.»
Erschrocken zuckte ich zusammen und wirbelte herum. Ich sah in ein kantiges Männergesicht. Unter dichten, aber gepflegten Brauen saßen ein paar misstrauisch dreinblickende Augen, getrennt durch eine leichte Zornesfalte, die durch einen Schwung lockiger Haare in der Stirn ein bisschen an Ernsthaftigkeit verlor.
«Hallo», sagte er nach einem kurzen Räuspern.
«Hallo», erwiderte ich und fügte unnötigerweise hinzu: «Ich hab mit mir selbst gesprochen.»
Er nickte. «Das passiert mir auch ständig.»
«Wie bist du hier reingekommen?»
Meine Frage blieb unbeantwortet. Vielleicht hatte ich die Wohnungstür nicht richtig geschlossen, als ich die Farben und Pinsel reingeschleppt hatte? Ich würde hier in den nächsten Tagen noch streichen müssen.
Er war viel größer als ich, hatte lange Beine und einen schlaksigen Oberkörper, der in einem abgewetzten olivgrünen Parka steckte. Das dunkelbraune Haar wirkte nicht ungepflegt, aber eindeutig ungekämmt. Er lächelte leicht, wobei sich ein Grübchen in seine Wange legte und so aussah, als würde es auch in Zukunft dort bleiben. Überhaupt hatten seine Züge etwas ungemein Faszinierendes. Denn über dieses ganz und gar männliche Gesicht zogen sich unzählige Sommersprossen, die so herrlich verspielt wirkten, dass sie unmöglich echt sein konnten. Erst recht um diese Jahreszeit, an einem nicht besonders hellhäutigen Typ.
«Also?» Er hatte den Kopf leicht in den Nacken gelegt, was seltsam herausfordernd wirkte, beinahe arrogant.
Wir betasteten uns mit Blicken, die Sekunden dauerten, aber mir vorkamen, als stünden wir schon minutenlang voreinander und übten uns in Vertrautheit. Ich studierte ihn, prägte mir die Details seines Gesichts ein, als hätte ich in diesem Moment schon gewusst, dass ich ihn nie wieder vergessen wollte. Gleichzeitig fragte ich mich, was er sah, wenn er mich anschaute. Ob er zuerst feststellte, wie viel kleiner ich war? Dass ich nicht rundlich war, aber auch nicht dürr? Ob ihm meine Augen auffielen, für deren munteren, blassblauen Glanz ich ab und an Komplimente bekam? Oder sah er meine überproportional langen Finger, von denen meine Mutter behauptete, sie wären hervorragende Klavierspielerhände, die aber gänzlich unmusikalisch waren?
Unsicher schob ich mir eine Strähne meines kinnlangen, braunen Haars aus der Stirn und fühlte das beginnende Lächeln, das um meinen Mund spielte. Ich verspürte den irrwitzigen Wunsch, mich durch seine Augen sehen zu wollen. Als wären sie der Spiegel für etwas, das ich vergessen hatte zu sein. Unter seinem Blick spannten meine Brüste in dem engen weißen Shirt, das ich trug, und meine nackten Beine in dem Jeansrock, für den es eigentlich schon zu kalt war, kribbelten. Der Kontrast zwischen uns beiden war nicht zu übersehen: Ich war barfuß und leicht gekleidet, weil ich nach jedem Sommer das Gefühl hatte, nicht wieder in dicke Klamotten steigen zu können. Er trug grobe Boots und einen dunklen Schal lose um den Hals geschlungen. Ich war der Frühling, er der Herbst.
«Ich bin Lukas. Dein Nachmieter», sagte er. «Die Tür war auf, und ich dachte, die Wohnung steht bereits leer. Die Hausverwaltung meinte, du hättest deine Möbel rausgebracht und wärst wahrscheinlich schon weg.»
«Ich … bin Annika», sagte ich.
«Annika.» Er wiederholte meinen Namen, langsam, betonte das I und die beiden letzten Silben, nicht wie die meisten Menschen die erste. Ich bekam eine Gänsehaut.
«Du bist zu früh», stellte ich fest. Und weil das irgendwie unhöflich klang, streckte ich entschuldigend die Hand aus.
Er ergriff sie und schüttelte sie fest. «Neun Tage zu früh, genau genommen. Aber wie gesagt, die Hausverwaltung … Wahrscheinlich ein Missverständnis. Ich musste kurzfristig … ausziehen.»
Dass die Hausverwaltung irgendeinen Fehler machte, außer den, die Mieter auszunehmen und jegliche Reparaturen zu verweigern, erschien mir seltsam. Ob er schwindelte? Ich wollte eigentlich nach dem wahren Grund seines frühen Erscheinens hier fragen. Aber dann wäre er vielleicht gegangen. Und so verwirrend, so naiv, so unvorsichtig das auch war und so wenig es zu mir und meiner tief verwurzelten, anerzogenen Vernunft passte: Ich wollte nicht, dass er ging.
Das kurze Zögern in seinen Sätzen war mir aufgefallen, aber er redete schon weiter. «Die Uni fängt bald wieder an, und ich musste raus aus meiner Bude.»
Ich nickte, als wüsste ich Bescheid und würde mich nicht überrumpelt fühlen.
Studentenapartment mit Aussicht – dreiundzwanzig qm Wohnfläche – Bad und Küchenzeile – Wohnanlage mit gemischtem Publikum – Parknähe … Der Wortlaut der Anzeige rauschte mir durch den Kopf. Wahrscheinlich hatten mehrere Dutzend verzweifelter Menschen darauf geantwortet. Und er war es geworden.
«Dieser Ausblick wird mir fehlen», sagte ich völlig zusammenhanglos und deutete durchs Fenster. Ich wollte, dass er die Platanen so schön fand wie ich.
Lukas zog eine Grimasse, schuldbewusst, als läge es in seiner Verantwortung, dass ich hier nicht mehr die Aussicht genießen könnte. «Es tut mir wahnsinnig leid, dass es da dieses Missverständnis gab. Aber …» Er zögerte. «Was meinst du, kann ich vielleicht schon hierbleiben? Ich würde dich auch nicht stören, und ich kann auf dem Boden schlafen. Aber warte, nein, das ist vermutlich wirklich ein dämlicher Vorschlag. Ich meine, ich will nicht, dass du denkst, ich würde irgendetwas ausnutzen.»
Es war tatsächlich ein dämlicher Vorschlag, einer, bei dem meine Alarmglocken schrillen müssten und bei dem ich höflich, aber bestimmt ablehnen und auf den Mietvertrag und die festgelegten Fristen verweisen sollte. Ein fremder Mann, hier allein mit mir? Neun Tage, neun Nächte?
Mein Verstand knuffte mir grob in die Seite und wollte mir eintrichtern, dass ich auf gar keinen Fall auf das Gefühl hören sollte, das sich von Sekunde eins in mir breitgemacht hatte. Dieses tiefliegende Vertrauen ihm gegenüber, begleitet von einer geradezu berauschenden Anziehungskraft.
Lächeln, sagte mein Verstand, lächeln und höflich, aber bestimmt ablehnen.
Stattdessen hörte ich mich sagen: «Ich habe einen Selbstverteidigungskurs belegt. Ich bin tough.»
Wie albern das klang! Doch wie zum Beweis machte ich sogar noch ein paar Karate-Tiger-Moves, bei denen ich ungeschickterweise gegen den Küchentisch knallte. Und ich ahnte, dass ich damit sicher genau das geschafft hatte, was ich irrationalerweise nicht wollte: ihn zu vertreiben.
Ich schluckte an dem Kloß in meinem Hals.
Ich sollte ihm sagen, dass er später noch genug Zeit haben würde, sich mit dem ständig verstopften Abfluss im Waschbecken, dem Schwefelgeruch von unten oder den Bumsgeräuschen von nebenan herumzuschlagen. Dass es in dieser Stadt Notunterkünfte für gestrandete Studenten wie ihn gab. Dass meine neue Wohnung erst in neun Tagen bezugsfähig war. Aber dann fiel mein Blick auf den breiten Seesack, den er neben der Tür abgestellt hatte und an dem zusammengerollt ein gefalteter Quilt in dunklen Farben hing. Und ich entdeckte den Geigenkasten daneben.
«Warum … nicht?», sagte ich und wollte es mehr aus Anstand, denn Überzeugung ausweichend klingen lassen. «Ich meine, ich bin ja sowieso bald weg und muss nur noch ein paar Dinge erledigen.»
«Du wirst mich gar nicht merken hier, es geht wirklich nur ums Schlafen.» Er lächelte schief. Das Grübchen aber hielt sich hartnäckig, es blieb auch bei vorsichtigem Lächeln – und es brachte mich dazu, zurückzulächeln.
«In Ordnung.»
«Ich bin auch gleich wieder weg … Ich will dich nicht stören.» Er deutete auf die Umzugskartons.
Ich wollte nicken und antworten: Vielleicht ist es doch eine schlechte Idee, ich rufe mal die Hausverwaltung an. Aber nichts davon sagte ich. Stattdessen fragte ich: «Du spielst Geige?» Ich deutete in Richtung des Kastens, auf dem das Emblem eines Cremoneser Violinenbauers zu lesen war.
«Ja, das tue ich», bestätigte er.
Das Lächeln saß da schon so fest in meinem Gesicht, dass ich fürchtete, es würde bleiben wollen. Ich wollte Lukas weiter anstarren, und es fiel mir schwer, mich loszureißen. Aber es wäre sicher besser, noch einmal nach den Blättern der Platanen zu sehen. Ich schaute aus dem Fenster und spürte alles an mir so deutlich wie nie zuvor. Fühlte mich, als sähe ich mich selbst durch seine Augen. Stellte mir vor, dass er das Zerrissene, das mein Leben prägte, sehen könnte, als wären all die Widersprüche in mir sichtbare Narben auf meiner Haut. Es war manchmal so schwer, nicht zu wissen, was man selbst wollte und was nur dem Wunsch anderer entsprach. Ich wäre gern jemand gewesen, der fröhlich wirkte, wusste aber, dass da etwas Melancholisches in mir war. Ich war niemand, der ansteckend lebendig war oder einen Raum zum Leuchten brachte. Ich hatte keine herausragenden Talente wie meine Schwestern, war nicht musikalisch wie sie. Und es schien fast ein bisschen wie Hohn, dass Lukas ausgerechnet ein Musikinstrument dabeihatte. Es hätte ja theoretisch auch ein Tennisschläger sein können.
«Vielleicht spielst du mal etwas für mich?» Ich drehte mich wieder zu ihm um und spürte, wie meine Wangen glühten.
«Gerne», antwortete er. «Sehr gerne.»
Er hatte warme Augen in einem kantigen Gesicht voller Geschichte. Und vom ersten Moment an wusste ich, dass ich meinen Blick nicht mehr von ihm abwenden wollte.
Kapitel 3Ben
HEUTE
«Anni ist schon ganz schön lange auf dem Klo», stelle ich fest. Aus Richtung der Toiletten ist niemand in Sicht. Dabei ist Anni nicht der Typ für minutenlanges Spiegelstarren oder Nachschminken.
Lena schaut von ihrer Serviette hoch, die sie lustlos in den Händen dreht. Sie sieht müde aus, es wäre wirklich langsam Zeit zu gehen. Sie hat aus dem Stück Stoff ein undefinierbares Tier gefaltet, von dem sie behauptet, es wäre eine Ente mit dem Schnabel eines Pelikans. Hat sie mit dem Basteln schon angefangen, bevor Anni weg war?
«Kati behauptet, dass sie auf dem Klo eine Wurst macht», meint Lena und lehnt den Kopf auf ihren Arm.
Gedankenverloren hole ich mein Handy raus, als könnte es mir sagen, warum Anni so lange verschwunden ist. In der Zeit, in der sie weg ist, habe ich die Rechnung beglichen, ihr fünf Edamame vom Teller geklaut und mit Lena ein Gespräch über ihre neue Schullektüre geführt, die sie doof findet.
«Handy!», tadelt meine Tochter jetzt und sieht mit einem Mal wieder hellwach aus. «Kein Handy am Tisch.»
Ich lege folgsam das iPhone weg und schaue Lena wieder an. «Warum soll sie keine Wurst machen können, die Kati?»
«Sie ist Vegetarierin!» Auch Lena schaut jetzt den Flur entlang. Immer noch keine Anni.
«Ah, verstehe … Was sagt sie dann?»
«Wir überlegen noch. Labskaus vielleicht.»
Ich muss schmunzeln. «Das ist auch nicht fleischfrei.»
«Klingt aber doch gut. Ich gehe mal ein Labskaus machen.»
«Ich finde, man kann das auch höflicher ausdrücken.»
«Wie denn?»
«Den Tiger grüßen?»
Ein lautes Glucksen hüpft aus ihrer Kehle und lenkt mich ein wenig ab. Ich liebe es, meine Tochter zum Lachen zu bringen. «Oder wie wäre es mit … einer Aubergine?»
Lena sieht mich entgeistert an, dann leuchten ihre Augen. «Das ist genial, Papa!»
Ich nicke zufrieden. Meine Tochter findet mich noch genial.
«Was macht Anni eigentlich so lange auf dem Klo?», fragt sie jetzt, als hätte ich nicht vor einer Minute das Gleiche gefragt.
«Eine Aubergine vielleicht», sage ich und blase die Backen auf.
Lena prustet. «Im Leben nicht. Die isst so gerne bayrische Sachen, das wird nichts mit der Aubergine. Das ist eher ein Leberkäs.»
«Wollen wir sie fragen, wenn sie kommt?»
«Unbedingt!»
Aber Anni kommt nicht. Die Kellnerin bringt einen Espresso aufs Haus und Lutscher für Lena, die ich ihr für heute verbiete, weil sie keinen abendlichen Zuckerspinner bekommen soll. Und da endlich, nach einer gefühlten halben Stunde, taucht Anni auf.
Ich mache ein übertriebenes Wurde-auch-Zeit-Gesicht, das sie hoffentlich als Spaß versteht, und tippe wie ein Oberspießer auf meine nicht vorhandene Armbanduhr.
Sie sieht irgendwie müde aus.
«Leberkäs oder Aubergine?», fragt Lena.
«Handkäs oder Haxen?», ergänze ich.
Anni schüttelt irritiert den Kopf, schaut mich nicht direkt an, schielt mehr auf die Plastikpflanzen hinter mir. Auf ihrer Stirn steht ein kleiner, feiner Schweißfilm. Vielleicht waren die Thunfischmaki schlecht?
Sie fragt: «Alles okay bei euch?»
Eigentlich müsste ich sie fragen, ob alles okay ist. Aber sie hasst das. Die Frage «Wie geht es dir, ist alles in Ordnung?» ist eine Art Garantie dafür, dass sie dichtmacht. Also frage ich nicht, sondern witzele weiter. «Sprudel oder Schnapsglas?»
Andere Menschen ziehen bei Missfallen die Augenbrauen hoch, bei Anni ist es das linke Ohr. Ich habe keine Ahnung, ob sie es weiß. Es gibt drei Arten, wie sie ihr Ohr hochziehen kann. Kurzes Zucken des linken Ohrs: Verwirrung, wie in diesem Fall – was zum Teufel wollt ihr mit euren Auberginen und den Haxen? Mehrmaliges Zucken hintereinander: Genervtheit. Hochgezogenes Ohr für längere Zeit: Explosionsgefahr!
Ich warte auf einen Anni-Spruch. So etwas wie «Kaum bin ich auf Haxe, macht ihr Insiderwitze.» Aber es kommt nichts, sie steht da und starrt uns an.
«Erde an Anni!», ruft Lena und kichert. Denn normalerweise antwortet Anni darauf mit: «Mars an Lena.»
Aber nichts …
«He, bist du sauer?», fragt Lena, die leider seit der Scheidung immer Angst hat, die Harmonie zu stören.
Etwas in Annis Gesicht verändert sich. Ihr Blick wandert jetzt im Raum umher, ohne dass er an etwas Bestimmtem hängen bleibt. Sie setzt sich auch nicht, stattdessen nimmt sie ihre Handtasche vom Stuhl und drückt sie gegen ihren Bauch wie einen Rettungsring. Ihre Mundwinkel wirken verspannt, die Lippen dünn und blass.
Plötzlich geht ein Ruck durch ihren Körper. Als wäre ihr eine Erkenntnis gekommen. Ihre verlorene Miene sieht exakt so aus, wie ich sie bei meinen Protagonisten an einer Schlüsselstelle beschreiben würde.
«Was ziehst du denn für eine Grimasse, Ben?», fragt sie, mit verändertem Ausdruck.
Es ist lächerlich, dass ich darüber so etwas wie Erleichterung verspüre. Warum auch? Aber ich kann nicht anders, ich stehe auf und drücke ihr einen dicken Kuss auf die Lippen.
«Wofür war das denn?»
«Eine Entschuldigung dafür, dass ich manchmal in meiner Romanwelt verschwinde.»
Sie wuschelt mir über den Kopf. Ich hasse es, denn ich fühle mich dabei immer wie ein Welpe, der gegen seinen Willen gestreichelt wird. Aber ich weiß, dass sie es liebt, also lasse ich es über mich ergehen.
«Jeder verschwindet doch mal in seiner eigenen Welt», sagt sie. «Wollen wir zahlen?»
«Schon erledigt», erkläre ich und signalisiere Lena, dass sie sich die Schuhe anziehen soll. Als wir das Restaurant verlassen, frage ich Anni dann doch: «Geht es dir gut? War dir schlecht?»
«Ja, mir war … schlecht und irgendwie schwindelig. Lass uns los.»
Ich nicke. Dieses Manuskript macht mich fertig, wenn ich aus einer einfachen Lebensmittelunverträglichkeit schon eine Schlüsselszene machen will. Ich werde Anni von dem unmöglichen Vorschlag meines Lektors erzählen und von meiner absoluten Unfähigkeit, ihn umzusetzen. Und Anni wird eine Lösung haben.
Während sie Lena ins Bett bringt, versuche ich aus den Sprachnachrichten meiner Schwester schlau zu werden.
«Hiiiii Bruuuuderherz, dachte, ich melde mich maaaal …»
Irgendetwas hat sie wieder gedreht, das spüre ich. Es macht etwas mit meinem Magen. Wie alles, was Maren betrifft. Ein wenig so, als wäre sie noch ein Kind. Mein Kind. Ein Kind von 25 Jahren allerdings. Aber anders als bei Lena kommt da hin und wieder diese Wut auf, die mir sagt, dass ich nicht jeden Mist, den sie anstellt, hinnehmen und verzeihen muss. Eine ihrer abstrusen, halblegalen Aktionen kommt bei ihren Besuchen meistens ans Licht. Beim letzten Mal hat sie allerdings den Vogel abgeschossen. Nicht genug damit, dass sie meine Abschlussarbeit zum Verkauf im Internet angeboten hat, nein, im Sommer hat sie während unseres Urlaubs zwei Wochen lang das Haus an eine fünfköpfige Familie untervermietet. Dummerweise landete die positive Bewertung des «Ferienobjekts» als Link in meinem E-Mail-Postfach. Ich hab es Anni nicht erzählt, weil sie ausflippen würde, wenn sie wüsste, dass fremde Menschen in unseren Betten geschlafen haben.
In ihrer heutigen Sprachnachricht entschuldigt sich Maren erneut dafür, also weiß ich, dass ein weiterer Besuch ansteht oder sie dringend Geld braucht.
«Du bist doch nicht mehr bööööse wegen dieser Kleinigkeit im Sommer, oder?»
Hunderte Male hab ich mir vorgenommen, dass es das letzte Mal war, dass sie bei uns Unterschlupf gefunden hat. Dass es jetzt reicht. Und dann gibt es doch immer noch ein nächstes Mal. Aus Liebe oder aus Gewohnheit oder aus Verantwortungsgefühl ihr gegenüber. Ich weiß es selbst nicht genau. Kann man jemanden lieben und gleichzeitig wahnsinnig wütend auf ihn sein? Darf man sich für seine Schwester verantwortlich fühlen und dennoch nicht wollen, dass sie ständig unangekündigt auftaucht und alles durcheinanderbringt?
Maren säuselt irgendwelche Nettigkeiten in ihr Mikro und schließt mit dem Satz: «Wir sehen uns ja baaaaaald.» Dann fügt sie noch hinzu: «Hoffe, du bekommst einen ordentlichen Vorschuss für dein neues Buch – vergiss nicht, dass ich stets gerne als Inspiration diene.»
Aber genau das ist der Grund, warum keine der Maren-Geschichten je Eingang in meine Bücher gefunden hat. Ich vermeide jegliche Ähnlichkeit mit lebenden Personen. Insbesondere mit meiner Schwester. Sie brächte es fertig, mich zu verklagen – und Anni noch zu fragen, ob sie sie vor Gericht vertritt.
Ich drücke auf Pause, als ich Schritte höre. Und dann lösche ich die Nachricht, ohne weiter darüber nachzudenken.
Anni kommt mit Lenas Jacke und ihrem Stofftier namens Futon, einem verblichenen Hasen mit plüschigem Bauch, die Treppe herunter. Im Durchgang zwischen Esszimmer und Wohnzimmer bleibt sie neben dem Kamin stehen und nimmt sich von der Etagere auf dem Esstisch eine Schokokugel. Sie dreht sie gedankenverloren in den Händen und legt sie dann wieder zurück.
«Schläft Lena?», frage ich.
Anni nickt und hält den Hasen in die Höhe. «Futon soll heute bei Fieps schlafen», erklärt sie.
Unser Hund reagiert auf seinen Namen und donnert mit dem Schwanz auf dem Boden, ist aber zu faul, aufzustehen.
«Solange Fieps nicht in unserem Futon schlafen soll», witzele ich und warte darauf, dass sie sich neben mich fallen lässt und ihren Kopf an meine Schulter legt.
«Wir haben ein Boxspringbett», korrigiert Anni. Sie lacht nicht dabei und wischt mit der Hand über das raue Holz der Tischplatte. Dann rückt sie ein Kissen auf der Bank zurecht, die an den Kamin anschließt, und wirkt irgendwie abwesend. Eigentlich lachen wir immer, wenn es um Futon geht, dem Lena ein sehr reges Eigenleben verpasst hat. Der Hase verdankt seinen Namen einem Werbespecial zu Schlafzimmern von Möbel Höffner – und vermutlich auch der Tatsache, dass Lena mit viel Phantasie gesegnet ist.
«Futon hat letzte Nacht eine Reise in die Anden gemacht und sich in ein Alpaka namens Lama verliebt. Jetzt möchte er auswandern. Lena meint, nur Fieps könnte diese Liaison vielleicht noch verhindern. Und –»
«Sie hat nicht Liaison gesagt, oder?», unterbreche ich sie.
«Nein, aber ich finde, die Anden reichen schon. Als ich so alt wie Lena war, wusste ich nicht einmal, wo die Alpen liegen.»
Anni lässt sich nun doch neben mich auf die Couch fallen und wirft einen kurzen Blick auf meine alte graue Sporthose. Dann sieht sie wieder hoch.
Ich lege meine Hand auf ihren Oberschenkel und tätschele ihn. «Du bist in München geboren.»
Sie macht eine Jaja-schon-gut-Miene, rückt ein Stück von mir ab und sagt in die Richtung, in der Fieps auf seinem Schafsfell vor sich hin haart: «Okay, ich wusste, wo die Alpen sind, aber von den Anden hatte ich da bestimmt noch nicht gehört.»
«Und wie geht die Liebesgeschichte weiter?»
Sie runzelt die Stirn.
«Na, die von Futon und dem Alpaka.»
«Ah, ja.» Sie lächelt. «Es ist eine …» Sie hält kurz inne. «Eine Ménage-à-trois. Denn Lama, das Alpaka, ist eigentlich schon Paco versprochen. Die Dame erbittet sich Bedenkzeit, weil sie nicht weiß, ob sie bereit ist für eine Fernbeziehung und die Problematiken einer gemischtrassigen Vereinigung.»
«Wow!», keuche ich. «Das waren Lenas Worte?»
«Nein, sie hat gesagt: Lama findet Alpakas schöner als Hasen, weil sie weicher sind, und sie glaubt, dass es zu teuer ist für ein Alpaka, nach Deutschland zu fliegen. Außerdem gibt es bei Paco im Stall immer genug Heu, sie weiß nicht, ob Futon mit seinen Karotten da mithalten kann.»
Ich seufze. «Meine Tochter ist mir um Welten voraus. Vielleicht sollte ich mit ihr über das Problem meines Manuskripts reden.»
«Das Problem! Richtig, dein Lektor.» Anni dreht sich zu mir und verschränkt die Beine im Schneidersitz. «Erzähl.» Ihr Blick fixiert mich jetzt, und das Blassblau ihrer Augen wirkt auf einmal nicht mehr kühl und abwesend, sondern vollkommen bei mir.
«Ich war heute bei Richard, und er ist sehr unglücklich mit der Rohfassung von Vielleicht bleibt es länger still. Er hasst den Titel, er findet den Plot langweilig, und er …» Ich zögere kurz. «Er meinte … ich zitiere: Du musst mal was anderes schreiben, mein Lieber. Raus aus der Komfortzone. Eine neue Reihe, vielleicht ein ganz anderes Genre …»
Annis Augen sind größer geworden, weiter. «Oh!»
Ich greife mit beiden Händen in meine Haare und kratze meine Kopfhaut. «Ja, genau. Oh. Es fehlt ihm das Besondere … Und das Schlimme ist, er hat recht.»
«Ein Twist?», fragt Anni. «Oder will er noch ein paar Kapitel mehr? Kommt die Auflösung zu früh?»
Ich schüttele den Kopf. «Nein, es geht um das große Ganze. Er findet meinen Ermittler Victor Alonso zu farblos. Er meint, er bräuchte ein Privatleben, viel mehr Struktur, und es würde nicht funktionieren, dass ich ihn wie Miro Groeben einfach nur skizziere. Der Verlag wünscht sich, dass der neue Roman auch mehr weibliche Leser anspricht.»
Kurz frage ich mich, ob ich Leser*innen hätte sagen sollen. Anni spricht immer mit Genderpausen, und bei ihr hört es sich selbstverständlich an, nicht eingeübt. Anni, meine Feministin, von der ich mir regelmäßig und zu Recht anhören muss, dass ich als weißer Mann verdammt privilegiert bin und gefälligst helfen soll, die patriarchalischen Strukturen aufzubrechen.
«Und jetzt?», fragt sie. «Bekommt Victor eine Partnerin, die mit ihm in eigener Sache ermittelt?»
Ich schnaufe ungeduldig und laut aus. Anscheinend so laut, dass Fieps den Kopf hebt und das Schwanzschlagen wieder losgeht.
«Wenn es nur das wäre! Nein, Richard und der Verlag haben sich offenbar darauf eingeschworen, dass ich eine Schmonzette schreiben soll.»