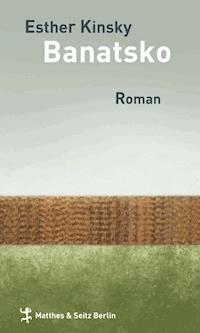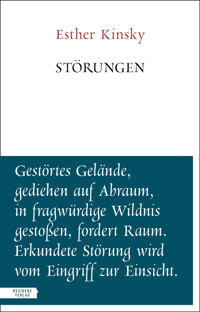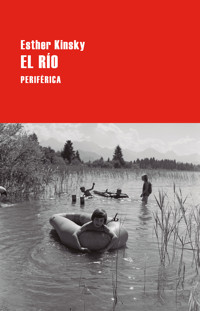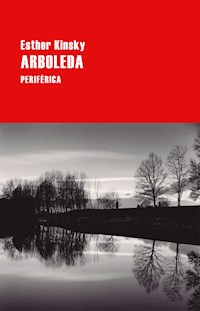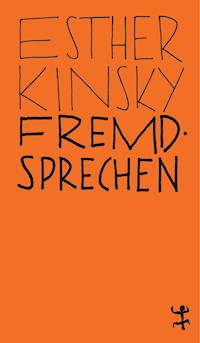
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Esther Kinsky, Autorin und vielfach ausgezeichnete Übersetzerin, beschreibt ausgehend von eigenen Erfahrungen das Verhältnis zwischen Namen und Dingen und die Veränderungen, die sich im Prozess des Übersetzens in diesem Verhältnis vollziehen. Wie wandeln sich die zu den Dingen gehörenden Bilder im Kopf und in der Erinnerung durch den steten Umgang mit der Umbenennung? Wie prägt die Erinnerung andererseits die Wertigkeit der Benennungen und beeinflusst damit die Wortentscheidungen, die man beim Übersetzen unentwegt trifft? Was geschieht in dem Raum, der sich zwischen den beiden Namen in der Herkunfts- und der Zielsprache auftut, während der Übersetzer die Bild- und Klangwelt des zu übersetzenden Textes "fremdspricht"? Kinskys Essay Fremdsprechen zeichnet die feine Grenzlinie nach, die zwischen eigenen und fremden Worten, zwischen eigener und fremder Sprache, zwischen eigenem und fremdem Leben verläuft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esther Kinsky
Fremdsprechen
Gedanken zum Übersetzen
Für Nadja-Nadenka
They said: ›You have a blue guitar You do not play things as they are‹. The man replied: ›Things as they are Are changed upon the blue guitar.‹
Wallace Stevens, The Man with the Blue Guitar
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Ich schreibe vom Übersetzen, dem Umgang mit zwei Sprachen und dem Raum zwischen diesen Sprachen, der sich beim Vorgang des Übersetzens auftut.
Es ist keine Anleitung zum Übersetzen, kein Handbuch der Grundregeln, die beim Übertragen von Text zu beachten wären, keine Unterweisung im Jonglieren von Worten für Erfolgsnummern im Großen Sprachzirkus.
Es ist mir zwar hier und da daran gelegen, Missverständnisse zurechtzurücken, die mir immer wieder begegnet sind, doch ich habe keine Empfehlungen zu geben und noch viel weniger habe ich Urteile zu fällen oder zu vermitteln. Die Auseinandersetzung mit dem Vorgang und den Mitteln des Übersetzens, die ich hier unternehmen möchte, ist eher ein Bericht, eine Bestandsaufnahme der Gedanken, zu denen ich über die Jahre des Übersetzens immer wieder zurückgekehrt bin. Diese Fragen zu Sprache und Fremde stellen sich unweigerlich, wenn man sich mit der Beziehung beschäftigt, in die zwei Texte durch die Übersetzung treten. Es ist ein persönlicher Bericht, weil die Handhabung von Sprache etwas Persönliches ist, das sich nicht in allgemeine Regeln, Tatsachen oder Grundsätze umschreiben oder übersetzen lässt.
Mein Gegenstand sind Prosatexte, keine Lyrik, zu deren Übersetzung ich anderes zu sagen hätte. Doch es geht immer um die Übersetzung von literarischen Texten und deshalb zwangsläufig nicht um die bloße Vermittelbarkeit von »Inhalten«. Ich halte nicht viel von der Betonung der Rolle des Übersetzers als »Brückenbauer« und Kulturvermittler. Der Übersetzer ist kein Fremdenführer, auch wenn die Fremde sein Gegenstand ist. Einblicke in andere Kulturen und Gepflogenheiten mögen ein Nebenprodukt der Veröffentlichungen und Verfügbarkeit übersetzter literarischer Texte sein, aber nicht ihr Zweck und Ziel. Jede Übersetzung ist in erster Linie das Ergebnis eines Gestaltungsprozesses von Sprache als Material, der nicht aus der Beschäftigung mit einem Gegenstand erwächst, sondern aus der Beschäftigung mit der Spannung zwischen zwei Arten der Behandlung eines Gegenstands. Das ist ein Prozess, in dem das »Was« hinter dem »Wie« zurücktritt. Dieses »Wie« ist hier der Gegenstand. Das »Was« ist nur insofern interessant, als es Schichten des »Wie« offenlegt, die weiter und tiefer reichen, als die meisten Leser vermuten.
I
Hat es jemals eine allen Menschen gemeinsame, eine »Proto«-Sprache gegeben? Hat es jemals eine Zeit gegeben, in der ein vollkommener Konsens über die Bezeichnung der Dinge herrschte? Wie hätte man sich eine solche Sprach-Welt vorzustellen? War es bloß »eine« Sprache, in der noch kein »Wie« das »Was« unterwanderte? Oder war es eine »reine« Sprache, in der das Wort noch unmittelbarer Ausdruck von Erkenntnis war? Die Existenz einer solchen Sprache ist fraglich, auch wenn die Unmöglichkeit universaler Verständigung – zumindest im Wirkungsbereich der Bibel – mit einer Art zweitem Sündenfall, also dem Verlust einer solchen Verständigung, assoziiert ist. Kaum eine biblische Episode – mit Ausnahme der Vertreibung aus dem Paradies und der Sintflut – ist so bekannt wie der Turmbau zu Babel. Man braucht nicht bibelkundig zu sein, um mit dem Namen Babel die Sprachverwirrung zu verbinden und zumindest die Grundzüge der knappen Geschichte zu kennen, die die Vielsprachigkeit als fundamentale Tatsache der Menschheit zur Folge hat.
Dabei ist es, gemessen an den langen Genealogien, aus denen die Verse Genesis 11.1-9 herausstechen, nur eine kurze Notiz, die über das einschneidende Ereignis berichtet. Die zweite Chance, die der Schöpfer den Menschen nach der Sintflut gegeben hat, liegt kaum ein paar Generationen zurück, als Er wieder über sie in Zorn gerät. Diesmal allerdings gibt nicht die Bosheit oder Destruktivität des Menschen den Anlass zum Zorn, sondern ein Akt kollektiver Konstruktivität: Kaum haben sie den Ziegelstein erfunden, wollen die Menschenkinder einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Dieses Vorhaben, unternommen zu einer Zeit, als es »auf der Erde eine Sprache und einerlei Worte« gibt, erregt das Missfallen des Schöpfers nicht deshalb, weil es, wie die Verkostung der kritischen Frucht im Paradies, gegen ein ausdrückliches Verbot verstößt, sondern weil es die Bekundung eines Machtgefühls des Menschen ist, das dem Ewigen geradezu einen Schrecken einjagt: »Jetzt … haben sie alle eine Sprache, und das ist nur der Anfang ihres Tuns, fortan wird ihnen nichts fehlschlagen, was sie auch ersinnen mögen.« So spricht der Ewige und greift ein. Ungehinderte Verständigung auf der Grundlage einer Sprache und einerlei Worte ist – der unwiderruflichen Sterblichkeit des Menschen zum Trotz – offenbar die Voraussetzung für eine Macht,die die vermessene Vorstellung einer Gottähnlichkeit nahelegt.Zwar wird der Konsens zweifellos von oben (Drahtzieher des Turmbaus) nach unten (ausführende Arbeiter beim Turmbau, Ziegelträger und Mörtelmischer) organisiert, doch stiftet er einen Sinn, an dem jeder teilhat: Mit dieser Handlung, diesem Turm-Werk, wollen sich die Menschenkinder, wie es in der Bibel heißt, insgesamt »einen Namen machen«, sich hervortun, ein Zeichen ihrer selbst setzen, Bedeutung gewinnen. Der Name bürgt für ihr Sein. Wie die Geschichte ausgeht, ist bekannt: Sprachverwirrung und Zerstreuung über die ganze Erde, Zerschlagung eines kollektiven Projekts, das die im sinnstiftenden Namen verankerte Identität erwirken sollte.
Eingerahmt von Auflistungen der unzähligen Stämme, die Noah und seine Söhne nach der Sintflut hervorbrachten, wirkt diese kurze narrative Episode, die das menschheitsdefinierende Ereignis schildert, nicht nur seltsam beiläufig, sie steht auch im Widerspruch zum vorhergehenden Kapitel, in dem die Nachkommen Noahs bereits »nach ihren Geschlechtern und Sprachen, nach ihren Ländern und Völkerschaften« aufgeführt sind. Demnach war die Sprache neben Abstammung (Geschlecht), Siedlungsraum (Ländern) und Sitten im weitesten Sinne (Völkerschaften) ein wesentliches Differenzierungsmerkmal.
Was also beim Turmbau zu Babel zerschlagen wird, ist keine alltägliche Sprache, keine Einheitlichkeit der Sprache als Benennung der Dinge, sondern eher eine Sprache über den Sprachen, eine Einheitlichkeit in der Artikulation schöpferischer Absicht, die der Mensch – bemerkenswerterweise in der Bibel zeitgleich mit der Erfindung des Ziegelsteins als Inbegriff des hergestellten Baumaterials – nach dem Schock der Sintflut und auf der Grundlage des Bundes zwischen Schöpfer und Schöpfung erlangt.In diesem nach der Sintflut geschlossenen Bund sagt der Ewige zu, die von ihm geschaffene Welt nie wieder vernichten zu wollen. Im gleichen Zug überantwortet er zwar die Macht zu schaffen und zu zerstören an den Menschen, zersplittert diese Macht jedoch dann anlässlich des Turmbaus, indem er die Sprache verwirrt und die Menschen über die Erde zerstreut. Nicht nur bleibt den Menschen der Zugang zu der einen, einenden Sprache versagt, sondern zugleich auch der »Name«, den sie sich machen wollten und der sie – wie man vermuten muss – in gefährliche Nähe zum Schöpfer gerückt hätte.
Nach Babel wird die Überwindung von Verständigungsschwierigkeiten einen guten Teil menschlicher Erfindungsgabe besetzen. Diese Überwindung ist ein Prozess, der nie zum Abschluss kommt, weil Sprache selbst eine Bewegung ist, die, solange es Menschen gibt, die Sprache nutzen, nie an ein Ende gelangt. Sprache wird unentwegt von kollektiver und individueller Geschichte geformt, unterliegt einem dauernden Prozess der Differenzierung, Filterung, Veränderung, sie ist kein Zustand, sondern Entwicklung, Fluch und Segen des Menschseins, denn der Verlust der Unschuld war auch der Verlust der Stasis. Die eine Sprache und einerlei Worte waren der letzte Rest der Unschuld, der nach der Erkenntnis von Gut und Böse und nach dem Brudermord noch erhalten geblieben war, eine Unmittelbarkeit und Verbindlichkeit des Wortes, die der Schöpfer verwirft und der Mensch verwirkt, als er mit dem Turmbau selbst zum Schaffenden wird. Mit der Entdeckung der eigenen Schaffenskraft verlässt der Mensch diesen letzten Geländestreifen der Unschuld, die in der Bescheidung in das Gegebene besteht. Und der damit verbundene Verlust der einen Sprache ist endgültig und irreparabel. Die Sprachverwirrung ist als Strafe gedacht, nach der Vertreibung aus dem Paradies und der Sintflut ist sie die dritte und letzte Universalstrafe für die Menschen schlechthin, sie entzieht ihnen ein für alle Male die Möglichkeit einer ungehinderten Verständigung miteinander und sieht das Missverstehen als prägende Menschheitserfahrung vor. Diese dritte Strafe der Sprachverwirrung ist die Erschaffung der Fremde, und auf diesem Boden nimmt die Übersetzung ihren Anfang.
II
Sprache ist die gängige Währung unserer Kommunikation. Als Sprachgruppe ist man sich einig über Bezeichnungen für Konkretes und Abstraktes, für Dinge, Handlungen, Empfindungen, und darüber, wie diese in einen zeitlichen Rahmen eingeordnet werden. Man ist sich einig über eine bestimmte Bandbreite von Lautungen der Namen, und über ein reglementiertes Repertoire von Zeichen, die diese Laute schriftlich fixieren. Es ist kein starres System, weil die Welt, die es verhandelt, kein starres System ist, sondern ein Prozess. Auf der kollektiven Ebene vollzieht sich dieser Sprachprozess langsamer als auf der individuellen, denn die Welt im Kopf eines jeden Einzelnen wandelt sich mit jeder Erfahrung von Sinnen, Gefühl, Körper und Verstand und verleiht den Worten unentwegt neue Schichten, die sich, auf einen zwangsläufig verkürzten gemeinsamen Nenner gebracht, im gemeinsamen Sprachgebrauch niederschlagen. Sprachtragend bleibt aber immer der Konsens, der, so wie jede Währung, beim Verlassen des Raums seiner Gültigkeit die Verbindlichkeit verliert. Dieses Abhandenkommen der Gültigkeit des Konsens ist die Fremde, die Erfahrung der Abwesenheit einer gemeinsamen Sprache.
Ob man diese Fremde wie biblisch vorgesehen als Strafe wahrnimmt, hängt natürlich in erster Linie davon ab, wie und unter welchen Bedingungen man ihr ausgesetzt ist und sich ihr öffnen kann. Der Übersetzer agiert immer in Bezug auf Fremde und hat sie als Ort, Sprache oder Kultur meistens freiwillig aufgesucht, doch es gibt etliche Beispiele dafür, dass auch die Not – das Geworfensein in die Fremde durch Flucht, Gefangenschaft, Verschleppung – eine Erfahrung der anderen Sprache zulassen kann, die zum Übersetzen führt. Der erste Lehrer, der mir in einem zerknitterten Studium die Augen dafür öffnete, in welchem Maße Sprache ein Material ist, in dem Original und Übersetzung miteinander verwoben werden können, war aus fünf Jahren Kriegsgefangenschaft in Sibirien mit einer Liebe zur russischen Sprache und zu Puschkin zurückgekehrt, die alle Gelehrsamkeit klein werden ließ. Aber die Einübung in den Umgang mit der anderen und der eigenen Sprache ist ohnehin keine Sache der Gelehrsamkeit, eher die einer praktischen Lehre mit Spielraum für das Unberechenbare. Das Erlernen einer Fremdsprache ist immer ein langwieriger Prozess, der eigentlich erst beginnt, wenn man einen Grundbestand von Worten schon beherrscht und sich in die Sprache eingehört hat. Für benötigte Dinge ist schnell gesorgt, ohne dass man von der fremden Sprache als gestaltbarem Material etwas mitbekommt. Das lernt man erst, wenn man sich auf den anderen Konsens einlässt und nach den fremden Regeln spricht. Jeder, der so eine Sprache lernt, wird irgendwann eine Phase des Übersetzens durchlaufen und spüren,wie sich die Welt verändert, wenn man die vertrauten Dinge bei den fremden Namen nennt, wie der gestaltende Umgang mit der Sprache auch Einfluss auf Denken und Wahrnehmung des Sprechers hat. Manchmal erwächst aus solchen Versuchen dann auch ein tatsächliches, tätiges Übersetzen von Text, wobei man sich nicht nur auf den fremden Konsens sondern auch auf den fremden Kontext einlässt. Das Übersetzen von Text ist ein Prozess der Annäherung, dessen erste Bedingung es ist, dass die Sprache, über die man verfügt, die eigene ist, die sich von den Zwängen der Floskeln und Konventionen, der bloßen Benennung, der zweckgebundenen Verständigung gelöst hat. Es muss nicht die Muttersprache sein, aber doch die vertrauteste Wort-Welt im Kopf, und eine solche Vertrautheit kommt ohne die frühen Prägungen durch das Zusammenwirken von Klang, Bild und Empfindung nicht aus. Die Verfügbarkeit einer Sprache beruht nicht auf der Kenntnis von Regeln, sondern auf ihrer Verbundenheit mit der eigenen Geschichte, in deren Verlauf man sich den Wortbestand der Sprache auf der kollektiven und der persönlichen Ebene zueigen macht und ein Verhältnis zu der Bedeutung der Namen entwickelt. Diese Bedeutung betrifft weniger das »Was« des Gemeinten als das »Wie« des Meinens, nicht die Sache oder Handlung, sondern einen ganzen Komplex von Assoziationen, die für jeden Text den Kontext schaffen. Walter Benjamin schreibt in seinem Essay zur »Aufgabe des Übersetzers«: »In ›Brot‹ und ›pain‹ ist das Gemeinte zwar dasselbe, die Art, es zu meinen hingegen nicht. In der Art des Meinens nämlich liegt es, dass beide Worte dem Deutschen und Franzosen je etwas Verschiedenes bedeuten, dass sie für beide nicht vertauschbar sind, ja sich letzten Endes auszuschließen streben, am Gemeinten aber, dass sie, absolut genommen, das Selbe und Identische bedeuten.« (Die Aufgabe des Übersetzers, Werkausgabe Bd 10, Frankfurt a.M. 1980, S. 14)
Aus der Vertrautheit mit dem »Wie des Meinens« in der eigenen Sprache entwickelt sich im Prozess des Übersetzens notwendigerweise ein Dialog mit der Fremde und der Fremdsprache, die sich langsam über das »Was« des Gemeinten erschließt, bis sich irgendwann auch ein »Wie«, eine Vertrautheit, eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit den Mitteln und Möglichkeiten der anderen Sprache etablieren, die jedoch unweigerlich in einer ganz anderen Beziehung zur Geschichte des Sprechers und Übersetzers stehen als die eigene, vertrautere Sprache.