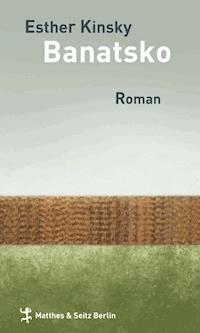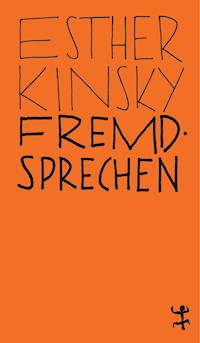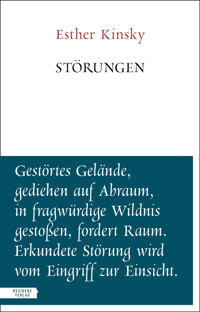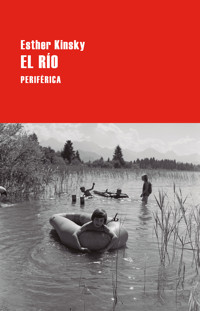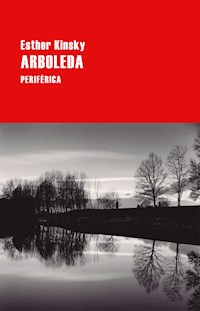9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droschl, M
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gedankenspiele
- Sprache: Deutsch
Die Hoffnung ist ein Phänomen, das den Menschen ganz wesentlich definiert und für unser Leben von größter Bedeutung ist. Aber was ist Hoffnung eigentlich? Ist sie ein ebenso unverdrossener wie hilfloser Vogel, wie sie in Emily Dickinsons Gedicht »Hope is the Thing with Feathers« beschrieben wird? Ist Hoffnung etwas Plötzliches, »Unverhofftes«, das uns schlagartig überkommt? In siebzehn kurzen erzählerischen Texten geht Esther Kinsky den Fragen nach, wie Hoffnung und Handlung wie auch Hoffnung und Zeit miteinander in Verbindung stehen und wie notwendig Utopie als Ausdruck kollektiver Hoffnung ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 28
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Esther Kinsky
Gedankenspiele über die
Hoffnung
Literaturverlag Droschl
I
Vor dreißig Jahren arbeitete ich vorübergehend in einem Büro des Jewish Refugee Comittee in London. Das Büro hatte nach Jahrzehnten des stillen Betriebs durch den Jugoslawienkrieg wieder aktive Aufgaben der Flüchtlingsfürsorge, doch ich war damit betraut, Anfragen zu bearbeiten, für die man deutsch, gelegentlich auch russisch lesen konnte. Bei vielen Anfragen handelte es sich um Erkundigungen nach Familienangehörigen, manchmal auch Freunden, die auf irgendeinem Weg zumindest dem Vernehmen nach bis Großbritannien gekommen waren. Seltener, wenn es etwa um ein Erbe ging, waren es Behördenanfragen. In der Regel waren es Briefe von Geschwistern oder Cousins, die fast fünfzig Jahre nach der Shoah nach verschollenen Nächsten suchten, noch ein Stück Papier besaßen, auf dem ein Ort, eine Adresse gekritzelt war, oder auch nur aus der Erinnerung Namen, Orte, Fluchtrouten nannten.
Das Büro befand sich in einer Kelleretage an der Euston Road. Die kleinen vorderen Fenster, ein Stück über Augenhöhe, befanden sich auf Gehsteigsniveau. Mein Platz war im hinteren, fensterlosen Teil des Büros, wo sich die Kästen mit unzähligen Mikrofilmrollen befanden, auf die die Unterlagen der dreißiger und vierziger Jahre übertragen worden waren. Es war ein sehr heißer Juni. Mein Vater lag seit Tagen in einem induzierten Koma nach einer missglückten Herzoperation, anfangs waren die Prognosen gut, mit den Tagen wurden sie immer düsterer. Die Arbeit lenkte mich ab. Je schlechter die Prognosen für meinen Vater wurden, desto besessener suchte ich nach Antworten auf die Suchen der Briefeschreiber und -schreiberinnen. In der Mittagspause saß ich vor einem Sandwichcafé in einer Nebenstraße und fragte mich, was sie so lange hatte zögern lassen. Warum erst jetzt? Aus den Namen, Adressen und Jahreszahlen der letzten erinnerten Begegnungen hätte man eine endlose Litanei der Traurigkeit, Wehmut, der aufgeschobenen Trauer erstellen können. Wo hatten diese Namen und Daten im Leben der Briefeschreibenden gelegen, fünfzig Jahre lang? Zwischendurch verfolgte ich andere Fäden, las ganze Akten, die nichts mit einer Anfrage zu tun hatten, wenn mich eine Herkunftsadresse, ein Name, eine zeitweilige Adresse nach der Ankunft in London, Manchester, Leeds oder Glasgow beim Durchspulen des Mikrofilms aufmerken ließen, eine ferne Assoziation weckte, einen Erinnerungssplitter in Bewegung setzte. Dann bildete ich mir ein, einem der geheimnisvollen halbverschwiegenen und verschollenen Verwandten meines Vaters auf der Spur zu sein, und dieser Gedanke schien mir Hoffnungspotential zu haben. Hoffnung für wen? Für meinen Vater im Koma, für mich im heißen London, für den, dessen Daten auf dem Mikrofilm eingebrannt waren? Jeden Tag fragte mich Patricia, die Leiterin der Abteilung, die mir diese Arbeit angetragen hatte, nach meinem Vater. Eines Tages lud sie mich zum Mittagessen ein, wir wechselten ein paar banale Sätze, dann sagte sie: Du weißt, dass es für deinen Vater keine Hoffnung mehr gibt? Nach kurzem Zögern sagte ich: Ja. Ich erinnere mich sehr gut an den Heimweg am späten Nachmittag. Der Verkehr staute sich vor der Themsebrücke, die ich überqueren musste, weil der Asphalt vor Hitze schmolz. Die Busse mussten anhalten, die Fahrgäste zu Fuß gehen. Die Absätze meiner Sandalen blieben mehrmals stecken. Alles war wie Blei, die Luft, das Themsewasser, die Straße. Ich kam nach Hause, setzte mich in mein Zimmer und wartete auf das Klingeln des Telefons. Aus allen Hintergärten drangen die Geräusche von Sommerabenden. Kindergeschrei, Besteckklappern, Gitarrenplinkern, Radiostimmen. Polizeisirenen, die Motoren der Flugzeuge im Landeanflug. Es war noch hell, als meine Schwester anrief, mein Vater war tot.