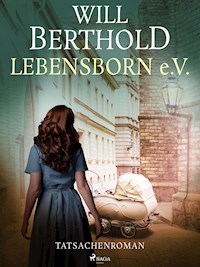Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gotenhafen, 11. Februar 1945: Die Flüchtlinge hatten gehofft, gezweifelt und gebetet. An der Ostsee wird in den letzten Tagen des Krieges der deutsche Luxusdampfer "Cap Arcona" eingesetzt, um Flüchtlinge und Verwundete aus Ostpreußen zu retten. Es ist auf seiner Rettungsmission zwischen alliierten Kampffliegern und russischen U-Booten unterwegs, und bisher sind bereits zwei Fahrten geglückt. Unter den Flüchtlingen ist auch Marion Fährbach, die Frau eines Marineoffiziers, der nach Neuengamme deportiert wurde. Doch da erfolgt der Befehl, Neuengamme zu räumen und die Häftlinge, die am Ende ihrer Kräfte sind, auf die "Cap Arcona" zu verladen und das Schiff auf offener See zu versenken ...Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen Kriminalität und Spionage.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Fünf vor zwölf und kein Erbarmen
SAGA Egmont
Fünf vor zwölf und kein Erbarmen
Fünf vor zwölf und kein Erbarmen (Der Untergang der Cap Arcona)
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1978 by Goldmann Verlag, Germany
Copyright © 1978, 2017 Will Berthold Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711727232
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Gotenhafen, 11. Februar 1945: Die Panik bricht so plötzlich aus wie ein Wirbelsturm. Sie fegt die Marineposten vom Fallreep hinweg wie welkes Laub. Tausende von Menschen haben bei minus 15 Grad eine endlose Nacht lang geduldig auf die Einschiffung gewartet. Ihre Angst wurde durch die Kälte gefüttert. Die Flüchtlinge hatten gehofft, gezweifelt, gebetet. Als der düstere Februartag des Jahres 1945 sein erstes, fahles Licht über Gotenhafen streute, stürmte die Hölle los.
Und mitten in ihr Marion Fährbach.
Keiner hat Zeit, sich um die erschöpfte, zierliche Frau zu kümmern. Niemand sieht, wie schön sie ist. Niemand hat einen Blick für ihre hohe, kluge Stirn, für ihren vollen Mund, für ihre dunklen Augen und für ihre schmale, zierliche Figur.
Niemand achtet auf den kleinen, schmächtigen Jungen an ihrer Hand, der Marion nach einer erbarmungslosen Flucht als letzter Besitz geblieben ist.
Frauen, Kinder, Greise, Männer, Verwundete, Halbwüchsige, die in wilder Horde das Schiff berennen, sind keine Menschen mehr: Männer keuchen an ihren Frauen vorbei; Frauen lassen ihre Kinder stehen; Greise schlagen um sich wie Amok laufende Rowdies. Einer klammert sich an den anderen, stößt sich auf Kosten des Nächsten ab, will an Bord, will flüchten, will nicht von den Russen überrannt, will nicht von den Rotarmisten vergewaltigt, will nicht nach Sibirien verschleppt werden.
Wer fällt, bleibt liegen. Wer zu Boden geht, wird zertrampelt. Wer nicht mehr aufstehen kann, geht ein wie ein Hund. Die Bestie Mensch wirft den letzten Anstand weg. Die Arme und Fäuste werden zu Waffen. Jeder kämpft gegen jeden.
Marion aber kämpft um ihren Jungen.
Ihr Mantel wird in Fetzen gerissen, das bunte Wolltuch vom Kopf gezerrt. Hundert Meter vor dem Ziel, vor dem Fallreep, kommt sie keinen Schritt weiter. Die Hand, mit der sie den Jungen festhält, ist verkrampft, wie abgestorben. Eine Sekunde lang möchte sie sich einfach hinlegen und von der Horde überrennen lassen. Doch dann sieht sie das Kind an, von dessen Vater sie seit Monaten nichts mehr gehört hat, in seine weit aufgerissenen, erschrockenen Augen, spürt den klammernden Druck seiner kleinen Hände an ihrer Hand. Sie hört Jürgen rufen mit seiner kleinen, hellen Stimme, die fast untergeht im Lärm. »Mami – Mami – es tut mir weh – Mami – wann sind wir auf dem Schiff – Mami – Mami – es …«
»Gleich«, ruft sie nach unten, zu dem emporgewandten Gesichtchen, und der Schmerz in ihm und die Angst geben ihr neue Kräfte. Wenn dies nur schon vorbei wäre! Wenn sie endlich weg wären von hier, auf dem Schiff, in einer warmen Kabine! Vielleicht kann sie ein bißchen Milch für den Jungen bekommen, Brot, einen Teller Suppe …
Gleich … Und dabei scheint es ihr, als wäre sie noch nie so weit von dem rettenden Schiff entfernt als gerade jetzt, wo es doch zum Greifen nahe ist.
Der Krieg liegt in seinen letzten Zügen. Aber bevor er stirbt, tobt er noch einen letzten Blutrausch aus: Am 12. Januar 1945 hatten die Sowjets auf breiter Linie die wankende Ostfront durchbrochen, waren tief nach Schlesien eingedrungen, um die Oder bei Küstrin und Frankfurt zu erreichen.
Zuerst zog Marion Fährbach mit ihrem Jungen in einem geordneten Treck nach Westen, bis dieser im zügellosen Durcheinander unterging. Dem russischen Vormarsch folgt der Einbruch der Kälte. Die Landeplätze deutscher Schiffe, die jeweils nur Tausende mitnehmen können, werden von Hunderttausenden belagert, berannt und umkämpft.
Der Tumult um das Fallreep der »Cap Arcona« steigert sich zu einem brüllenden Inferno. Die Verstärkung für die Posten kann keine Ordnung in das Chaos bringen.
Ein Maat schreit durch sein Megaphon: »Nur noch Frauen und Kinder! Seid vernünftig, Leute, so seid vernünftig, zum Teufel! Nur noch Frauen und Kinder!«
Aber seine Stimme geht unter, und diejenigen, die sie hören, kümmern sich nicht um sie. Der Anstand liegt im Massengrab. Ritterlichkeit ist Friedensware. Der Anführer der Posten reißt die Maschinenpistole von der Schulter, legt an, zielt auf einen Mann, der mit seinen großen, von Frost tiefroten Fäusten eine Frau weggestoßen hat, um voranzukommen.
Aber der Soldat schießt nicht. Wie sollte er hier schießen, in diese verzweifelte Menge? Er flucht, brüllt, aber er schießt nicht.
»Mami – Mami – hilf mir – Mami –!« Das Stimmchen des Kleinen ist kaum zu hören. Marion versucht, ihn emporzuheben, aber sie schafft es nicht. Der Kleine ist zu sehr eingekeilt.
»Gleich – gleich –!« ruft sie wieder. In ihrer Stimme ist Angst und Verzweiflung. Lieber Gott, betet sie, lieber Gott, laß uns hinkommen, den Jungen und mich, lieber Gott …
Vorne am Fallreep verengt sich der Abfluß. Es ist, als würde ein Faß Flüssigkeit durch einen einzigen Flaschenhals gepreßt. Die Letzten drängen brutal, die Vorderen stemmen, schlagen und stoßen zurück.
Ein alter Mann hält einen Radioapparat in beiden Armen, preßt ihn an sich wie ein Kind seine Puppe, während er mit den Ellbogen wild um sich stößt. Aber es hilft nichts – der Apparat wird ihm aus den Händen gerissen, emporgeschleudert wie ein Sektkorken. Dann verschwindet er zwischen den Leibern, zwischen den Füßen, platzt wie ein fauler Kürbis. Füße trampeln über das Gewirr von Drähten, Spulen, Röhren. Der Alte schreit mit einer hohen, überkippenden Stimme nach seinem Radio, flucht, weint, vergißt die Flucht, kämpft jetzt nicht mehr um sein Leben, bückt sich, um von dem zertrümmerten, zertretenen Apparat noch etwas zu retten, und über sein faltiges, schmutziges Gesicht laufen Tränen.
»Mami – Mami – es tut so weh – Mami – hilf mir …«
In diesem Augenblick verliert Marion den Jungen. Sie fährt herum, stemmt sich gegen den Sog, aber der Ansturm wirft sie zurück, drängt sie zum Fallreep ab. Sie klammert sich am Geländer fest. Zwei Marinesoldaten ziehen sie weg, sanft zuerst, dann mit Gewalt. Ihr Gesicht mit den weit offenen, vor Angst fast irrsinnigen Augen ist nach rückwärts gewendet, aber sie sieht den Jungen nicht mehr, sie sieht nur verzerrte Gesichter, offene Münder, Fäuste, die sich heben und wie Hämmer nach unten fallen, emporgestreckte Arme und Hände mit weit gespreizten Fingern: Hände von Ertrinkenden; die vergeblich einen Halt suchen.
Und plötzlich hebt sich über den Lärm ihre Stimme – nicht sehr laut, mit wenig Kraft, doch so voller Verzweiflung, so schrecklich hoffnungslos, daß es plötzlich still wird um sie. Eine atemlose, erschrockene, beschämte Stille. Und immer noch der Ruf, der klingt, als wäre er die laut gewordene Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit all dieser Menschen: »Jürgen – Jürgen – mein Junge – Jürgen – Jürgen …«
Drei Mann müssen Marion Fährbach nach unten ins Schiff bringen. Sie wehrt sich verzweifelt, schlägt um sich, ruft, schreit. Dann wird sie still und schwer, als hätte sie alle Kraft verlassen. In der Kabine bricht sie zusammen, ihr Gesicht hat alle Farbe verloren, über ihre Wange zieht sich ein blutiger Striemen, und Tränen, die unter ihren geschlossenen Augenlidern laufen, vermischen sich mit dem Blut zu einem dünnen, roten Rinnsal.
Die Matrosen bleiben draußen stehen.
»Junge, Junge«, sagt der erste und wischt sich über die Augen. »Hätte mir jemand das gesagt …«
»Die arme Frau!« sagt der zweite.
»Halt’s Maul!« schreit ihn der dritte an. »Halt jetzt bloß dein Maul!«
»Das Schiff wird unter einem guten Stern die Meere befahren …«, hatten die Seeleute nach der Jungfernfahrt gesagt. Sie hatten geglaubt, einen guten Grund für ihre Prophezeiung zu haben: Gleich hinter Southampton wurde – ein wenig verfrüht – ein Kind geboren, ein Mädchen, dem die Reederei lebenslänglich Freipassage schenkte.
Der gute Stern begleitete das Schiff auf allen seinen Fahrten. Doch jetzt, am 11. Februar 1945 in Gotenhafen, scheint es, als wäre sein Stern verblaßt, als hätte er sich verborgen hinter den eisigen Winterwolken, die grau und schwer über dem brennenden Land hängen.
Damals:
Das Schiff lief in Hamburg auf der Helling von Blohm & Voß vom Stapel. »Ich taufe dich auf den Namen ›Cap Arcona‹!« rief die elegante Tochter des Reeders mit heller, vor Erregung ein klein wenig heiserer Stimme und ließ die übliche Flasche Sekt am Bug des neuen Ozeanriesen zerschellen.
Ein großartiger Abschied von Hamburg. Die Geburt des Mädchens. Mutter und Kind ertranken fast im Blumenmeer, in der Kabine und im Gang davor. Rio de Janeiro: Zuckerhut und drei Flugzeuge, die zur Begrüßung Blumen abwarfen. An der Kaimauer eine 80 Mann starke Kapelle der brasilianischen Marine, Tausende von Menschen an der Pier, die dieses neue Wunderschiff mit seinen 1700 Passagieren bestaunten. Auf dem Promenadendeck die glückliche junge Mutter, die das Baby den drängenden Fotografen entgegenhielt.
Ein Wunderschiff: Fachleute aus aller Welt bestätigten, daß mit der »Cap Arcona« der Schiffsbau eine neue Meisterschaft erreicht hatte. Schon äußerlich bot das Schiff mit den drei Schornsteinen ein Bild anmutiger Eleganz und Vollkommenheit. Die harmonischen Formen des Promenadenund Bootsdecks, die senkrecht aus dem Wasser steigende Linie des mächtigen Vorderstevens, die leicht nach hinten abfallenden Masten und Schornsteine, die ausladende Kommandobrücke, die das Deck über seine ganze Breite beherrschte, das alles ließ schon optisch die »Cap Arcona« als ein Schiff erscheinen, das der Entwicklung vorausgeeilt war.
Der 206 Meter lange und 26 Meter breite Dampfer hatte 27 56o Brutto-Register-Tonnen. Seine Turbinen trieben ihn mit ihren 24000 PS mit rund 20 Knoten durch das Wasser – eine erstaunliche Geschwindigkeit. Das »Blaue Band« des Südatlantiks errang er mühelos.
Komfort, Küche und Keller machten »Cap Arcona« zur Dauermode. In fünf Küchen arbeiteten 84 Köche. Auf einer einzigen Überfahrt verbrauchten die Passagiere 15000 Kilo Fleisch, 6000 Kilo Geflügel und Wild, 6000 Kilo Fisch, 3 000 Kilo Schinken und Würste, 15 000 Kilo Gemüse, Salate und Küchenkräuter, 12000 Sack Kartoffeln, 40000 Eier, Hunderte von Kisten mit frischen Früchten neben einer Unmenge von Trockenproviant und Alkohol.
Die Passagierliste nahm sich aus, als hätte sich hier die hohe Gesellschaft ein permanentes Stelldichein gegeben. Es konnte geschehen, daß an einem Tisch der Exkönig von Sachsen und der Präsident von Uruguay saßen, am nächsten Charlie Rivel, der »Akrobat Schö-ö-ö-n«, und Gustaf Gründgens. In einer Ecke hatte der britische Botschafter in Deutschland, Sir Nevill Henderson, Platz genommen, in der anderen Fritz Thyssen und zwei Tische von ihm entfernt die deutsche Kronprinzessin Cecilie.
Im Jahre 1935 betrat ein knapp 25 Jahre alter Anfänger mit einem noch sehr jungen Offizierspatent der deutschen Handelsmarine, ein gutgewachsener Bursche mit hellen Augen und breiten Schultern, ein Kerl mit einem Appetit für zwei, auf alles, was ihm das Leben bieten konnte, die Gangway der »Cap Arcona«, um seinen Dienst als dritter Vierter auf dem Luxusschiff anzutreten.
Er sah den Atlantikhimmel voller Sterne und das Oberdeck voll schöner Frauen. Er wollte die Sterne einzeln vom Himmel holen und die Schönen alle in die Arme nehmen, und er blinzelte, als blendete ihn der Glanz dieses schwimmenden Paradieses.
Christian Straff, der Neue, blieb stehen, kostete die Salzluft, betrachtete »sein« Schiff, bewunderte es, während über sein Gesicht ein übermütiges Lächeln huschte.
Na denn los, dachte er, nichts wie drauf, dem Mutigen gehört die Welt. Dabei sah er auf die Linie des Schiffes und auf die Linien der weiblichen Passagiere und wußte nicht, was ihm besser gefiel.
Das war damals gewesen.
Und heute, am 11. Februar 1945:
Christian Straff, der Erste Funkoffizier der »Cap Arcona«, steht, vom Landurlaub zurückkehrend, auf dem Kai: in der schreienden, wogenden, nach vorne drängenden Menge eingekesselt, unfähig, sich zu rühren, unfähig, einen selbständigen Schritt nach vorne zu tun.
Flüchtlinge.
Der Prachtdampfer, der sich fast sechs Jahre lang als Wohnboot für die Kriegsmarine mit Erfolg vor den alliierten Bombern versteckt hatte, ist zu einem Frachtkahn massierter Verzweiflung geworden. Er steht nicht mehr im Dienst des Luxus, sondern in der Heuer des Elends. Er ist der letzte Ausweg für 10 000 Flüchtlinge geworden, die er an Bord nehmen soll, um sie zu retten, und die in den nächsten Stunden vielleicht schon in der Ostsee absaufen werden wie Ratten, wie die 4000 Flüchtlinge auf dem früheren Kraft-durch-Freude-Dampfer »Wilhelm Gustloff«, wie die 7000 auf dem Passagierschiff »Goya«, wie die 3 000 auf dem Lazarettdampfer »Steuben«.
Die Ostsee, dieses im bisherigen Kriegsverlauf ziemlich ruhige Binnenmeer, ist seit September 1944, seit der Kapitulation des kleinen Finnland vor der russischen Übermacht, ein Hexenkessel geworden, auf dem das Schicksal von Millionen schwimmt wie Treibeis.
Mit der »Cap Arcona« sollten 10 000 Flüchtlinge in Sicherheit gebracht werden. Aber es sind zweimal, dreimal, viermal so viele da, die mitgenommen werden wollen.
Der Erste Funkoffizier Christian Straff steht nur ein paar Meter von Jürgen entfernt, als der Junge von der Mutter weggerissen wird. Er sieht, wie der Junge zwischen Beinen verschwindet, wie zwei, drei Menschen über ihn fallen, sich wieder aufrichten, fluchend weiterdrängen.
Er handelt, ohne lange zu überlegen.
Die letzten drängen, stoßen. Das sich balgende menschliche Knäuel am Boden wird größer, wird zum Strudel, zur Falle, zu einer wütenden Schlägerei über einem Kind.
Der Seeoffizier ist von der Menge eingekeilt. Er kann sich selbst kaum rühren. Er hebt den linken Fuß, winkelt ihn ab, stößt mit dem Knie zu, wieder und wieder, kümmert sich nicht um die empörten, schmerzlichen Aufschreie der Menschen, die er trifft. Mit der freien Faust hämmert er in ein wütend verzerrtes Männergesicht, spürt kaum, daß der Mann zurückschlägt. Als er sieht, daß er so nicht durchkommt, läßt er seinen prall gefüllten Seesack von der Schulter gleiten. Aufprall. Flaschen splittern. Ein durchdringender Geruch nach Schnaps.
Schade, denkt er, verdammt schade um den Schnaps. Egal. Der Junge. Ich muß hin. Weiter. Schade um den Schnaps. Fünf Flaschen. Futsch. Egal.
Mit beiden Fäusten schlägt er jetzt in das Gesicht des Mannes, der ihm den Weg versperrt. Der Mann schreit, sein Gesicht verschwindet.
Weiter.
Jetzt hat er zwei Arme frei. Kommt besser voran. Und kommt dennoch kaum vom Fleck. Was sucht dieser Alte hier am Boden herum? Ein Gewirr von Drähten. Der Alte schluchzt.
»Platz da …«, schreit Christian Straff, »macht Platz, verflucht … macht Platz!« Stößt den Alten, der sich um seine Rufe nicht kümmert, beiseite. Weiter.
Ein Posten der Verstärkung erkennt den Funkoffizier, ruft zwei weitere Kumpel herbei. Zu dritt gehen sie jetzt gegen die Menge vor, mit den Fäusten zuerst, dann mit dem Gewehrkolben. Sie sehen, wie das Gesicht des Offiziers verschwindet, wieder auftaucht, nicht vom Fleck kommt. So holen sie noch schnell aus und dreschen noch gemeiner zu, bahnen sich eine Gasse, während sich Straff Zentimeter um Zentimeter vorankämpft, zu der Stelle, wo der Junge unter dem Menschenknäuel verschwunden ist.
Er erreicht sie schließlich, holt unter den Leibern der Erwachsenen das blutende, bewußtlose Kind hervor, legt es über die Schulter.
Sie erkämpfen sich den Weg zum Fallreep, erreichen die Gangway. Christian Straff wirft einen wehmütigen Blick über die freie Schulter auf die hin und her wogende Menge auf dem Kai. Dort irgendwo ist sein Schnaps … der Teufel soll ihn holen.
Auch auf dem Schiff kann sich Christian Straff nur langsam vorwärtskämpfen. Die grauen Menschen sind aufeinandergestapelt wie auf der Bekleidungskammer graue Sokken.
Endlich erreicht der Funkoffizier, vorsichtig den reglosen Jungen tragend, sein Deck, kämpft sich mühsam weiter. Er ist an die Fünfunddreißig, groß, kräftig, gut genährt. Zum makellosen Trojer trägt er einen sauberen Wollschal, was inmitten dieser zerlumpten Flüchtlinge mit den hungrigen Augen in den mageren Gesichtern auffällt. Schon vom Aussehen her ist Christian Straff der typische Seeoffizier: knapp in der Geste, sicher im Wort, selbstbewußt in der Haltung. Ein Gentleman mit einem Schuß Windhund, ein Zyniker mit Herz.
Bereits vor dem Krieg, in legendärer Friedenszeit, ist der junge Seeoffizier auf der »Cap Arcona« als dritter Vierter mehr auf Gesellschaftswache als im Brückendienst gefahren.
Die Reederei, unter deren rot-weißer Flagge er fuhr, verlangte von ihren Jungoffizieren nicht nur die besten seemänischen Examen, sondern auch geschliffene Manieren und ein blendendes Aussehen.
Die »Cap Arcona« war kein billiges KdF-Schiff, sondern ein Dampfer für Millionäre und solche, die dabei waren, es zu werden. Für Passagiere, die zwischen Hamburg und Rio tanzten und flirteten, Tennis spielten und sich sonstwie vergnügten, durfte es niemals Langeweile geben. Und wollte sie einmal aufkommen, setzte der Kapitän seine jungen Seeoffiziere vom Schlage eines Christian Straff als Stoßtrupp ein.
1939 wurde Straff direkt aus seiner Luxuskabine zur Kriegsmarine eingezogen, um Minen zu räumen. Ein verteufeltes Geschäft! Zweimal versenkt, einmal in die Luft geflogen und schließlich ein Kapitänleutnant ohne Schiff – bis ihn vor ein paar Wochen sein alter Kapitän Gerdts wieder für die zweckentfremdete »Cap Arcona« anforderte.
Das früher so leuchtende Schiff ist grau gestrichen. Grau das Heck, grau der Bug, grau die Aufbauten, grau selbst die Schornsteine, von denen früher schon von weitem das weiß-rote Emblem der Reederei leuchtete. Grau ist der Platz dahinter, das Sportdeck, vor dem Krieg ein maßgetreuer Tennisplatz, auf dem sich jetzt Menschen drängen, Menschen, die so grau sind wie das Schiff.
Als Christian Straff über diese Menschenbündel steigt mit dem Kind auf den Armen, als er die schmalen Kindergesichter mit den hungrigen Augen sieht, als er daran denkt, woher die Verpflegung genommen werden soll für die zehntausend, Milch für die Kinder, fällt ihm der südamerikanische Millionär ein, der gegen doppelte Gebühr eine lebende Kuh an Bord brachte, damit seine drei Kinder die Milch weitertrinken konnten, an die sie sich gewöhnt hatten. Bei diesem Gedanken muß er unwillkürlich lächeln: eine lebende Kuh, die für sich allein so viel Platz hatte wie jetzt fünfzig oder hundert Menschen. Eine Extra-Kuh für drei Kinder, und jetzt Hunderte von Kindern, die nicht einmal Magermilch haben …
10 000 Menschen, denkt er, zehntausend …! Früher gab es in der ersten Klasse 575, in der zweiten 275 und in der dritten 465 Passagiere. Und heute 10 000! Eine graue Masse ohne Klassenunterschied – vor der Fahrt über die Ostsee, die der Feind von oben und unten einsieht.
Wenn wir nicht auf dieser Fahrt absaufen, dann auf der nächsten, denkt er, während er den Jungen fast zärtlich in seine Kabine trägt. Aber absaufen werden wir.
Am Ende ist auch das egal.
Christian Straff, der Erste Funkoffizier, merkt, daß er auf seinem eigenen Schiff nicht mehr zu Hause ist. Die fünf Decks, die Niedergänge, die Treppenhäuser, das Bordkino, das Schwimmbassin, die Tanzbars, der Musikraum, der Festsaal sind überfüllt mit menschlicher Fracht. Überall kauern Flüchtlinge.
Plötzlich steht er vor dem Alten mit dem Radio.
»Sie haben mich gestoßen … getreten … mein Radio …«, fährt ihn det Alte an. Sein Blick ist haßerfüllt, aber Christian Straff hat das Empfinden, dieser Blick gilt nicht ihm allein, sondern allen um ihn, dem Schiff, dem Himmel, der Zeit, in der dieser Alte gezwungen ist zu leben.
»Gehen Sie nach unten, dort ist es wärmer«, sagt der Seeoffizier.
»Wissen Sie, wie alt ich bin?« fragt der Alte zusammenhanglos.
»Sie sollten unter Deck gehen, wenn Sie nicht erfrieren wollen.«
»Dreiundsiebzig Jahre«, sagt der Alte.
»Und wissen Sie, wie alt der Junge ist?« fragt Christian Straff gereizt und deutet auf den Jungen in seinen Armen.
»Das geht mich nichts an«, sagt der Alte. »Mein Radio …«
»Vergessen Sie’s«, sagt Christian Straff, macht sich frei, stapft vorsichtig weiter, hört den Alten hinter sich mit seiner hohen, weinerlichen Stimme reden: »Wie soll ich’s vergessen, wie? Der einzige Sohn tot, die Frau verbrannt, und ich mußte zusehen, und die Tochter – wo ist meine Tochter? Das Radio gehört ihr, und wenn ich sie wiederfinde … wo ist sie? Jetzt ist das Radio weg, und was soll ich ihr sagen, wenn ich …«
Der Funkoffizier hebt die Schultern. Es sieht aus, als zöge er den Kopf ein. Sein Zorn auf den Alten, seine Ungeduld gehen im Mitleid unter.
Endlich erreicht er seine Funkbude. Sie riecht nach Fusel. Der Mann an der Morsetaste hat anscheinend nichts weiter zu tun, als dämlich zu grinsen: sicher betrunken. Ein betrunkener Funkmaat … Himmel, wenn es das früher gegeben hätte! Undenkbar.
Der Funkmaat zieht den Hörer vom Kopf, steht langsam auf. Von seinen Kameraden wird er »Möhrenkopf« genannt – wegen seines schmalen, sich spitz nach unten verjüngenden Kopfes, auf dem die struppigen Haare wie Unkraut wuchern. Sein Blick gleitet unsicher von dem Gesicht des Seeoffiziers nach unten zu dem Jungen.
»Was is ’n das, Herr Kaleu? Ich dachte. Sie wollen Schnaps mitbringen?«
»Du brauchst keinen mehr«, sagt der Seeoffizier.
»Ist das etwa Ihr Sohn, Herr Kaleu? Wer hat ihn denn so zugerichtet?« Sein Grinsen ist schief, sein Blick glasig. »Familienanschluß gefunden?«
»Schnauze!« Straff legt den Jungen behutsam auf ein Notbett. Er sucht Wasser, einen Lappen, wischt dem Kind das Blut aus dem Gesicht, untersucht den Kopf. »Halb so schlimm«, murmelt er erleichtert. »Die haben sich vielleicht benommen! Wie Schweine.«
»Wer?« fragt der Maat.
»Die Leute am Fallreep.«
»Alles Volksgenossen«, sagt der Maat. »Gefallen sie Ihnen vielleicht nicht, unsere Volksgenossen?«
»Genauso wie du.«
»Sachte, sachte«, grinst der Möhrenkopf. »Wir bilden jetzt eine verschworene Gemeinschaft, Herr Kaleu. Bei Tag und bei Nacht. Ob ich Ihnen gefalle oder nicht – Sie werden sich an mich gewöhnen müssen. Stubenkameraden. Ihre Kabine ist nämlich beschlagnahmt für werdende Mütter, Herr Kaleu. Is ’n Ding, was?«
Der Offizier antwortet nicht.
Der Maat läßt sich auf seinen Stuhl fallen, streckt die Beine weit von sich, feixt. »Für mich geht ein alter Traum in Erfüllung. Wollte schon immer mal mit einem Offizier schlafen.«
»Wenn du aufwachst, mein Sohn«, murmelt Straff, während er die Nachrichten durchgeht, »wirst du einen Katzenjammer haben, der sich gewaschen hat. Und ich werde nichts tun, um es dir leichter zu machen. Jetzt aber halt endlich deine Schnauze.«
Die Nachrichten sind meistens Blind- und Füllsprüche. Aus Gründen der Geheimhaltung ist der eigentliche Funkverkehr mit der »Cap Arcona« stillgelegt. Nur im äußersten Notfall darf sie funken, bei einem russischen U-Boot-Angriff zum Beispiel, wie er die vor zehn Tagen aus dem gleichen Hafen ausgelaufene »Gustloff« versenkte, von der jetzt noch Leichen, Wrackteile und Gepäckstücke als Strandgut angetrieben werden.
»Sonst nichts?« fragt der Funkoffizier schließlich.
»Nee. Wie wär’s mit einem Schluck, Herr Kaleu?« Der Möhrenkopf kramt eine Flasche hervor, nimmt den Korken ab, setzt sie an, sein Adamsapfel hüpft auf und nieder.
»Genug!« fährt ihn Straff an.
»Ich sauf’, bis ich absauf’«, erwidert der Maat, setzt aber die Flasche gehorsam ab. »Wissen Sie, ich mach’ mir vorher warm. Das Wasser nämlich ist verflucht kalt.«
»Witzbold.« Der Funkoffizier nimmt die Flasche, setzt sie ohne Umstände an den Mund.
»Nich so ville!« jammert der Möhrenkopf. Dann lacht er, und sein Gesicht spielt Weihnachtsmann. »Wissen Sie, wie viele ich noch habe?«
»Wie viele?«
»Fünfe.«
»Woher?«
»Beziehungen. Hab’ einem Zahlmops auf das Schiff geholfen.«
»Freut mich, daß du so tüchtig bist. Jetzt kannst du’s gleich noch mal beweisen. Erst holst du einen Arzt, und dann schaust du, daß du die Mutter von diesem Jungen auftreibst.«
»Herr Kaleu – ich …«
Straff sieht den anderen nur an. Der Möhrenkopf duckt sich wie unter einem Peitschenhieb, grinst kläglich, trollt sich ohne Widerspruch. Er weiß genau: Mit Männern, die einen so ansehen wie dieser Funkoffizier, kann man eine Menge Spaß haben, man kann sich hundertprozentig auf sie verlassen – aber man muß ihnen parieren.
Einen Arzt auftreiben, das geht schnell, denkt er, als er aus der Kabine stolpert. Aber wo soll ich die Mutter finden? Wie? Leichter findest du ein Sandkorn in der Wüste …
Der Tag bleibt grau, diesig. Der Nordostwind schneidet wie mit einem Messer in die Gesichtshaut, läßt die Augen tränen, reißt die Worte wie Nebelfetzen von den Lippen. Über den drei Schornsteinen des Schiffes hängt ein niedriger Himmel, die Deckaufbauten sind von einer Eisschicht überzogen. Die vermummten Besatzungsmitglieder sehen aus wie Marsmenschen.
Marion Fährbach irrt über die Schiffsgänge zwischen den Decks, geht von Raum zu Raum, von Mensch zu Mensch. Sie kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Aber die Angst um Jürgen treibt sie vorwärts.
»Haben Sie einen kleinen Jungen gesehen … fünf Jahre alt … mit einem schwarzen Lodenmantel … ich habe ihn verloren, er ist so zart und …«
Die Gefragten schütteln die Köpfe. Es gibt welche, die sie mitleidig ansehen, die meisten jedoch nur gleichgültig.
Weiter. Fragen. Immer wieder fragen. Zehnmal. Hundertmal. Tausendmal.
Als man Marion nach unten gebracht hatte, war sie ein paar Minuten später schon wieder zu sich gekommen. Sie hatte sich benommen umgesehen, während ihre Hand nach dem Jungen tastete. Und dann das Begreifen, die Erinnerung, das Entsetzen. Und die Suche.
Jetzt ist sie im ehemaligen Billardsaal. Aber das weiß sie nicht. Sie wandert immer wieder durch die gleichen Decks. Das Schiff ist ein Labyrinth.
Marion, die Frau eines Seeoffiziers, von dem sie seit Monaten nichts mehr gehört hat, sollte eigentlich wissen, wie es auf einem Schiff aussieht. Aber ihre Gedanken laufen schneller, als es ihre Beine zu tun vermögen. Sie bangt und betet, glaubt und verzweifelt, sucht, sucht, sucht …
»Haben Sie einen kleinen Jungen gesehen, blond, mit einem schwarzen Lodenmantel …«
Tanzbar. Musikraum. Nur fremde Kinder. Ein Riesenbild des Führers an der Wand. Bunt. Feldherrnpose.
Ein Matrose verwehrt Marion den Aufgang zum Oberdeck. »Jetzt nicht«, sagt er. »Später können Sie ’rauf.«
»Ich muß! Bitte! Sie müssen mir helfen, verstehen Sie doch, es ist mein Junge … vielleicht ist er da oben und friert, er ist fünf Jahre alt, er ist das einzige … mein Mann ist vermißt, und …«
Sie spricht wie im Fieber. Aber es sind nicht ihre Worte, die den Posten umstimmen, sondern ihr Gesicht und ihre Augen.
»Kommen Sie mit.« Er geht voran, vorbei an mürrischen, verdrossenen Menschen, die ihnen nur nörgelnd Platz machen.
Die Panik hat sich gelegt. Nach ihr kommt die lähmende, schleichende Angst. Jetzt denken die Menschen kaum noch daran, daß dieses Schiff ihre Rettung bedeuten kann. Die »Cap Arcona« wird für sie plötzlich zu einer Mausefalle. Wenn ein U-Boot oder feindliche Bomber … ein Torpedo …
»Wir finden Ihren Jungen schon«, sagt der Matrose, als sie das Oberdeck erreichen, und lächelt ihr aufmunternd zu. »Verlassen Sie sich darauf, das Schiff ist nicht die Welt. Wir müssen nur ein bißchen Geduld haben.«
Früher konnte man binnen weniger Sekunden auf der »Cap Arcona« einen Passagier finden. Sie war für 1 300 gebaut, nicht für 10 000.
Und so suchen Marion und der Matrose vergeblich – auch noch, als das Schiff fertig ist zum Auslaufen.
Die Turbinen arbeiten halblaut. Die beiden Schlepper, die das Schiff aus dem Hafenbecken in die Ostsee ziehen sollen, dampfen heran. Soweit den Passagieren die Vorbereitungen zum Ablegen bewußt werden, zeigen sie Unruhe. Die einzelnen Decks werden von bewaffneten Posten versperrt.
Als sich Christian Straff bei Kapitän Gerdts meldet, huscht über das zerfurchte, vor Müdigkeit graue Gesicht des Kapitäns ein kurzes Lächeln.
»Erinnern Sie sich, wie’s früher war, wenn wir ausliefen, Straff?«
»Und ob ich mich erinnere!« Christian Straff lächelt zurück. »Musik, Blumen – und wir wie aus dem Ei gepellt. Und meistens schien die Sonne.«
»Zum Glück scheint sie heute nicht.« Kapitän Gerdts blickt gegen den Himmel. »Und hoffentlich bleibt sie verborgen hinter dieser Waschküche.«
Straff weiß genau, was der Alte damit sagen will. Wenn der Himmel weiter so bedeckt bleibt, haben sie nur mit einer Gefahr zu rechnen – mit den U-Booten.
In der Funkkabine kommt der kleine Jürgen zu sich, beginnt zu weinen, ruft nach der Mutter. Der Arzt, den der Möhrenkopf schnell auftreiben konnte, hat den Kopf des Jungen verbunden. Sonst nur Prellungen. Der Arzt ging wieder, und Möhrenkopf versucht jetzt, das Kind durch alberne Späße und Grimassen abzulenken.
Dies gelingt ihm auch: Sein Gesicht ist für so was wie geschaffen.
Jürgens Mutter sucht auf der anderen Seite des Oberdecks weiter. Zwischen Backbord und Steuerbord sind nur 26 Meter Distanz, aber zwischen den beiden hockt der Teufel und freut sich über den Krieg.
Soweit die Flüchtlinge an Oberdeck sind, drängen sie sich in die Nähe der großen Rettungsboote, die insgesamt für 2000 Menschen bestimmt sind. Theoretisch hätte also nur jeder Fünfte eine Chance, falls das Schiff sinken würde – praktisch aber könnte sich kein einziger retten.
Denn mit diesen Rettungsbooten hat es eine besondere Bewandtnis. Und wie es damit steht, erkennt der Funkoffizier Christian Straff erst, nachdem er auf dem Wege vom Kapitän an den Rettungsbooten vorbeikommt.
Ein Mann zupft ihn plötzlich am Ärmel. »Herr Kapitänleutnant – einen Augenblick, bitte!«
Unwillig dreht sich Christian Straff um. »Was, zum Teufel …«
Der Mann, der ihn angesprochen hatte, hat ein altes, wettergegerbtes Gesicht. Die Spitzen seines großen grauen Schnurrbartes hängen nach unten, seine Augen sind hell und aufmerksam.
»Die Rettungsboote«, sagt er leise und deutet mit dem Kopf nach oben.
»Ja, und? Was ist damit?«
»Sehen Sie sich das mal selber an, Herr Kapitänleutnant.« Die Stimme des alten Mannes ist leise, gleichmütig, kalt. »Es sind keine Taljen da. Man kann die Boote nicht zu Wasser lassen.«
»Verflucht!« Christian Straff blickt erschrocken nach oben. Der Alte hat recht. Keine Taljen. Um das Tauwerk während der langen Jahre auf der Reede vor Nässe zu schützen, hatte man an den Booten zwischen den Davits sämtliche Taljen abmontiert. In der Eile konnten sie nicht mehr angebracht werden, vielleicht auch hat niemand daran gedacht.
»Na?« fragt der Alte.
»Sie verstehen was davon?« Christian Straff wundert sich darüber, wie ruhig seine Stimme klingt.
Der Alte lächelt kurz. »Ich fuhr zur See, als Sie noch nicht auf der Welt waren, Herr Kapitänleutnant. Ich bin ein alter Mann … es ist nicht meinetwegen. Aber die vielen Kinder und Frauen …«
»Halten Sie bloß den Mund! Um Himmels willen – halten Sie den Mund! Wenn die Leute erfahren …«
Der Alte nickt. Sein Gesicht ist sehr ruhig. »Ich weiß. Ich wollte es Ihnen bloß sagen.«
Aus, denkt Straff, als er weitergeht. Aus, Schluß. Sollten die westlichen Flugzeuge wegen des diesigen Wetters ausbleiben, so wimmelt es in der Ostsee von russischen U-Booten. Sollten diese den dicken Pott verschlafen, so muß die »Cap Arcona« durch Hunderte von Magnetminen hindurch, von denen jede das Ende des Schiffes bedeuten kann.
Und kein einziges einsatzbereites Rettungsboot!
Endlich wird der Anker gelichtet. Die schweren Glieder der riesigen Kette rasseln wie ein Steinschlag. Die Flüchtlinge an Oberdeck fahren entsetzt auseinander, als würde die Stahlhaut ihres Potts schon von einem russischen Torpedo zerfetzt.
Gleich beginnt wieder die Völkerwanderung auf dem lichtlosen Sonnendeck. Wer links steht, drängt nach rechts, wer vorn ist, will nach hinten. Jetzt, da sich die Flüchtlinge in Sicherheit wähnen, können sie sich auch wieder um andere kümmern, und nun fällt jedem ein, was er bei dem Sturm auf das Schiff vergaß: den Koffer vielleicht oder den Nachbarn, die Mutter oder den Freund, ein Radiogerät oder nur eine Wolldecke.
Vielleicht auch nur das Gewissen …
Marion Fährbach kommt vom Achterschiff. Sie spürt die Kälte nicht und auch ihre Beine nicht mehr, die sie Hunderte von Kilometer trugen, querfeldein, auf einer entfesselten Massenflucht, weitergehetzt von dem gräßlichen Hurräh der Russen in ihrem Rücken. So lange hat sie Jürgen getragen, gezogen, geschleppt. Sie hat ihn Tag und Nacht an der Hand gehalten, der Sicherheit entgegen … Und nun soll sie ihn verloren haben?
Sie glaubt es nicht. Sie wehrt sich mit allen Mitteln dagegen. Sie fragt und geht von einem zum andern. Vielleicht sprach sie hundert an, vielleicht auch mehr. Ein Matrose hilft ihr. Er verläßt seinen Posten. Er kann dem wunden Blick dieser großen traurigen Augen nicht widerstehen. Er hat kein Granitgesicht wie viele dieser Flüchtlinge, die zu viel erlebt und erlitten haben, um für andere noch mitfühlen zu können.
»Wir werden ihn gleich finden«, sagt er schon zum drittenmal.
Marion Fährbach nickt. Aber im nächsten Moment läuft der junge Matrose seinem Chef in den Weg, wird zusammengebrüllt und zurückkommandiert.
Ein alter Mann, vielleicht siebzig, ein Herr, der inmitten dieser grauen, zerlumpten Gestalten gepflegt wirkt, verfolgt die Szene, wirft seine Zigarette weg, lächelt Marion zu. »Kommen Sie, junge Frau«, sagt er, »ich helfe Ihnen.«
Immer höflicher antworten die Flüchtlinge, die Marion fragt, immer fühlbarer wird ihre Teilnahme. Nichts erinnert mehr an die Menschen von vorhin, die wie Bestien über ein Kind hinwegtrampelten.
Sie sind ja gar nicht so wie am Fallreep, denkt die Mutter, nur ihre Nerven haben versagt, nicht ihr Anstand. Einer von ihnen hat sicher Jürgen mitgenommen; hat ihn aufgehoben, beschützt, und jetzt liegt der Junge wahrscheinlich irgendwo auf einem Strohsack und schläft, mit dem Daumen im Mund, wie es seine Gewohnheit ist …
Marion Fährbach spürt auf einmal etwas von dem Fluidum und Zauber, den sie früher erlebte, als sie an der Rampe stand, als der Beifall zu ihr emporrauschte, als sie die »Mimi« sang oder die »Tosca«, als sie sich verbeugte, schmal, hübsch, rassig, und als sie immer wieder gerufen wurde, als die Besucher ihre Garderobe stürmten, klatschten, ein Autogramm wollten, als alle Gesichter, die ihr entgegensahen, sie liebten, sie bewunderten, ihr dankbar waren.
Mein Gott, denkt die junge Frau, wie lange ist das her? Drei Jahre, noch nicht einmal ganz, zwei Jahre erst. Dieser Krieg, alles hat er zerstört. Georg hat er mir genommen. Die Luftangriffe vertrieben uns aus Berlin. Und jetzt hier, Ostpreußen, Flucht, Jürgen … er ist hier an Bord. Ich bin ganz sicher. In einer dieser tausend Kabinen und Decks, in diesem Labyrinth, in dem man sich erst nach Tagen zurechtfinden kann.
»Der Musikraum soll für die Kinder hergerichtet werden«, sagt der alte Mann an ihrer Seite.
»Da war ich schon«, antwortet Marion Fährbach.
»Geduld, wir finden ihn …«
Im gleichen Moment sieht sie seitlich vor sich einen schmalen Blondkopf mit lebhaften Augen.
»Jürgen!« ruft sie und hastet mittschiffs, so daß der alte Herr ihr kaum folgen kann. »Jürgen!«
Und dann steht sie vor einem anderen Kind, das nur eine flüchtige Ähnlichkeit mit ihrem Jungen hat, sieht das zärtliche Lächeln der Mutter und spürt einen Stich im Herzen.
Marion bleibt erschöpft stehen, sieht zum Pier hin, wo immer noch Hunderte stehen, die nicht auf das Schiff kamen, schweigend aneinandergepreßt, dunkel, Menschen, die mit gierigen Augen zu dem Dampfer sehen, der in die vermeintliche Sicherheit schwimmt … Gescheiterte, Wartende, die vielleicht das bessere Los gezogen haben.
Auf einmal überfällt Marion die Vorstellung, daß Jürgen unter ihnen sein könnte, verletzt vielleicht, dieser Horde ausgesetzt, die in wütender Panik über ihr Kind hinwegtrampelte. Rette sich, wer kann! Einer auf Kosten des anderen, einer des anderen Feind oder sein Opfer.
Der Gedanke wird zum Wahn, zum Zwang.
Die Mutter sieht auf einmal wieder das gräßliche Bild, erlebt es zum zweitenmal, atmet schwer, spürt den wütenden, zuckenden Schmerz im Kopf, merkt, wie sich die Angst wie ein Lasso um ihren ganzen Körper legt. Der Boden scheint nachzugeben. Ihre Augen tränen …
Marion Fährbach reißt sich von dem alten Herrn los, der sie festhält, sieht entsetzt, wie das Fallreep eingezogen wird, die letzte Verbindung mit dem Land, wo ihr Kind, wo Jürgen, der Fünfjährige, ist, allein … bei 15 Grad unter Null! Irgendwo abseits liegend wie ein Bündel Kleider. Kleider würden sie mitnehmen. Kinder lassen sie liegen …
Marion Fährbach reißt sich los, hastet auf die Reling zu, steht da, starrt hinab. Der Schwindel überkommt sie. Sie breitet die Arme aus, beugt den Oberkörper vor, versucht sich abzudrücken, schafft es nicht, schließt die Augen, wird endlich von Männerhänden festgehalten, zurückgezogen.
»Nehmen Sie doch Vernunft an«, sagt eine Frau.
Marion reißt sich los, schlägt um sich, mit beiden Händen. Sie schreit, beißt, atmet schwer. Sie hat einen irren Ausdruck im Gesicht, als sie es noch einmal versucht. Zwei Matrosen halten sie fest. Ihr letzter Widerstand zuckt in harten Männerfäusten.
»Laßt mich los!« schreit Marion. »Ich will zurück … an Land … ich muß! Jürgen … Jürgen!« brüllt sie. Die Verzweiflung zerlegt den Namen in Silben des Wahnsinns.
»Die spinnt«, sagt ein Umstehender.
»Komm«, stößt der eine Matrose seinen Kumpel an, »wir schaffen sie ins Lazarettdeck … der Doktor soll ihr ’ne Beruhigungsspritze verpassen.«
Die beiden ziehen Marion gewaltsam weiter. Ein letztes Mal bäumt sie sich auf, versucht sie sich loszureißen, wie ein Tier, das die Nähe des Schlachthofes wittert.