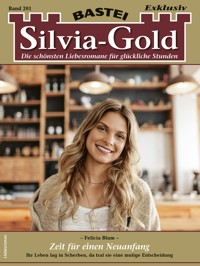1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Seraphina Prinzessin von Buchheim hat den Höhepunkt ihrer Künstlerkarriere erreicht. Ihre Werke werden in einer renommierten Galerie ausgestellt, und ein Käufer aus Frankreich ist bereit, ihre gesamte Kollektion zu erwerben. Bei der Vernissage trifft Seraphina persönlich auf den charmanten Fremden, der ihr Herz im Sturm erobert: Phillipe Prinz de Lorraine. Es knistert gewaltig zwischen den beiden, und die Prinzessin lässt sich nur zu gerne in eine Welt voller Luxus und Romantik entführen. Der Spross einer altehrwürdigen Adelsfamilie scheint tatsächlich der Mann ihrer Träume zu sein, sehr zum Leidwesen von Frederick von Preusbach. Der Baron liebt Seraphina schon lange heimlich, und als sie dem Prinzen tatsächlich auf sein Schloss nach Frankreich folgt, sieht Frederick seine Chance endgültig verpasst. Schon bald folgt eine Blitzhochzeit ohne Familie und Freunde. Frederick wird misstrauisch, denn das entspricht nicht Seraphinas Wesen. Doch niemand ahnt, dass aus dem Prinzessinnentraum ein wahrer Albtraum geworden ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Ähnliche
Inhalt
Cover
Hätte ich dich doch nie geheiratet!
Vorschau
Impressum
Hätte ich dich doch nie geheiratet!
Niemand ahnt das Unglück der Prinzessin
Von Felicia Blum
Seraphina Prinzessin von Buchheim hat den Höhepunkt ihrer Künstlerkarriere erreicht. Ihre Werke werden in einer renommierten Galerie ausgestellt, und ein Käufer aus Frankreich ist bereit, ihre gesamte Kollektion zu erwerben. Bei der Vernissage trifft Seraphina persönlich auf den charmanten Fremden, der ihr Herz im Sturm erobert: Phillipe Prinz de Lorraine. Es knistert gewaltig zwischen den beiden, und die Prinzessin lässt sich nur zu gerne in eine Welt voller Luxus und Romantik entführen. Der Spross einer altehrwürdigen Adelsfamilie scheint tatsächlich der Mann ihrer Träume zu sein, sehr zum Leidwesen von Frederick von Preusbach. Der Baron liebt Seraphina schon lange heimlich, und als sie dem Prinzen tatsächlich auf sein Schloss nach Frankreich folgt, sieht Frederick seine Chance endgültig verpasst. Schon bald folgt eine Blitzhochzeit ohne Familie und Freunde. Frederick wird misstrauisch, denn das entspricht nicht Seraphinas Wesen. Doch niemand ahnt, dass aus dem Prinzessinnentraum ein wahrer Albtraum geworden ist ...
Gleich in der Kastanienallee, gegenüber der kleinen Galerie, kam die schwarze Limousine zum Stehen. Frederick Baron von Preusbach stieg als Erster aus. Feiner Nieselregen legte sich auf sein blondes, zurückgekämmtes Haar. Er zog den Mantelkragen enger um den Hals und sah entschlossen auf die andere Straßenseite. Zwischen all den stuckverzierten Gründerhäusern tanzte dieser schlichte, modernisierte Bau aus der Reihe.
Kunstsalon SVB stand in eleganter Schrift auf dem Schild über der Eingangstür. Große, bodentiefe Fenster gaben den Blick frei in das Innere des Gebäudes. Der Ausstellungsraum erinnerte an ein Loft: Backsteinwände, freiliegende Stahlträger und eine halbgewendete Treppe, die auf ein Podest hinaufführte. Frederick sah Seraphina vor den Treppenstufen, gleich neben einer ihrer Kupfersticharbeiten.
Die Prinzessin trug ein schlichtes, olivgrünes Kleid und hatte ihr dunkles Haar zu einem strengen Dutt zusammengebunden. Konzentriert blickte sie beim Telefonieren auf den Boden, eine Hand dabei um ihre schlanke Taille geschlungen. Sein Herz pochte aufgeregt.
Heute. Heute sage ich ihr endlich, wie ich fühle, dachte er.
Eilig wandte er sich wieder der Limousine zu und reichte der darin noch sitzenden Dame seine Hand. Mit gewohnter Eleganz stieg nun Theresia Fürstin von Buchheim aus und strich mit einer schnellen Bewegung über ihren Rock, der farblich perfekt auf ihren blauen Glockenhut abgestimmt war. Dann betrachtete auch sie die Galerie.
»Ah, sieh nur. Meine Tochter war wieder fleißig. Zwei neue Bilder.« Zufrieden blickte sie zu dem Baron auf und hakte sich bei ihm unter. »Nun denn. Wollen wir ihr die freudige Nachricht überbringen?«
Frederick nickte lächelnd. Gemeinsam überquerten sie die Straßenseite und wichen dabei mehreren Pfützen aus. Seraphina bemerkte sie, noch bevor sie die Galerie betraten. Sofort beendete sie ihr Telefonat und öffnete ihnen beschwingt die Tür.
»Mama! Frederick! Was macht ihr denn hier?«
Glücklich begrüßte sie die beiden mit einem Wangenkuss, ihre grünen Augen leuchteten dabei. Wieder einmal kam der Baron nicht umhin zu denken, wie schön diese Frau doch war.
Seraphinas Mutter griff nach ihrer Hand.
»Wir wollen dir etwas Wichtiges mitteilen«, erklärte die Fürstin. »Um genauer zu sein, hat Frederick dir etwas zu sagen.«
Sie nickte ihm aufmunternd zu. Ihre Tochter betrachtete ihn nun so eindringlich, dass in Fredericks Wangen eine leichte Hitze aufstieg.
Er räusperte sich. »Wir kommen gerade von Tabeas Galerie.«
Seraphina blinzelte. »Tabea? Tabea Hirscher? Die Galeristin in der Potsdamer Straße?«
Frederick nickte.
Seraphina wandte sich an die Fürstin.
»Sag nicht, du hast eine Kooperation mit dieser Frau auf die Beine stellen können. Soweit ich weiß, vertritt sie mittlerweile über vierzig internationale Künstlerinnen. Und sie ist auf allen wichtigen Kunstmessen tätig. Wer seine Werke in ihren Programmen ausstellen darf, gilt entweder als extrem etabliert oder verdammt talentiert.«
»Ja, ihr Geschmack ist fantastisch«, bestätigte Theresia und rückte ihrer Tochter den Spitzenkragen ihres Kleides zurecht, obwohl alles perfekt saß. »Vor allem in Dessertangelegenheiten. Seit sie unserem Wohltätigkeitsverein beigetreten ist, bringt sie die leckersten Kuchen mit. Ich kann mir ein Komiteetreffen ohne Tarte Tatin nicht mehr vorstellen.«
Frederick übernahm schnell das Wort, bevor sich die Fürstin in der Beschreibung weiterer vorzüglicher Kuchensorten verlor.
»Ihre aktuelle Gruppenausstellung endet diesen Monat«, fuhr er also fort. »Ich stand Tabea für die Konzeptionalisierung der nächsten Ausstellung zur Seite. Es soll um die Verbindung verschiedener Welten gehen, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich. Sie wollte Werke mit Vielschichtigkeit in ihrer Ausdruckskraft. Die eine Neubewertung traditioneller Techniken und Motive ermöglichen. Ich habe ihr klargemacht, dass sie Bilder wie deine will.«
Seraphina blinzelte mehrmals. »Du machst Witze.«
»Keineswegs.« Er grinste. Es gelang selten, diese Frau aus der Fassung zu bringen. »Drei Kunstschaffende sollen präsentiert werden. Eine davon bist du. Tabea und ich haben uns auf sieben Bilder von dir geeinigt. Welche genau wir nehmen, müssen wir natürlich auch noch mit dir besprechen, aber es gibt ein, zwei Werke, auf die ich schon jetzt bestehen muss.« Er lächelte sanft.
Ihr fehlten immer noch die Worte.
»Ich kann nicht fassen, dass ihr das für mich getan habt«, stammelte Seraphina.
Die Fürstin hob sogleich die Hände.
»Ich habe nur den Kontakt hergestellt, Liebes«, erwiderte sie, »es war vor allem der ehrgeizige Kurator neben mir, der das ermöglicht hat.«
Frederick freute sich über den anerkennenden Blick, den sie ihm schenkte. Dann sah sie auf die Uhr, nickte kurz und legte Seraphina beide Hände um ihr Gesicht.
»Also gut. Ich muss los, dein Vater erwartet mich schon. Ich wollte mir bloß nicht deinen Gesichtsausdruck bei den Neuigkeiten entgehen lassen.« Sie gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Dein Vater auch. Und denk dran: Wir sehen uns morgen zum Abendessen.« Die Fürstin wandte sich an Frederick. »Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, sofern du Zeit hast. Annabelle macht wieder ihr fantastisches Chateaubriand in Portweinjus.«
»Wie könnte ich da ablehnen«, sagte Frederick augenzwinkernd, während er ihr die Tür aufhielt.
Sie drehte sich noch einmal zu ihrer Tochter um.
»Und überleg dir das noch einmal mit deinem Stillleben. Der Immobilienfreund deines Vaters ist nach wie vor interessiert.« Dann war sie auch schon weg.
Sogleich drehte Seraphina ihren Kopf zu dem Baron. Ihre Augenbrauen waren zusammengezogen.
»Frederick, ich ... ich bin dir sehr dankbar. Aber genau wegen solcher Dinge gehöre ich nicht in die Ausstellung.«
Er runzelte die Stirn. »Was meinst du damit?«
»Ich will nicht, dass mein Stillleben wegen guten Zuredens meines Vaters gekauft wird. Und ich will mir auch keinen Platz in Tabeas Galerie erschleichen, weil ihr Kurator mein bester Freund ist. Ich will durch meine Bilder überzeugen, nicht durch meine Beziehungen.«
»Aber Seraphina, Tabea ist von deinen Bildern überzeugt«, widersprach der Baron. »Ich habe sie ihr doch gezeigt. Denkst du, sie hätte sonst zugestimmt? Sie ist derselben Meinung wie ich: Deine Kunst gehört gesehen. Sie und viele andere hätten dich schon längst ausgestellt, wenn du mehr auf deine Arbeit aufmerksam machen würdest. Aber du bist da zu bescheiden und zurückhaltend. Also muss jemand für dich sprechen, wenn du es nicht tust.
Du musst endlich einsehen, dass der Erfolg deiner Arbeit nichts mit deiner Herkunft zu tun hast. Deine Arbeit wird überwiegend von unseren Kreisen gekauft, weil du dich nicht aus unseren Kreisen heraustraust. Aber sie muss von noch viel mehr Menschen gesehen werden. Sie ist fantastisch, Seraphina. Und das sage ich nicht nur aus persönlicher Überzeugung. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist schließlich auch mein Job.«
»O Frederick.« Er gab bei ihrer Umarmung einen überraschten Laut von sich. Sie wirkte gerührt, als sie zu ihm aufblickte. »Was würde ich nur ohne dich tun«, gestand sie dankbar und lächelte ihn dabei warm und unschuldig an.
Jetzt, dachte er, jetzt ist der Moment. Nutze ihn!
Er errötete, räusperte sich. »Seraphina, ich liebe deine Arbeit. Sie ist etwas ganz Besonders. Genau wie du.«
Ihr Lächeln wurde breiter. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals.
Jetzt, ertönte es wieder in seinem Kopf, sag es ihr. Sag es ihr endlich!
»Ich ...«
Er zuckte zusammen, als das Glöckchen über der Eingangstür klingelte. Sofort löste er sich von der Umarmung, als hätte man ihm bei etwas Verbotenem erwischt.
Seraphina sah erfreut zu der jungen, aschblonden Frau, die die beiden breit angrinste.
»Ihr seid mir vielleicht zwei Zuckerschnuten. Wenn ihr wüsstest, wie süß ihr von draußen ausgesehen habt.«
Frederick zwang sich zu einem Lächeln. »Hallo, Marie.«
»Hallo, Frederick«, erwiderte sie gut gelaunt. »Seraphina und ich gehen noch was trinken. Kommst du mit?«
Er überlegte. Schließlich stimmte er zu.
Seraphina klatschte begeistert in die Hände. »Ich mache nur noch schnell die Lichter aus!«
Er sah ihr nach, wie sie nach hinten ins Atelier verschwand.
Morgen, dachte Frederick resigniert. Morgen ist auch noch ein Tag.
Rund um den Kurfürstendamm gab es einige Lokale, die Marie zu ihren Favoriten zählte. Im Sommer war es die Rooftop-Bar gleich bei der Gedächtniskirche. Feierabendcocktails gab es meist in der Lounge am Ende der Budapester Straße. Und ihr Tanzbein schwang sie am liebsten im Nachtclub gleich beim Zoologischen Garten.
Doch heute hatten die Ladies beschlossen, eine ganz neue Bar auszutesten. Das Elysium hatte erst vor wenigen Wochen seine Pforten geöffnet und war schon jetzt extrem angesagt. Die goldenen Art-Deko-Verzierungen, samtroten Vorhänge und kunstvollen Kristallleuchter erinnerten sie an die Clubs der 1920er-Jahre. Alles war in warmes, schummriges Licht getaucht.
Zufrieden nippte Marie an ihrem fantastischen Cosmopolitan und hörte Frederick und Seraphina dabei zu, welche Bilder für die anstehende Ausstellung gewählt werden sollten.
»Das Selbstporträt in Großformat müssen wir auf jeden Fall nehmen. Die verzerrte Perspektive ist genial, vor allem mit der Mischtechnik. Die Spannung zwischen Tradition und Moderne wird hier wunderbar sichtbar. Und den Kupferstich der bewegten Farben – so ein modernes Motiv, kombiniert mit traditioneller Technik. Ich finde es fantastisch.«
»Ich finde vor allem fantastisch, wie sehr du meine Bilder verstehst. Das ist so ein tolles Gefühl.«
Marie sah dabei zu, wie diese zwei unglaublich attraktiven Menschen sich warm anlächelten. Frederick griff nach Seraphinas Hand und drückte sie liebevoll.
Marie verzog das Gesicht.
»Ihr wollt mich doch veräppeln.« Sie stellte ihr Cocktailglas auf dem Marmortisch ab, verschränkte die Arme und lehnte sich tiefer in das samtige Sofa zurück. »Wie lange wollt ihr noch behaupten, ihr wärt nur befreundet? Ein Blinder mit Krückstock sieht doch, was da zwischen euch läuft.«
Wie gewohnt errötete der Baron bei diesem Thema, während ihre adelige Freundin vergnügt lachte.
»Zum hundertsten Mal, Marie: Natürlich lieben wir uns, aber wie Bruder und Schwester.« Sie schenkte ihm einen zarten Blick, bevor sie sich wieder zu Marie drehte. »Ich meine, Frederick ist praktisch Teil der Familie, Mutter und er arbeiten ja sogar eng zusammen. Es gibt auch niemanden, der so an mich glaubt wie er, und ich bin verdammt stolz, was er als Kurator leistet. Wir hegen also eine tiefe Verbundenheit füreinander, nicht mehr und nicht weniger. Freundschaften zwischen Mann und Frau sind möglich, Marie. Irgendwann geht das auch in deinen Kopf.«
Marie rollte mit den Augen. »Ich weiß, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen möglich sind. Ich weiß nur auch, dass ihr ein verdammt hübsches Ehepaar abgeben würdet.«
»Niemals«, erwiderte Seraphina so energisch, dass Frederick bestürzt die Brauen hob.
»So eine schlechte Partie bin ich nun auch wieder nicht.«
Marie musste schmunzeln, und auch die Prinzessin konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Das sage ich doch auch gar nicht. Ich meine nur, dass ich niemals heiraten will. Ich will unabhängig bleiben.« Sie nahm einen großen Schluck von ihrem Mai Tai. »Mal ernsthaft ... wahre Liebe hat etwas mit Leidenschaft zu tun. Die habe ich noch nie für einen Mann empfunden. Und ich glaube, das werde ich auch nicht. Dafür liebe ich meine Arbeit und meine Freiheit zu sehr.«
»Aber wahre Liebe engt nicht ein. Sie ist vor allem mehr als nur Leidenschaft«, widersprach der Baron. »Sie erfüllt und beflügelt einen. Umso mehr, wenn diese Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen.« Seine Worte wirkten gepresst.
»Das sehe ich ja nicht anders«, erwiderte Seraphina flink, »diese Gefühle empfinde ich aber nur in meinem Beruf. Von mir aus kann das für alle Ewigkeiten so bleiben.«
»Sera, komm schon«, schaltete sich nun Marie ein, »in zwei Jahren bist du dreißig. Deine Eltern werden dich doch sicherlich schon bald mit einem Mann adeliger Abstammung verloben wollen. Ich dachte, das gehört sich in euren Kreisen so?«
»Meine Eltern sind nicht so«, widersprach die Prinzessin. »Sie machen mir da überhaupt keinen Druck. Das ist in Adelskreisen tatsächlich oft anders, aber meine Eltern mischen sich nicht in mein Leben ein. Sie wünschen sich nur, dass ich glücklich bin.«
Marie machte große Augen, dann griff sie wieder nach ihrem Cocktail.
»Manchmal vergesse ich, wie wohlbehütet und privilegiert du aufgewachsen bist. Kein Wunder, dass dir alles in den Schoß fällt.«
»He!« Die Prinzessin verschränkte die Arme. »Ich mag mit gewissen Privilegen aufgewachsen sein, aber das heißt noch lange nicht, dass mir alles in den Schoß fällt! Wenn man nur etwas wirklich will und hart dafür arbeitet, dann bekommt man es auch. Die Welt ist ein freundlicher Ort, solange man positiv bleibt.«
Marie verschluckte sich fast an ihrem Cocktail. »Wie naiv ist das bitte? Du hattest lediglich Glück, dich weder mit existenziellen Krisen noch mit schwierigen Menschen auseinandersetzen zu müssen.«
»Das würde ich nicht sagen. Immerhin bist du eine meiner engsten Freundinnen.«
Marie schnaubte belustigt. »Touché.«
»Und für mein Leben komme ich finanziell ganz allein auf«, setzte die Prinzessin nach.
Marie runzelte die Stirn. »Ach ja? Du hast die Wohnung und die süße Galerie samt Atelier also ganz allein gekauft?«
»Marie«, mahnte Frederick, doch die errötete Seraphina gab sofort klein bei.
»Okay, das waren meine Eltern. Aber ich habe auch nie behauptet, dass ich es schwer gehabt hätte. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die ich habe. Und die nutze ich auch. Mir fliegt nicht alles zu. Wenn überhaupt, dann fliege ich hin, wo ich hinmuss.«
Marie entschied, sie nicht weiter zu triezen. Sie hatte ihren Standpunkt schon deutlich genug vertreten.
»Du süßer kleiner Vogel«, sagte sie also versöhnlich und tschilpte.
Seraphina schmunzelte. »Jedenfalls«, sagte die Prinzessin mit abschließendem Ton, »bin ich in der privilegierten Position, mich nicht gesellschaftlichen Konventionen beugen zu müssen und tue das daher auch nicht. Ich brauche weder einen Mann noch eine Ehe. Es wird niemals jemanden geben, der mein Herz so erobern könnte wie die Kunst.«
Marie zog die Augenbrauen zusammen.
»Wie du meinst«, murmelte sie schließlich in ihr Glas hinein.
Frederick blieb stumm.
Phillipe Prinz von Lorraine saß in dem schwarzen Ledersessel seines Privatjets und blickte hinunter auf Berlin. Das Fenster bot eine atemberaubende Sicht auf die Stadt. Wie kleine Diamanten funkelten ihre Lichter in der Dunkelheit und versprachen die Auszeit, nach der er sich so sehnte. Mochte der Tapetenwechsel noch so kurz sein, nur ein paar Tage wollte er nicht Sklave sein. Sklave der Erwartungen seiner Eltern. Sklave seiner eigenen Sehnsüchte. Er seufzte und griff nach dem Kristallglas auf dem kleinen Tisch neben ihm. Der Champagner prickelte angenehm in seiner Kehle.
»Darf ich Ihnen noch etwas bringen, Durchlaucht?«
Phillipe sah auf.
Die Stewardess betrachtete ihn aufmerksam. Er roch den betörenden Duft ihres Parfüms, spürte ihre feingliedrigen Finger, die seine Schulter berührten. Schon vor dem Flug waren ihm ihre Blicke nicht entgangen. Genauso, wie die angefeuchteten Lippen, als sie ihm das Essen serviert hatte. Doch er verbot sich, auf jegliche Avancen einzugehen und setzte das professionelle Lächeln auf, das ihn auch stets bei seinen Vorträgen begleitete.
»Merci, Julie, doch mir fehlt nichts. Du darfst dich zurückziehen.«
Sie biss sich auf die Unterlippe und zögerte einen Moment. Schließlich gab sie mit einem kurzen Nicken nach und verschwand in Richtung Bordküche. Er blickte ihren schwingenden Hüften nach und seufzte leise.
Contenance, dachte er. Selbst wenn sie sich als deine wahre Liebe entpuppen würde, es hätte keine Zukunft. Also reiß dich zusammen, Phillipe.
Er hatte kein Recht, so trübsinnig zu sein. Eigentlich liebte er doch sein Leben. Er war stolz auf seine reiche Familiengeschichte, das imposante Anwesen nördlich von Nancy, den Titel, der ihm Türen öffnete, die für die Mehrheit der Menschen verschlossen blieb. Er schätzte seine Privilegien. Doch außerhalb seines Kreises schien niemand begreifen zu wollen, wie eingeschränkt er dafür auch war – zumindest in der Liebe.
»Du bist nun dreißig Jahre alt, Phillipe«, hatte er noch die mahnenden Worte seiner Mutter ihm Ohr. »Es wird Zeit, dass du dich für die Richtige entscheidest.« Bei der Erinnerung spürte er wieder den wohlbekannten Druck aufsteigen und blickte erneut hinunter auf die Lichter der Hauptstadt.