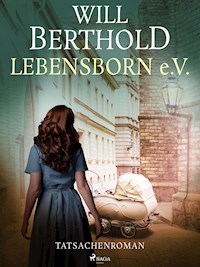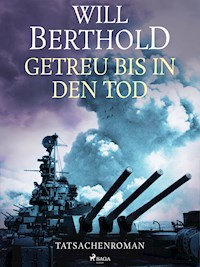
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was mit einem ungeheuren Triumph begann endete nach nur sieben Tagen mit einem tragischen Untergang, der fast 2000 Menschen das Leben kostete: Dieser spannende Tatsachenroman erinnert an das Schicksal des damals größten deutschen Schlachtschiffs, der "Bismarck", deren Untergangsstelle heute mit einem schlichten Kreuz auf den Seekarten vermerkt wird. Die traditionelle Parole "Getreu bis in den Tod" traf hier mehr denn je zu. Anhand von Einzelschicksalen rückt Berthold dieses Stück maritime Kriegsgeschichte in den Fokus der Aufmerksamkeit.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Getreu bis in den Tod - Tatsachenroman
Saga
Getreu bis in den Tod - TatsachenromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1978, 2020 Will Berthold und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444711
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Seit Stunden jagen sich die Latrinenparolen. Als die ersten Abendnebel den schlanken grauen Koloß streifen, kommt der Admiral an Bord. Jetzt weiß jeder, daß es Ernst wird, daß es dahingeht. In den Krieg. An die Wasserfront. In den von den Engländern beherrschten Atlantik. Totale Urlaubssperre ab sofort. Die Hafenbräute und die Hafendirnen, die Frauen der Offiziere und die Mütter der blutjungen Matrosen warten heute vergeblich.
Der Einsatz beginnt mit Eintopf. Noch verbindet die Gangway das Flottenflaggschiff Bismarck mit dem Land, das 2287 Mann der Besatzung nie mehr sehen werden. So viele werden sieben Tage später von den Granaten zerrissen, von den Torpedos zerfetzt, von den Bomben zermalmt; so viele werden in den brennenden Ölpfützen der gepeitschten See ertrinken.
Aber daran denkt keiner, der jetzt mit großem Appetit einen Labskaus hinunterlöffelt. Wer denkt schon an das Sterben, solange er noch im Hafen liegt?
Die Männer an Bord spielen Karten. Sie hören Radio. Sie erzählen sich derbe Witze und sie lachen darüber. Andere sind ernster, schreiben an ihre Mütter, an ihre Bräute, an ihre Frauen. Sie sind unruhig, aber zuversichtlich. Zuversicht steckt an. Zuversicht ist erwünscht. Zuversicht ist befohlen. Zuversicht ist selbstverständlich, wenn man an Bord des modernsten Schlachtschiffes der Welt ist. Von den eisgrauen, stahlkalten 38-cm-Geschützen strahlt sie aus, von den 175 000 Pferdestärken der Turbinen, von den 190 000 Granaten in den gepanzerten Munitionskammern des Riesenschiffes.
Die Matrosen wissen, daß sich die feindlichen Geschosse erst durch unbezwingbare Chromnickel-Stahlplatten hindurchbeißen müssen, wie sie außer der Bismarck kein Schiff der Welt hat; sie wissen, daß ihr Kahn nicht sinken kann, daß in den letzten Monaten der Baubelehrung, bei den Übungsfahrten in der Ostsee jeder Handgriff, jedes Manöver, jede Eventualität hundertmal, tausendmal exerziert wurden.
Es gibt nichts, was das 46 000-Tonnen-Schiff Bismarck zu befürchten hätte — nichts außer dem, was kommen wird . . .
Vier Mann der Besatzung fehlen noch: Oberfähnrich zur See Peters und drei Mann, abkommandiert zur Kartenvergleichsstelle. Sie sollten den letzten Stand der minenfreien Wege in die Karten der Bismarck eintragen. Damit waren sie am Nachmittag fertig. Da sie später an Bord zurückerwartet wurden, entschlossen sie sich, ihre Freizeitgestaltung in die eigenen Hände zu nehmen.
Sie stoppten einen Lastwagen und fuhren von Gotenhafen nach Danzig, wo es teuren Schnaps und billige Mädchen gab. Sie passierten sattgrüne Kastanienalleen und blühende Kirschbäume. Aber sie sahen den Frühling nicht. Sie interessierten sich nicht für die Schönheit des Maitags. Sie wollten noch einmal Land schnappen oder vielmehr das, was sich ein Seemann unter Land vorstellt.
Der Lastwagen hält vor einer Gaststätte. Sie geben dem Fahrer ein paar Zigaretten und haben es eilig.
»Um 19 Uhr seid ihr hier«, sagt der Oberfähnrich, »sonst soll euch der Teufel holen!«
»Jawohl, Herr Oberfähnrich«, entgegnen die drei Männer. Dann machen sie sich lachend auf den Weg . . .
Nur das typische Schiffsgeräusch, das halblaute, gleichbleibende Surren und Sausen der Maschinen, zeigt an, daß die Bismarck bald von Schleppern aus dem Hafen gezogen werden soll. Der Besatzung fällt die surrende Monotonie nicht mehr auf. In den letzten Stunden wurde sie durch 300 »Badegäste« verstärkt; so nennt man die Prisenkommandos, den 82-Mann-Stab des Flottenchefs Admiral Lütjens, und die Besatzungen der fünf Bordflugzeuge, die so lange auf Freiwache sind, bis es mulmig wird.
Das Flottenflaggschiff Bismarck ist eine schwimmende Stadt mit Nachbarn, die einander kennen, und Fremden, die sich nie gesehen haben und kühl aneinander vorbeilaufen; mit Plätzen und mit Straßen, mit Friseurgeschäften, Wäschereien, Schuhmacherwerkstätten und Schneidereien. Erst im Einsatz unterstehen die Friseure, Schuster, Schneider, Zivilstewards und Kantinenpächter als Hilfssanitäter militärischem. Befehl. Die Vorgesetzten werden nur einmal am Tage gegrüßt.
Auf dieser 246 Meter langen und 36 Meter breiten schwimmenden Stadt gibt es natürlich keine Frauen. Frauen kleben nur als Fotografien mit gefrorenem Lächeln oder erstarrtem Ernst, mit hochgeschlossenen, züchtigen Kleidern oder in halbnackter Pinup-Stellung an den Spinden, zwischen den Kojen oder an den stählernen Wänden der Decks. Die Fotos sind Allgemeingut der Besatzung und das ständige Thema Nummer eins.
Der Flottenchef befiehlt fünf Offiziere in den Kartenraum. Er hat ein schmales, verbissenes Gesicht, kurzgeschnittene, sorgfältig gescheitelte Haare. Er spricht dialektfreies Hochdeutsch und mustert seine Offiziere, darunter den Kommandanten, Kapitän zur See Lindemann, ohne ein Zeichen persönlicher Teilnahme.
»Meine Herren«, beginnt er, »wir laufen in zwei Stunden aus. Aus Tarnungsgründen wird heute nacht unser Schwesterschiff, die Tirpitz, hier festmachen. Wir erreichen morgen früh norwegische Gewässer, bunkern in Bergen kurz auf und vereinigen uns dann mit der Prinz Eugen, die mit uns zusammen operieren wird. Wir werden im Atlantik Kreuzerkrieg führen. Auf Befehl des Oberkommandos der deutschen Kriegsmarine sind Kampfhandlungen mit feindlichen Kriegsschiffen nach Möglichkeit zu vermeiden.«
Der Admiral sieht einen Augenblick vom Kartentisch auf. Noch immer ist in seinem Gesicht der verbissene Zug. Sein schneeweißer Kragen ist eine Nuance zu weit. Zwischen den Ecken hängt das Ritterkreuz.
»Es ist anzunehmen, daß der Gegner den bevorstehenden Einsatz der Bismarck bereits in Norwegen ausmacht. Wir laufen aus Bergen mit Scheingeleit aus und gehen dann mit der Prinz Eugen allein weiter. Die verfügbaren deutschen U-Boote halten sich in dem beabsichtigten Operationsgebiet auf, ebenso verstärkt die Luftwaffe ihre Tätigkeit. Die Versorgungsschiffe stehen an den von mir benannten Positionen. Haben Sie noch eine Frage?«
»Nein, Herr Admiral«, entgegnet Kapitän Lindemann.
»Gut . . . Ich habe keinen Zweifel, daß sich der Feind über die Feuerkraft und den Aktionsradius der Bismarck im klaren ist. Er wird uns alles entgegenwerfen, was er hat. Wir werden siegen oder nicht zurückkehren.«
Der Admiral entläßt mit einem flüchtigen Kopfnicken seine Offiziere. Er sieht durch sie hindurch, als ob sie aus Glas wären. Er ist kein Mensch nach ihrem Geschmack. Aber sie wurzeln viel zu sehr in der Tradition der Kriegsmarine, als daß sie sich das eingestehen würden.
Die Mannschaften haben es leichter. Sie nennen den Flottenchef Günther Lütjens kurzerhand »Schwarzer Teufel«.
Oberfähnrich Peters ist als erster am Treffpunkt. Er ist schlank, schmal und blaß. Vor einer Viertelstunde hat er sich von seiner Mutter verabschiedet. Er sagte ihr nicht, daß die Bismarck ausläuft, aber sie wußte, sie fühlte es, und sie weinte. Er ärgerte sich über ihre Tränen und er ärgerte sich darüber, daß sie ihm auf die Nieren gingen. Er schüttelt den Gedanken an die alte Dame barsch ab, flucht über das Ausbleiben seiner drei Leute und hat das Gefühl, daß er einen Schnaps gut gebrauchen könnte.
Als zweiter kommt der Matrosengefreite Pfeiffer, ein Junge von knapp achtzehn Jahren, dem der Krieg lieber ist als die Schule. Vorläufig wenigstens.
»War wohl schön, was?« fragt Peters.
»Jawohl, Herr Oberfähnrich.«
»Wo sind die anderen?«
»Ich weiß nicht. Ich habe mich von ihnen getrennt.«
»Warum?«
»Ich habe plötzlich keine Lust mehr gehabt. Ist ja immer das gleiche . . . Sie sind ja auch nicht mitgegangen, Herr Oberfähnrich.«
»Wenn die zwei jetzt nicht kommen, sind wir aufgeschmissen.« Der Oberfähnrich bereut bereits seinen Ausflug nach Danzig. Neben ihm, auf der Wirtshausbank, liegen die Seekarten, die der Navigationsoffizier dringend erwartet. Er denkt an seine Mutter und sieht auf die Armbanduhr. Im gleichen Augenblick kommen die beiden Maate. Mehring lallt schon unter der Türe: »Jetzt müssen wir sehen, daß wir auf den Dampfer kommen.« Hinrichs sieht nicht viel besser aus. Er hat ein gerötetes Gesicht und rülpst vor sich hin.
»Der Teufel soll euch holen«, sagt Peters.
»Zu Befehl, Herr Admiral«, entgegnet Mehring. »Der Teufel kann uns alle noch holen. Aber jetzt wird’s Zeit, Kinder. Draußen wartet unser Auto.«
Der Oberfähnrich stutzt, als er den Wagen sieht. Ein schwarzes Kastenauto mit silbernem Palmenzweig und der Aufschrift »Pietät«. Die beiden Maate haben einen Leichenwagen organisiert.
»Sehr symbolisch«, sagt der Matrosengefreite Pfeiffer.
»Halts Maul!« versetzt Hinrichs. »Totenautos bringen Glück.«
Die vier Soldaten stehen gebückt zwischen immergrünen Zweigattrappen und verblichenen Kranzschleifen. Sie halten sich an der Sargstange fest. Die ungewöhnliche Umgebung dämpft für einen Augenblick ihre Gespräche.
Bei jeder Kurve fallen sie gegeneinander, fluchen und lachen. Mehring holt unter seinem Troyer eine Flasche Schnaps hervor, nimmt den Korken ab und hält sie Peters hin.
»Prost«, sagt er, »besser saufen, als absaufen.«
Die Flasche pendelt von Mund zu Mund. Peters, der nichts verträgt, steigt der Schnaps sofort in den Kopf. Mehring grölt den »Westerwald«. Pfeiffer trinkt widerwillig mit verbissenem Gesicht.
»Wo warst du denn überhaupt?« fragt Hinrichs.
»Das geht dich nichts an.«
»Mensch«, erwidert der Maat, »ich glaub’, der war in der Kirche. Hast’ wenigstens für uns mitgebetet?«
Wieder kreist die Flasche.
»Wollt ihr wissen, wo wir waren?« fragt Mehring.
»Wo ihr wart, wissen wir ganz genau«, entgegnet Peters, »im Puff natürlich.«
»Wo ein Seemann hingehört.«
Mehring rülpst und fährt dann fort:
»Wir haben’s für euch mitgetrieben.«
Die Flasche ist jetzt fast leer. Pfeiffer hat seinen Widerwillen gegen den Fusel aufgegeben und trinkt kräftig mit. Peters ist fast blau. Die beiden Maate haben den üblichen Pegelstand längst erreicht.
»Möcht’ wissen, für was ihr nach Danzig gefahren seid«, beginnt Mehring wieder. »Mensch, da bin ich doch gleich an die Rote gekommen. Dachte, die wäre es. War einen Dreck wert. Zehn Mark hat es gekostet. Dann hab’ ich mir die Blonde geschnappt, die mit dem prima Herz, weißt schon. Kann nur sagen: Extraklasse. Das ist immer so, die Blonden halten, was die Roten versprechen. Wie war’s denn mit dir?«
Er stößt Hinrichs an. Aber Hinrichs ist geistig weggetreten und grölt den »Westerwald« vor sich hin.
»Der wird gleich kotzen!«
»Reißt euch zusammen«, sagt Peters, »wir sind da«.
»Reiß dich selbst zusammen, Oberfähnrich. Du machst schließlich die Meldung.«
Der Wagen hat sein Ziel erreicht, fährt am Kai entlang, hält. Es ist ziemlich neblig, dreißig, vierzig Meter Sicht vielleicht.
»Na, wo ist denn unser Dampfer?« fragt Mehring. Er gibt dem Fahrer Zigaretten. »Wenn du so weiter machst«, sagt er zu ihm, »springt noch einmal der Sargdeckel auf, Kumpel.«
Der Oberfähnrich hält die eingerollten Seekarten krampfhaft unter dem Arm. Die frische Luft wirft ihn fast um. Der Wagen wendet, fährt ab.
»Bin ich besoffen?« fragt Peters, »das Schiff ist weg!«
Die Bismarck hat ihren Liegeplatz verlassen. Sie liegt auf Reede. Bis das der Oberfähnrich und seine drei Mann erfahren, vergeht eine halbe Stunde. Es ist jetzt allerhöchste Zeit. Eine Barkasse bringt sie zum Flottenflaggschiff. Sie klettern das Fallreep hoch. Hinrichs tritt Pfeiffer auf die Hand. Pfeiffer flucht. Mehring fällt eine volle Flasche Schnaps aus dem Troyer.
»Scheiße«, sagt er.
Peters erreicht als erster das Deck. Fünf Meter neben ihm steht Kapitänleutnant Werner Nobis. Peters geht auf ihn zu, grüßt.
»Oberfähnrich Peters und drei Mann vom Seekartenvergleich zurück«, meldet er.
»Besoffen?« antwortet Nobis.
»Nein, Herr Kaleu.«
»Mensch, fressen Sie Kaffeebohnen. In einer halben Stunde werde ich abgelöst, dann kommen Sie mit den Seekarten zu mir. Nüchtern! Verstanden!«
»Jawohl, Herr Kaleu.«
Mehring, Hinrichs und Pfeiffer verziehen sich fluchtartig.
»Mensch, wo bin ich denn zu Hause?« fragt Mehring. »Der Schnaps ist auch im Eimer . . . Wohl bekomm’s . . . Aber jetzt werd’ ich den Kameraden mal was erzählen.«
Eine halbe Stunde später geht die Bismarck Anker auf in See. Kurs Großer Belt/Skagerrak. Die Antriebsturbinen sind jetzt eingeschaltet. Erst ab Brücke A kann man die Vibration spüren. Marscherleichterung ist befohlen. Die Freiwache soll schlafen, um sich für den Einsatz zu schonen. Aber für die meisten der jungen Matrosen ist es die erste Feindfahrt, und sie erwarten, daß jeden Augenblick etwas geschehen müsse.
Die Stimmung ist ausgezeichnet. Es sind fast nur Freiwillige an Bord, junge, prächtige Burschen, denen der Krieg noch nichts gegeben und genommen hat. Der Krieg des Jahres 1941, der zielstrebig auf den deutschen Sieg zuzumarschieren schien . . .
Ruhig und souverän stampft das Flottenflaggschiff durch die See. 28 Seemeilen macht es in der Stunde, die sich bei äußerster Kraft auf 31 Meilen steigern lassen. Der Tiefgang ist 11 Meter bei voller Belastung. Dann hat die Bismarck 46 000 Tonnen Wasserverdrängung. Von der Wasserlinie bis zur Mastspitze ist sie 22 Meter hoch. Die Bordwand ragt vier Meter hoch über den Wasserspiegel. Die Außenhaut ist durch einen Torpedogürtel aus starkem Chromnickelstahl zusätzlich geschützt. Kein britischer Torpedo des Jahres 1941 ist stark genug, um diese Wand zu durchschlagen.
89 Geschütze aller Kaliber warten auf den Feind. Die vier Türme verfügen über hydraulisch zu ladende Zwillingsrohre von 38 cm Durchmesser. Das besagt noch nichts, denn mit gleichen Kalibern hat diedeutsche Marine schon im ersten Weltkrieg geschossen. Neu aber ist, daß die Geschütze der Bismarck auch bei Nacht und Nebel durch elektrische Ortung fast metergenau zielen können.
Der Gefechtsstand ist in die Artillerie-, in die Kommando- und in die Signalbrücke unterteilt. Je eine halbe Division, etwa 60 Mann, schlafen in den Mannschaftsdecks, die so nahe wie möglich bei den Gefechtsständen liegen. Die Offiziere schlafen zu zweit. Nur der Kommandant, der Flottenchef und der Erste Offizier haben Einzelkammern.
Unter Deck ist es reinlich, ruhig und ordentlich — wie in einem Sanatorium. Die Dampfkessel heizen das Schiff. Die Klimaanlage regelt die Temperatur. Fünf Jahre war die Bismarck im Bau; über 300 Millionen Mark hat sie gekostet. Bei der monatelangen »Baubelehrung« hat sich kein wesentlicher Konstruktionsfehler herausgestellt. Auch im Einsatz nicht.
Auch nach dem Untergang nicht . . .
Im Deck der zweiten technischen Halbdivision schläft keiner. Die Männer sind seit zwei Stunden wachfrei. Wenn kein Fliegeralarm kommt, für weitere sechs Stunden. Es ist nicht viel passiert heute. Mößmer wurde beim Rauchen erwischt und sollte strafweise auf dem Oberdeck eine Runde drehen. Ein Oberleutnant verdonnerte ihn dazu. Mößmer lief hundert Meter, sprang durch eine Luke und verschwand. Der Offizier kannte ihn nicht, und Mößmer kannte den Offizier nicht, es gab auf der ganzen Welt kein besseres Versteck als die Bismarck.
Hengst war zu Kapitänleutnant Bilk befohlen worden. Er suchte die Offiziersmesse drei Stunden, fragte zwanzig Kameraden, aber keiner konnte ihm Auskunft geben. Er wollte sie telefonisch einholen, aber man erklärte ihm, daß alle Leitungen für den Dienstverkehr gesperrt seien. Bis er den Kapitänleutnant fand, hatte der Offizier vergessen, was er von ihm wollte, und der Matrosengefreite kam mit einem Anschiß davon.
Burger hatte Bauchschmerzen. Er verbiß sie zwei Stunden lang und meldete sich dann im Lazarettzwischendeck. Es war eine hochgradige Blinddarmentzündung, und bis sich der Gefreite besann, lag er schon narkotisiert auf dem Operationstisch. Noch unter der Äthermaske fluchte er, daß er den ersten Einsatz verschlafen würde. Die Operation verlief ohne Komplikation.
Dann meldete Lauchs, daß er beobachtet habe, wie ein Zivilsteward eine Kiste Kognak auf die Seite brachte. Plötzlich hatten alle Durst. Sie erinnerten sich daran, daß der Maat Lindenberg im Zivilberuf Schlosser war. Sie weihten ihn ein, und er fabrizierte einen Dietrich. Die Zivilstewards hatten als einzige ihre Spinde abgeschlossen. Der Dietrich funktionierte tadellos. Aber erst im sechsten Spind fanden sie den Schnaps. Sie schlichen sich lautlos in ihr Deck zurück und machten das Schott dicht. Es ließ sich nicht vermeiden, daß die Kameraden des Maats Lindenberg mitsoffen. So brauchten sie wenigstens die Steuermänner nicht zu fürchten . . .
Auf dem Gang stand abwechselnd einer Schmiere. Später, als die ersten zwei Flaschen ausgetrunken waren, wurde er vergessen, und er meldete sich mit durstigem Protest. Sie zogen ihre Beobachtungsposten zurück. Von jetzt an war ihnen alles wurscht. Um diese Zeit betraten erfahrungsgemäß die Offiziere selten ein Mannschaftsdeck, und die Unteroffiziere ließen sich mit Schnaps kaufen. Bis auf ein paar Spinner. Aber die waren bei anderen Divisionen.
So beginnt für die zweite technische Halbdivision die erste Feindfahrt. Sie verbrüdern sich mit den betrunkenen Maaten. Im Einsatz oder beim Männertrunk können Unteroffiziere prima Kerle sein. Die Zeiten, da die blutjungen Bismarck-Fahrer noch auf dem Kasernenhof geschliffen wurden, liegen schon Monate zurück.
Sie lassen immer wieder den Obergefreiten Link hochleben. Er heiratet in sieben Tagen. Da sie nicht wissen, ob sie zu diesem Zeitpunkt noch Schnaps haben oder Zeit, ihn zu trinken, feiern sie die Ferntrauung vorweg.
»Wie heißt sie denn?« fragt Lindenberg.
»Else.«
»Zeig mal ein Foto!«
Link reicht es bereitwillig herum.
»Das Gesicht ist hübsch«, stellt ein Maat sachkundig fest. »Aber wie steht’s mit den Beinen?«
»Dafür verbürg’ ich mich.«
»Busen auch gut?«
»Verlaß dich drauf.«
»Hast du schon mal?«
»Das geht euch einen Dreck an.«
Die Runde lacht schallend.
»Ich glaube, der hat noch nicht«, ruft alles durcheinander.
Link steigt beleidigt in seine Matte. Nach ein paar Minuten kommt er wieder und gießt sich Schnaps ein.
»Also dann auf deine Hochzeit!« ruft ihm der Chor zu.
Sie schütten das Zeug in einem Zug hinunter.
»Schön blöd bist du. Ferntrauung, so was. Du bringst dich ja um den Heiratsurlaub.«
»Sind bloß die Tommies daran schuld«, sagt Link.
»Und wie machst du das mit der Hochzeitsnacht?«
Wieder lachen sie schallend.
Verdammt lustig, dieser Krieg! Wie im Schlafwagen! Herr Ober, noch einen Kognak, bitte! Gut geheizt, der Dampfer. Gepflegte Weine, ff Aufschnitt. Tadellose Maate, saufen wie die Löcher. Prima Offiziere, schlafen oder machen Dienst. Ausgezeichnetes Schiff, nicht mal seekrank wird man! Vorläufig wenigstens . . .
Sie lassen alles der Reihe nach hochleben. Zuletzt den Seekrieg.
»Wie lange bist du eigentlich schon bei der Marine?« fragt einer Lindenberg.
»Drei Jahre.«
»Und wo hast du das EK II her?«
»Von einem Minenräumboot.«
»Und für was hast du es gekriegt?«
»Zwei EKs waren zugeteilt. Da ist der Pott abgesoffen, und ich war einer der beiden, die am Leben blieben.«
»Wieso denn abgesoffen?«
»Eine Mine. Wir fuhren direkt mit dem Kiel drauf. Ich stand zufällig achtern.«
»Und die anderen?«
»Die standen nicht achtern . . . Na, werdet nicht blaß. Minen tun uns gar nichts.«
»Wo warst du sonst noch?«
»Auf einem Versorgungsschiff«, antwortet Lindenberg. Auf einmal hat er den Alkohol abgeschüttelt. Er wirkt jetzt blaß und verkniffen. Er steckt die anderen an. Die Stimmung ist beim Teufel.
»Das ist die größte Scheiße im Seekrieg. Da hockst du und wartest, bis so ein dicker Pott kommt wie die Bismarck zum Beispiel. Sie kommt aber nicht. Dafür kommen die Tommies mit ihren Flugzeugen und knallen dich in aller Seelenruhe ab. Du hast zwar ein paar Geschütze, aber die Flieger können ihre Bomben aus solcher Höhe abwerfen, daß deine Granaten gar nicht hinkommen. Wenn eine Bombe das Ding trifft, dann brennt der Kahn. Feuerbestattung erster Klasse . . . Na, werdet nicht blaß, Kinder. Ihr sitzt ja nicht auf einem Tanker . . . Ihr habt alle Schwein! Hier sind wir in Abrahams Schoß oder wie der olle Knilch hieß.«
Der Maat hat keine Lust mehr zum Trinken. Er sagt gute Nacht, steht auf und geht. Auch die anderen lassen jetzt den Schnaps stehen.
Link ist längst in seinen Verschlag gekrochen. Er schließt die Augen. Er sieht Else vor sich. Das Mädchen, das er liebt. Die schlanke, blonde Else mit den Kinderaugen, die in sieben Tagen, um 10 Uhr 30, allein auf dem Standesamt stehen wird. Und die Witwe sein wird, noch bevor sie Frau wurde.
Aber das weiß sie nicht. Das weiß auch Link nicht.
Der Rauch steigt ihm in die Augen. Sie tränen. Auf dem Tisch steht noch eine angebrochene Flasche Kognak, die keinen Interessenten mehr fand. Link steigt noch einmal aus seiner Hängematte, geht auf den Tisch zu und setzt die Flasche an den Mund. Wenn er sich jetzt gleich wieder hinhaut, hat er noch drei Stunden Zeit zum Schlafen.
Wie gesagt, er weiß nichts von seinem Schicksal. Keiner der Bismarck-Fahrer weiß, ahnt, fühlt es. Keine noch so düsterne Phantasie kann ausmalen, was dem deutschen Flottenflaggschiff bevorsteht.
Dem Matrosenobergefreiten Herbert Link wird lediglich eine Granate den Kopf wegreißen. Das ist noch ein barmherziges Schicksal . . .
Als die kühlen Morgennebel den Vorhang über dem kommenden Tag, dem 20. Mai 1941, aufziehen, ist die Bismarck, umgeben von Zerstörern, von Räum- und Sicherungsfahrzeugen, geleitet von Flugzeugen, genau an der vorher berechneten Position. Noch führt Kapitän Lindemann, der drahtige Offizier, der von seiner Mannschaft vergöttert wird, sein Schiff. Erst nach dem Zusammentreffen mit der Prinz Eugen wird er das Kommando an Admiral Lütjens abgeben.
Jetzt wäre die erste Feindberührung mit Flugzeugen oder U-Booten möglich. Aber sie läßt auf sich warten. Auch Stunden später geschieht nichts, als die Bismarck in norwegischen Gewässern dahinzieht.
Die Operation Bismarck ist mit einer Sorgfalt ohnegleichen vorbereitet. Der Oberbefehlshaber Nord verlegt Infanterieeinheiten nach Bergen und zieht in der norwegischen Hafenstadt Panzerstreitkräfte zusammen. Scheingeleite fahren an der Küste hin und her. Pionierboote treten in Aktion. Die zweite, fünfte und siebte R-Flottille kontrollieren pausenlos die minenfreien Seewege »Agathe« und »Dorothea«. Die Vorpostenketten des Seebefehlshabers Norwegen stoßen bis zur Eisbarriere vor. Deutsche Fernaufklärer sind ständig in der Luft.
All diese Maßnahmen sollen den Gegner verwirren. Er soll nicht wissen, ob die Bismarck eine deutsche Invasion in Island unterstützt, ob sie einen Mammut-Convoy geleitet oder ob sie, mehr oder weniger auf sich allein gestellt, zum Kreuzerkrieg in den Atlantik durchbricht.
Die norwegischen Agenten der Engländer melden nach London, was ihnen vor die Augen kommt. Sie ahnen nicht, daß die deutsche Abwehr mit Abhörgeräten jede ihrer Durchsagen registriert. Seit Monaten kennen die Leute von Canaris das größte norwegische Agentennetz. Längst haben sie eigene V-Leute eingebaut. Die Aufhebung dieser Zentrale aber haben sie sich für den Tag aufgespart, an dem die Bismarck zum erstenmal auf Feindfahrt geht.
Gegen Mittag erreicht das deutsche Flottenflaggschiff Bergen, bei strahlend blauem Himmel und bei kleinem Seegang. Das wachfreie Personal sonnt sich auf Deck. An Land strömen deutsche Landser zusammen und winken dem Schiff zu. Einer besorgt sich ein Boot, rudert auf die Bismarck zu und schreit auf das Oberdeck: »Kumpels, habt ihr was zu rauchen?«
Die Matrosen lachen und werfen dem cleveren Ruderer ganze Bündel von Zigaretten zu.
Der Obergefreite winkt hinauf, lacht und ruft:
»Im nächsten Krieg melde ich mich auch zur Marine.«
An Land gibt es eine andere Attraktion: Zwei blonde, hochgewachsene Norwegerinnen bummeln am Kai entlang, verfolgt von hungrigen Landseraugen. Ab und zu bleiben sie stehen, lachen den Soldaten zu.
»Was für ein schön Schiff? Wie heißen?« fragte eines der Mädchen einen Unteroffizier in gebrochenem Deutsch.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte der Mann. »Jedenfalls ist es toll.« Die beiden Mädchen ahnen nicht, daß sie an diesem Tag auch von Augen verfolgt werden, die ganz und gar nicht ihren weiblichen Reizen gelten. Daß ihnen die Abwehr auf den Fersen ist, daß jede ihrer Bewegungen bewacht wird. Daß die Männer, die sie verfolgen, genau wissen, wohin sie gehen werden. Daß ihr Ziel bereits umstellt ist. Daß man nur noch einen einzigen Funkspruch abwarten wird, um sie zu verhaften.
Die Mädchen gehen zurück zu Arne, zu Arne Svjenrod, der mit der linken Hand die deutsche Marine tonnenweise mit Klippfisch versorgt und mit der rechten die Morsetaste nach London bedient. Sie melden ihm, was sie gesehen haben. Er wird nicht klug aus ihren Beobachtungen. Die Engländer bestürmen ihn, die Armierung des Schiffs, die Tonnage, den Aktionsradius durchzugeben. Noch ist man in Scapa Flow unsicher, ob es die Bismarck ist. Nach den Berechnungen der britischen Admiralität dürfte die Bismarck erst in zwei Monaten einsatzfähig sein.
Die Engländer wissen nicht, daß die Baubelehrung verkürzt wurde. Arne geht selbst zum Hafen. In Sachen Klippfisch zunächst. Er kündigt der Marineleitung eine neue Sendung an. Dann bummelt er am Strand. Einer von vielen, die das schöne Wetter und die Neugierde angelockt haben. Er registriert: vier Geschütztürme. Sein Blick ist geschult. Er schätzt die Tonnage annähernd richtig. Und er kommt zu der Ansicht, daß es die Bismarck oder die Tirpitz sein muß, an deren Deck sich die Matrosen sonnen. Er sieht, daß sie aufbunkert. Er stellt die Vorbereitungen zum Auslaufen fest.
Jetzt hat er es auf einmal eilig. Er geht in sein Büro zurück, verläßt es schnell, geht in ein Nebengebäude, in eine Hinterstube, holt einen Kasten von der Wand, zieht das Wachstuch ab, bedient die Taste.
Man wartet schon auf seinen Funkspruch. Er meldet:
»Deutsches Schlachtschiff, vermutlich Bismarck oder Tirpitz, 42 000 Tonnen, vier Geschütztürme mit 38-cm-Zwillingen, fünf Bordflugzeuge. Einsatzklar. Läuft heute noch aus. Vermutlich Invasion in Island.«
Er gibt noch eine Menge durch. Wahres und Falsches. Denn viele seiner Unteragenten, denen er vertraut, tragen auf zwei Schultern. Arne sitzt mit verbissenem Gesicht an der Taste. Er hat zwei Kinder und eine junge, hübsche Frau. Er hat ein gutgehendes Geschäft. Aber er vernachlässigt alles. Er hat nur einen Gedanken, ein Ziel — und seinen Haß.
Die Antwort auf seinen Funkspruch wird er mit einem gewöhnlichen Radioapparat in seinem Hauptbüro abhören. Das Zimmer ist überheizt, aber Arne Svjenrod wagt es nicht, die Fenster zu öffnen.
Jetzt, auf dem Weg zum Büro, erfüllt sich sein Schicksal. Nur hundert Meter entfernt von ihm hat die Abwehr seine Meldung mitgehört. Sie wird sofort dechiffriert. Korvettenkapitän Stembrinck von der Abwehr nickt. »Gut«, sagt er, »es ist soweit.« Es ist alles vorbereitet. Die Abwehr greift schlagartig zu.
Arne Svjenrod erwischt es im Hausflur. Zwei Männer in Zivil kommen ihm entgegen.
»Hände hoch!« rufen sie ihm zu.
Er zögert eine Sekunde, langt in die Tasche, da knallt es schon. Er bricht zusammen.
Ein Norweger ist der erste Tote der Operation Bismarck . . .
Kapitänleutnant Werner Nobis macht sich fertig zur Wache. Sobald die Bismarck ausläuft, wird er im Kartenraum stehen und dem Ersten Navigationsoffizier assistieren. Er ist groß, breitschultrig, jung; er wirkt wie ein moderner Wikinger, der gern Frauen küßt und Kaviar ißt. Den Anflug von Gepflegtheit, seine gelöste, überlegene Erscheinung wird er auch noch behalten, wenn ganz andere Werte zum Teufel gegangen sind.
Der Kapitänleutnant ist einer der wenigen, die ohne Illusion in den Atlantik ziehen. Er kennt den Seekrieg. Sein Ritterkreuz hängt im Spind. Später, wenn einmal alles vorüber sein wird, legt er es nie mehr an. Soweit ist er schon. Aber er wird noch viel weiter kommen . . .
Nobis ist frei vom patriotischen Fieber der anderen, er ist auch frei von der stumpfen, stieren Selbstverständlichkeit, mit der der Landser dem großen Sterben entgegentritt.
Etwas ganz anderes hatte ihn zur christlichen Seefahrt gebracht, als der unchristliche, unbarmherzige Kampf an der Wasserfront. Die Weite des Ozeans, das Spiel mit Wind und Wellen, die Sonne mit ihren tausend Lichtern, und ein wenig auch die Abenteuerlust ließen ihn als Sechzehnjährigen den blauen Rock anziehen.
Er ging zur Handelsmarine, passierte ohne Zwischenfall alle Stationen und Schikanen und kam als »zweiter Vierter«auf den französischen Luxusdampfer Ile de France. Dort heuerte man gern junge, gut aussehende Schiffsoffiziere verschiedener Nationalität an, um sie als eine Art uniformierter Gigolos auf »Gesellschaftswache« einzuteilen.
Statt seine »Bestecke« zu schießen, spielte er mit vereinsamten Millionärsgattinnen Tennis und stillte den Lebenshunger jugendlicher Dollarprinzessinnen. Von Brückendienst war nie die Rede. Dann begann die See sich rot zu färben . . .
Ein Steward klopfte an die Kabinentür von Mrs. Webbster, deren Mann täglich tausend Rinder schlachten ließ. Nobis löste sich aus den Armen der Vierzigerin, keineswegs ungern übrigens, und nahm die Depesche entgegen.
Es war sein Stellungsbefehl an die Wasserfront.
In Le Havre nahm er Abschied. Er sprach noch einmal mit seinen Freunden, die jetzt seine Feinde zu sein hatten. Er gab dem großen, jungen Oly, der ihm wie ein Bruder glich, die Hand. Sie schlugen sich gegenseitig auf die Schultern, sahen aneinander vorbei und lachten über ihre verkniffene Sentimentalität.
Auch Oly hätte seinen Stellungsbefehl bereits in der Tasche. Zur Royal Navy . . .
Der Lehrgang war rasch vorüber. Ein halbes Jahr später war Nobis schon wieder auf See. Er jagte britische Frachter, beschoß britische Flugzeuge, übernahm französische Beuteschiffe, führte Geleite durch den Kanal, machte Minen unschädlich und legte Minen, versenkte und wurde versenkt.
Dann kam Deina.
Am falschen Ort, zur falschen Zeit.
Als Kommandant eines winzigen Geleitbootes, als Leutnant zur See, war er hart an der Drei-Meilen-Grenze die spanisch-portugiesische Küste entlanggeblubbert. Er lauerte auf einen australischen Eierdampfer, der sich verspätete. Deshalb gingen ihm Wasser und Öl aus.
Nobis setzte sich, alles auf die eigene Kappe nehmend, mit den neutralen Portugiesen in Verbindung. Er hißte die Quarantäneflagge und lief den Hafen Oporto an. Die Portugiesen hatten versprochen, seine Tanks aufzufüllen. Das Versprechen hielten sie auch. Aber er saß jetzt in der Mausefalle und konnte keinen Meter vor noch zurück. Denn an der Pier von Oporto hing eine britische Korvette, die eben ihre Havarie ausgebessert hatte. Ebenfalls unter Mißbrauch der Quarantäneflagge . . .
Nobis durfte als einziger seiner Besatzung an Land. Man gab ihm vierundzwanzig Stunden Zeit, und man gab ihm Wasser und Öl. Dann mußte er auslaufen. Der britische Zerstörer würde ihm auflauern und schon mit der ersten Salve versenken. Wenn nicht ein Wunder geschah . . .
Der junge Offizier bummelte verdrossen durch die Hafengassen, auf die er sich in den letzten Stunden so gefreut hatte. Er landete in einer Kneipe, in der ihm durch den Krieg arbeitslos gewordene Dirnen auflauerten. Er zahlte ihnen eine Runde Schnaps und schüttelte sie ab. Jetzt ließ er sich selbst vollaufen, so weit wenigstens, wie es seine Situation erlaubte.
Die Portugiesen waren deutschfreundlich. Die Zwei-Mann-Kapelle wollte ihm einen besonderen Gefallen tun und spielte immer wieder das Englandlied. Der Teufel mochte wissen, woher sie die Noten hatte.
Nobis sann verzweifelt auf einen Ausweg und wußte schon im voraus, daß es keinen geben konnte. Er hatte die Verantwortung für ein Boot und einundzwanzig Mann. Einundzwanzig prächtige Burschen, die ihm durch dick und dünn folgten und die ihn um seinen Landurlaub beneideten. Ein Kapitän verläßt als letzter das sinkende Schiff — geht aber als erster an Land.
Da ging die Türe auf.
Zuerst sah er hur sie.
Sie war schlank, groß und blond. Sie war elegant und selbstsicher. Sie paßte so wenig in die Kneipe, daß sie es sich leisten konnte, sie zu besuchen. Nobis verbot seinen Augen, sie anzustarren, aber die Augen machten sich selbständig. Dann erblickte er ihn. Flüchtig nur, schräg von der Seite. Kein Portugiese, registrierte Nobis.
Dann erstarrte er.
Es war Oly, sein Freund von der Ile de France, der Engländer Oly, der genau wie er einen schlechtsitzenden dunkelblauen Zivilanzug trug und ihm so lächerlich ähnlich war.
Im gleichen Augenblick erkannte ihn auch Oly.
Eine Sekunde nur zögerten die Freunde, dann gingen sie lachend aufeinander zu. Ein toller Zufall hatte sie zusammengeführt.
Dann waren sie befangen und schwiegen. Oly hob sein Glas.
»Verdammte Schweinerei«, sagte er, »Prost! Hilft alles nichts. Morgen müssen wir uns beschießen, heute werden wir uns besaufen.«
Sein Inspektionschef von der Kriegsschule hätte die Ausdrücke nicht hören dürfen . . .
»Dein Kahn an der Pier?« fragte Nobis.
Oly nickte.
»Deine Nußschale weiter oben?«
Jetzt nickte Nobis.
Sie lachten, aber es war ihnen nicht danach. Sie kannten ihre Situation. Und sie waren Freunde, der eine Deutscher, der andere Engländer — plötzlich mit dem Befehl zur Feindschaft ausgestattet und mit der nationalen Reserve des Seeoffiziers belastet.
Olys Begleiterin hieß Deina. Oly war mit ihrem Vater befreundet gewesen. Werner Nobis saß neben ihr. Sie trug ein enganliegendes Kleid, vermutlich selbstgemacht. Nobis mußte sie immer wieder ansehen. Sie bemerkte es, wurde aber weder böse noch verlegen darüber. Ein paarmal streifte er sie wie zufällig. Die Berührung ließ ihn alles vergessen, aber nur für Minuten, die bereits abgezählt waren.
Sie standen auf und gingen. Deina in der Mitte. Es waren nur ein paar hundert Meter zum Hafen. Vom Meer her wehte eine frische Brise, die die beiden einander gegenüberliegenden Kriegsfahrzeuge sanft hin und her schaukelte.
»So ist das«, meinte Oly.
»So ist das«, erwiderte Werner.
»Und ihr seid richtige Freunde?« fragte Deina.
»Ja«, entgegneten beide gleichzeitig.
»Dann ist die Lösung ganz einfach«, fuhr sie fort. »Der eine fährt nach Süden, der andere nach Norden — und wenn ihr euch wiederseht, ist der Krieg aus.«
»Das geht nicht«, versetzte Nobis.
»Das geht nicht«, antwortete Oly.
Er gab Werner die Hand und sah an ihm vorbei.
»Ich bringe jetzt Deina nach Hause.«
Nobis nickte.
»Machs gut«, antwortete der Deutsche.
»Take it easy«, sagte der Engländer.
Die beiden Freunde drehten sich nicht nacheinander um. Sie bissen die Zähne aufeinander und verfluchten den Krieg. Dabei würden sie ihn erst am nächsten Tag richtig kennenlernen.
Leutnant Nobis dachte an Deina und dachte an sein Schiff. Er konnte nicht ahnen, wie es weitergehen, konnte nicht wissen, wie er sein Schiff heil nach Hause bringen würde, und er konnte sich noch weniger ausmalen, wie er Deina wiedersehen und lieben und wie ihn der Krieg von ihr wegtreiben würde . . .
Kapitänleutnant Nobis erhebt sich mit einem Ruck. Oberfähnrich Peters ist eingetreten. Ein wenig zu stramm meldet er: »Kommandant wünscht Herrn Kaleu zu sprechen.«
»Wo?«
»Auf der Brücke.«
Im gleichen Augenblick lichtet das deutsche Flottenflaggschiff Bismarck die Anker. Automatisch sieht Nobis auf die Armbanduhr. 17 Uhr 02. Die Bismarck fährt dem Feind entgegen.
Sie läuft aus zum größten Sieg der deutschen Kriegsmarine. Sie läuft aus zur schmerzlichsten Niederlage der deutschen Kriegsmarine . . .
Langsam und gelassen schert die Bismarck aus dem norwegischen Fjord bei Bergen aus. Dicht gefolgt von dem schweren Kreuzer Prinz Eugen, einem 19 000-Tonnen-Schiff mit 1400 Mann an Bord, die ebenfalls zu ihrer ersten Feindfahrt ausläuft. Auf See formiert sich der Verband. Zwei Sperrbrecher fahren an der Spitze. Die Seiten- und Achtersicherung übernehmen fünf Zerstörer.
Auf der Kommandobrücke der Bismarck steht Admiral Günther Lütjens, ein Mann, den noch niemand lachen sah. Kurs 260°. Seegang zwei bis drei. Windstärke vier bis fünf. Sicht: acht Seemeilen. Fahrtgeschwindigkeit: 22 Seemeilen.
Der Abend bringt diesiges Wetter. Nach vier Stunden und dreißig Minuten Fahrt stößt der Verband rund 100 Seemeilen nordnordöstlich auf einen Convoy von Handelsschiffen. Der Admiral fordert Erkennungssignal an. Der Convoy antwortet richtig.
Es ist ein deutscher Scheingeleitzug mit elf Schiffen, gesichert von einem leichten Kreuzer und drei Zerstörern. Der Verband ist lediglich ausgelaufen, um die Operation Bismarck zu tarnen. Er erhält den Befehl: »Marsch fortsetzen!«
Die Fahrt geht zurück in die Heimathäfen.
Jetzt werden auch die Sicherungsfahrzeuge entlassen. Das Flaggschiff Bismarck und der schwere Kreuzer Prinz Eugen gehen auf neuen Kurs. Als ihn Kapitän Lindemann erfährt, schüttelt er den Kopf. Das Oberkommando der Kriegsmarine hatte dem Verband nahegelegt, zwischen Island und den Faröern zum Atlantik durchzubrechen. Grundsätzlich jedoch hat Admiral Lütjens als Flottenchef Handlungsfreiheit. Daß er sich für die viel gefährlichere Dänemarkstraße entschied, ist eine seiner Maßnahmen, die die Seekriegsleitung niemals begriff.
Die Marscherleichterung ist aufgehoben. Die Mannschaft an Oberdeck hat die Schwimmwesten und Stahlhelme griffbereit. Vom Bug bis zum Heck, von der Mastspitze bis zum Kiel knistert Nervosität. Auf einmal spürt jeder das Vibrieren des Schiffes, sagt sich, daß es natürlich ist, und fürchtet sich doch — die blutjungen Matrosen im ersten Einsatz genauso wie die erfahrenen Offiziere, die es sich um keinen Preis der Welt anmerken lassen möchten. Jeder reagiert auf seine Weise. Die einen reden doppelt soviel, und die anderen sagen gar nichts mehr, die einen flüstern, die anderen schreien, die einen kommen aus dem Klo nicht raus, und die andern kommen nicht mehr hinein.
Der Maat Mehring vergißt seine Weibergeschichten. Link denkt an seine Braut. Oberfähnrich Peters erzählt Witze. Aber die Pointen kommen gequetscht. Die Leisen werden angeschrien, sie sollen nicht so laut sein.
Plötzlich fühlt jeder den Gegner, der aus der Nacht, aus dem Nebel heraus, aus der Luft oder unter Wasser angreifen kann. Daß stundenlang nichts geschieht, erhöht die Spannung. Die Männer am Ausguck kämpfen mit Nachtgespenstern. An allen Seiten sehen sie plötzlich U-Boote. Die feixende Fata Morgana löst Latrinenbefehle am laufenden Band aus. Sie werden widerrufen, nochmals gegeben und abermals widerrufen. Nichts ist stürmischer als Waffenruhe auf Feindfahrt . . .
Oberfähnrich Peters schmeckt das Essen nicht. Aber er faßt nach, um Appetit vorzutäuschen. Warum mußte ich blöder Hund zur Marine gehen, denkt er verbissen. Er stellt seinen »Scheinwerfer« — das Eßgeschirr — weg und meldet sich wieder im Kartenraum.
»Sie sind ja blaß, Peters«, empfängt ihn Kapitänleutnant Nobis. »Ich bin immer blaß, Herr Kaleu . . . Schon als Kind.« Im gleichen Augenblick wird er rot.
»Jetzt nicht mehr«, stellt Nobis grinsend fest.
»Ich habe keinen Schiß, Herr Kaleu.«
Der Offizier klopft ihm auf die Schulter.
»Hat ja auch niemand behauptet. Mensch, was meinen Sie, wie mir’s beim erstenmal mulmig war. Sie brauchen es ja nicht weiterzusagen: Damals habe ich zweimal am Tag gekotzt.«
»Verstehen Sie den Admiral?« fragt Peters.
»Ne. Hab’ auch gar nicht die Absicht.«
»Der Alte wäre viel lieber durch die Faröer gefahren.«
»Ich auch«, brummte Nobis.
»Lütjens meint wohl, daß die Engländer glauben, wir nähmen diesmal den anderen Weg. Der Admiral denkt eben um zwei Ecken herum. Dafür ist er schließlich Admiral . . . Wenn die Engländer auch um zwei Ecken denken, dann klappt alles . . . Und jetzt hau’ ich mich eine halbe Stunde hin.«