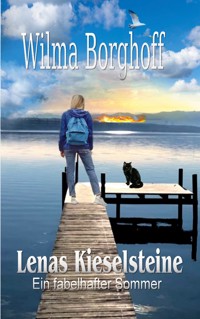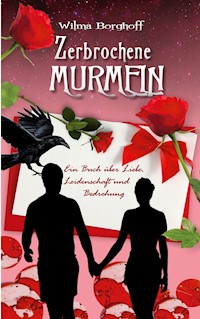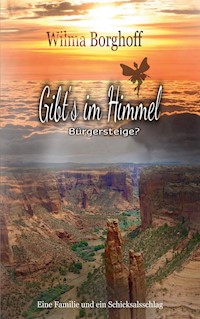
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oliver Bergmann stirbt mit 43 Jahren an einem Hirntumor. Seine Familie muss die tiefe Trauer über seinen viel zu frühen Tod überwinden. Dabei verfolgen sie unterschiedliche Herangehensweisen. Olivers Tochter Emily trifft Aislinn, eine zarte rothaarige Elfe, mit der sie die irische Familiengeschichte erkundet. Emilys Bruder Matthias schreibt sich auf seinem Trauerblog die Seele frei und hilft damit trauernden Jugendlichen weltweit. Ihre Mutter Sofia stößt auf ein Familiengeheimnis: Alexander, den Halbbruder ihres Ehemannes. Alexander ist eine gescheiterte Existenz, er sehnt sich nach einer Familie und liebt Kinder. Die Zusammentreffen von Alexander mit Sofias großer Familie führen zu einigen Konflikten, die Sofia fürsorglich und entschlossen löst. Hilft eine dreiwöchige Reise in den Westen der USA, die Oliver eigentlich miterleben sollten, Sofia und ihren Kindern, den Weg zurück ins Leben zu finden? "Gibt's im Himmel Bürgersteige?" erzählt von Tod und Trauer, von Liebe, von starken Frauen und ihrem Weg, mit der Trauer weiterzuleben, und von der Magie enger Familienbande.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Oliver Bergmann stirbt mit 43 Jahren an einem Hirntumor. Seine Familie muss die tiefe Trauer über seinen viel zu frühen Tod überwinden. Dabei verfolgen sie unterschiedliche Herangehensweisen.
Olivers Tochter Emily trifft Aislinn, eine zarte rothaarige Elfe, mit der sie die irische Familiengeschichte erkundet.
Emilys Bruder Matthias schreibt sich auf seinem Trauerblog die Seele frei und hilft damit trauernden Jugendlichen weltweit.
Olivers Ehefrau Sofia stößt auf ein Familiengeheimnis: Alexander, den Halbbruder ihres Ehemanns.
Alexander ist eine gescheiterte Existenz, er sehnt sich nach einer Familie und liebt Kinder. Die Zusammentreffen von Alexander mit Sofias großer Familie führen zu einigen Konflikten, die Sofia fürsorglich und entschlossen löst.
Hilft eine dreiwöchige Reise in den Westen der USA, die Oliver eigentlich miterleben sollte, Sofia und ihren Kindern, den Weg zurück ins Leben zu finden?
»Gibt’s im Himmel Bürgersteige?« erzählt von Tod und Trauer, Liebe, von starken Frauen und ihrem Weg, mit der Trauer weiterzuleben, und von der Magie enger Familienbande.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65 – Neun Monate später
Kapitel 1
Emily war dreizehn Jahre und vier Monate alt, als ihr Vater starb. Zwei Tage später sah sie zum ersten Mal die kleine Elfe.
Sie lag traurig auf ihrem Bett und versuchte, ein Buch zu lesen. Sie liebte Fantasy und hatte schon Harry Potter gelesen, Werke von Ursula Poznanski, und fast alle Bände der Serie Warrior Cats. Als sie klein war, hatte ihre Mutter ihr und ihrem Bruder »Die unendliche Geschichte« von Michael Ende und Bücher von Cornelia Funke vorgelesen und damit ihr Interesse für Fantasy geweckt. - Doch es gelang ihr nicht, sich auf die Erzählung zu konzentrieren. Immer wieder schweiften ihre Gedanken ab, zu ihrem Vater, seiner Krankheit, zum Hospiz. Sie wollte weinen, aber sie hatte keine Tränen mehr. Sie seufzte, stand vom Bett auf und reckte sich. Ihre Schultern waren verspannt. Vermutlich war es eine dumme Idee, flach auf dem Rücken liegend zu lesen. Sie überlegte, was sie anstellen solle, sie hatte die Seite im Buch schon zum dritten Mal gelesen und den Inhalt nicht aufgenommen.
Sie warf ihre Haare nach hinten und fasste sie im Nacken zusammen. Ihre Haare waren rotblond, dicht und lockig und reichten bis zur Mitte ihres Rückens. Sie hatte die Haare ihrer Mutter geerbt, ebenso die grauen Augen und die gerade Nase. Ihr Vater hatte ihr die zu großen, etwas abstehenden Ohren vermacht. Er hatte immer gesagt, dass sie froh sein könne, nur seine Ohren geerbt zu haben, und nicht seine große Nase.
Ihr Bruder Matthias – ein Jahr und drei Monate älter – kam nach dem Papa, er hatte sowohl die Ohren als auch die Nase von seinem Vater, außerdem die ausdrucksvollen braunen Augen. Der Vater war mittelgroß und etwas untersetzt gewesen, Matthias hingegen war schmal und lang aufgeschossen, größer als sein Papa, und zum Leidwesen seiner Eltern völlig unsportlich.
Emily nahm ihren Koalabär in den Arm, schlurfte zum Fenster und sah in den Garten hinaus. Das Wetter war typisch für Anfang März: grau, regnerisch und kühl. Die Bäume hatten hellgrüne Blätter ausgetrieben, und die ersten Frühlingsblumen – Hyazinthen und Krokusse - standen in voller Blüte. Die Schneeglöckchen waren schon verblüht, sie hatten dieses Jahr Dutzende gehabt, zur Freude ihrer Mutter. Der große Garten lud zum Spielen ein, mit der Wiese, auf der im Sommer Gänseblümchen und Löwenzahn wuchsen, und der breiten Terrasse, die mit grauen und altrosafarbenen Steinen gepflastert war.
Auf einmal hörte Emily ein Geräusch aus der Ecke ihres Zimmers. Sie drehte sich um, konnte aber zunächst die Ursache nicht finden. Es war ein leichtes Scharren oder Kratzen und schien von ihrem Regal zu kommen. War da eine Maus in ihrem Zimmer?
Emily legte den Plüschbär auf ihr Bett und tappte vorsichtig in die Richtung, aus der sie das seltsame Geräusch zu hören meinte. In der Mitte des Raums blieb sie stehen, weil sie eine Bewegung im Regal neben ihren Porzellankatzen sah. Sie besaß etwa ein Dutzend davon, in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Einige der kleineren Katzen saßen vor einem Miniaturhaus aus Holz, das einem venezianischen Palast nachempfunden war, mit einer kurzen Brücke über einem gemalten Kanal. Sie hörte wieder ein Rascheln. Was war das? Sie überlegte, ob sie ihre Mutter oder ihren Bruder rufen sollte. Es wurde ihr langsam unheimlich.
Sie fasste sich ein Herz, schlich zögernd näher an das Regal und erblickte eine kleine Elfe neben dem Katzenpalast. Zumindest sah das Wesen so aus, wie sie sich eine Elfe vorstellte: winzig, nur etwa 20 cm hoch, sie trug ein blaues Kleidchen, das knapp unter dem Knie endete, silberne Sterne verzierten den schimmernden Stoff.
Emily hielt die Luft an, schlug die Hand vor den Mund und starrte die Kleine an. Es schien ein Mädchen zu sein, mit einem zarten hübschen Gesicht, grünen Augen, die von dichten Wimpern umschattet wurden, und langen glatten roten Haaren. Aus den Haaren ragten die Spitzen ihrer Elfenohren hervor. Sie trug keine Schuhe an den zierlichen Füßen. Vom Hals baumelte eine dünne silberne Kette mit einem Anhänger in Form eines angebissenen Apfels. Sie drehte sich hin und her, als wollte sie sich Emily von allen Seiten zeigen, und damit sie die feingemaserten, fast durchsichtigen Flügel bewundern konnte.
Die Elfe sah Emily auffordernd an und schien zu erwarten, dass sie etwas sagte. Emilys Kopf war etwa auf der Höhe des grazilen Geschöpfes, das auf schmalen Beinen herum tippelte. Es sah ausgesprochen lebendig aus, und das Kleidchen raschelte beim Tippeln.
Sie konnte es nicht glauben – eine lebendige Elfe! In ihrem Zimmer! Träumte sie, oder stand sie wirklich vor einem Fabelwesen? Das aus einem ihrer Fantasy-Romane herausgesprungen sein könnte? In ihrem Kopf drehte sich alles, sie konnte nicht denken, ein einziger Gedanke kreiste in ihrem Hirn: »eine Elfe«. Emily kniff die Augen zu und öffnete sie wieder – die kleine Elfe stand immer noch vor ihr. Und sah ausgesprochen lebendig aus. Sie sah dem zarten Mädchen ins Gesicht und stellte amüsiert fest, dass die Fee ein kleines bisschen schielte. Das nahm sie als Hinweis, dass sie nicht träumte, dass die Fee ganz real in ihrem Zimmer im Regal stand und auf eine Reaktion von ihr zu warten schien.
Sie nahm ihren Mut zusammen und räusperte sich. »Wer bist du denn? Und wie kommst du in mein Zimmer?« Sie sprach leise, damit sie die Kleine nicht erschreckte.
Die Elfe sah sich um. »Das ist dein Zimmer? Ziemlich unordentlich. Räumt denn hier niemand auf?« Sie hatte eine helle melodiöse Stimme, nicht allzu laut, mit einer klaren Aussprache. Und einen leichten Akzent, den das Mädchen nicht einordnen konnte.
Emily ließ den Blick schweifen, als sähe sie ihr Zimmer zum ersten Mal. Sie musste der Kleinen recht geben. Es war unordentlich. Kleidungsstücke lagen herum, auf dem Bett, auf dem Boden, dem Schreibtischstuhl. Selbst im Regal fanden sich ein Tuch und ein paar schmutzige Socken. Ihr Bett war übersät mit Kuscheltieren in vielen Größen: Eisbären, Teddys, Echsen, Löwen, Koalas und einem weißen Pinguin. Ein vertrocknetes Blümchen fristete ein trostloses Dasein in einem Tontopf neben der Elfe, daneben lag ein angebissener braungewordener Apfel. Ihr Schulranzen lag offen auf dem Boden, ein Teil der Bücher und Hefte war davor verstreut, außerdem Buntstifte, Lineal, Radiergummi und ein zerbrochenes Geodreieck.Und aus einer Butterbrotdose mit einem halben Sandwich waren ein paar kleine Tomaten gekullert.
Sie schob den Ranzen rasch mit dem Fuß zur Seite. »Also, ich bin Emily, und ich wohne hier. Und ja, du hast Recht, ich könnte mal aufräumen. Und wie heißt du und was bist du? Eine Elfe? Eine Fee? Oder eine Fata Morgana?«
Die Elfe strich mit einer eleganten Bewegung ihr langes Haar zurück. »Ich heiße Aislinn, und ich bin eine Elfe. Ich weiß nicht, was eine Fata MoDingsbums ist.«
Emily: »Sorry, wie heißt du? Was ist das für ein Name?«
»Aislinn«, wiederholte die Elfe. »Ein irischer Name, mit A am Anfang und zwei ‚n‘ am Ende, Aislinn.« Sie sprach den Namen langsam und klar aus: A-i-s-l-i-n-n.
»Aha«, sagte Emily. »Aislinn.«
»Nein«, korrigierte die Elfe. »Du musst den Namen schnell aussprechen.« Sie sprach den Namen nochmals, schnell, verschluckte ihn fast.
»Auch gut«, sagte Emily. »Es ist jedenfalls schön, dich kennenzulernen. Willkommen in meinem Zimmer. Und wie bist du hier herein gekommen? Was willst du von mir?«
Aislinn reagierte nicht auf Emilys Fragen. Stattdessen flog sie los – sie konnte tatsächlich fliegen. Ihre aparten Flügel flatterten und sie drehte eine Runde durch den Raum, in Höhe von Emilys Kopf, bis sie auf dem Fensterbrett landete und hinaussah.
»Du hast ein schönes Zimmer, außer dass es unordentlich ist. Und einen schönen Garten – ich sehe Pferde, Schafe, Hühner – gehört das alles dir?«
Emily musste lächeln und ging zu Aislinn. Der Garten war groß, einige schöngewachsene alte Bäume standen drin – ein Ahorn, ein knorriger Apfelbaum und ein Kirschbaum. Eine Buchsbaumhecke fasste die Anlage ein, an der linken Seite stand ein rot gestrichenes Gartenhäuschen. Ein Holzzaun schloss sich an die Laube an, dessen ehemals braune Farbe abblätterte. Ihr Papa hatte vor, den Zaun in demselben Rot wie das Häuschen zu streichen, aber dieses Vorhaben immer wieder verschoben, bis er nicht mehr in der Lage zum Malern war. Emilys Blick fiel auf die Schaukel, auf der kaum noch geschaukelt wurde, und das Klettergerüst, das noch weniger benutzt wurde. Neben der Schaukel stand eine Sitzgruppe aus Rattan, auf der die Familie oft im Schatten des Ahornbaums zu viert gesessen hatte, wenn es ihnen auf der Terrasse zu heiß wurde. Jetzt würden sie nur noch zu dritt unter dem alten Baum sitzen.
»Uns gehört der Garten bis zu der Hecke, die du da siehst. Dahinter die Pferde und die Schafe und Hühner gehören dem Nachbarn. Ich hätte gerne ein Pferd oder wenigstens einen Hund, aber meine« – sie stockte kurz, weil sie »Eltern« sagen wollte – »meine Mutter erlaubt es nicht.«
»Aha«, sagte Aislinn. »Aber das Zimmer und die Möbel und Kleidungsstücke gehören alle dir? Und die vielen Fotos?«
Emily sah zur Wand über ihrem Bett auf die Fotos, etliche davon hatte sie selbst geschossen. Einige der Bilder waren gerahmt, es gab zwei größere Rahmen mit jeweils einer Collage von mehreren Aufnahmen. Und ein paar Fotos waren mit durchsichtigen Klebestreifen an die Tapete geklebt. Sie zeigten ihre Familie, ihre Freundinnen, die Pferde vom Nachbarn, Emily im Urlaub am Strand, ihre Tanzgruppe, den Hund ihrer Tante.
»Ja, das Zimmer gehört mir, und die Fotos auch. Jetzt aber zurück zu dir. Woher kommst du? Und was machst du hier?«
»Ich wollte dich besuchen. Mich mit dir unterhalten. Und sehen, ob ich etwas für dich tun kann.«
Emily kamen die Tränen. »Kannst du meinen Papa wieder lebendig machen?« Sie setzte sich auf ihr Bett. Kurz bemerkte sie, wie zerwühlt es war.
Aislinn schüttelte den Kopf. »Nein, das tut mir sehr leid, das kann ich nicht. Ich kann keinen Menschen lebendig machen, und auch keine Krankheiten heilen. Aber ich kann gut zuhören. Erzähl mir doch etwas von ihm.«
Emily musste nicht lange überlegen, die Worte sprudelten heraus. »Mein Papa war ein ganz toller Papa. Bevor er krank geworden ist, war er meistens lustig, hat meine Mama geneckt und mit meinem Bruder und mit mir gespielt und gebastelt und rumgetobt. Er hat mir Fahrradfahren beigebracht und Schwimmen und Skifahren. Er …«, sie brach ab und weinte.
Aislinn flog auf den Nachttisch. Sie fand kaum Platz für ihre Füßchen zwischen den zerknüllten Taschentüchern, einer Box für Papiertücher, Büchern, Zetteln und mehreren Halsketten und Armbändern.
»Es ist schön, dass du so einen tollen Papa hattest – diese Erinnerung kann dir niemand nehmen. Du brauchst dir nur die Fotos anzuschauen, und weißt sofort, das hab ich mit meinem Papa unternommen, das war ein besonders schöner Urlaub, oder ein schöner Ausflug. Er wird immer in deinem Herzen und bei dir bleiben.«
Emily wischte sich die Tränen mit dem Ärmel ihres T-Shirts ab. »Es ist einfach ungerecht, es ist so unfair. Alle anderen Kinder haben noch ihren Papa, keine von meinen Freundinnen hat einen todkranken Vater. Mein Papa war acht Monate krank und konnte nichts mehr richtig mit uns unternehmen. Wir konnten nicht mehr in den Urlaub fahren, wir waren im Winter nicht Ski fahren, und was wir diesen Sommer machen, wissen wir auch noch nicht. Und er kann mich nicht mehr in den Arm nehmen, mich nicht mehr trösten, und auch nicht mehr zanken. Keiner nennt mich mehr ‚Milly‘, das durfte nur mein Papa sagen. Es ist so unfair. Warum musste mein Papa sterben?«
Sie wischte sich nochmals mit dem Ärmel über die Augen, dann fiel ihr Blick wieder auf Aislinn. »Aber du hast mir meine Fragen immer noch nicht beantwortet. Woher kommst du? Warum kannst du fliegen? Wo warst du bisher?«
Aislinn lächelte fein. Sie flatterte auf den Schreibtisch, der ebenfalls keinen freien Platz hatte, sie landete auf einem Buch, dem Englischbuch, wie Emily feststellte. »Du stellst zu viele Fragen. Vielleicht will ich dich auf andere Gedanken bringen.«
Sie betrachtete ein Foto auf dem Schreibtisch. Es zeigte eine Gruppe von Jungen und Mädchen, die zu tanzen schienen. Die Mädchen trugen braune knielange weite Röcke, dazu beigefarbene Blusen, ihre braunen Schuhe sahen etwas plump aus mit den dicken halbhohen Absätzen. Die Jungen trugen mittelbraune lange Hosen und beigefarbene Hemden, darüber eine braune Weste. Eines der neun Mädchen, vorne links, war Emily.
»Was ist denn das für eine Gruppe? Was macht ihr da?«
Emily erhob sich vom Bett und ging langsam zum Schreibtisch. »Das ist meine Irish Celtic Dance Group. Ich bin seit zwei Jahren dabei, wir haben jedes Jahr ein bis zwei Auftritte.« Sie brach ab, weil ihr einfiel, dass ihr Papa dieses Jahr die Darbietung nicht sehen würde.
»Ach, eine Irish Dance Group?« Aislinn grinste vielsagend. »Und, gefällt es dir? Und die Musik?«
Emily nickte. »Ja«, sagte sie leise. »Es gefällt mir gut. Nur Papa war schnell genervt von der Musik.«
Es klopfte an der Zimmertür. Emilys Mutter fragte: »Emily, wir essen zu Abend, kommst du bitte herunter?«
Emily eilte zur Tür: »Moment, ich komme gleich«, rief sie und wollte die Tür abschließen, als sie hörte, wie die Schritte ihrer Mutter sich entfernten. Sie drehte sich um, gerade rechtzeitig, um Aislinns Verschwinden zu beobachten: Sie fasste sich an den Apfelanhänger an ihrem Hals und war mit einem leisen »Plopp« verschwunden.
Emily hastete zum Schreibtisch – die Elfe war nicht mehr zu sehen, niemand stand auf dem Englischbuch. Sie sah sich irritiert um, aber die Kleine war nirgends zu entdecken – sie war weg. Nicht weggeflogen, sie hatte sich scheinbar in Luft aufgelöst. Mitsamt ihrem blauen Kleidchen und den schillernden Flügeln.
Emily fragte sich, ob sie geträumt hatte. War da wirklich eine Elfe in ihrem Zimmer? Eine lebendige Elfe, mit Armen und Beinen und filigranen Schwingen? Die mit ihr gesprochen hat und durch den Raum geflogen ist? Die sich über die Unordnung mokiert hat und den Garten bewunderte. Ein zartes Feenwesen, aus einer anderen Welt, bei ihr zu Hause?
Emily stand an der Tür und sah sich noch einmal um. Es war jemand in ihrem Zimmer und ist mit glitzernden Flügeln vom Regal zum Fenster geflogen. Aislinn ist tatsächlich durch ihren Raum geflattert. Leider ist die Elfe abrupt verschwunden, ohne Abschied,ohne Erklärung oder eine Antwort auf ihre vielen Fragen. Aber Emily war tief in ihrem Herzen davon überzeugt, dass sie Aislinn wiedersehen würde.
Sie fühlte sich etwas getröstet und war gespannt und neugierig auf weitere Begegnungen mit der kleinen Elfe. Sie lief hinunter zum Abendessen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder.
Kapitel 2
Angefangen hatte alles mit Kopfschmerzen. Im letzten Sommer. In Emilys Erinnerung kamen sie plötzlich, ohne Vorwarnung, wie ein trauriger Gedanke. Bloß blieb dieser und nahm ihr ihren Papa. Der hatte auf einmal zu nichts mehr Lust, nicht zum Grillen, nicht zum Herumalbern, nicht zum Von-der-Couch-Aufstehen.
»Da ist etwas in Papas Kopf, das herausgeschnitten werden muss«, hatte ihre Mama erklärt, nachdem sie ihn endlich überzeugt hatte, zum Arzt zu gehen. Das hatte Emily und ihren Bruder geschockt. Aber sie hegten keinerlei Zweifel, dass es ihrem Papa bald besser gehen würde. Dass nur die faule Stelle entfernt werden musste, wie bei einem Apfel. Und dass Papa dann der Alte sein würde. Wieder Lust hätte zum Toben, zum Herumalbern.
Am Abend vor der Operation hatten sie gemeinsam im Krankenhaus Pizza gefuttert. »Das war das letzte Mal, dass wir als fast glückliche Familie zusammen gegessen haben«, war es Emily durch den Kopf gegangen. Papa wurde nie mehr der Alte und seine Familie ebenfalls nicht.
Es waren fast acht Monate vergangen, seit die Kopfschmerzen angefangen hatten. Emily war mit ihrer Mutter Sofia und ihrem Bruder Matthias im Hospiz. Die Ärztin hatte gesagt, dass Papa nicht mehr lange leben würde und es jetzt bald mit ihm zu Ende ginge. Papa konnte seit drei Tagen nicht mehr sprechen, der Hirntumor hatte ihm die Sprache genommen. Emily, ihre Mutter und ihr Bruder saßen abwechselnd an seinem Bett. Zwischendurch schlichen sie im Zimmer auf und ab – achtzehn Quadratmeter, ein Bett, ein großer Tisch mit zwei Stühlen, in einer Ecke ein Einbauschrank. Schräg gegenüber der Eingangstür befand sich ein geräumiges Badezimmer. Im Zimmer lag ein schwerer Geruch, nach Krankenhaus, nach Desinfektionsmittel, und nach etwas Undefinierbarem, Bedrohlichem. Nach Tod, mutmaßte Emily.
Das Zimmer war hellgelb gestrichen, an den Wänden hingen viele Fotos, die meisten ungerahmt. Die Fotos zeigten die Familie, Oliver mit Sofia, Fotos von ihrer Hochzeit, vom Skifahren, von Kollegen und Freunden. Ein großes Fenster ließ viel Licht hinein. Das Wetter war trübe – strahlender Sonnenschein hätte wie Hohn gewirkt. Es war ein langer Winter gewesen, mit wenig Sonne, wenig Schnee, viel Regen und Kälte. Alle warteten auf den Frühling – bis auf die Familie – die wartete auf seinen Tod.
Mit aller Kraft hatte Oliver, der nur 44 Jahre alt wurde, gegen die Krankheit gekämpft. Über sieben Monate waren seit der schrecklichen Diagnose vergangen. Oliver litt an einem bösartigen Hirntumor, einem Glioblastom Grad IV. Dieser Tumor metastasiert nicht, lässt sich aber fast nie vollständig entfernen. Nach der ersten Operation musste er Bestrahlungen und Chemotherapie über sich ergehen lassen, und die Familie hoffte, hoffte auf ein Wunder, darauf, dass Oliver länger als das vorausgesagte Jahr leben würde.
Doch der Tumor kam wieder.
Auch in einer zweiten Operation konnte das Glioblastom nicht komplett entfernt werden, es wuchs weiter, und Ende Januar war klar, dass Oliver nicht mehr lange leben würde.
Oliver schrieb sein Testament und besprach mit seiner Frau, wie er sich seine Beerdigung vorstellte. Eine Freundin der beiden, Anne, ermutigte ihn, Briefe an seine Kinder zu schreiben. Seine Handschrift wurde zittrig, aber er zwang sich, Briefe für seinen Sohn und seine Tochter zu verfassen: zu ihrem nächsten Geburtstag, zu ihrer Volljährigkeit, zu ihrer Hochzeit, zu ihren ersten Kindern, den Enkelkindern, die er nicht kennenlernen durfte. Sofia nahm die Briefe an sich und verwahrte sie in ihrem Arbeitszimmer.
Olivers Familie war allmählich mit seiner Pflege überfordert, er schaffte es kaum die Treppe hinauf zu Schlafzimmer und Badezimmer. Brigitte, eine Cousine von Sofias Mutter Marlene, arbeitete in einem Hospiz. Sie hatte vor einiger Zeit mit ihr darüber gesprochen, dass Oliver dort besser aufgehoben sei, und ihr geschildert, wie das Leben eines Menschen in einer Sterbeklinik aussah. Außerdem hatte sie ihr eine Liste der Hospize in ihrer Umgebung geschickt.
Marlene telefonierte die Hospize ab, Plätze waren rar. Es war eine schwierige Aufgabe, sie hatte ein enges Verhältnis zu ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn. Sie war 67 Jahre alt und seit zwei Jahren im Ruhestand. Marlene war froh, dass sie jetzt zur Verfügung stand und ihre Tochter in der schweren Zeit unterstützen konnte.
Sie hatte viele Pläne für ihr Pensionärsleben geschmiedet und wollte mit ihrem zweiten Ehemann Manfred, genannt Manni, den gemeinsamen Ruhestand genießen. Sie planten zu reisen, wandern und faulenzen. Aber als ihr Schwiegersohn erkrankte, hatte sie keine Sekunde gezögert, ihn und seine Familie zu unterstützen. Sie fuhr ihren Schwiegersohn zu den Strahlenbehandlungen, zur Chemotherapie, und zu den vielen Untersuchungen. Da es Oliver beim Autofahren häufig schlecht wurde, hatte sie ihren Fahrstil geändert. Sie fuhr langsamer, gemächlich um die Kurven und bremste früher und bedachtsamer.
Sie hatte den Eindruck, dass ihr Verhältnis zu Schwiegersohn und Tochter enger geworden war, dass das Leid sie näher zusammengebracht hatte. Es gab ihr das Gefühl, dass sie bei allem Kummer die Familie tatkräftig unterstützen konnte. Ihre Tochter musste ja weiter ihrem Beruf nachgehen, und Marlene war froh, dass sie einspringen konnte.
Leider gab es häufig Diskussionen mit ihrem Ehemann. Manni liebte Sofia und deren Kinder, seine erste Ehe war geschieden und kinderlos geblieben. Matthias und Emily waren für ihn die Enkelkinder, die er nie haben würde. Aber er wollte mehr Zeit mit Marlene haben, schließlich kümmerte sich Olivers Mutter Magda kaum um ihren Sohn oder seine Familie.
Magda wohnte etwa zwei Autostunden entfernt. Sofia hatte ihrer Schwiegermutter schon mehrfach ihr Gästezimmer angeboten, damit sie mehr Zeit mit ihrem Sohn verbringen konnte. Sofia verstand nicht, warum Magda ablehnte und nur alle paar Wochen auf einen kurzen Besuch vorbeikam.
Marlene hatte Glück und fand beim dritten Hospiz, das sie anrief, einen freien Platz. Es war relativ neu, wenige Kilometer entfernt und mit dem Auto oder der Straßenbahn bequem erreichbar. Sie besichtigte es am gleichen Tag mit Sofia. Die Pflegedienstleiterin Frau Hamann war Anfang 40, etwas füllig, sie hatte dunkle Haare und warme braune Augen.
»Wir werden nach Kräften dafür sorgen, dass Ihr Mann sich hier wohlfühlt«, erklärte sie und sah Sofia mitfühlend an. »Wir richten uns nach ihm, es gibt keine festen Zeiten für Aufstehen, Frühstück oder sonstige Mahlzeiten. Er ist unser Gast. Sie können sich auf uns verlassen.«
Sie erzählten Oliver nach der Rückkehr von ihrem Besuch, und er stimmte schweren Herzens seinem Umzug in das Hospiz zu. Abends verabschiedete er sich von seinen Kindern. »Ihr könnt mich ja besuchen«. Das tröstete keinen der Familienmitglieder.
Marlene und Sofia fuhren tags darauf mit ihm zum Hospiz und parkten vor der Tür. Er setzte sich in den Rollstuhl und sie schoben ihn zu seinem Zimmer im Erdgeschoss. Oliver sah sich um.
»Das ist jetzt mein Zuhause? Bis zum Tod?«
Die beiden Frauen wussten keine Antwort. Mit dem Umzug nahmen sie ihm alles, was ihm wichtig war: seine Frau, seine Kinder, sein Zuhause, seine Musikanlage, seinen Bastelkeller.
Oliver verbrachte vier Wochen im Hospiz - bis zu seinem Tod. Er hatte viele Freunde und eine große Familie. Fast alle besuchten ihn im Hospiz, und das Pflegepersonal war sehr beeindruckt: Andere Patienten im Hospiz hatten kaum Gäste, bei oliver gaben sie sich die Türklinke in die Hand. Seine Kollegen erzählten Neuigkeiten aus dem Büro. Mitglieder aus seiner ‚Fahrradtruppe‘ ließen Erinnerungen aufleben: Wohin ihre Radtouren sie geführt hatte, wer gestürzt war, wie einer sich den Fuß gebrochen hatte, ein anderer sich verirrt hatte, und viele Geschichten mehr. Seine Schwägerinnen und Schwäger erinnerten ihn an ihre gemeinsamen Urlaube, die vielen unterhaltsamen Familienfeiern. Die Besucher brachten ihm Süßigkeiten mit, oder Hamburger, oder Obst, insbesondere Äpfel, sein Lieblingsobst. Und vor allem brachten sie Zeit mit.
Sofia besuchte ihren Mann fast täglich, sie fuhr meist direkt vom Büro zu ihm. Einige Tage nach seinem Umzug ins Hospiz fragte sie ihn, ob dies die richtige Entscheidung war. Er hatte vor der Einlieferung nur zögernd dem Hospiz zugestimmt und wäre lieber zu Hause bei seiner Familie geblieben. Zu Sofias Erleichterung bejahte er, er fühle sich gut betreut.
Der Tagesablauf im Hospiz drehte sich nur um ihn. Er durfte schlafen, solange er wollte und konnte, und Wünsche bezüglich Frühstück und Mittagessen äußern. Es gab mehr Pfleger pro Gast – keine Patienten! – als in einem Krankenhaus, und er führte viele Gespräche mit dem Personal.
Und die freundlichen Schwestern und Pfleger bereiteten ihn vorsichtig auf den Tod vor, fragten ihn, was er vorher tun wolle, wen er sehen wolle, und ob er im Himmel jemanden treffen könne. Diese Gespräche empfand Oliver zunächst erschreckend, dann tröstlich. Sofia fühlte genauso, als er ihr davon erzählte.
Er führte Gespräche mit seinen Kindern, zunächst mit Emily. Sie war in Tränen aufgelöst, sein Sohn Matthias ballte seine Hände zu Fäusten zusammen. Beide sprachen mit keinem Menschen, auch nicht mit ihrer Mutter, über das Gespräch mit ihrem Papa.
Und Sofia hielt sich aufrecht, fuhr ins Büro, kaufte ein, erledigte die Hausarbeit, und besuchte täglich ihren Mann. Viele fragten sie, warum sie sich nicht krankschreiben ließ, aber die Arbeit half ihr, es war etwas Normales, das sie an ihr altes Leben erinnerte. Sie würde nicht zusammenbrechen, sondern weiterleben. Bald ohne ihren Mann. Sie musste ja demnächst den Vater für ihre Kinder ersetzen. Solche Gedanken schob sie schnell beiseite.
Oliver wurde Mitte Februar 44 Jahre alt, sein letzter Geburtstag. Sofia hatte eine kleine Feier im Hospiz arrangiert, die Familie und einige enge Freunde kamen, Andreas, Marcel, Anne und Jules. Das Hospiz hatte einen hübschen Gemeinschaftsraum auf der ersten Etage, daneben gab es eine kleine Kapelle. Vor dem Gemeinschaftsraum erstreckte sich eine große Terrasse mit bequemen Bänken und Korbsesseln, außerdem Tische und Blumenkübel aus Terrakotta, die mit Heidekraut und Rhododendron bepflanzt waren. Das Wetter war ausnahmsweise mild und trocken, so dass sie die Terrasse nutzen konnten. Alle Gäste hatten etwas zu essen mitgebracht: Kuchen, Muffins, Snacks. Sie aßen und redeten und lachten zusammen, und für etwa eine Stunde konnten alle fast vergessen, dass Oliver todkrank war.
Bei einem ihrer Besuche Ende Februar bemerkte Sofia auf den Straßen Leute in Kostümen, bunte Clowns, Hexen, Vampire, kleine Jungs als Superman verkleidet mit rotem Umhang, kleine Mädchen als Prinzessinnen oder Einhörner. Im Radio lief Karnevalsmusik – Sofia schaltete schnell auf einen anderen Sender. Sie hatte nie viel für Karneval oder Fastnacht übriggehabt; Oliver war immer die treibende Kraft gewesen, und wegen ihm hatten sie jedes Jahr Karnevalssitzungen oder Partys besucht. Und jedes Jahr hatten sie mit der ganzen Familie den örtlichen Karnevalsumzug bejubelt, beim gleichen Zug und am selben Platz, an dem ihre Eltern schon mit ihr und ihren Geschwistern gestanden hatten, als sie Kinder waren. Dieses Jahr fiel Karneval für sie und ihre Kinder aus.
Am dritten März, nach fast acht Monaten Kampf und vier Wochen im Hospiz, hatte Oliver es geschafft. Er musste nicht mehr kämpfen, nicht mehr leiden, und konnte für immer die Augen schließen. Sofia war bei ihm, und Matthias und Emily. Sie hielten abwechselnd Olivers Hand und unterhielten sich leise. Sie erzählten sich und ihm von den schönen Erlebnissen, die sie gemeinsam hatten, von lustigen und traurigen Begebenheiten. Sie konnten nicht erkennen, ob er sie verstehen konnte oder überhaupt wahrnahm, aber es war ihnen ein Bedürfnis, mit ihm zu reden.
Am frühen Abend hörte er auf zu atmen. Eine Schwester kam herein und bestätigte seinen Tod, die Ärztin aus dem Hospiz würde am nächsten Tag den Totenschein ausstellen.
Sofia küsste ihn: »Jetzt hast du es geschafft.«
Emily dachte: »Wo ist er jetzt?«
Und Matthias konnte nicht aufhören zu weinen.
Nach etwa einer Stunde hatten sie sich etwas gefasst. Sie verabschiedeten sich von Oliver und informierten die Familie und die engsten Freunde. Dann verließen sie das Zimmer. Vor der Tür brannte eine weiße Kerze in einem großen Glas, daneben lag eine weiße Rose. Sie hatten dieses Arrangement bei früheren Besuchen im Hospiz vor anderen Zimmern gesehen: Der Bewohner oder die Bewohnerin war gestorben.
Sie fuhren zu dritt nach Hause.
Kapitel 3
Eine Oase der Ruhe empfing Sofia, untermalt von einigen Vögeln, die mit hellen Stimmen den Frühling herbei zwitscherten. Es roch nach feuchter Erde, nassem Laub und etwas Moder, und nach verblühenden Blumen. Ein rotbraunes Eichhörnchen lief wenige Meter vor ihren Füßen den gekiesten Weg entlang und flitzte eine knorrige Eiche hoch.
Sofia war mit dem Bestatter verabredet, um auf dem örtlichen Friedhof eine Grabstelle für ihren Ehemann auszusuchen. Auf dem Friedhof waren ihre Großeltern mütterlicherseits begraben.
Der Bestatter hatte sie in seinem alten BMW mitgenommen. Er hieß Bernd Schmitz, und Sofia fand, dass er wie das Zerrbild eines Bestatters aussah: Groß und dünn, in einen schwarzen Anzug gekleidet, der ihm etwas zu weit war. Eine dunkelgraue Hornbrille auf der langen spitzen Nase beherrschte sein schmales Gesicht, die strähnigen Haare waren nach hinten gekämmt.
Sie fanden eine geeignete Stelle für Olivers Urnengrab, wenige Meter von den Großeltern entfernt, unter einem Ahornbaum.
Auf dem Rückweg hielten sie beim Institut des Bestatters an und Sofia wählte eine Urne aus. Oliver und sie hatten vor seinem Tod über seine Beerdigung gesprochen, und er hatte sich für eine Urnenbestattung entschieden. Sie hatten über den Ablauf der Begräbnisfeier geredet und welche Musik gespielt werden sollte.
Bei ihrem ersten Besuch im Beerdigungsinstitut war Sofia von einer jungen Frau bedient worden, die unerfahren und unsicher gewirkt hatte. Sie hatte im Laufe des Gespräches gefragt, wie viele Teilnehmer Sofia bei der Beerdigung erwartete. Als Sofia die Zahl von etwa 150 bis 200 Trauergästen genannt hatte, wurde sie sofort gebeten, einen Moment zu warten. Die Mitarbeiterin war durch eine Tür in den hinteren Teil des Geschäftes gegangen und mit dem Geschäftsinhaber, Herrn Schmitz, zurückgekommen.
»Und Sie erwarten etwa 150 bis 200 Gäste bei der Beerdigung Ihres Mannes?«, hatte er skeptisch gefragt. Sofia hatte genickt und die vielen Freundesgruppen, Familien und Kollegen aufgezählt. Herr Schmitz war bald überzeugt worden und hatte zu Sofias Erleichterung ihre Beratung übernommen.
Emily war zu Hause, als ihre Mutter zurückkam. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Mutter nicht zum Friedhof begleitet hatte. Heimlich hatte sie gehofft, dass die Elfe Aislinn sich noch einmal blicken ließe – seit ihrem Auftauchen vor zwei Tagen war sie nicht wieder erschienen. Emily fragte sich zum wiederholten Mal, ob die Elfe wahrhaftig in ihrem Zimmer aufgetaucht war, oder nur in ihrer Phantasie. Hatte sie geträumt, dass Aislinn mit ihr gesprochen hatte, durch ihren Raum geflattert war, versucht hatte, sie aufzumuntern?
Sie wollte jedenfalls beim nächsten Wiedersehen besser vorbereitet sein und der Kleinen etwas anbieten. Sie hatte sich den Kopf zerbrochen, was Elfen essen oder naschen. Popcorn, Nüsse, Zuckerstreusel und kleine Schokoladenstücke kamen ihr in den Sinn. Eine Tasse hatte sie damit gefüllt und in ihrer Schreibtischschublade deponiert. Aus dem Nähkorb ihrer Mutter hatte sie einen Fingerhut entwendet und zusammen mit einer Flasche Apfelschorle ebenfalls in der Schublade versteckt.
Als ihre Mutter die Haustür öffnete und rief: »Ich bin zurück – ist jemand hier?«, lief Emily sofort zum Wohnzimmer hinunter.
Sofia sah ihre Tochter munter die Treppe herunterlaufen und merkte auf. Hatte Emilys Stimmung sich endlich gebessert? Emily hatte die letzten Tage viel Zeit, zu viel Zeit, in ihrem Zimmer verbracht, auf dem Bett gelegen und vor sich hingestarrt. Sie kam kaum zum Essen heraus. Sie wollte weder ihre Freundinnen noch einen anderen Menschen sehen.
Matthias hatte bisher nicht so problematisch reagiert. Er verbrachte ebenfalls mehr Zeit in seinem Zimmer als normalerweise, aber sein bester Freund Johannes durfte ihn besuchen. Gemeinsam hatten sie sich das letzte Automodell vorgenommen, einen Ford Mustang, den er seinem Papa vor zwei Jahren geschenkt hatte. Oliver hatte die Arbeit an dem Auto vor anderthalb Jahren unterbrochen,jetzt wollte Matthias das Modell fertig stellen. Das gab ihm das Gefühl, etwas für seinen Papa vollendet zu haben.
Während Sofias Treffen mit dem Bestatter war Johannes wieder einmal bei Matthias. Die beiden Jungen hatten die meiste Zeit schweigend gearbeitet und lediglich Bemerkungen über das Auto und den Fortschritt beim Zusammenbau gemacht. Ihre Beziehung basierte überwiegend auf Computerspielen, sie sprachen miteinander selten über ihre Gefühle. Matthias hatte sich krampfhaft auf die filigranen Teile des Automodells konzentriert, die restliche Arbeit überließ er seinem Freund. Er hatte sich bemüht, möglichst wenig an seinen Papa zu denken, um nicht vor Johannes in Tränen auszubrechen.
Als er seine Mutter rufen hörte, unterbrach er seine Bastelarbeit und ging hinter Emily die Treppe hinunter. Beide sahen die Urne in den Händen ihrer Mutter und blieben stehen. Matthias riss die Augen auf, drehte sich um und rannte wieder die Treppe hinauf. »Ich muss noch mit Johannes das Auto für Papa fertig bauen«, sagte er mit brüchiger Stimme und verschwand in seinem Zimmer.
Er schloss die Tür hinter sich und lehnte sich dagegen. Sein Freund sah kurz auf. »Alles okay?«, fragte er. »Ja«, brachte Matthias nur heraus. Johannes gab sich damit zufrieden, er hätte nicht gewusst, was er sagen sollte oder wie er seinen Freund hätte trösten können.
Emily war am Fuß der Treppe stehen geblieben und sah ihre Mutter an. Mama sah müde aus, fand sie. Sie musste wieder an die Elfe Aislinn denken – ihre Mama hatte genauso rote lockige Haare wie die Kleine. Allerdings waren Sofias Haare kurz geschnitten und verwuschelt, so dass sie in alle Richtungen abstanden. Emily bezeichnete die Frisur ihrer Mutter als Sturmfrisur oder out-of-bed Frisur. Ein langer Pony fiel Sofia in die Stirn, eine Strähne war lila gefärbt, das gab ihr ein kapriziöses Aussehen.
Sofia sah die steile Falte auf der Stirn ihrer Tochter und seufzte. Emily war ihr ähnlich, äußerlich und charakterlich. Sie hoffte, dass Emily nicht so rebellisch werden würde wie sie selber. Mit sechzehn Jahren hatte sie ihre Haare zu einer Punkfrisur gestylt, igelkurz und giftgrün. Die Frisur passte zu ihrem damaligen aufsässigen Benehmen und stand ihr ausgezeichnet. Dazu hatte sie sich ein Tattoo in Form eines Schmetterlings auf der linken Schulter stechen lassen und trug einen kleinen Ring in der Nase. Sofia hatte ernsthaft überlegt, die Schule zu verlassen und Schauspielerin zu werden. Ihre Mutter hatte den Verdacht gehegt, dass Sofia Drogen nahm und war erleichtert, als die trotzige Phase vorbei war, Sofia ihr Abitur bestanden hatte und zur Uni gegangen war. Marlenes jüngere Kinder Rainer und Laura hatten ihr in der Teenagerzeit weniger Sorgen bereitet.
Mutter und Tochter sahen sich immer noch an, Sofia mit der Urne aus hellem Buchenholz in den Händen. Sie hatten am Vorabend beim Abendessen über die Urne gesprochen und beschlossen, dass Emily sie anmalen würde, und der Bestatter hatte geeignete Farben und Pinsel mitgegeben.
Emily nahm ihrer Mutter die Urne aus der Hand. »Dann fange ich am besten mal an«, sagte sie, und stellte das Gefäß auf den Beistelltisch im Wohnzimmer. Sie hielt inne: Sie war unschlüssig, wie sie beginnen sollte.
Sofia holte die Farbtöpfe und Pinsel aus ihrem Beutel.
Emily hatte verdrängt, dass sie zugestimmt hatte, die Urne anzustreichen. Sie hatte sich keine Gedanken über ein Motiv oder einen Text gemacht, sie hatte keine Idee, was sie malen könnte. Und ihr Bruder war in sein Zimmer gerannt, anstatt zu helfen. Er hätte doch Vorschläge für ein Motiv oder einen schönen Spruch machen können.
Sofia spürte die Unsicherheit ihrer Tochter. »Komm, ich hole einen Block, und dann machen wir gemeinsam ein paar Skizzen, einverstanden?« Sie empfand es als wohltuend, aktiv sein zu können, etwas zu gestalten, zusammen mit ihrem Kind. Diese Beschäftigung ließ weniger Raum für Gedanken und Trauer.
Emily nickte und Sofia holte einen DIN-A3-Zeichenblock aus dem Wohnzimmerschrank, dazu einige Filzstifte. Sie setzten sich nebeneinander an den Esstisch, ein großer ovaler Tisch aus hellem Buchenholz, von acht passenden Stühlen umgeben. Emily konnte gut zeichnen und erstaunte manchmal ihren Kunstlehrer mit ihren Einfällen und ihrer Kunstfertigkeit. Der Filzstift – sie begann mit dem roten – schwebte über dem Papier, und in rascher Folge bemalte sie mehrere Blätter – Herzen entstanden, Tränen, ein Bach mit einer Holzbrücke darüber, Wolken, Sonnenstrahlen, ein Regenbogen – und eine Elfe. Sofia saß daneben und sagte kein Wort; ihre Tochter brauchte keine weitere Hilfe. Und sie selber war zeichentechnisch völlig unbegabt.
Schließlich war Emily mit einem ihrer Entwürfe zufrieden, und sie begann, das Motiv auf die Urne zu übertragen. Sie öffnete alle Farbtöpfchen und stellte beruhigt fest, dass eines mit silberner Farbe gefüllt war. Mit feinen Strichen malte sie einen Bach, der um die ganze Urne floss. An einer Stelle überquerte ein Holzsteg den Bach. Ein Regenbogen überspannte die Vorderseite der Urne, dazu zeichnete sie einige Regentropfen und Sonnenstrahlen. Auf die Rückseite malte sie eine Elfe mit langen roten Haaren in einem blauen Kleid, umgeben von silbernen Sternen. Sie fügte außerdem rote Herzen und ein »Papa« hinzu. Auf den Deckel malte sie ein weiteres Herz, in dem »Papa« stand.
Ihre Mutter war inzwischen in die Küche gegangen, um das Abendessen zuzubereiten. Emily rief sie, als sie mit ihrer Arbeit zufrieden war.
Sofia war begeistert. »Von wem hast du das nur? Weder ich noch dein Vater sind künstlerisch begabt – das ist wirklich sehr schön geworden!« Sie betrachtete die Urne von allen Seiten. »Da ist ja eine kleine Elfe! Wie schön! Wie kommst du denn darauf? Deinem Papa hätte das sicher sehr gut gefallen.«
Sofia nahm Emily in den Arm, die Erwähnung des Vaters ließ beiden die Tränen über die Wangen laufen. Emily löste sich als Erste aus der Umarmung.
»Glaubst du eigentlich an Elfen?«, fragte sie ihre Mama. »Also, dass es sie wirklich gibt, so richtig lebendig, und Menschen sie sehen können.«
»Elfen?« Ihre Mutter sah überrascht aus. »So wie du sie hier gemalt hast?«
Emily überlegte; eine leise Stimme flüsterte ihr zu, dass sie besser nicht von der Elfe erzählen sollte. Aislinn war ja sofort verschwunden, als ihre Mutter an die Türe klopfte.
Matthias rettete sie vor einer Antwort, er kam die Treppe hinunter und bewunderte die Urne. »Emily, wie gut, dass du so gut zeichnen kannst. Soll ich noch einen Computer dazu malen?«
Er zwinkerte; seine Mutter und Schwester wussten, dass er überhaupt nicht zeichnen konnte. Sie lächelten und freuten sich über seinen unbeholfenen Versuch, sie aufzumuntern.
Weder Sofia noch Emily schnitten das Thema Elfe ein weiteres Mal an. Sofia fühlte sich bei dem Thema unsicher, fast schon unbehaglich. Es war ihr zu geheimnisumwoben, geradezu mystisch. Glaubte ihre Tochter etwa an Fabelwesen? Was hatte der Tod des Vaters bei Emily ausgelöst?
Sie brachte nicht die Energie auf, weiter darüber nachzudenken oder gar nachzufragen, daher schob sie die Elfe weg und hatte sie bald fast vergessen.
Und Emily sprach ebenfalls nicht mehr darüber, weil sie die Elfe nicht verraten wollte. Sie zerbrach sich den Kopf, was sie ihrer Mutter mitteilen könnte, ob sie ihr von Aislinn berichten könnte oder ob die kleine Elfe dann fernbleiben würde. Es fiel ihr keine Antwort ein.
Vorläufig gehörte die Elfe ihr allein.
Kapitel 4
Schon von weitem hörten sie das Johlen und Kreischen der Kinder auf dem Schulhof. Drei Tage nach dem Tod ihres Vaters besuchten Emily und Matthias wieder die Schule. Sofia hatte sie mit dem Auto hingefahren. Sie war krankgeschrieben, aber ihre Kinder sollten wieder ihr normales Leben aufnehmen und nicht zu viel von der Schule verpassen.
Matthias und Emily besuchten dasselbe Gymnasium. Es war relativ neu, mit vier zweistöckigen Gebäudeteilen, in rot und weiß gestrichen. Die Gebäude gruppierten sich um einen zentralen großen Schulhof, seitlich fanden sich ein Klettergarten und ein Bolzplatz.
Matthias entdeckte seinen Freund Johannes und schlenderte zu ihm. Johannes war etwa gleich groß wie Matthias, hatte blonde kurzgeschnittene Haare und helle Augen. Emily mochte Johannes nicht, ohne dass sie einen Grund hätte benennen können. Möglicherweise weil Johannes fast nichts sagte und ihr nicht in die Augen sehen konnte. Sie lästerte gegenüber ihrem Bruder, dass die Augen von Johannes aussähen wie Computerbildschirme. Und sie glaubte, dass Johannes ihren Bruder zum Nerd, zum Computerfreak, gemacht hatte.
Auf ihrem Weg zum Klassenraum erzählte Johannes, auf welchem Level er in seinem neuesten Computerspiel schon war. Matthias hörte kaum hin, war aber froh, dass sein Freund sich benahm wie immer. Im Klassenraum angekommen kam ein Mädchen – Denise, hübsch, kurze dunkle Haare, auf Matthias zu, umarmte ihn zaghaft, und sagte: »Matthias, es tut mir so furchtbar leid.« Ein weiteres Mädchen, Johanna, tat es ihr gleich. Daraufhin kamen noch drei Mädchen und zwei Jungen und sprachen ihr Beileid aus. Matthias war gerührt, unfähig zu sprechen, er kämpfte mühsam seine Tränen hinunter und war froh, als der Lehrer in die Klasse kam.
Herr Bender wandte sich an Matthias und sagte: »Matthias, es tut mir und dem ganzen Kollegium sehr leid, dass dein Vater gestorben ist. Sag es bitte, wenn wir etwas für dich tun können.« Er hielt kurz inne. Matthias schwieg. »Dann fangen wir mit unserem Englischunterricht an.«
Als Matthias mit Johannes abgezogen war, sah Emily sich um, konnte keine ihrer Schulkameradinnen sehen und schlurfte in Richtung ihres Klassenraums. Auf dem Weg dorthin sah sie Erik aus ihrer Klasse. Erik war ein paar Monate jünger als sie, einen Kopf größer und kräftig gebaut, ohne dick zu sein. Er sah gut aus mit seinen dunklen lockigen Haaren. Sie reichten weit im Nacken hinunter und eine dichte Tolle hing ihm über seine sanften braunen Augen.
Emily steuerte an ihm vorbei, doch er trat schon auf sie zu und legte den Arm um ihre Schulter. Emily schob rasch seine Hand weg, sie konnte seine Berührung nicht ertragen, ohne zu weinen. Sie ging einen Schritt zurück.
»Emily, es tut mir so furchtbar leid. Was kann ich für dich tun? Wie geht es dir?«, fragte er und versuchte, ihr ins Gesicht zu sehen.
Emily hielt den Kopf gesenkt. »Lass mich in Ruhe«, fauchte sie ihn an. »Mir geht es gut, und ich brauche keine Hilfe.« Sie eilte weiter und Erik blickte ihr betroffen nach. Mit dieser Reaktion hatte er nicht gerechnet, er hatte impulsiv gehandelt und sie trösten wollen.
Emily erreichte den Klassenraum. Vor der Tür standen zwei Mädchen, Julia, ihre beste Freundin, und Miriam, die sie nicht leiden konnte.
»Was war das denn?«, fragte Miriam. »Warum stößt du Erik weg, so einen coolen Typen?« Sie hätte wohl gerne die Aufmerksamkeit von Erik gehabt. Dabei hatte Erik einmal gespottet, dass sie wie eine graue Maus aussähe. Sie war klein, dünn, und zeigte meist ein missmutiges Gesicht.
»Lass sie«, meinte Julia und zog Emily fort. »Wir gehen schon mal rein.«
Emily ließ sich gerne fortziehen, Eriks Umarmung und die neidischen Kommentare von Miriam waren zu viel. Ihr Kopf schwirrte: Sie dachte abwechselnd an ihren Papa, an Erik – der ihr gefiel -, an die blöde Miriam, an Julia und an ihr neues Leben ohne Papa. Und zwischendurch tanzte eine kleine Elfe in einem blausilbernen Kleidchen in ihren Gedanken herum. Sie seufzte, setzte sich auf ihren Platz hinten im Klassenraum und stützte den Kopf auf die Hände. Julia setzte sich neben sie und streichelte ihr sacht über den Rücken.
Die anderen Schüler kamen herein, ihr munteres Plappern verstummte, sobald sie Emily sahen. Einige wandten sich ihr zu, aber Julia wehrte sie mit unmissverständlichen Gesten ab. Es war ruhig in der Klasse, bis auf leises Flüstern und das Rascheln von Heften und Büchern. Schließlich kam der Klassenlehrer Herr Krause mit energischem Schritt zur Tür hinein.
»Guten Morgen«, begrüßte er die Klasse.
»Schön, dass du wieder bei uns bist, Emily. Der Tod deines Papas tut mir und den Kollegen furchtbar leid. Lass mich oder die Kolleginnen und Kollegen bitte wissen, wenn du etwas brauchst, oder wenn wir sonst etwas tun können.«
Emily nickte nur mit dem Kopf.
»Wo waren wir in Mathe stehen geblieben?«
Emily war froh, als der erste Schultag vorüber war. In der Pause war sie mit Julia im Klassenraum geblieben, das wurde an diesem Tag toleriert. Sie nahm ihren Apfel aus dem Ranzen, aber nach einem Blick steckte sie ihn wieder weg. Äpfel waren das Lieblingsobst von ihrem Papa gewesen: Das Symbol seines bevorzugten Computerherstellers, bei dem er seine berufliche Karriere gestartet hatte. Sie mochte jetzt keinen Apfel essen.
Nach der Schule eilte sie mit Julia direkt zur Bushaltestelle, ohne jemanden anzusehen. Sie bemerkte im Vorbeigehen Erik, der ihr betroffen nachblickte. Sie wandte den Kopf ab, stieg in den Bus und fuhr nach Hause.
Kapitel 5
** Beerdigung Oliver Bergmann. 14.00 Uhr **
Das Schild stand vor der doppelflügeligen Kirchentür, ein schlichtes weißes Schild mit schwarzer Schrift. Olivers Beerdigung fand an einem Dienstag Mitte März statt.
Marlene war die Erste der Trauergemeinde vor der Kirche. Sie sah das Schild und erstarrte: Das durfte nicht die Ankündigung der Beerdigung ihres Schwiegersohns sein, ihr charmanter gutaussehender Schwiegersohn konnte nicht tot sein, durfte nicht beerdigt werden. Es war unfassbar, unmöglich, dass ihre Tochter Witwe war, ihre Enkelkinder Halbwaisen.
Sie dachte zurück an den Tag im Juli letzten Jahres, als ihre Tochter sie angerufen und von Olivers bösartigem Tumor erzählt hatte. Marlene erinnerte sich, als wäre es gestern gewesen. Es war, als hätte bei Sofias Worten ein kleines Händchen um ihr Herz gegriffen und es kräftig zusammengedrückt. Wie oft hatte sie sich seither gewünscht, der Tumor hätte sie befallen statt ihren Schwiegersohn.
Jetzt war es endgültig. Sie trafen sich hier an der Kirche, um Oliver zu beerdigen. Sie atmete tief durch, um ihre zitternden Hände zu beruhigen. Dann holte sie ein Taschentuch aus ihrer Jacke und tupfte die Tränen weg, die gegen ihren Willen herausquollen.
Das Wetter zeigte sich angenehm: 14°C, windstill, bewölkt, ohne Regen. Marlene fand, dass dies das geeignete Wetter für eine Beerdigung war. Soweit man bei einer Beerdigung – bei dieser Beerdigung – überhaupt von geeignet sprechen konnte. Annehmbar passte besser.
Manni hatte endlich das Auto geparkt und trat an ihre Seite. Seine Nähe wirkte beruhigend auf sie, ihre Hände hörten auf zu zittern. ‚Zum Glück habe ich meinen Manni‘, dachte Marlene. Und im gleichen Atemzug schämte sie sich, schämte sich, dass sie weiter glücklich sein durfte, dass sie einen Mann an ihrer Seite hatte, während ihre Tochter mit 43 Jahren Witwe war, allein mit ihren minderjährigen Kindern.
Marlene und Manni waren seit fünf Jahren verheiratet, für beide war es die zweite Ehe. Manni – der bis zu seiner Rente in der Stadtverwaltung gearbeitet hatte - hatte Oliver sehr geschätzt und viel Zeit mit ihm verbracht. Er war 69 Jahre alt, zwei Jahre älter als Marlene, mittelgroß und etwas korpulent. Seine wenigen Haare waren weiß, kurz geschnitten und bildeten einen Kranz um seine Glatze. Er war glattrasiert und trug eine randlose Brille.
Marlene schmiegte sich an ihn und fand, dass der dunkle Anzug mit dem hellblauen kleinkarierten Hemd und der dezent gestreiften Krawatte ihm richtig gut stand, obwohl der Anzug etwas um seine korpulente Figur spannte. Sie schalt sich, dass ihr sein Beerdigungsanzug gefiel. Aber seine großkarierten Hemden im Holzfällerstil, die er normalerweise trug und in vielen Ausführungen besaß, hätten zu diesem Anlass nicht gepasst. Marlene - mittelgroß, mollig, kurze rotblonde Haare mit hellen Strähnchen, trug eine graukarierte Hose, eine schwarze Bluse und eine beigefarbene Steppjacke.
Manni legte den Arm um sie und tätschelte sie beruhigend.
Sofia stieß mit Matthias und Emily zu ihnen. Sie trug eine lange beigefarbene Hose, dazu eine schwarze Bluse und Jacke. Um den Hals hatte sie ein lilafarbenes Halstuch geschlungen, passend zu ihrer lila-gefärbten Haarsträhne. Sie hatte keinen Schmuck angelegt, nur eine klobige grüne Armbanduhr und ihren goldenen Ehering. Sie wirkte gefasst. Freunde hatten ihr geraten, Beruhigungsmittel für den heutigen Tag zu nehmen, aber das widerstrebte ihr. Sie würde den schweren Tag durchstehen, ohne Medikamente. Sie zwang sich, sich auf ihre Kinder und die Trauergäste zu konzentrieren.
Olivers Mutter Magda Bergmann schritt hinter den Kindern. Sie war von Frankfurt aus zu Sofia gefahren.
Marlene ging zu Magda und bemerkte, dass Magda unberührt vom Tod ihres Sohnes schien. Während sie selber rot geweinte Augen hatte und immer wieder ein Taschentuch zum Gesicht führte, zeigte Magdas Gesicht keine Tränenspuren. Sie begrüßte Magda mit einer leichten Umarmung und Luftküsschen rechts und links. Sie musste sich bücken, da Magda nur 1,60 Meter groß und schmal, fast schon dürr, war. Man sah ihr die 71 Jahre kaum an. Sie war ganz in Schwarz gekleidet.
»Warum trägst du nicht schwarz?«, fragte Magda. »Und von den anderen auch kaum jemand?«
Marlene seufzte. »Oliver hat keinen Wert auf Trauerkleidung gelegt, und das hatten wir auch in die Traueranzeige geschrieben.«
»Ach so«, Magda wandte sich rasch zu Matthias um. Sie setzte zu einer Umarmung an, aber er stand so steif da, dass sie es bei einem Armtätscheln beließ.
Sofias Geschwister trafen ein, ihre Schwester Laura und ihr Bruder Rainer mit ihren Familien, außerdem Olivers Schwester Melanie mit ihrem Mann.
Allmählich füllte sich der Vorplatz der Kirche. Oliver war zeit seines Lebens sehr beliebt gewesen, und viele wollten ihm die letzte Ehre erweisen. Einige Trauergäste waren in Schwarz gekleidet, aber die meisten trugen normale Kleidung, wie Sofia zufrieden bemerkte. Eine Versammlung von schwarzen Krähen hätte nicht zu Oliver und seinem bunten Leben gepasst.
Der Pfarrer trat aus der Kirchentür und forderte zum Eintreten auf. Er war Ende vierzig, hatte ein sympathisches schmales Gesicht und trug einen schwarzen Talar. Marlene ging mit Manni als Erste hinein, es folgten Sofia mit ihren Kindern und Magda, dann die anderen. Es war eine kleine Kirche, etwa 50 Jahre alt, mit weißen Wänden und wenigen Figuren. Das einzig auffallende Element waren die schönen hohen Fenster, im gotischen Stil, mit bunten Gläsern. Emily versuchte, zu erkennen, was die Fenster darstellten, gab es aber schnell auf. Die Urne mit der Asche ihres Vaters stand im Altarraum auf einem Tisch mit einem weißen Tischtuch. Die aufgemalte Elfe schien Emily anzusehen. Neben der Urne standen mehrere gerahmte Fotos von Oliver, zwei davon waren auf hölzernen Staffeleien ausgestellt.
Sofias Nichten und Neffen und weitere Kinder – viele der Freunde hatten ihre Töchter und Söhne mitgebracht - liefen im Altarraum der Kirche herum und sahen sich die Fotos an.
»So was gehört sich doch nicht!«, zischte Magda ihrer Schwiegertochter zu. Sofia schüttelte den Kopf, Oliver hatte Kinder gern gehabt. Es hätte ihm gefallen, dass die Kleinen herumliefen und die Fotos ansahen, statt brav bei ihren Eltern auf den Bänken zu sitzen.
Die Kirche füllte sich bis auf den letzten Platz, ein paar Besucher mussten stehen. Der Pfarrer trat nach vorne, schickte die Kinder mit freundlichen Worten zu ihren Eltern, und die Trauerfeier begann.
Da Oliver nicht religiös gewesen war und keiner Kirche angehörte, hatte Sofias Bruder einen befreundeten Pfarrer gebeten, die Trauerfeier durchzuführen. Der Pfarrer kannte Oliver nur flüchtig, aber Sofia hatte lange mit ihm gesprochen und von ihrem Mann erzählt.
»Oliver war ein Familienmensch«, begann er. Es war mucksmäuschenstill. »Er liebte seine Frau, seinen Sohn Matthias und seine Tochter Emily«. Leises Schluchzen aus dem hinteren Bereich der Kirche war zu hören. »Oliver liebte das Leben, seine große Familie und seine Freunde. Er übte den Beruf aus, der ihm gefiel. Zeit für seine vielen Hobbys fand er immer noch – Radfahren, gutes Essen und Trinken, aber auch ‚Chillen‘ wie man faulenzen heutzutage umschreibt.« Leises Lachen der Anwesenden ertönte. Der Pfarrer sprach über Olivers Werdegang, sein Studium, seinen Beruf. Er hielt eine warmherzige persönliche Ansprache, in die er viele Begebenheiten aus Olivers Leben einflocht, die er von Sofia erfahren hatte.
»Sofia erzählte mir, dass Oliver ihr bester Freund war, ihr Ratgeber, und der beste Vater für die Kinder, den sie sich denken konnte.« Er legte eine kurze Pause ein, dann wandte er sich an Sofias Kinder. »Matthias und Emily, ihr beide müsst nun ohne euren Papa auskommen. Das ist furchtbar, und ihr fragt sicher, warum Gott so etwas zulässt. Ich habe keine Antwort darauf. Aber ich weiß, dass er für euch sorgen wird. Dass er dafür sorgen wird, dass es euch wieder besser geht. Dass ihr wieder lachen und euch freuen könnt. Und das wäre genau das, was Oliver wollen würde – dass ihr auch ohne euren Papa das Leben genießen könnt. Ich wünsche euch dafür viel Kraft. Ich werde für euch beten.«
Er trat vom Mikrofon zurück.
Eine Gruppe von Olivers Freunden – Andreas, Marcel, Anne und Jules - traten nach vorne, stellten sich vor den Altar und erinnerten an ihn und was sie mit ihm verbanden. »Fahrradfahren«, sagte Andreas und bewegte die Arme, als wollte er damit ein Rad antreiben. »Barbecue«, fügte Marcel hinzu. »Musik«, Anne spielte Luftgitarre. »Kämpfer«, rief Jules und führe einige Boxbewegungen vor. So ging es weiter mit »Zocken«, »Skifahren«, »Multitalent«, »Tierliebhaber trotz Allergie«, »Anführer«, »Urlaub mit Freunden« und vieles mehr. Es entstand ein farbenprächtiges Bild von einem Mann, der das Leben und seine Familie und Freunde geliebt hatte und bei vielen Unternehmungen die treibende Kraft war.
Matthias hatte all seinen Mut zusammengefasst, trat auf einen Wink des Pfarrers ebenfalls nach vorne, neben die Freunde, stellte sich ans Mikrofon und holte den Zettel, den er mit Sofia vorbereitet hatte, aus der Hosentasche.
»Mein Papa war der beste Papa, den man sich denken kann. Er hat gerne mit uns gespielt, er hat mir schwimmen und Skifahren beigebracht. Und natürlich Fahrradfahren – obwohl ich das nicht so gerne mache.« Leises Lachen - die meisten Anwesenden wussten, dass Matthias unsportlich war. Seine Stimme war brüchig, aber gut verständlich. »Papa hat mit Begeisterung mit mir Computer gespielt, manchmal bis tief in die Nacht. Natürlich nur am Wochenende oder in den Ferien. Er war immer für mich da, und er konnte so witzig sein! Wenn ich mal eine Klassenarbeit verhauen hatte, sagte er nur: ‚Kopf hoch, die nächste wird besser!‘ Mama hat immer gesagt, er wäre ein Bruder Leichtfuß. Das stimmt wahrscheinlich, er hat uns das Leben leicht gemacht. Dafür hat er uns genervt mit seiner Unpünktlichkeit – darauf konnte man sich wirklich verlassen.« Er wischte kurz mit dem Handrücken über seine Augen. Es war völlig still, die Kirche schien den Atem anzuhalten. »Papa hat mir vor kurzem gesagt, ich soll nach vorne gucken. Das werde ich tun.«