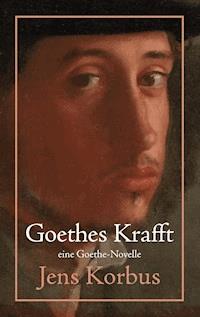
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der historische Johann Friedrich Krafft, dessen wahre Identität unbekannt ist, ist im Jahr 1785 gestorben. Goethe diente der Unbekannte als Zuträger in Ilmenau. Jens Korbus verlegt seine Existenz in die unruhige Zeit kurz nach der Völkerschlacht bei Leipzig ins Jahr 1813. Krafft kämpft in der Nacht des 21. Oktober um sein Überleben. Eine Novelle um Macht, Rivalität und subtile Formen der Ausbeutung. Goethe einmal aus der Perspektive eines von ihm Abhängigen gesehen. Wird Krafft seine beiden französischen Entführer abschütteln? Wird es ihm gelingen, sich von Goethe freizumachen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
KAPITEL 1
„DER VULKAN ist aufgebrochen“, rief Goethe.
„Die Schlacht scheint gewonnen“, sagte Krafft.
„Die Lava drückt in breitem Strom ins Tal. Ohne uns geht nun nichts mehr!“
„Leipzig scheint gefallen!“
„Was hat das mit Leipzig zu tun?“, rief Goethe, „die Wissenschaft geht über die Nationen hinweg!“
„Ist der Franzose etwa nicht bei Leipzig geschlagen?“, fragte Krafft.
„Ich rede nicht von diesen Dingen!“, rief Goethe, „ich rede von meiner Farbenlehre. St. Hillaire hat endlich mir darüber geschrieben. Die Akademie hat sie akzeptiert. Heute, an diesem 21. Oktober des Jahres 1813, einem Donnerstag.“
Vollkommener Stillstand der Gedanken! Hirnlähmung! Napoleons Truppen flohen nach Westen, lagen einquartiert in SEINEM Haus, biwakierten unter SEINEN Fenstern, und DER DA kroch einem kleinen Echo auf seine Irrlehre nach!
Goethe wippte mit den Füßen in den kleinen, absatzlosen Lederpfoten. Seine Fußspitze zeigte auf ein Bild neben der Tür. Ein muskulöser Mann in zerrissener, orangeroter Toga saß auf einem dicken Delfin, der ihn von einem Schiffswrack im Hintergrund ans Ufer getragen hatte. Am Horizont das leckgeschlagene Schiff. Das Grau-Blau des Meeres war auch die Farbe der Tapete im Raum.
„St. Hillaire hat zugegeben, dass wir einen grünlichen Schein sehen, nachdem wir der Netzhaut ein rotes Glasvorhalten, einen roten Schein, wenn die Scheibe grün war. Das Bedürfnis nach Gegensätzen liegt also in unserem Auge. Ja, mehr noch! Es sitzt tief in der menschlichen Natur. Das Auge verlangt nach Totalität“, fuhr Goethe fort, „und es bringt sie selbst hervor, wenn man sie ihm verweigert. Alle Wissenschaften werden sich umstellen müssen. – Ein Schlückchen Melnicker, Krafft? Ein Wasserweinchen, das sich leicht hinunterschleicht.“
Krafft nickte. Er hieß gar nicht Krafft. Er hieß Johann Jakob Schwachinger. Aber DER DA hatte ihn vor zehn Jahren Krafft genannt und in Jena untergebracht. Zehn Jahre hatte er Spitzelberichte schicken müssen, was die Professoren lehrten, was die Studenten redeten.
Christiane betrat den Raum. Goethe bestellte den Wein „und den blauen Hausrock für Doktor Krafft. Er zittert ja vor Kälte.“ Vor zwei Jahren hatte er wieder nach Weimar gedurft, als Schnellschreiber und Ideenlieferant. Christiane brachte den Wein und schenkte ein. Sie ähnelte ihrem Bruder, dem Bibliotheksverwalter. Beide hatten den gleichen Zug von Verlassenheit im Gesicht. Vorsichtig half sie ihm in Goethes blauen Hausrock. Goethe saß dabei, als heckte er was aus. Er hat ja kaum noch Zähne, dachte Krafft. Aber er schaut, als wären alle seine Sinne zu EINEM angespannt. Dachte er an Flucht aus Weimar, falls die Franzosen die Leipziger Schlacht doch noch nicht ganz verloren hatten?
„Der Wein ist mir aufs Gedärm geschlagen“, sagte Goethe, „ich will mich erleichtern.“ Er drückte die Hände auf den Rücken und ging in den Garten. Er wollte ins Häuschen, aber die Tür ging nicht auf. „Bitte sich zu beeilen“, rief er. Eine Stimme sagte etwas Französisches. „Es eilt“, rief Goethe.
Die Tür ging auf. Ein kleiner, französischer Soldat kam mit hängenden Gurten heraus. Goethe trat ein und setzte sich auf das warme Holz, ohne abzusperren.
Ein kleiner Fleck vor dem Brettlhaus war mit grauen Kalksteinen zugepflastert. Zwischen den Steinen wucherte Gras. Gestern während der Verrichtung hatte die purpurrote Abendsonne auf das Pflaster gestrahlt. Ihr roter Schein hatte das Grün der Grasbüschel unglaublich tief und schön leuchten lassen. Nach der Verrichtung hatte er lange ins Grün von Herters Wiese geblickt, dann ganz schnell auf die Baumstämme. Die hatten plötzlich einen roten Schimmer.
Jemand hatte einen weiblichen Unterleib aufs Wandholz geschmiert. Materie, Resultat des All-Einen: Das Weib! So weit würde es nicht kommen, dass die Männer sich ihm unterwerfen würden. Alle diese Frauen, die sein Haus bevölkerten, waren von IHM abhängig. Frauen UND Männer. Krafft, den Nützlichen, eingeschlossen. Vielleicht war Krafft gut und ER war böse. Böses als Akzidenz des Guten? Dann gäb’s keine Hoffnung. Dann erst war das Böse möglich, und Tier, Pflanze, Mineral im Menschen litten arg. Damals in Frankfurt hatte er den gemütsschwachen Doktor Clauer, der auch im Hause wohnte, dreimal am Tag herunterführen müssen. Während der Gänge hatte er Prophezeiungen abgegeben: Mit dem Leonardoapparat über die Alpen wie ein Vogel! Das war das Einzige, das der Mensch nicht zuwege bringen würde.
Die Kutsche stand gedeichselt im Hof. Er konnte jederzeit weg. Er blickte durch die Ausfahrt. Im Muschelkalk des Frauenplans spiegelte sich die Nacht. Drei Männer unterhielten sich über den Raubmord am Weber Herter. Wahrscheinlich das Lösegeld verweigert. Marodeure zogen genug herum. Gierig lauschte man dem Feldscher, der Einzelheiten wusste. Dreimal hatte er in den letzten fünfzig Jahren mit der Grande Nation zu tun gehabt. Die Angst vor den Truppen des Tugendwächters im Jahr 1793. Die Einquartierung am Frauenplan 1806. Noch früher! Er war noch keine zehn Jahre alt gewesen, da hatten die Franzosen Frankfurt besetzt. Der Vater hatte in der Nachtmütze, die Mutter im Flügelhäubchen neben seinem Bett gestanden. Im Hirschgraben hatten Biwakfeuer gebrannt. Opa Textor redete mit den Fremden. Vom Roßmarkt her kreischten die Proviantschafe. Er hatte mit seinem Bruder Hermann-Jakob, der damals noch gelebt hatte, in den Hirschgraben geschaut, wo die Fremden ihre Zelte aufbauten.
Halb Frankfurt hatte gemunkelt, der Großvater, der Stadtbürgermeister war, habe den Franzosen kampflos in die Stadt gelassen. Warum hatte der Neunpfünder vor der Hauptwache nicht gefeuert? Der Vater war auf Friedrichs Seite. Seit dem Franzoseneinfall war ein Riß durch die Familie gegangen.
Jedes Haus hatte Einquartierung bekommen. Der Vater als Schwiegersohn des Stadtschultheißen hatte den Zivilgouverneur bekommen, Comte de Thoranc, der ein Ekzem an der Wange hatte und seiner Mutter Komplimente machte. Thoranc hatte das erste Gefrorene ins Haus gebracht. Die schöne fremde Sprache, die hinten im Rachen gesprochen wurde. Das flächige Gesicht des Grafen. Die starke Nase. Er sollte schon vor dem Handstreich, als Postillon verkleidet, in der Stadt gewesen sein. Er hatte die Zimmer mit den chinesischen Tapeten im ersten Stock bekommen, und hatte viel für die Stadt getan. Die Häuser hatten Nummern bekommen und die Straßen Ölbeleuchtung. In den Junghof war ein Theater gekommen. Der Großvater hatte ihm und der Schwester Freibilletts geschenkt. Der Graf hatte eine Liebschaft angefangen, von der ganz Frankfurt wusste: mit einer Malerin.
Draußen auf dem Frauenplan sangen sie ein Lied von Körner:
Und wenn sie winselnd auf den Knien liegen und zitternd um Gnade schrein,
laßt nicht des Mitleids falsche Stimme siegen!
Stoßt ohn’ Erbarmen drein!
Wer so was sang, wusste nicht, was man Rousseau und Voltaire verdankte. Zadig allein war’s wert, der sich den Versuchungen der Astarte entzogen hatte. Der weiße Stier, der in der Nähe der Geliebten weidete. Der Weise Mambres, der sich von Gedanken nährte. Jean-Jaques, der in den Bekenntnissen mehr als Beichte ablegte: „Ich plane ein Unternehmen, das ohne Vorbild ist.“ Nicht das Verbrecherische war am schlimmsten zu sagen, sondern das Lächerliche und Schimpfliche.
Dann brennt sie an und streut es in die Lüfte,
was nicht die Flamme fraß!
Damit kein Grab das deutsche Land vergifte mit überhein’schem Aas!
Das war kein Lied vom Krieg, in dem man sich ein Stück Land nahm und ins Kabinett zurückging. Diese Verse wollten sich im Leben verwirklichen. Konnte nicht irgendwo in einer Kellerkammer ein zweiter Robespierre hocken, der die Botschaft herausschrie, als habe sie ihm ein höheres Wesen eingepflanzt? Gab es solche Botschaften nicht auch im eigenen Werk? War Dorothea nicht während der französischen Umwälzung vertrieben worden? Hatte sich nicht Hermann, der Deutsche, ihrer angenommen? Hatte er den Herzog nicht unbedingt begleiten wollen, als es zweiundneunzig gegen den Franzosen ging? Hatte er Christiane nicht erst geheiratet, als sie sich im Haus zwischen ihn und ein paar Franzosen geworfen hatte?
KAPITEL 2
IN EINEM französischen Linienregiment dienten die Grenadiere Le Grand und Seignerolles. Le Grand war ein magerer, verwachsener Bursche mit einem Gesicht wie eine verweste Löwenschnauze. Seignerolles viereckiger Kopf saß auf einem dicklichen, kraftvollen Körper. Le Grand hatte im Waschhaus von Avignon gearbeitet und abends die Pferde der Poststation versorgt. Während die Reisenden auf den Pferdewechsel warteten, zeichnete er ihre Köpfe und träumte, vom Verkauf der stereotypen Portraits zu leben.
An einem Märzabend des Jahres 1812 hatte er im Hof der Poststation damit herumgeprahlt. Seine Zuhörer, zwei französische Offiziere, merkten, dass er sich der Wehrpflicht entzogen hatte, und nahmen ihn mit. Am nächsten Tag hatte er einen blauen Rock an und fand sich im Carré eines französischen Exerzierkorps wieder. In der Schlacht von Bautzen bekam er einen Streifschuss am Arm und lernte im Lazarett Seignerolles kennen, der sich schon im vergangenen Winter freiwillig gemeldet hatte. Er sah Le Grands Zeichnungen und nannte die Stümpereien „wahre Kunst“. Wenn der Krieg gewonnen war, würden sie sich zusammentun. Le Grand als berühmter Maler und Seignerolles als sein Agent.
Dazu mussten sie aber erst mal überleben. Wann immer es ging, ließen sie sich von Linie oder Carré überrollen und nahmen den Verwundeten das Geld oder die letzte Ration ab. Wer so aussah, als würde er doch noch überleben, den stachen sie ab. An den Tagen nach ihren Raub- und Mordexzessen fühlten sie eine Leere im Kopf wie nach einem Kater, mit zugeschwollenen Augen und Gestank aus der Schnauze. Mit der Zeit kamen sie darauf, dass das Ausplündern der eigenen Leute immer gefährlicher wurde, falls doch mal einer überlebte. Sie unterhielten sich oft darüber und fassten den Plan, in einer besetzten Stadt einen reichen Bürger zu entführen und sich mit dem erpreßten Geld in Hyeres niederzulassen.
Im September 1813 wurden sie vom 4. Korps in Lindenau unter General Bertrand nach Leipzig verlegt und wohnten einen Monat in der Großen Feuerkugel, jenem sechsstöckigen Mietshaus, in dem Goethe die Jahre 1765 bis 1768 mit Schreiben, Zeichnen und der genauen Planung seiner Zukunft verbracht hatte. Aber im Oktober 1813 stürmten die Preußen die Stadt. Sie wurden nach Liebertwolkitz verlegt und sahen Napoleon und den Fürsten Poniatowski übers Feld reiten. Dann liefen die Sachsen zu den Preußen über, und der französischen Artillerie ging die Munition aus. Le Grand und Seignerolles spürten mit dem Instinkt der Fledderer, dass die Schlacht verloren war. Vor der plötzlich einsetzenden Kanonade flohen sie in Richtung Zschocher, wo wie sich einem rheinwärts fliehenden Regiment anschlossen. Am Abend des 20. Oktobers waren sie vor Weimar, wo sie die Nacht in einem Laubwäldchen an der Ilm verbrachten. Aber die Gegend wurde von den Kosaken des Generals von Bock durchkämmt, und so stahlen sie sich am 21. Oktober frühmorgens nach Weimar hinein, wo fast achttausend Soldaten ungeachtet der vor Leipzig tobenden Kämpfe nebeneinanderlagen. Zwischen den Kolonnen von französischen Reservisten durchstreunten sie die Stadt und musterten die schönsten Bürgerhäuser nach einem Opfer für die geplante Entführung durch, die sie „le grand ravissement“ nannten. Die meisten Leute standen vor einem Haus auf einem großen Markt, der sich Frauenplan nannte, zeigten mit dem Finger auf ein großes, gelbes Haus, das wie eine Kanzlei aussah und sagten dabei immer wieder das Wort Minister. Weil aber die Leute vor dem Haus mehr und nicht weniger wurden, ließen sie den Plan fallen, und suchten sich das Nachbarhaus aus, in dem der Weber Herter wohnte.
Le Grand brach mit dem Seitengewehr die Tür auf. Herter saß im Speisezimmer am Tisch. Er sah die beiden Fremden, schrie und hörte nicht eher auf, bis ihm Le Grand die Pranke auf den Mund legte und ihn erstickte. Dann setzten sie sich an den Tisch und aßen weiter. Sie plünderten die Speisekammer und fraßen sich mit Pökelfleisch und eingeweckten Früchten voll. Dann legten sie sich nebeneinander in Herters Bett und schliefen bis abends. In der Dunkelheit gingen sie durch die Hintertür nach draußen und sahen in Goethes Garten, der direkt an den Garten Herters grenzte, Goethes Brettlhaus. Bei seinem Anblick spürte Seignerolles ein Rühren im Darm, verrichtete seine Notdurft und war dabei von Goethe gestört worden. Hinter den Blumenbeeten versteckt, beobachteten die beiden Goethe und machten sich rasch klar, dass er und kein anderer der Minister sein konnte, von dem die Leute so ehrfurchtsvoll gesprochen hatten. Sie wollten ein wenig warten, ihn oder seine Bedienten mit Steinwürfen nach draußen locken und ihn dann irgendwie in ihre Gewalt bekommen.
KAPITEL 3
VOR DEM Schwan hatten sie zu Ende gesungen. Goethes Kopf war heiß. Er wollte nachsehen, ob die Kutsche reisefertig war, falls die Franzosen doch noch kämen. Das schwarze Holz. Die gelbe Polsterung. Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n? Es war Vollmond.
Mit zwanzig hatte er zum ersten Mal - bei Vollmond übrigens - den Mond- und Kerzenschatten eines Holzstabes auf ein Blatt Papier fallenlassen. Der Mondschatten hinter der Kerze war rötlich gelb, der Kerzenschatten hinter dem Mond war blau. Brachte man die beiden zusammen, wurde der Kerzenschatten schwarz. Fast schwarz. Es war auch noch etwas Blau darin, weil es das Auge wollte. Oft sah man darin noch ein gelbes Rot.
Auf Blau und Rot folgte oft die Gegenfarbe der Gegenfarbe: meergrün. Er war damals wie betäubt gewesen. Das Auge brachte also die Farben durch Wille und Vorstellung hervor. War es wirkliche Erkenntnis oder nur ein Taschenspielertrick? Ich weiß, dass dem Menschen seine Wünsche Wirklichkeiten sind ...





























