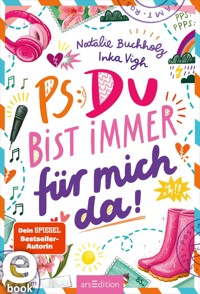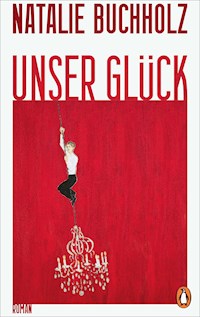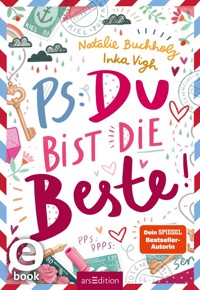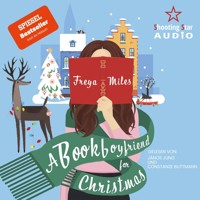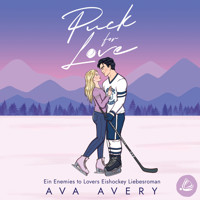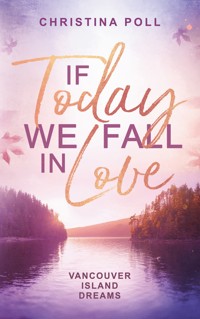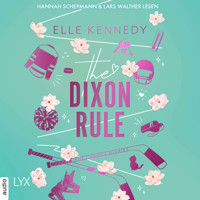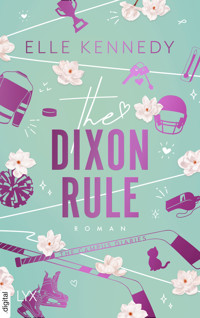18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine vergessene Urne, ein neugieriges Kleinkind und der Schatten des Großvaters – so beginnen Natalie Buchholz‘ poetische Ermittlungen, die mitten hinein ins schattige Gestrüpp des zwanzigsten Jahrhunderts und in die Geheimnisse einer Familie führen. Man legt das Buch nicht mehr aus der Hand.« Nils Minkmar
Ein kleiner Zufallsfund ist es, der Natalie Buchholz an ihren verstorbenen Großvater Anatole erinnert. Wer war dieser zwischen Deutschland und Frankreich hin- und hergerissene Mann? Erstmals setzt sich die Autorin mit dem Großvater auseinander, der stets ein Fremder für sie war und doch bis in ihr eigenes Leben hineingewirkt hat. In seinen jungen Jahren geht er zur französischen Armee, den Zweiten Weltkrieg allerdings erlebt er als zwangsrekrutierter Soldat der Wehrmacht. Danach entscheidet er sich vehement für eine Seite und lehnt sogar seine Tochter ab, die einen Deutschen heiratet.
Mit poetischer Präzision geht die Autorin dieser Herzenskälte nach. Sie erzählt von einer deutsch-französischen Familie, deren Ambivalenz und Zerrissenheit sich in der Geschichte der Region Elsass-Lothringen widerspiegelt – und wird dabei eine bittere Entdeckung machen.
»Sehr poetisch, mit sehr viel Humor auch.« ― Florian Valerius, ARD Buffet, Buchtipps für Weihnachten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Natalie Buchholz wurde 1977 in Frankreich geboren und wuchs in München und dem Münchner Umland auf. Sie studierte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim und an der Université Aix-Marseille. Bislang erschienen von ihr die Romane Der rote Swimmingpool, Unser Glück sowie eine Jugendbuch-Reihe. Natalie Buchholz wurde für ihr literarisches Schaffen mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrer Familie in München und im Inntal.
www.penguin-verlag.de
Die Arbeit an diesem Roman wurde gefördert durch die Bayerische Akademie des Schreibens, das Ludwig-Harig-Stipendium und das Münchner Arbeitsstipendium. Die Autorin dankt für die Unterstützung.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Marion Blomeyer/Lowlypaper, München
Umschlagabbildung: © »Lost in Thought« by David Storey
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28377-3V003
www.penguin-verlag.de
»Was wissen wir von unseren Eltern? Nicht viel. Und von unseren Großeltern? Noch viel weniger.«
Julien Green
Je les ai lues, Grand-papa
Im schmalen Trinkglas spitzen die Kerne von Grand-papas Mirabellen zur Wasseroberfläche, als zeigten sie an, wohin sie wollen. Kleine Blasen haben sich an ihren Rändern gebildet, Kronen aus Perlen der Luft. Ich nehme die Kerne heraus, braun und runzlig, manche ein wenig glitschig auch. Ich trage sie in den Garten meiner Eltern, und die Morgensonne schickt ihre schwachen Strahlen in meine Richtung.
Noch ein paar Schritte, dann stehe ich an der Stelle, an der früher der Teich mit den Goldfischen gewesen ist. Ich erinnere mich, wie ich einmal an einem schläfrigen Wintertag an ihn herangetreten bin und sich vor meinen Augen das Bild leuchtorangener Tupfen im gefrorenen Wasser auftat. Hübsch sah das aus. Und so stark in seinem Kontrast. Die Fische schienen in ihrer Schwimmbewegung von der Kälte überrascht worden zu sein. Ich konnte den Moment sehen, in dem ihr Leben festgehalten wurde, mitten im Fluss. Das machte ihren Tod für mich erträglich, zu etwas Besonderem auch. Jahre später kam der Teich weg. Die Enkelkinder könnten hineinfallen und ertrinken, das wollten meine Eltern nicht verantworten. Also wurde die Grube zugeschüttet – und der Klee wuchs.
Jetzt knie ich am Boden. Leicht dringt die Gartenschaufel in den dunklen Grund, in den ich behutsam einen Mirabellenkern nach dem anderen lege und wieder mit Erde bedecke. Ich bleibe noch eine Weile davor stehen, senke den Kopf, feucht ist die Luft. Während meine Gedanken an meinen Großvater zu Boden fallen, erhebt ein Hausrotschwanz sein raspelndes Gezwitscher von seiner Singwarte im Tulpenbaum aus. Der Tag beginnt.
1 DER FUND
Herbst 2021: Ich bin mit meinen Kindern zu Besuch bei meinen Eltern in ihrem Haus am Münchner Stadtrand. Mein Vater ist irgendwo mit meinem Sohn unterwegs. Meine Tochter will lieber bei mir und meiner Mutter bleiben. Sie spielt, wo sie am liebsten spielt: im Treppenaufgang, der einmal als Wintergarten gedacht war. Das viele Glas spricht dafür. Auch der Ausblick auf die Fliederhecke, den Magnolienbusch und auf den groß gewachsenen Tulpenbaum, dessen letzte goldgelbe Blätter sich in das träge Grau des Tages brennen.
Dass es der Treppenaufgang dennoch nie zum Wintergarten geschafft hat, liegt an seiner Temperatur: im Sommer heiß wie ein tropisches Gewächshaus, im Winter so kalt, dass er als Kühlkammer genutzt wird. Pflanzen beherbergt der Aufgang jedenfalls keine. Dafür jede Menge Selbstgetöpfertes und diverses Strandgut, das irgendjemand aus der Familie irgendwann einmal von irgendeinem Urlaub mitgebracht und dort abgeladen hat. Dieser Raum bietet sich dafür an. Er ist ein Zwischenort, an dem niemand lange bleibt und der trotzdem oft betreten wird, um vom Elternbereich im Untergeschoss in den früheren Kinderbereich im Obergeschoss zu gelangen.
Meine Tochter fühlt sich wohl zwischen den Geschossen. Hier kann sie immer etwas Neues entdecken. Sie muss nur eines der Figürchen oder Müschelchen oder Steinchen aus einem der Töpfchen heben, schon kommt darunter ein neues Figürchen oder Müschelchen oder Steinchen hervor, das in diesem Museum der Vergangenheiten in Vergessenheit geraten ist.
Ich liege auf dem Sofa im Wohnzimmer und genieße die Ruhe, bis sie mir verdächtig vorkommt. Ich stehe auf, um nach meiner Tochter zu sehen. Sie sitzt zufrieden auf dem Boden und hat ein bordeauxrotes Behältnis zwischen ihre Beine geklemmt. Ein kleiner, silberner Deckel liegt neben ihr wie ein Kreisel. Ich beobachte, wie sie voller Neugier in das Gefäß langt, von dem ich mich frage, was es ist. Es ist keine Vase, aber auch kein Blumentopf, scheint irgendetwas dazwischen zu sein. Als meine Tochter die Hand wieder hervorzieht, betrachtet sie kurz ihre Finger, dann schleckt sie sie ab. Ich renne zu ihr, weil ich fürchte, Fischfutter oder pulverisierter Teichschlammentferner könnte gerade auf ihrer Zunge zergehen. So etwas lagerte früher einmal im Treppenaufgang. Ich greife nach ihrer Hand, schaue sie mir an, rieche auch an ihr. Doch da ist nichts. Ich freue mich über das Nichts, denn Nichts bedeutet nichts Giftiges, keine Gefahr. Erleichtert nehme ich das Behältnis hoch, dünnwandig und aus Metall. Die Öffnung ist klein. Ich blicke in ein dunkles Loch, dann drehe ich das Gefäß um. Staub rieselt zu Boden, so fein und so wenig, dass er sich auf dem kurzen Weg bis zu den Fliesen in Luft aufzulösen scheint. Ich hebe auch noch den Deckel auf, der offensichtlich zum Behältnis gehört, und lese, was darauf graviert steht:
Anatole Frey
11 novembre 1918 – 13 mai 2004
Sofort sind meine Finger im Mund meiner Tochter. Ich fahre über ihre Zunge, als könnte ich tatsächlich noch etwas von der Asche meines Großvaters entfernen. Ich weiß, dass es sinnlos ist, das zu tun, weil die Asche – oder soll ich sagen er? – schon in ihrem Speichel aufgegangen sein muss und sie ihn hinuntergeschluckt hat. Trotzdem wische ich ihren Mund weiter aus. Sie sträubt sich nicht. Im Gegenteil. Sie macht mit. Sie spürt meine Aufregung, ihre Augen groß und fragend. »Alles in Ordnung«, flüstere ich und gebe ihr einen Kuss. Dann klemme ich sie mir wie eine Zweijährige auf die rechte Hüfte. Die Urne trage ich links. Ich mache mich auf die Suche nach meiner Mutter. Ich will wissen, was die Urne ihres Vaters hier verloren hat und wo seine restliche Asche ist. Und überhaupt: Wie kann es sein, dass meine Mutter, die nie ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatte und keine Träne vergoss, als er starb (das sagte sie mir einmal) – wie kann es sein, dass ausgerechnet sie seine Urne behielt, wenn auch leer? Und wieso weiß ich davon nichts?
Meine Mutter schneidet in der Küche Äpfel zu Schnitzen. Ich stelle die Urne vor ihr ab und meine Tochter auf den Boden.
»Was ist los?«, fragt sie.
»Das ist los«, sage ich und klopfe auf die Urne. »Deine Enkelin hat davon genascht.«
Meine Mutter runzelt die Stirn, nimmt das Gesicht meiner Tochter zwischen ihre Hände, lächelt. »Schmeckt staubig, oder?«
Meine Tochter nickt.
»Nicht schlimm«, sagt meine Mutter und hält ihr ein Stück Apfel hin. »War sowieso nichts mehr drin«.
»Wieso eigentlich?«, frage ich.
»Weil wir seine Asche im Wald verstreut haben, in der Nähe von Ammerschwihr. Mein Vater hat es so gewollt.«
»Warum war ich nicht dabei?«
Sie nimmt das Messer in die Hand, teilt einen weiteren Apfel in zwei Hälften. »Er wollte leise gehen«, sagt sie. »Ohne eine richtige Beerdigung. Mir war das recht. Ich brauche keinen Ort zum Trauern, das weißt du. Und jetzt stell das Ding weg, ich habe sonst nicht genug Platz für das Obst.«
2 ANGSTWOLKE
Ich muss gestehen: Mein Großvater war mir nie wichtig. Genauso, wie ich ihm nie wichtig war – dachte ich zumindest, lange Zeit. Er starb, als ich siebenundzwanzig Jahre alt wurde. Dennoch kannte ich ihn kaum. Das heißt, ich kannte ihn schon. Immerhin fuhren wir meine gesamte Kindheit und Jugend über in den Pfingstferien nach Frankreich, um ihn und meine Grand-mi zu besuchen, wenn auch nur kurz. Aber wir entwickelten keine Beziehung zueinander. Zu viel stand dem entgegen. Er war der gefürchtete Vater meiner Mutter, über den ich viele Geschichten hörte, nur keine guten. Vor allem war er der Grund für die dicke, dunkle Wolke, die sich jedes Mal über ihrem Kopf zusammenbraute, wenn er zugegen oder wenn von ihm auch nur die Rede war. Diese Wolke nahm meiner Mutter das Licht. Und damit auch mir. Das gefiel mir nicht. Ich wollte, dass meine Mutter glücklich ist, so wie jedes Kind möchte, dass seine Mutter glücklich ist, um selbst glücklich zu sein.
Als Kind hatte ich Angst vor Grand-papa.
Es gibt ein Foto von dieser Angst. Da sitzt mein Großvater im Wohnzimmersessel meiner Eltern und hat seine langen Beine übereinandergeschlagen. Auf seinen Knien liegt das Fotoalbum, das meine Eltern mit Aufnahmen von meinen ersten Lebensjahren gefüllt haben. Ich stehe in Latzhose und Nickipullover hinter dem Sessel, schaue Grand-papa über die Schulter und in das Album hinein. Die Finger habe ich im Mund. Man könnte meinen, so ängstlich, wie ich gucke, mit beinahe schmerzverzerrtem Blick, und dazu an meinen Nägeln kaue, obwohl ich nie Nägel gekaut habe, müssten die Fotos in meinem Album Schreckliches zeigen. Was sie aber nicht tun. Da sind nur mein älterer Bruder zu sehen, den ich vergötterte, ich vergöttere ihn bis heute, und ich: Geburt, Geburtstagsfeiern, Kindergarten, Fasching und so weiter. Doch in meinem fünfjährigen Kindergesicht kann ich keine Freude über die festgehaltenen Momente meines Lebens ablesen, sondern das Unbehagen, das meine Mutter plagte, weil ihr Vater da war. Dieses Unbehagen hat sie an mich weitergegeben. Oder ich habe es von ihr übernommen. Oder beides zusammen. Auf dem Foto jedenfalls ist es ganz deutlich zu sehen. Es hat sich in meine Augen gesetzt wie ein fremdes Wesen. Und schaut aus mir heraus.
3 DAS BLAUE BUCH
Am nächsten Morgen bin ich früh auf, wie üblich, seit die Kinder auf der Welt sind. Über Nacht hat es unerwartet geschneit. Ich schaue aus dem Fenster und in den Garten. Die Äste der einzäunenden Sträucher und des Tulpenbaums tragen Hauben. Doch es ist kein Schnee, der lange liegen bleiben wird. Für ein paar Stunden aber wird sich die Schneestille mit der Hausstille decken, denn ich bin allein. Meine Eltern haben die Kinder mit zum Einkaufen genommen, damit ich die Zeit sinnvoll nutzen kann, wie sie sagen. Es ist ein Angebot, das sie mir so oft es geht machen. Ich frage mich, wofür ich die Zeit sinnvoll nutzen könnte. Schon lange weiß ich nicht mehr, wie das geht. Zeit zu haben überfordert mich. Ich kann mehr mit ihr anfangen, wenn ich keine habe. Dann funktioniere ich. Mit Zeit funktioniere ich nicht. Mit Zeit bin ich haltlos.
Im Haus ist es hell. Das liegt am vielen Glas der bodentiefen Fenster. Aber auch am Schnee. Beides kalt. Beides schön.
Ich mache mir einen Kaffee. Ich mag es, wenn die Tasse meine Hand wärmt, bevor ich trinken kann.
Im Wohnzimmer bleibe ich vor dem Bücherregal stehen, das die gesamte Wand einnimmt. Dort habe ich am Nachmittag zuvor Grand-papas Urne hineingestellt. Es kam mir falsch vor, sie wieder zurück in den Treppenaufgang zu tragen. Unwürdig auch.
Das Behältnis macht sich gut im Regal. Es schmiegt sich ein, ist kein Fremdkörper. Es hat die gleiche Farbe wie die lackierten Bretter und könnte auch ein Pokal für eine vollbrachte Leistung sein.
Als Kind habe ich oft Stunden vor diesem Regal verbracht. Damals gab es einen Lesesessel, bespannt mit einer Art Nylonstoff, der lange Zeit einen unangenehm künstlichen Geruch verströmte. Trotzdem zog es mich immer wieder zu ihm hin. Einfach weil ich es liebte, vor einer Wand zu sitzen, die aus von Menschen geschaffenen Welten bestand. Ich musste nur zugreifen, um in eine von ihnen abzutauchen.
Meistens nahm ich eines der deutschen Bücher rechts im Regal heraus, selten eines der französischen auf der linken Seite. Meine Mutter hatte diese Einteilung vorgenommen, und ich hatte ihr dabei geholfen.
Seit Jahren habe ich die Trennung der Bücher in beide Sprachen nicht mehr wahrgenommen. Ungefähr so, wie ich den französischen Akzent meiner Mutter nicht mehr höre, ihn nie gehört habe. Ich werde nur dann auf ihn aufmerksam, wenn mich jemand auf ihn anspricht und fragt, ob meine Mutter zufällig Französin sei.
Ja. Zufällig. Diese Ungenauigkeit trifft es genau.
Irgendwo in diesem Regal, das weiß ich, befinden sich Grand-papas Memoiren. Ich war gerade fünfzehn geworden, als er mir mein Exemplar übergab. Aber damals war mir das, was er über sein Leben zu sagen hatte, egal. Außerdem traute ich mir so viele Seiten auf Französisch nicht zu.
Vielleicht wäre mir sein Leben auch für immer egal geblieben, wenn meine Mutter seine Urne nicht aufbewahrt und meine Tochter sie nicht gefunden hätte. Die Tatsache allerdings, dass meiner Mutter wohl doch irgendetwas an ihrem Vater liegen muss (so meine Interpretation), verändert viel für mich. Denn bis heute habe ich ihren emotionalen Abstand zu ihm als den für mich vorgegebenen eingehalten. Ich habe die Linie, die sich wie eine Grenze durch unsere Familie zieht, nicht übertreten, um meine Mutter nicht zu verletzen. Oft genug, das wusste ich aus ihren Erzählungen, war sie schon von ihm verletzt worden, und nicht erst, seit sie achtundzwanzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs meinen Vater geheiratet hatte – einen Deutschen, den Feind, wie mein Großvater ihr vorwarf.
Der erste Schluck Kaffee tut gut. Ich trinke und suche – und entdecke passenderweise genau an der Stelle im Regal, an der Frankreich auf Deutschland trifft, den Namen meines Großvaters.
Anatole Frey, Mémoires d’un septuagénaire. Goldene Buchstaben, ein schmaler, königsblauer Band. Ich fahre mit dem Finger über den Buchdeckel der Memoiren eines Siebzigjährigen, schließe die Augen, spüre der Struktur des Stoffs nach und der Prägung der Lettern. Etwas Feines hatte sich mein Großvater da ausgesucht, Gold und Leinen, für zweihundertzweiundfünfzig Seiten Leben. Zweihundertzweiundfünfzig Seiten Erinnerungen. Zweihundertzweiundfünfzig Seiten, auf denen er erzählen wollte, wer er ist.
Ich blättere auf die erste Seite. AnNatalie Geneviève steht da in akkurat geschwungener Schrift, schwarze Tinte. Und darunter:
Ich hoffe, daß du sie eines Tages lesen kannst und auch lesen wirst, diese Mémoires. Später, wenn es einmal in dir und um dich ruhiger geworden ist!
Dein Grand-papa,
Juni 1991
»In dir und um dich ruhiger«, sage ich laut und wundere mich, dass er mir die Widmung ausgerechnet auf Deutsch schrieb, der Sprache, die ihm so verhasst war. Es kommt mir vor, als wollte er sichergehen, dass ich auch verstehe, was er mir sagen will.
Ich habe keine Ahnung, welche Unruhe er damals meinte und wie er auf die Idee kam zu glauben, es könnte in mir und um mich unruhig sein. Wir sahen uns zu selten für eine solche Behauptung. Und wenn wir uns sahen, dann redeten wir kaum miteinander. Wieso also richtete er diese Zeilen an mich? Dachte er in dem Moment vielleicht an seine eigene Unruhe als Jugendlicher? Ich selbst war wahrscheinlich so unruhig wie viele Fünfzehnjährige. Mehr aber als unruhig war ich verdruckst, versteckte mich hinter meinen Haaren, Vorhang zu.
Ich habe auch keine Ahnung, ob es je ruhig in mir und um mich werden wird, ob das überhaupt geht im Leben.
4 KÄLTE
Über meinen Großvater schreiben heißt, über einen Verschlossenen schreiben – und über einen Unbekannten. Mir sind keine Situationen in Erinnerung, in denen ich mich ihm gegenüber unbefangen gefühlt habe. Kein Besuch, kein Telefonat, keine Grußkarte brachten uns einander näher. Und wenn über ihn geredet wurde, dann waren es eben Erzählungen, die seine Kühle und Strenge unterstrichen und seine angebliche Unfähigkeit zu lieben oder Empathie zu zeigen. Eine dieser vielen Erzählungen steht mir bis heute so klar vor Augen, als wäre ich selbst dabei gewesen, ja, als wäre ich selbst meine Mutter gewesen. Ich sah, was sie sah. Ich hörte, was sie hörte. Ich zitterte, als sie zitterte. Ich ekelte mich, wie sie sich geekelt hatte.
Ich halte ihre kleine Hand, als sie mit ihrem Vater an einem heißen Maitag im Jahr 1954 durch den Parc Salvator in Mulhouse spaziert. Sie trägt ein knallgelbes Kleid, das in seiner Strahlkraft mit der Sonne konkurriert und immer sonntags aus dem Schrank geholt wird. Ihre Schuhe glänzen und machen ein klackerndes Geräusch auf dem Asphalt, was mir gefällt. So kann ich jeden ihrer Schritte hören und mir sicher sein, dass es sie gibt. Auch meine Mutter mag, wie die Steine auf den Wegen im Park unter ihren glatten Sohlen knirschen. Trotzdem wünscht sie sich nach Hause, Tür zu. Grund sind die Maikäfer, die in diesem Jahr die reinste Plage sind. Fürchterliche Angst hat sie vor diesen Insekten, die aussehen wie fette Datteln mit Flügeln und Fühlern und Widerhaken an den Beinen, und ich verstehe das. Auch mir graut es vor dem Anblick, wenn sich die Luft wegen ihnen bräunt.
Mein Großvater geht uns voraus. Er steuert auf die Wiese mit den Kastanienbäumen zu, zwischen denen die Käfer besonders gerne fliegen. Meine Mutter bleibt stehen, fleht ihn an, einen anderen Weg einzuschlagen, bitte, bitte, doch er hebt nur streng den Zeigefinger, zeigt vor sich auf den Boden, hierher sollen wir kommen, mitten unter die Tiere, die er mit der anderen Hand aus seinem Gesicht fegt. Ils ne font rien! – Die machen doch nichts! Er duldet keine Widerrede, kein Theater, wir haben zu gehorchen. Also versteckt meine Mutter ihr Gesicht hinter beiden Handflächen und blinzelt zwischen den Fingern hindurch, um zu sehen, wohin sie ihre glänzenden Schuhe setzt. Ich mache es ihr nach. Das Kitzeln meiner Wimpern auf der Haut ist jedes Mal ein kleiner Schock, es könnten die Beinchen der Käfer sein oder deren fächerartige Fühler. Ich kneife wie meine Mutter den Mund zusammen, halte die Luft an, damit bloß keiner hineinfliegt. Als wir fast auf seiner Höhe sind, verfangen sich zwei der Tiere in ihrem Haar. Meine Mutter schreit auf, schüttelt sich wie von Strom berührt, bittet ihn unter Tränen, sie von den Käfern zu befreien. Doch mein Großvater steht nur da und lacht uns aus, ils ne font rien!
5 SPURENSUCHE
Eingeklebt auf der zweiten Seite der Mémoires ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ein Profi hat sie aufgenommen, in einem Studio. Die Porträtaufnahme sieht aus wie mit Pastellkreide gemalt, weiche Konturen, die zu den Rändern hin ausfransen, leicht rauchig. Der Hintergrund ist von einem hellen Grau, während sich dunklere, schraffierte Schatten um das Konterfei des jungen Mannes abzeichnen, der mein Großvater ist, noch bevor er es war.
Ich streiche mit dem Finger über sein ovales Gesicht, die buschigen Augenbrauen, die gerade Nase, den geschlossenen Mund, schaue ihm tief in die Augen. Kurz habe ich die absurde Idee, mein Großvater könnte das spüren. Ich glaube eine Veränderung in seinem Blick zu erkennen, so als würden Gedanken hinter seiner hohen Stirn vorbeiziehen oder als würde er mir etwas sagen wollen.
Ich frage mich, wie alt mein Großvater auf dem Foto ist. Er sieht aus wie Anfang dreißig, doch wahrscheinlicher ist, dass sein zwanzigster Geburtstag zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht allzu lang hinter ihm lag. Schon oft habe ich die Beobachtung gemacht, dass Menschen auf Fotografien von früher älter wirken, als sie es tatsächlich waren.
Ich lege meine rechte Hand auf seine Stirn, verdecke seine nach hinten gekämmten Haare und den geraden Haaransatz. Ohne diese akkurate Frisur wirkt er sofort jünger, und ich beschließe, dass er auf dem Foto nicht älter als einundzwanzig Jahre alt ist.
Ich lege auch noch meine linke Hand unter sein Kinn, sodass weder Hemd, Krawatte noch Sakko zu sehen sind, nur die Wangen, das Kinn mit dem Grübchen und die Augen, die sich in ihrer stechenden Klarheit von den weichen, pastelligen Konturen abheben.
Das Gesicht, in das ich nun blicke, könnte eines von heute sein. Ich könnte es beim Italiener um die Ecke sehen, an der Kasse im Supermarkt, in der U-Bahn, am Kiosk im Park. Es könnte zu einem der jungen Väter mit Käppi gehören, die ihre Töchter und Söhne vom Kindergarten abholen und eine Menge Kraft in den tätowierten Oberarmen haben.
Einundzwanzig. Erwachsen, ja, und doch nah dran an dem Kind, das er wenige Jahre zuvor noch gewesen war. Ich rechne. Es muss also 1939 gewesen sein, als mein Großvater zum Fotografen ging. Für wen war dieses Porträt gedacht? Und wofür? Pass? Bewerbung? Geschenk? Wo wurde es aufgenommen? Was dachte mein Großvater, als er in die Kamera schaute? Hoffentlich ist der Fotograf das Geld wert? Ich möchte gut aussehen? Wer weiß, vielleicht ist es das letzte Foto von mir und wird auch mein Sterbebild sein? Schließlich brach gerade der Zweite Weltkrieg aus, und die Folgen des Ersten Weltkriegs, der am Tag seiner Geburt geendet hatte, waren noch lange nicht überwunden.
Ich blättere vor in seinen Mémoires, orientiere mich an den vielen Daten, die auf jeder Seite zu finden sind, dafür kaum ein Wort darüber, wie es ihm in dieser Zeit erging, was seine Gedanken waren, seine Hoffnungen, seine Träume. Der Ton ist überwiegend sachlich, was mich nicht überrascht. Grand-papa gehörte einer Generation an, in der nicht viel Aufhebens um Gefühle gemacht wurde. Man zeigte sie nicht, redete auch nicht über sie. Ganz anders als heutzutage, wo das Artikulieren der eigenen Gefühle einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat.
Mit Gefühlen kann ich nicht, soll er auch einmal zu meiner Mutter gesagt haben, als sie ihn darum bat, in einem Streit zu vermitteln.
Ich frage mich, ob mein Großvater etwas dagegen hätte, dass ich seine nüchternen Fakten mit meinen Fantasien mische, weil ich nicht anders kann, als ihm, der mir etwas hinterlassen wollte, was Bedeutung für mich habe, ein Leben anzudichten, von dem ich wünschte, er hätte davon erzählt.
Und so halte ich beim 29. November 1939 inne, dem Tag, an dem er zum französischen Militär einberufen wurde. Ich folge ihm nach Poitiers, einer Kleinstadt im Westen des Landes im Département Vienne, wo er zum Offizier der Artillerie ausgebildet werden soll. Von seiner Unterkunft am höchsten Punkt der Stadt nahe der Bronzestatue Notre-Dame des Dunes sehe ich ihn die vielen Treppen in die Altstadt hinabsteigen, um seine Wäsche zum Waschen zu bringen. Oft nimmt er zwei Treppenstufen auf einmal. Er schreitet in die Stadt. Er fühlt den Aufbruch in sich, seine Entschlossenheit. Er kann etwas erreichen, etwas werden, ein guter tapferer Soldat sein. An der Ecke, unweit der Laverie, entdeckt er das Schild eines Fotografen. Er fährt sich durchs Haar, vielleicht denkt er, da gehe ich später hin, wenn ich fertig bin, jetzt muss ich los zur Übungsanlage, es eilt.
Er ist schlank und groß und sportlich und froh, eine Aufgabe zu haben, die ihm sinnhaft erscheint. Auch ist er stolz, genau an dem Ort militärisch ausgebildet zu werden, an dem Karl Martell im Jahr 732 die muslimischen Araber auf ihrem Vormarsch nach Gallien stoppte.
Auf dem Feld lernt er mit einer Canon de 75 das Schießen. Ich habe keine Ahnung, was eine Canon de 75 ist. Ich stelle mir darunter ein Gewehr vor und finde heraus, dass es sich dabei um ein leichtes französisches Feldgeschütz handelt, das sowohl im Ersten als auch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Einsatz kam und im Vergleich zu früheren Waffen dieses Kalibers dank eines Schnellfeuerverschlusses leicht zu bedienen war.
Ich sehe mir Bilder der Canon de 75 an, auch Videos. Ein leichtes Feldgeschütz, denke ich, während ich das Monstrum von Waffe betrachte mit seinem langen Rohr, den großen Rädern und dem heftigen Rückstoß. Damit hat er also das Schießen gelernt. Auch das Töten?
Mein Großvater hebt eine Sprenggranate hoch, steckt sie in die Öffnung, verschließt sie wieder. Es geht viel leichter, als er gedacht hat. Das Feuer entzündet einer seiner Kameraden. Sie arbeiten zusammen, zu ihrem eigenen Schutz und weil das Nachladen und Abfeuern so schneller geht. Er mag seine Ausbildung. Abwechslungsreich ist sie und fordernd. Erst ist er auf dem Feld, dann übt er Morsezeichen, dann heißt es weiter aufs Pferd. Ihm wird ein schwarzes zugeteilt, ein richtiger pur-sang. Ich staune, wie energisch dieser junge Mann ist, den ich später, als seine Enkelin, als steif und befangen erlebe, wie er seine Muskeln anspannt, um sich im Sattel des Vollblüters zu halten. Der Wind zerstört seine Frisur. Er hatte sie extra mit etwas Zuckerwasser festgemacht. Süßer Schweiß läuft über seine Stirn. Ich spüre seiner Energie in der Textpassage nach, kann das rasche Klappern seiner Finger auf der Tastatur der Schreibmaschine hören, als er Jahrzehnte später seine Mémoires verfasst, das Klingelgeräusch, das sie macht, wenn er in die nächste Zeile wechselt wie im Rausch.
Voilà du vrai sport, notiert er, richtiger Sport.
»Von wegen, du kannst das rasche Klappern seiner Finger auf der Tastatur hören«, sagt meine Mutter. »Nicht mein Vater hat die Mémoires getippt. Es war deine Grand-mi. Sie konnte wahnsinnig schnell tippen, sogar Steno. Das solltest du korrigieren.«
6 IRRTUM
Ich dachte immer, Grand-papa sei Elsässer gewesen. Colmar war die Stadt, in die wir fuhren, um ihn und meine Grand-mi zu besuchen.
Ich kann mich nicht erinnern, je in ihrem Haus in der Rue de Katzenthal übernachtet zu haben. Aber ich erinnere mich an den Mirabellenbaum in ihrem Garten und wie mein Großvater mir einmal die kleinen reifen, orangegelben Früchte von dem Baum pflückte.
Ich erinnere mich auch, wie die Kerne später in meiner Hosentasche gegen meine Beine drückten und ich es kaum erwarten konnte abzufahren, um sie bei uns daheim in München einzupflanzen, damit wir auch so schöne Früchte bekämen. Vor allem aber, damit sich endlich die dicke, dunkle Wolke über meiner Mutter verzog.
Mein Großvater kam jedoch in Lothringen zur Welt, in Kapellenhof. Es ist das erste Mal, dass ich davon erfahre.
Ich gebe den Namen des Weilers in meinen Laptop ein. Sieben Grad Celsius, stark bewölkt wird mir angezeigt. Nicht viel anders als hier, denke ich und sehe mir die Landkarte auf meinem Bildschirm genauer an. Viel Grün, kaum besiedelt. Ein paar Straßen, nur eine davon hat einen Namen, Rue de Petit Réderching. Ich könnte die Häuser links und rechts der Straße zählen, so wenige sind es, lasse es aber sein. Stattdessen klicke ich auf Street View und befinde mich nun im Juni 2019, dem Sommer, in dem die Satellitenbilder aufgenommen wurden. Ein heißer Tag. Das viele Grün der Landkarte entpixelt sich zu Feldern, Wiesen, Wäldern. Keine Wolke steht am Himmel, es scheint windstill zu sein.
Kurz schließe ich die Augen, höre Insekten brummen, rieche den Wald, lausche den Geräuschen meiner Vorstellung, während die Wintersonne durch das Fenster auf meinen Schreibtisch und in mein Gesicht scheint.
Dann begebe ich mich in die Rue de Petit Réderching, auf der ich mit jedem weiteren Klick ein paar Meter vorwärtskomme. Armchair Travelling in eine fremde Vergangenheit, denke ich, und wie scheinbar einfach es ist, mehr als hundert Jahre nach der Geburt meines Großvaters von meinem Schreibtisch aus seine Herkunft zu erkunden.
Die Straße steigt an, dann das Ortsschild, fast hätte ich es übersehen. Dahinter, erst auf der rechten, dann auf der linken Seite, ein paar Häuser aufgereiht. Vielleicht lebte er in diesem Haus, vielleicht aber auch in dem angrenzenden. Es könnte jedes sein.
Ich durchquere den Weiler in westlicher Richtung, bis ich das letzte Gebäude hinter mir gelassen habe, drehe schließlich um. Auf dem Rückweg sehe ich mir nun jedes Haus genauer an. Vor einem Gebäude, das sich kurz vor dem Ortsausgang befindet, bleibe ich länger stehen, weil es die gleichen nach unten gewölbten Fenstergitter hat wie das Haus meiner Großeltern in der Rue de Katzenthal. Es ist ein banales Detail, doch eines, das mir bekannt vorkommt. An irgendetwas muss man sich ja festhalten. Und warum nicht am Banalen? Wer weiß, vielleicht hatte mein Großvater diese Fenstergitter für sein erstes eigenes Zuhause ausgesucht, weil sie ihn an sein Elternhaus erinnerten? Oder waren diese Gitter einfach nur typisch für eine gewisse Zeit?
Ich rufe meine Mutter an, frage nach, obwohl ich keine Antwort von ihr erwarte. Es gefällt ihr nicht, dass ich Grand-papas Mémoires lese und Fragen habe. Noch weniger gefällt ihr, dass ich mich auf seine Spuren begebe. Sie versteht nicht, weshalb ich mich ausgerechnet für das Leben ihres Vaters interessiere, der sich ihrer Meinung nach nie für sie interessiert hat und auch nicht für uns. Sie will nichts wissen. Auch nichts vom Banalen. Trotzdem frage ich sie, wie das Haus ausgesehen hat, in dem Grand-papa geboren wurde. Ich spüre ihr Achselzucken durchs Telefon hindurch. Ich erkläre ihr Street View, überzeuge sie, mir für einen Moment zu folgen. Am Ende siegt ihre Neugierde. Sie klickt sich ebenfalls in die Rue de Petit Réderching und führt mich endlich zu dem Haus, in dem mein Großvater seine Kindheit verbrachte und meine Mutter gelegentlich die Ferien. Es ist tatsächlich das Haus mit den gewölbten Fenstergittern.
Ha!, sage ich und schaue zu dem Porträt meines Großvaters auf, das ich in der Zwischenzeit abfotografiert und im Drogeriemarkt aus dem Automaten gelassen habe. Es hängt nun an der Wand über meinem Schreibtisch, auf Augenhöhe.
»Übrigens«, sagt meine Mutter, »habe ich die Mirabellenkerne damals in deinen Hosentaschen gefunden. Du hattest sie vergessen. Als ich sie dir brachte, hast du sie genommen und weggeworfen. Das solltest du vielleicht der Vollständigkeit halber erwähnen.«
7 HERKUNFT 1
Das Haus sieht gepflegt aus. Es ist renoviert worden. Dort, wo die gewölbten Fenstergitter sind, war früher der Stall für die Ziegen gewesen, rechts daneben der für die Kühe. Um in den Kuhstall zu gelangen, musste ein großes schweres Tor zur Seite gerollt werden, sonnenverbrannt sein Holz. Über den Ställen befand sich die Scheune. Dort lagerte das Heu, dessen süßliche Würze bis in den Wohnbereich hineinduftete und sich mit dem sauren Stallgeruch vermengte. Die Küche war über ein paar wenige Stufen an der Seite des Hauses zu erreichen. Sie grenzte an die gute Stube, in der immer ein paar Fliegen um die Lampe über dem Esstisch kreisten.
Das Schlafzimmer meiner Urgroßeltern Joseph und Gersande lag direkt über dem Kuhstall mit Blick auf die Straße. Sie konnten hören, wenn sich die Tiere in den Ställen bewegten und mit den Ketten an den Haltegestängen rüttelten. Eine niedrige Tür trennte ihr Schlafzimmer von der Kammer meines Großvaters. Sie war der kleinste Raum, aber der ruhigste. Durch sein Fenster konnte er auf die vielen Mirabellenbäume hinter dem Haus und auf die Felder blicken, Anatole war ihr einziges Kind.
Auf die Toilette ging es nach draußen, in das Nebenhäuschen. Es ist ebenfalls renoviert worden und scheint bewohnt zu sein. Die Tür steht offen und gewährt trotzdem keinen Blick ins Innere, zu dunkel. Früher war dort der Waschraum gewesen mit Bottichen aus Holz und Zinn, Waschbrettern und mehreren Leinen, die von der einen zur anderen Seite des Raumes gespannt waren. Es roch nach Seifenlauge, frisch und sauber.