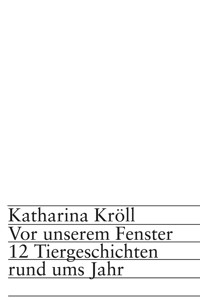8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sele, Psychologin, gut situiert, verheiratet, drei Kinder, eigensinnig, emotional, spontan, entflieht einem als schal empfundenem Leben. Es wird eine Reise zu sich selbst. Wie Sele einmal sagt: »Was weißt du schon, wer ich bin und was zu mir passt. Ich weiß es selbst nicht. [...] Was weiß ich, wer ich alles bin, wenn ich es überhaupt nicht ausprobieren kann.« Ihre Suche führt sie über New York, wo sie eine seltsame Malerin kennen lernt, nach Afrika in ein »Gesundheitsdorf«, gegründet und geleitet von dem amerikanischen Arzt Neil. Dieser Neil ist ein eigenartiger Mensch. Sanftmütig, in sich ruhend, mit eigenwilligen Ansichten über Krankheit und das Leben an sich, mit einer Ausstrahlung, der sich Sele nicht entziehen kann. Und dann kommt sie wieder zurück, und einige Überraschungen warten auf sie. Ausgerechnet sie muss einen Vortrag zum Thema »Treue« halten. Was sagt sie ihren Zuhörern im Lichte der Erkenntnisse, die sie gewonnen hat? Die Autorin scheut sich nicht, die ganz großen Fragen zu diskutieren und mit ihnen in griffigen Bildern zu spielen: Was ist Liebe? Kann man auch mehrere Menschen zur gleichen Zeit lieben? Was ist Sexualität? Muss sie immer im Bett enden? Und was ist das überhaupt: das Leben? Harter Stoff, eingebettet in eine temporeiche Handlung mit überraschenden Wendungen, getragen von Figuren, die auf ihrer Individualität beharren. Wie man beides von der Autorin kennt. Vielleicht ihr eindringlichstes Buch. Ganz sicher aber das wagemutigste, weil es alle überkommenen Vorstellungen sprengt, mit ihnen spielt und das auch thematisiert. Eine Vision vom glücklicheren, besseren Leben. Wenn da nicht diese festge-fahrenen Konditionierungen wären ... Der Autorin gelingt, was nur Literatur kann: einen Kosmos zu erschaffen, der den Leser verstört zurück lässt, weil es keine einfachen Lösungen gibt. Vielleicht gibt es sie, wir sehen, wir verstehen sie nur nicht? Ein atemberaubendes Buch, trotz der Leichtigkeit, mit der es geschrieben ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Katharina Kröll
Großfamilie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Anfang
Sele in New York
Die Farbe Rosa
Afrika
Gesundheitsdorf
Gefleckt
Freunde
Sannah und Sele
Dornröschen
Mühelos
Sele, Neil und die Konditionierung
Konzert
Haut
Neil’s Peak
Abschied
Passiv
Daheim
Jean
Zu dritt
Essen bei Conrad
Die richtige Frage
Conrad und die Wüste
Treue
Beine
Geständnis
Entwürfe
Rumpelstilzchen
Falsch/richtig
Léger
Herumwirbeln
Hintergrund
Und wieder New York
Die Autorin
Impressum
Impressum neobooks
Der Anfang
Russland oder Südamerika, überlegte Sele. Sie war entzückt. So etwas läuft einem nicht jeden Tag vor die Füße, dachte sie. Nein, Nordamerika. Australien. Ach komm, halt dich damit nicht solange auf. Du bist gleich da. Gedankenverloren schaute Sele hinaus. Ich könnte auch noch ein Stück weiterfahren, überlegte sie, und dann durch die Fußgängerzone zurücklaufen. Ach was, zähl es an den Knöpfen ab, aber mach weiter. Hab keine Knöpfe. Also: Nordamerika.
Wir reiten durch das weite Land, rote Felsen, tiefe Taleinschnitte, endlose Ebenen, und kein Mensch, soweit das Auge reicht. Nur wir beide. Aber wir haben ein Problem. Wir haben nichts mehr zu essen, und nichts zu trinken. Der Sonnenuntergang ist zwar grandios, aber er kündigt auch die Nacht an, und dann wird es noch schwieriger, etwas Nahrhaftes aufzutreiben, von einem Nachtlager ganz zu schweigen. Er wird einen Bären schießen müssen. Aber es lässt sich kein Bär sehen. Die Lage ist relativ aussichtslos. Und was macht der Typ in so einer Situation? Er hält sein Pferd an, schaut ihr tief in die Augen und sagt mit rauer Stimme: „Baby, ich habe jetzt nur noch eine Sorge: Wo finden wir hier einen guten Platz, auf dem wir uns niederlassen können und ich dich mal ordentlich an mich drücken kann?”
Sele ist nicht zufrieden. Nein, irgendetwas passt nicht zusammen. „Ich hab’s”, denkt sie, „der Bauch. Es ist der leichte Bauchansatz.” Sonst sieht er wirklich wie ein ungestümer Reiter aus, aber die leichte Wölbung über seinem Gürtel zeigt mir zu deutlich die Illusion.
Also, was könnte er sonst sein? Archäologe bei Ausgrabungen im heißen Arabien. Und ich die Archäologin. Wir haben den ganzen Tag in der Erde gebuddelt und am Abend versucht, eine logische Einheit in den Scherbenhaufen zu bekommen. Jetzt ist der grandiose Sonnenuntergang vorüber, und nach der kurzen Dämmerung der tropischen Gebiete ist die Nacht hereingebrochen mit einem glitzernden Sternenhimmel. Und wir beide ganz allein in einem Zelt mitten in der Wüste. Passt da der Bauch besser? Ach was, auch nicht. Der Typ ist zu nichts nütze. Nicht für den wilden Ritt durch Nordamerika und nicht für das Zelt in Arabien.
Sele sieht den Typ noch einmal an. Nach dem ersten Blick, den sie auf ihn geworfen hatte, als er in den Bus gestiegen und sich auf den freien Platz ihr gegenüber gesetzt hatte, war sie angenehm berührt, mehr als angenehm. Solche Typen sieht man selten in den öffentlichen Bussen. Abgesehen davon, dass es ihr auch Spaß machte, ihr Spiel mit den seltsamsten Gestalten zu treiben. Aber der hier war absolut ein Genuss, ein wahres Fest für meine Augen, dachte sie beglückt. Aber, was für eine Enttäuschung, er taugte nichts, nicht für Amerika und nicht für Arabien. Wie kann man bei einem so perfekten Gesicht einen Bauch haben?, dachte Sele. Tja, schade. Dann kann ich ebenso gut gleich an der richtigen Haltestelle aussteigen.
Sie stand auf, und kurze Zeit später hielt der Bus. Als sie durch die Straße bummelte, musste sie lachen. Ein Glück, dass er nichts von ihren Gedanken mitgekriegt hat, dachte sie. Dieses Spiel machte ihr immer wieder Spaß. Allein, um es zu spielen, nahm sie öfters mal den Bus, statt mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Wenn sie nicht viel einzukaufen und zu tragen hatte.
Freilaufende Phantasie nannte sie die Gedankensprünge, die sie zu dem Spiel anregten. Sie stieg in Gedanken einfach in andere Kostüme, andere Gegenden, andere Rollen, und sie war immer angenehm überrascht, wo sie in ihrer Vorstellung schließlich landete. Einfach aus dem Stegreif waren ihr da schon die tollsten Geschichten in den Sinn gekommen, und die schaute sie sich dann an wie einen spannenden, turbulenten Film.
Aber heute hatte es nicht geklappt. Vielleicht hatte sie von dem Typ auch zu viel verlangt. Vielleicht wäre er besser geeignet gewesen als italienischer Fürst aus dem Mittelalter, den seine Geliebte, nämlich sie, Sele, vergiften wollte. Ach, selbst dazu taugt er nicht, dazu ist er viel zu schön. Womit wieder einmal bewiesen ist, dass schöne Männer im Allgemeinen langweilig sind, dachte Sele und schloss damit dieses Kapitel ab.
Sie war mit ihren Einkäufen fertig und setzte sich bei ihrem Lieblingsitaliener auf einen Cappuccino in die Sonne. Manchmal spielte sie ihr Spiel auch, wenn sie im Café saß. Aber heute hatte sie keine Lust mehr, lehnte sich nach hinten und schloss die Augen, während sie ihr Gesicht der Sonne entgegenstreckte. Der Bus, überlegte sie, ist sowieso viel besser, weil nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht, in dem der Film fertig sein muss. Im Cafe gerät man leicht in Gefahr, sich zu verlieren.
Dem Stühle-Scharren neben ihr entnahm sie, dass sich jemand nicht weit von ihr niedergelassen hatte. Sollte es noch so einen Frischluftfanatiker wie sie geben? Die meisten Leute saßen drinnen, weil der Wind kalt war. Sie wollte ihn ignorieren, den Fanatiker, und die Augen einfach nicht aufmachen, aber da sagte er (ja, es war eindeutig ein Er): „Entschuldigen Sie, ich möchte Sie etwas fragen.” Da musste sie ja wohl. Die Stimme klang zudem so, dass sie neugierig war, den Rest zu sehen. Hätte sie vielleicht besser nicht sein sollen, dann der Mann war der Mann aus dem Bus.
Das hatte noch nie jemand gewagt, dachte sie aufgebracht. Und ich habe auch noch nie damit gerechnet. Ruhig, er will dich wahrscheinlich nur nach der Uhrzeit fragen. Sie wollte schon ihren Mantelärmel leicht nach hinten ziehen, um ihre Armbanduhr sehen zu können.
„Haben Sie zufällig eine Schuhbürste dabei?”, fragte er und deutete auf seinen linken Schuh. Der war etwas staubig mit einem Abdruck im Staub, so, als sei ihm jemand zu nahe getreten. Also ich war’s nicht, dachte Sele.
„Eine Schuhbürste? Meinen Sie eine Schuhbürste?”, fragte sie ungläubig.
Er sah sie unschuldig an: „Ja, eine Schuhbürste. Haben Sie keine?”
Sele warf wieder einen Blick auf seine Schuhe. Es waren prachtvolle Schuhe, ohne Zweifel. „Ich sehe ein, dass Sie eine Schuhbürste brauchen. Aber ich habe keine”, sagte sie.
Er hob leicht die Schultern und sagte höflich: „Macht auch nichts.”
Sele schloss wieder die Augen. Dieser Kerl. Der hat mich irgendwie hereingelegt. Am liebsten wäre sie gegangen, aber sie hatte den Cappuccino schon bestellt. Und im Übrigen wollte sie ja einen trinken. Da würde sie sich doch von so einem Kerl nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ob der was gemerkt hat? Sele fühlte sich erheitert. Irgendein Spiel spielt der auch. Ich sollte ihn nach seinem fragen. Aber das erschien ihr dann doch etwas gewagt. Vielleicht braucht er wirklich eine Schuhbürste. Warum hatte sie dann nicht den Mut, ihn danach zu fragen? Sie musste fast über sich selbst lachen. Lag das Abenteuerliche und das Zimperliche so dicht beieinander?
Sele machte sich auf den Heimweg. Der Bus war weg, und der nächste fuhr erst in einer halben Stunde. Ihr Einkaufssack war doch recht schwer geworden, denn am Abend würden sie Gäste zum Essen haben. Also ein Taxi. Im Taxi war sie sicher. Dort würde sie kaum Gelegenheit haben, ihr Spielchen zu spielen. Taxifahrer von hinten sehen meistens nicht sonderlich anregend aus.
Auf der Fahrt zu ihrem Haus überlegte Sele, was passiert wäre, wenn sie dem Schönen auf der Café-Terrasse gesagt hätte, dass sie versucht habe, mit ihm geistige Abenteuer und Liebesnächte zu erleben – das wäre ein schöner Skandal geworden. Wahrscheinlich hätte er mich wegen sittlicher Belästigung angezeigt, dachte sie amüsiert.
Sie lachte leise. Sie liebte das Unvorhersehbare. Und dass er plötzlich auf der Terrasse neben ihr aufgetaucht war, gehörte schon in diese Kategorie. Das regte die Phantasie bereits wieder zu neuen Sprüngen an. Er könnte ja von Seeräubern gefangen, auf eine einsame Insel verschleppt und dort zu einigen Wochen Wasser und Brot verdonnert werden. Das würde das Problem des Bauches lösen. Ja, so war es gut. Sie wäre dann die Alleinumseglerin und würde ihn retten. Dann hätte er keinen Bauch mehr, wäre aber sonst wahrscheinlich auch nicht in sehr passablem Zustand. Also auch nichts. Jetzt geb ich’s auf, beschloss Sele. Mit diesem Typ ist einfach nichts anzufangen.
Das Abendessen war gar nicht übel. Sele kochte gern und meistens auch gut, wenn ihr nicht gerade beim Kochen die Geduld ausging.
„Wir sind ganz unter uns und haben unendlich Zeit und Ruhe”, hatte Sele zu Hella und Conrad bei der Einladung gesagt.
„Die Jungens machen in Frankreich bei ihren Großeltern Ferien, und Phylia ist sehr beschäftigt mit ihrer großen Liebe.”
Conrad schlürfte genüsslich den Wein und fragte dann Sele: „Ist dein Zimmer immer noch leer?”
„Ja, und das wird es wahrscheinlich auch weiterhin bleiben. Ich kann mich nicht dazu überwinden, etwas hineinzustellen oder auch nur Pläne zu machen, wie es einmal aussehen soll. Dieses leere Zimmer ist etwas so Besonderes, ich habe fast das Gefühl der Entweihung, wenn ich daran denke, es vollzustopfen.”
Jean, Seles französischer Ehemann, meinte:
„Da gibt es doch Unterschiede. Zwischen Vollstopfen und Einrichten, meine ich.”
Sele stimmte ihm zu:
„Ja. Und das einzige, was ich einrichten könnte, wäre ein Bild an der Wand. Und zwar denke ich da an ein ganz bestimmtes Bild, das ich letzten Monat in einer Galerie in New York gesehen habe. Ich ärgere mich jetzt, dass ich es nicht gekauft habe. Ich muss nämlich seitdem immer daran denken. Und wenn ich mein leeres Zimmer sehe, hängt vor meinem geistigen Auge dieses Bild an der Wand, sonst nichts. Vielleicht irgendetwas, um sich darauf niederzulassen. Aber bitte kein Designer-Möbel. Die langweilen mich inzwischen total. Weil ich festgestellt habe, das einzige Designermöbelstück, das für mich spannend sein kann, ist eines, das ich selbst gemacht habe. Weil ich es ja für mich brauche, und nur ich allein weiß, welches Möbel meine Wünsche erfüllt.”
Hella kannte Sele gut:
„Und du fährst nach New York, um dieses Bild zu kaufen”, stellte sie fest. Das war keine Frage. Für sie gab es keinen Zweifel. Sie war schließlich seit langer Zeit Seles Freundin.
„So ist es”, gab Sele zu. Jean sah sie, wenn auch mit einer gewissen Nachsicht, so doch einigermaßen erstaunt an. Aber er wusste, es hatte keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren. Ihr zu sagen, dass er das für einen leichten Blödsinn hielt. Blödsinn? Wenn es wirklich ein Blödsinn war. Seles Gedanken wirkten auf ihn immer so ansteckend.
Er könnte es vielleicht für Blödsinn halten. Aber das war seine Entscheidung, wie Sele immer feststellte. Und wenn er Sele so ansah, wie sie unternehmungslustig dasaß und ihre Augen blitzten, dann musste er zugeben, dass es immer noch alternative Betrachtungsweisen für ihre Ideen gab. Und aus denen suchte er sich jetzt die aus, nämlich dass die Idee gar nicht so blöd war. Aber das war allein seine Entscheidung, wie er zufrieden feststellte. Es war nicht so, dass er vor Seles Ideen klein beigab.
„Wann willst du fahren?”, hörte er Conrad fragen. „Wenn ich noch einen Flug bekomme, morgen”, sagte Sele ungerührt.
Auch hierzu, überlegte Jean, steht es in meiner Entscheidung, was ich dazu denke, wie Sele immer versucht, mir beizubringen. Besonders eifrig darin ist sie, wenn sie von ihren psychologischen Gruppen kommt. Da bringt sie dann alles auf einen Nenner: Jeder entscheidet selbst, was er von einer Sache hält und wie er darauf reagiert. Es gibt also niemand, der an irgendetwas Schuld hat, außer man selbst. Ist doch ganz einfach, Jean. Du musst dich also überhaupt nie über mich aufregen, es sei denn, du willst es selbst. Und jetzt, beschloss Jean, ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich beschließe, mich über dich aufzuregen.
„Das kommt überhaupt nicht infrage, Sele!”
„Was?”
„Dass du morgen nach New York fliegst.”
„Und warum nicht?”
„Ich bin auch nur ein Mensch, und das kommt mir zu plötzlich.”
„Du bist doch morgen sowieso den ganzen Tag nicht da, Jean. Und abends hast du eine Verabredung. Komm, je eher ich abfahre, desto eher bin ich wieder da.”
„Liebste Sele, um dir das zu glauben, dürfte ich dich nicht so gut kennen.” „Ach komm, so schlimm bin ich doch auch wieder nicht. Was hältst du übrigens von der Idee überhaupt?” „Sie ist so übertrieben, dass sie mir Appetit macht. Es könnte sein, dass mir, während du weg bist, auch eine Idee kommt.”
„Na bestens. Und wenn ich wieder heim komme, können wir uns ausgiebig über unsere Ideen erheitern.”
Jean war sauer. Solche Überraschungen mochte er nicht besonders. Aber seit er mit Sele verheiratet war, hatte er sie dauernd. Aber, gestand er sich fairerweise ein, ohne Seles Überraschungen wäre ihr Eheleben auf keinen Fall so prickelnd, wie es immer wieder ist. Also gut, es ist prickelnd, aber trotzdem darf ich sauer sein. Und das bin ich jetzt. Ich habe nämlich keine Lust, allein daheim zu bleiben.
„Ich würde am liebsten mitfahren, aber ich kann gerade nicht weg”, sagte er. Und das machte ihn noch saurer. Und die Sauerkeit erreichte ihren Höhepunkt, als Sele sagte: „Ist auch besser so. Manche Dinge muss man allein erledigen.”
Hella grinste. Conrad auch.
„Jean”, begann er, „kannst du noch einen Schlag vertragen?”
„Nein”, stellte Jean fest.
„Du kriegst ihn trotzdem. Ich fliege morgen auch nach New York. Ich habe dort zu tun. Aber der Flug steht schon seit vier Wochen fest.”
„Jetzt reicht’s”, schimpfte Jean. „Möchtest du dort mit Sele vielleicht gleich deine alte Beziehung wieder aufnehmen?”
„Die Idee könnte mir wirklich kommen. Lust hätte ich dazu.”
„Seid ihr denn alle verrückt geworden?” Jean hatte jetzt wirklich genug. In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen, und Phylia kam schwungvoll herein.
„Hallo”, rief sie vergnügt. „Lasst es euch weiterhin schmecken. Ich geh gleich wieder. Ich wollte euch nur sagen”, wandte sie sich an Sele und Jean, „dass ich heute Nacht bei John bleibe.”
Jean war zu verstimmt, um über Phylias Vorhaben nachzudenken. Wenn er schon Sele keine Vorschriften machen konnte, dann würde er das wenigstens bei seiner Tochter tun. Mit 17 muss man noch nicht bei seinem Freund übernachten.
„Das kommt nicht infrage”, versuchte er es mit seiner Autorität. „Also, Papa, was ist denn los mit dir? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Oder eine Sele?”, fragte sie, aus langer Erfahrung im Zusammenleben mit ihren Eltern wohl wissend, aus welcher Ecke ab und zu Jeans schlechte Laune kam.
„Schluss damit. Du tust, was ich dir sage.”
Phylia stand einen Augenblick still. Sie kam sonst mit ihrem Vater prächtig aus. Aber so konnte er nicht mir ihr umgehen.
Das konnte sie sich auf keinen Fall bieten lassen. Und um die Sache ganz deutlich zu machen, sah sie ihn voll an und sagte:
„I’m a sexuell woman and not your little baby.” Und ging würdevoll hinaus.
„Das stimmt”, sagte Sele voll Anerkennung. „Sie ist wirklich kein kleines Baby mehr. Der Abgang war mehr als Klasse. Das muss man ihr lassen.”
„Und du unterstützt sie noch”, sagte Jean wütend. „Aber was kann man von einer Mutter schon erwarten, die so mir nichts dir nichts nach New York fliegt und ihren Mann einfach allein lässt.”
„Und noch dazu mit ihrem ehemaligen Liebhaber”, fügte Sele hinzu.
Schweigen. Nach einer Weile, und nach dem sie genüsslich einige Bissen gegessen hatte, sagte Sele: „Womit wir mitten im Thema wären, das die Welt bewegt.”
„Und das wäre? New York? Phylias ausschweifendes Liebesleben?” Jean war immer noch nicht bei Laune.
„Sexualität”, sagte Sele mit dunkler Stimme.
„Vielleicht bewegt sie deine Welt. Ich habe auch noch anderes zu tun”, sagte Jean mürrisch.
„Jean, schließen wir wieder Frieden?”, bot sie ihm an. „Ich wollte dich nicht ärgern. Und in dieser Atmosphäre können wir so schlecht miteinander reden.” Sie sah Jean an und lächelte.
„Frieden.” Er grinste. „Du willst ja nur deine Rede über die Sexualität loswerden.”
„Soll ich das schon wieder als Kriegserklärung ansehen?”
Er sah sie an. Ich könnte sie jetzt küssen. Ich hätte wirklich Lust dazu. Weiß der Himmel warum. Jean stand auf, trat hinter Seles Stuhl, nahm ihren Kopf in seine Hände, beugte ihn leicht zu sich nach oben und küsste sie, erst sanft, dann mit einer gewissen Intensität.
„Ich gebe zu, dass die Sexualität auch meine Welt bewegt. Also, schieß los”, sagte er.
„Ich wollte eigentlich gar nicht losschießen”, meinte sie. „Nur – ich hatte heute früh ein witziges Erlebnis.” Sie erzählte von dem Schönen im Bus.
„Und das Seltsame ist, dass es mir entsetzlich peinlich gewesen wäre, wenn er irgendwie erfahren hätte, was für Gedanken ich gehabt habe”, schloss sie.
„Ist schon schlimm, wenn man sich nicht einmal selbst die Erlaubnis geben kann, zu denken, was und wie man will”, sagte Hella ironisch.
„Weil ich zu allen möglichen Sachen stehen kann, nur nicht dazu, dass ich sexuell angehauchte Ideen über einen schönen Mann im Bus hatte.”
„Dann denke sie besser nicht”, meinte Hella gelassen. „Und zwar nicht aus dem Grund, weil sie unmoralisch sein könnten, sondern weil du nicht dazu stehst.”
Sele nickte ihrer Freundin zu: „Du hast Recht. Weißt du, ich überlege mir gerade, was passiert wäre, wenn ich zu ihm auf der Terrasse gesagt hätte: Ich habe mir im Bus Gedanken über Sie gemacht, und zwar abenteuerlich-sexuelle, aber Sie haben sich leider als ungeeignet herausgestellt.”
Alle lachten los. Hella sagte: „Und wenn er nicht so verklemmt gewesen wäre?
Sele unterbrach sie: „Warum sagst du: so verklemmt? Das wissen wir doch gar nicht.”
„Doch, wenn du dich auf irgendwas verlassen kannst, dann auf sexuelle Verklemmtheit”, lachte Hella und fuhr fort:
„Also, wenn er nicht so verklemmt gewesen wäre, dann hätte er dich gefragt, wofür er eigentlich nicht geeignet gewesen war, und er hätte versprochen, sich um Besserung zu bemühen. Also hättest du ihm noch einen Gefallen getan.”
Wieder erheitertes Gelächter.
Sele stellte fest:
„Ja. Allerdings hätte er sich dafür bestimmt nicht bedankt. Denn dieses Thema gehört nun mal zu den Katastrophenthemen. Warum eigentlich?”
„Hm, vielleicht, weil sie deinen Körper in so einschneidender Weise berühren. Ich meine, Freisein oder Nicht-Freisein entscheidet hier über deine ganze Lebenskraft”, überlegte Conrad.
„Dann könnte das Essen genauso ein Katastrophenthema sein. Das berührt den Körper ja genauso, vielleicht noch mehr.”
Jean beugte sich zu Hella, räusperte sich und fragte: „Liebste, versteh mich bitte nicht falsch, und denke auf keinen Fall, dass ich es anders meine als ich es sage, aber ich habe das Gefühl, dass ich zu dieser Frage das Recht habe und dazu auch alt genug bin und dir ganz bestimmt nicht zu nahe treten will: Aber könnte ich einmal von dem hübschen kleinen Hummer auf deinem Teller ein Stückchen probieren? Natürlich nur der Wissenschaft halber.”
Hella setzte ein abweisendes und undurchdringliches Gesicht auf und sagte scharf:
„Wenn du dir noch einmal so einen Fehltritt erlaubst, werde ich dich wegen speisueller Belästigung belangen müssen, mein Lieber.”
Jean murmelte: „Na ja, ich dachte, ich als dein Freund ...”
Conrad sagte: „Gerade wir aufrechten Männer müssen den schwachen Frauen in Sachen Speisualität beistehen. Es ist eine Zumutung für Hella, dir sagen zu müssen, dass dich ihr Hummer nichts angeht. Für einen Mann von Anstand und Erziehung versteht sich so etwas übrigens von selbst. Er wird nie eine Frau in die unangenehme Lage bringen und ihren Hummer auch nur erwähnen. Das wäre im Übrigen auch das Ende jeder Freundschaft, berechtigterweise.”
Sie lachten, und Jean fuhr Hella, die neben ihm saß, mit seiner Hand durch die Haare und sagte: „Also gut, ich respektiere deinen unaussprechlichen Hummer. Aber dafür darf ich ohne Hemmungen über deine wunderschönen Brüste sprechen.”
„Das zeigt doch, wie künstlich und abstrakt das alles ist”, sagte Sele. „Also Hellas Brüste sind wirklich schön. Und ab und zu habe ich gewaltigen Appetit auf Salat, Hummer oder Seezungen. Je nachdem, welche Konventionen wir als wahr ansehen, darf ich das nicht laut sagen, weil ich andernfalls ein unanständiger Mensch bin.”
Jean schüttelte den Kopf und lachte: „Jetzt möchte ich nur noch wissen, als was du mich siehst: Schweinebraten, Hummer, Seezunge?”
„Diese Antwort wird mein Geschenk zur Goldenen Hochzeit sein. Aber den Typ im Bus ordne ich als Hummer ein. Der hat geistige Zangen. Der hat bestimmt irgendwie gespürt, dass er mir im Kopf herumgeht. Und so etwas ist unanständig.”
„Legst du denn Wert darauf, eine anständige Frau zu sein?”, fragte Conrad.
„Welche Antwort willst du haben?”, mischte Jean sich ein. „Wird sie vielleicht irgendwie deine New York-Reise beeinflussen?”
„Also hört mal: Über meine Anständigkeit oder Nicht-Anständigkeit entscheide allein ich, und zwar von Fall zu Fall, ich habe keine Absicht, mich festzulegen.”
„Wobei die Anständigkeit ein weites Feld ist”, grinste Hella.
„Eben”, stimmte Sele ihr zu. „Allein in der Sexualität kann sie alles oder nichts bedeuten.”
„Alles auch? Wie das?”, fragte Jean.
„Ich kann mir alles nehmen, was ich brauche, und bin dann anständig mir gegenüber, nämlich, weil ich mir meine Wünsche und Bedürfnisse erfülle, meine Psyche und meinen Körper ernst nehme. In diesem Fall kann ich auch anständig den Beteiligten gegenüber sein, in dem ich ihnen vertraue, gut zu ihnen bin, ehrlich vor allem, sie nicht gegenseitig ausspiele, schlecht mache, sie als Persönlichkeit respektiere und eine gute Meinung von ihnen habe.”
„Hm. Das klingt auf jeden Fall durch und durch nach edler Gesinnung”, gab Jean zu.
„Nicht wahr?”, sagte Sele fröhlich. „Denn Anständigkeit in der Sexualität kann natürlich, je nach Auffassung, auch lauter schreckliche Dinge bedeuten: Unbildung, Engstirnigkeit, Scheuklappen, Zwang, Qual.”
Sele machte eine Pause, um sich erneut den guten Dingen auf ihrem Teller zu widmen. „Wir warten”, sagte Conrad.
„Kommt schon”, sagte Sele, noch mit vollen Backen kauend. „Also nehmt bloß mal die Unbildung in diesem ganzen Komplex. Was machen wir nicht alles, um das Leben und die Umwelt zu erforschen, um uns zu bilden und zu informieren, und auch um Spaß zu haben. Wir reisen, probieren alle Speisen aus, die sich uns bieten, gehen ins Kino, ins Theater, in die Oper, probieren immer wieder aus, welcher Friseur, welches Kleid, welche Schuhe, welche Hautcreme, welche Matratze und Bettdecke, welcher Cocktail, welcher Duft uns am besten tut. Wir lesen Bücher und haben herausgefunden, wie viel und welche Speisen wir am Abend essen dürfen, damit wir gut schlafen, auch wenn wir uns nicht immer daran halten. Aber wir wissen es jedenfalls, und zwar ganz allein aus Erfahrung, weil wir unermüdlich probieren und uns den verschiedensten Situationen ausgesetzt haben. Bei all dem Entdeckungs- und Forscher- und Genießerdrang bleiben die Sexualität, die Liebe, die Erotik, all die zündenden Funken zwischen Mann und Frau ganz, ganz weit zurück.”
„Aber du kannst doch nicht sagen, dass wir in unserem Zusammenleben nichts mehr erforscht haben”, knurrte Jean.
„Aber vielleicht zu wenig. Vielleicht kommt da viel zu wenig von außen. Vielleicht drehen wir uns viel zu sehr um uns selber. Könnte doch sein. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen eigentlich nichts.”
„Oh Gott, da kommen ja Zeiten auf mich zu”, stöhnte Jean. Conrad lächelte ihm zu und bot ihm an: „Ich steht dir bei, Jean.”
„Du?”, zweifelte Jean. „Du fährst mit meiner Frau nach New York. Hella wäre mir lieber.”
Conrad tat beleidigt: „Wie du willst.”
„Hm, wie du willst, Jean”, sagte Hella.
***
Nach dem Abendessen, als die vier Freunde die Küche in Ordnung brachten, herrschte wieder Harmonie. Aber war es wirklich Harmonie? Jean versuchte, die Stimmung zu fassen.
„Habt ihr das Gefühl, wir sind uns wieder einig? Oder ist das nur etwas Aufgesetztes? Darüber denke ich gerade nach”, sagte Jean, während er einen Stapel Teller mit ziemlichem Getöse aus der Spülmaschine holte. Nicht einen nach dem anderen, sondern einen ganzen Haufen auf einmal, wie Sele missbilligend feststellte. Aber sie sagte nichts. Sie liebte es, Jean wegen seiner Spülmaschinen-Taktik anzumeckern, die in ihren Augen einfach unzulänglich war. Aber heute genügte es. Heute bitte keine Scherze mehr. Sie fühlte sich erschöpft. Und sie musste doch noch wenigstens ein Minimum an Vorbereitung für ihre New York-Reise durchdenken. Denn die Idee, dorthin zu fliegen, war ihr wirklich erst beim Abendessen gekommen. So ging es ihr oft. Sie ließ ihren Gedanken im Kopf ziemlich viel Freiheit, und manches wurde ihr erst deutlich, wenn sie es aussprach. Dann stand es plötzlich vor ihr, wie ein Gemälde, und sie konnte es in Ruhe betrachten: Aha, so sieht es also aus. Es gefällt mir ganz und gar. Oder auch: Nein, das ist absolut nicht mein Geschmack, weg damit.
Sie hatte Mühe, von ihren Gedanken wegzukommen und über die Stimmung nachzudenken, von der Jean gesprochen hatte. Hella sagte gerade: „Ich habe so ein Gefühl, als würden wir alle uns etwas nähern, dem wir noch ein bisschen misstrauen, so wie ein Tier, das an etwas Unbekanntes vorsichtig schnuppernd herangeht. Aber durchaus interessiert. Ja, ich habe das Gefühl, als seien wir alle durchaus interessiert.”
Jean holte den nächsten Stapel Teller mit einer solchen Lautstärke aus der Spülmaschine, dass er das, was er gesagt hatte, wiederholen musste:
„Ich sagte, das trifft es in etwa, was auch mir im Kopf herumgeht. Wobei das Neue du zu sein scheinst, Conrad. Es ist schon schlimm genug, dass Sele so einfach abreist, wieso musst ausgerechnet du mit ihr fahren?”
„Es ist übrigens Sele, die mit mir fährt. Jean, von mir hast du absolut nichts zu befürchten. Die Betonung auf befürchten.” „Die Betonung auf nichts wäre mir lieber. Was verstehst du unter befürchten?”, fragte Jean seinen Freund.
Der dachte kurz nach und lachte dann: „Komm, das ist uns heute Abend zu hoch. Wieso bist du so beunruhigt, weil Sele einen kurzen Trip nach New York macht? Solche Dinge sind doch nichts Ungewöhnliches bei ihr.”
„Das stimmt schon. Und trotzdem... Vielleicht spüre ich irgendwo im Hintergrund das Neue, von dem Hella gesprochen hat. Auf jeden Fall habe ich heute ein anderes Gefühl, als bei Seles früheren spontanen Entschlüssen.”
***
Sele saß an ihrem Schreibtisch und dachte nach. Vor ihr lagen ein Zettel und ein Stift. Sie wollte sich ein paar Notizen für die Reise machen. Irgendwie wirbelte alles in ihrem Kopf. Gott sei Dank war wenigstens um sie herum Ruhe.
Also, das war ja wieder typisch: Ausgerechnet ihr Lieblingspullover war in der Wäsche, die Schuhe, die sie mitnehmen wollte, waren nicht geputzt und jetzt hatte sie dazu überhaupt keine Lust, und am Mantel fehlte ein Knopf, den hatte sie verloren, und einen gleichen hatte sie nicht mehr daheim, und einen anderen konnte sie nicht annähen, das sah ja fürchterlich aus. Außerdem waren ihre Haare nicht gewaschen, und ihr Rouge war fast leer. Na ja, das wenigstens würde sie ja wohl auch in New York kaufen können. Und an Kleidern brauchte sie für die paar Tage auch nicht viel. Also, wirklich nur das Allernötigste einpacken, und dann mit leichtem Gepäck weg. Ja, so klappte es. Langsam kam ihre Vorfreude wieder. Auf die Idee, dass es vielleicht gar keinen Platz mehr gab im Flugzeug, kam sie überhaupt nicht. Sie war wild entschlossen, und das genügte.
Sie ging unter die Dusche. Jetzt erstmal schön schlafen und an gar nichts mehr denken, nahm sie sich vor. Und morgen einfach früh aufstehen und zum Flugplatz fahren. So einfach ist das.
Unter der Dusche fiel ihr etwas ein. Da war doch vorhin noch ein Gedanke, den sie nach dem Abendessen notieren wollte. Was war das gleich wieder? Sie erinnerte sich, dass sie den Gedanken für ihren nächsten Vortrag verwenden wollte. Mein Gott, der war ja schon bald, und sie hatte noch nichts vorbereitet. Das wurde dann etwas knapp, befürchtete sie. Der Jetlag nach der Rückfahrt legte ihre Kreativität meistens zwei Tage lahm, und an einen Vortrag konnte sie dann bestimmt nicht denken. Also musste sie heute Abend noch ein bisschen dran arbeiten, wenigstens die Hauptidee. Und die war ihr vorhin, beim Essen gekommen, und jetzt war sie weg. Verflixt.
Sie stieg aus der Wanne und trocknete sich ab. Sie betrachtete sich dabei im Spiegel. Sie liebte ihre Brüste und strich mit den Händen drüber, sanft und fest. Wie wunderschön diese Berührungen waren. Seltsam, dachte sie, dass solche schönen Körperteile in unserer sogenannten zivilisierten Gesellschaft so streng versteckt werden müssen. Ihr Ärmsten, ihr gehört zu den Unaussprechlichen. Ihr dürft euch auf keinen Fall so zeigen, wie ihr seid. Denn dann seid ihr unanständig.
Wisst ihr, was das ist? Nö.
Dachte ich mir. Ihr müsst in so etwas hinein wie einen Maulkorb, denn vielleicht könntet ihr beißen. Oder etwas aussagen. Vielleicht sogar das höchst Unanständige, dass der Körper Spaß macht. Und dass euch das Leben ganz besonders Spaß macht, wenn ihr in Freiheit wippen und schaukeln könnt. Wenn ihr direkt und ohne Zwischenschaltung mit Wind und Wellen kommunizieren dürft, wenn Hände, die euch lieben, euch streicheln, und wenn sanfte Kleider sich auf euch bewegen, indem sie eurer Bewegung immer ein Stückchen hinterher eilen.
Sele ließ ihre Hände entzückt über ihre Brüste gleiten und dachte, ach ja, der Vortrag, hatte er was zu tun mit der Unschuld der Körperempfindungen, oder was war es denn gleich, an das ich vorhin dachte? Ach ja, um Projektionen ging es, also wie ich als Frau Macht und Fähigkeiten auf einen Mann projiziere, weil ich denke, er muss das für mich tun, weil ich als Frau das nicht kann, oder so. Also das muss ich mir dann gleich aufschreiben.
Zum Beispiel bin ich im Brüstestreicheln genauso gut wie Jean. Trotzdem brauche ich ihn dazu, das war jetzt kein gutes Beispiel. Aber vielleicht, hm, den Mülleimer hinaustragen. Also komm, Sele, so etwas Abgegriffenes wie einen Mülleimer gibt es gar nicht. Davor hast du ja zumindest keine Angst. Den trägst du doch ohne Probleme hinaus, wenn es sich ergibt, sagte sie sich. Nein, nein, darum geht es ja gar nicht. Worum dann? Den Mülleimer nicht hinauszutragen, wenn ich keine Lust dazu habe. Wenn Jean aber auch keine Lust dazu hat? Ihn davon überzeugen, dass ich als Frau absolut zu schwach für solche Sachen bin? Nein, das geht irgendwie in die falsche Richtung. Das stimmt ja schon: selbst entscheiden, was für mich wichtig ist, und zu der Entscheidung stehen, und nicht den Mann fragen, ob ihm das auch recht ist. Nur ist vielleicht das Mülleimerniveau zu anrüchig. Hm. Oder nicht anrüchig genug. Denn die sogenannten anrüchigen Dinge sind es doch auch, in denen wir klein beigeben um des lieben Friedens willen und dessen, was sich gehört.
„Was meinst du, Jean, in welchen Situationen musst du für mich den starken Mann spielen, weil ich glaube, dass ich das selbst nicht kann?”
Jean war ins Badezimmer gekommen. Er trug nur seinen leichten Morgenmantel, und als er sie von hinten umarmte, seinen Körper fest an ihren drückend, spürte sie ihn durch den dünnen Stoff.
„Das kann ich dir sofort sagen: bei deiner absoluten Unfähigkeit beim Ordnen deiner Kontoauszüge, deiner Termine, deiner Papiere überhaupt, deinem Umgang mit der Bohrmaschine, deiner bequemen Weigerung, das verstopfte Flusensieb an der Waschmaschine herauszubekommen, weil es angeblich klemmt ... Also, das kommt mir so auf Anhieb in den Sinn, wobei ich sagen muss, dass ich mich jetzt, wo ich dich umarme, nicht so ganz auf Flusensiebe konzentrieren kann. Aber eines möchte ich jetzt doch noch wissen: Brauchst du mich in diesen Dingen eigentlich als Freund oder als Mann?”
Sele überlegte: „Ich weiß nicht so recht. Lass mich nachdenken. Als Mann wahrscheinlich. Wie heißt doch das schöne Sprichwort: Der Mann im Haus erspart den Zimmermann, oder so.”
„Tja, siehst du, und gerade als Mann muss ich in Zukunft solche Anfragen strikt ablehnen. Denn du bist als Frau in all diesen Sachen nicht unbegabter, du bist bloß zu faul. Und das bin ich im Grunde auch. Also, als Mann fühle ich mich für deine Faulheit nicht mehr zuständig. Als Mann bin ich für andere Dinge da.”
Sele seufzte: „Wow, der Schuss ging gewaltig nach hinten los. Ich glaube, ich nehme bei meinem Vortrag ein anderes Thema. Aber vielleicht könnten wir noch über deine Rolle als Freund reden?”
„Schon zu spät. Jetzt bin ich schon dein Mann ...”
Seine Hände strichen über ihre Brüste, und sie lehnte ihren Kopf an den seinen. Sie war nur wenig kleiner als er. Dann drehte sie sich um, legte ihre Arme um seinen Hals, und sah ihn an.
„Im Moment ist mir völlig unklar, warum ich nach New York will und nicht hier bei dir bleibe”, seufzte sie.
„Genau, warum bleibst du nicht hier bei mir? Das ist auch meine Frage.”
„Komm, reden wir im gemütlichen Bett weiter”, forderte sie ihn auf. Sie schlüpften beide nackt unter eine Decke, drückten voller Genuss ihre Körper aneinander und unterhielten sich leise.
Jean ließ seine Hand über ihren Rücken hinunter gleiten und ließ sie dann auf der Rundung ihres Gesäßes liegen, während der Druck seiner Hand stärker wurde.
„New York ist eine der Chancen, die eine Ehe hat”, sagte Sele gerade .
„Wie meinst du das?”
„Eine Ehe ist interessanter, wenn New York in ihr Platz hat. Ist doch ganz klar. Wenn wir die New Yorks der Welt aus unserer Beziehung aussperren, dann dümpelt die Liebe in einem engen, abgestandenen Teich herum, und das tut ihr nicht gut.”
„Hm”, murmelte Jean. Er streichelte Sele mit einem Genuss, als wäre es das erste Mal. Dabei ist es das letzte Mal, dachte er. Aber das kommt wohl aufs Gleiche raus. Denn nach dem letzten Mal kommt dann wieder das erste Mal. Auf jeden Fall sind sie besondere Kostbarkeiten, diese ersten Male und diese letzten Male. Keine Spur von Dümpeln. Er drückte Sele an sich.
Sele in New York
„Hi Jean, ich habe gerade sehr köstlich gefrühstückt.”
„Amerikanisch?”
„Nein, daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Ich habe Berge von Melonen, Ananas, Papaya verdrückt und fühle mich jetzt rundherum unternehmungslustig. Wie geht es dir?”
„Wie es so einem verlassenen Ehemann eben geht. Keine Melonen, keine Ananas, keine Papaya, und auch sonst nichts.”
„Soll ich dich bedauern, oder tust du das bereits selbst?”
„Ach Sele, so hast du mir schon lange nicht mehr gefehlt.”
„New York zwischen uns wird uns total erfrischen.”
„Hm. Ich fühlte mich eigentlich erfrischt genug. Was hast du gestern Abend gemacht?”
„Ich war mit Conrad tanzen. Wir haben den ganzen Abend wie verrückt getanzt und sind dann völlig ausgepumpt ins Bett gesunken.”
„Jeder in sein eigenes, hoffe ich.”
„Ja, jeder in sein eigenes. Wir wohnen auch in verschiedenen Hotels, wenn es dich beruhigt.”
„Verdammt noch mal, Sele, ich werde total wütend, wenn ich das höre. Ich bin eifersüchtig wie schon lange nicht mehr, und werde es immer mehr, je mehr ich offensichtlich keinen Grund dazu habe. Ich habe mich ja mit deinen spontanen Ideen abgefunden, auch wenn sie nicht immer so ohne weiteres nachzuvollziehen sind, aber dass du ausgerechnet mit Conrad in New York bist und ich bin hier, das bringt mich zur Weißglut. Ich möchte, dass du umgehend nach Hause kommst, Sele, verstehst du?”
Sele sagte eine Weile gar nichts.
„Hast du mich verstanden, Sele, es ist mir ernst. Du sollst heimkommen, und zwar sofort.”
„Warum sollte ich das?”
„Weil ich es will.” Jean schrie es fast. „Weil du meine Frau bist. Weil ich dich wiederhaben will. Weil ich das Gefühl habe, als seiest du gar nicht mehr die Sele, die ich kenne. Weil ich finde, dass das alles gar nicht zu dir passt.”
„Ach Jean, was weißt du schon, wer ich bin und was zu mir passt. Ich weiß es selbst nicht. Ich bin nicht eine einzige Sele. Ich bin nicht nur deine Frau oder die Mutter unserer Kinder oder die Psychologin, die ihre Vorträge ausarbeitet. Das bin ich zwar auch, und gerne. Aber ich bin auch die Sele, der es ein riesiges Vergnügen bereitet, mit Conrad eine halbe Nacht lang in New York zu tanzen, und die Sele, die hier in einem Schaufenster Kleider gesehen hat, die sie daheim nie kaufen würde, weil du sie als lasziv bezeichnen würdest, die sie aber liebend gerne anziehen würde. Die bin ich auch. Und das ist nur ein winzig kleiner Teil von mir. Was weiß ich, wer ich alles bin, wenn ich es überhaupt nicht ausprobieren kann? Also komm mir nicht damit, etwas passe nicht zu mir. Was bisher hier passiert ist, passt sogar hervorragend zu mir.”
„Ich versuche, das zu verstehen, aber es klappt nicht. Kommst du nun heim oder nicht?”
„Nicht, bevor ich hier fertig bin, genau wie ich es vor hatte.”
„Und wann wird das sein?”
„lch weiß es nicht genau. Gegen Ende der Woche, denke ich.”
„Denkst du. Denkst du dabei ein einziges Mal an mich? Verdammt, heute ist der Tag, an dem ich alles mehr als satt habe.”
Jean warf den Hörer auf die Gabel. Sele glaubte, die Wucht über den ganzen großen Atlantik zu spüren. Sele dachte nach. Nach herkömmlichen Auffassungen, überlegte sie, hat er Grund, sauer zu sein. Aber wenn ich dieses herkömmliche Gerüst genauer anschaue, so ist es total hohl. Er ist sauer, okay. Aber es gibt dazu keinen einzigen Anlass, der mit mir zu tun hätte.
Trotz dieser Feststellung war Seles Stimmung etwas gedämpft, als sie weiterschlenderte durch ihr geliebtes New York. Sie kaufte sich das laszive Gewand. Als sie es anprobierte, schmiegte es sich derartig leicht und geschmeidig an ihren Körper, dass sie die Berührung ausgesprochen genoss. Das ist also lasziv, stellte sie mit Genugtuung fest. Wenn es so ist, dann liebe ich das Laszive. Warum hat es eigentlich so einen unanständigen Beigeschmack? Womit wir mal wieder beim Anstand angelangt wären, grinste sie. Also, wenn lasziv ist, dass mir die Berührung des Kleides auf der Haut großes Vergnügen bereitet, dass mein Busen ganz besonders liebevoll zur Geltung kommt, dass ich meinen Bauch nicht einmal einziehen muss, weil der alles umfassende matte Glanz sogar den in ein lustvolles Licht rückt – ja, dann müssten laszive Kleider das Beste und Gesündeste sein, das wir uns und unserem Körper antun können.
Sehr zufrieden mit sich und dem Kauf schlenderte Sele weiter. Bei Bloomingdales kaufte sie sich noch eine hübsche Dose Rouge, und dann war es schon Zeit für das Mittagessen, zu dem sie sich mit Conrad verabredet hatte. Er wartete auf sie. Er sah sie unternehmungslustig an und seufzte: „Also Sele, New York mit dir ist ein absolutes Highlight.”
„Hm, besonders, wenn ich an unsere Nacht denke. Eine Liebesnacht könnte mir nicht prachtvoller in Erinnerung bleiben.”
„Das kannst du so gar nicht beurteilen. Vergiss nicht, dass die letzte Erfahrung mehr als 20 Jahre her ist. Wir müssten es einfach mal wieder ausprobieren, was prachtvoller ist: eine durchtanzte oder eine durchliebte Nacht.”
Sele erwiderte nichts. Ihr kam auf einmal alles sehr kompliziert vor. Sie seufzte. Sie sah sich in dem kleinen Restaurant um, in dem sie sich an einem Tisch für zwei Personen gegenüber saßen. Es gefiel ihr gut.
„Es ist appetitanregend hier”, sagte sie. „Aber ich möchte nicht viel essen, sonst werde ich so müde.”
Conrad fragte: „Warst du schon in deiner Galerie?”
„Ja. Und was sag ich dir: Das Bild gefällt mir überhaupt nicht mehr.”
„Woran liegt es?”
„Daran, dass ich jetzt jemand anderer bin als daheim. Nein, niemand anderer. Aber meine New Yorker Seite ist anders als meine Seite zu Hause. In New York habe ich einen anderen Geschmack. Das muss es wohl sein. Denn sonst hätte ich das Bild schon das letzte Mal gekauft.”
„Oder du brauchtest einen Vorwand, um allein nach New York zu fahren.”
„Schlimm, wenn es so wäre, ich meine, wenn ich einen Vorwand bräuchte, um nach New York zu fahren. In meinen Gruppen würde ich es jedem, der mir so eine Geschichte erzählte, auf den Kopf zusagen, dass er nur einen Vorwand suchte. Aber bei mir? Tja, offensichtlich bin ich auch nur ein Mensch.”
Conrad lachte: „Den Verdacht habe ich schon länger. Aber eine Maschine oder einen Roboter an deiner Stelle fände ich auch lange nicht so aufregend.”
„Und du, warst du schon bei deiner Malerin?”
„Ich gehe heute Nachmittag hin. Willst du mitkommen?”
Ihr Essen wurde serviert. Duftendes Käsesoufflee, kalifornischer Weißwein. Sele seufzte vor Vergnügen, und Conrad auch. Sie genossen schweigend. Als sie fertig waren, fragte Conrad: „Hast du schon mit Jean telefoniert?”
„Ja, aber es war nicht ganz erfreulich.”
„Was ist los?”
Sele antwortete mit einer Gegenfrage: „Sag, Conrad, kennst du auch das Gefühl, dass du, wenn du jemanden sehr liebst, nur ein ganz kleiner Teil von dir selbst sein solltest? Wenn du den Erwartungen entsprechen willst. Und denen musst du ja irgendwie entsprechen, sonst klappt es mit der Liebe nicht so recht.”
„Allerdings kenne ich dieses Gefühl. Und es ist nicht nur ein Gefühl. Nimm zum Beispiel mich und euch beide. Ich liebe dich, und ich liebe Jean. Aber Jean kann mir das nicht so recht glauben. Wenn ich dich liebe, dann kann ich nicht ihn lieben. Eins schließt für ihn das andere aus. Und nicht nur das. Ich denke, irgendwo im Geheimen pflegt er die Überzeugung, dass ich sogar automatisch sein Feind sein muss, wenn ich dich liebe.”
„Weil er denkt, dass er einen Verlust erleiden könnte, wenn wir uns nahe sind. Er erwartet die Gefahr allerdings von der falschen Seite. Er versteht nicht, dass die Möglichkeit einer Entfremdung nie von außen oder von jemand anderem kommen kann, sondern nur aus uns selber. Wenn ich in unserer Beziehung aus meiner ganzen, vollständigen Kraft und Persönlichkeit heraus leben kann, dann ist unsere Ehe nicht in Gefahr. Nur wenn ich das nicht kann, könnte Enttäuschung sich ausbreiten und alles ersticken.”
„Ja, ersticken, das ist ein gutes Wort.”
„Also brauchen wir viel frische Luft in einer Beziehung. Und alles, was von außen kommen darf, bringt auch frischen Wind mit.”
„Wobei das Hauptproblem wahrscheinlich die Definition ist: Was ist frische Luft?”
Sele zahlte, und sie gingen Arm in Arm hinaus.
Die Farbe Rosa
Im Taxi fragte Sele: „Wie hast du sie eigentlich kennen gelernt, deine Malerin? Ist sie jung und hübsch?”
„Sie ist alt und schön”, sagte Conrad. Er erzählte Sele von ihrer ersten Begegnung.
„Es ist ein paar Jahre her, wart mal, vier, oder erst drei? Also, ich war Ende November geschäftlich in New York, und am Vormittag, bevor ich am Abend zurückfliegen sollte, bummelte ich durch die West Side. Es war ein nasser, düsterer, ungemütlicher Tag, und meine Laune war nicht zum Besten.” Conrad machte eine Pause und lachte: „Ja, und was sah ich da?”
„Mach’s nicht so spannend.”
„Ich sah einen üppigen, verwilderten Garten mit dichten Bäumen, und mitten zwischen diesen kahlen, nassen Bäumen stand eine Frau in einem leuchtend rosa Mantel. Die Frau hatte den Mantel wie einen weichen Umhang umgewickelt, sie sah aus, wie in eine rosa Wolke eingehüllt und schien sich um das dunkle Wetter nicht zu kümmern. Im Gegenteil, es hatte eher den Anschein, als leuchte alles in ihrer Umgebung. Ich blieb fasziniert stehen. Ich stellte mich an den Gartenzaun und starrte die Frau an. Jetzt konnte ich ihr Gesicht näher betrachten, und es war alt, aber so lebendig, so eigenwillig, so strahlend, wie zuvor der rosa Mantel.”
Conrad lächelte in der Erinnerung.
Die Frau, die in die Kronen der Bäume hoch geschaut hatte, hatte bemerkt, dass sie beobachtet wurde. Sie war auf Conrad zugegangen und hatte gefragt: „Wünschen Sie etwas?”
„Ich sagte: Nein”, berichtete Conrad weiter, „dann verbesserte ich mich und sagte: Das heißt: doch. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie traumhaft schön aussehen.”
Die Frau lachte: „Wer sind Sie?”, fragte sie.
Conrad nannte seinen Namen und sagte ihr, dass er ein paar Tage geschäftlich in New York verbracht hatte. „Ich heiße Anna”, sagte die Frau, „und bin Malerin.” „Wohnen Sie hier?”
„Ja, das ist mein Haus.”
„Sind Ihre Bilder in Ihrem Haus?”
„Ja.”
„Darf ich sie ansehen?”, fragte Conrad.
„Warum nicht?”, stimmte die Frau zu. Sie ging hinüber zum Gartentor und öffnete ihm. Ein athletisch gebauter junger Mann mit dunkler Haut kam aus der Haustür, ging die breiten Treppen zu Anna und Conrad hinunter und schloss hinter Conrad das Gartentor wieder.
„Wir gingen ins Haus, und ich betrachtete ihre Bilder, und sie gefielen mir genauso gut wie die Frau. Wir waren uns vom ersten Augenblick an sympathisch, Anna und ich. Wir verbrachten einen interessanten Tag miteinander, denn ich verschob meinen Flug, und am Abend gingen wir in New York aus. Wir haben uns keine Minute miteinander gelangweilt.”
„Du sagst, sie ist alt.”
„Sie ist zumindest nicht jung, den Jahren nach. Aber sie ist auch nicht das, was wir unter alt verstehen. Na ja, du wirst ja gleich selber sehen.”
Das Taxi hielt, Sele schob sich hinaus, und stand vor einem eindrucksvollen älteren Haus mit einem eindrucksvollen Garten. „Wunderschön”, murmelte Sele
Conrad drückte auf den Klingelknopf. „Was heißt da Knopf?”, sagte Sele. „Das ist kein gewöhnlicher Knopf, sondern eine venezianische Türklingel. Wie kommt die hierher?”
Annas schwarzer Mitbewohner öffnete ihnen und führte sie nach hinten in das Atelier. Sele war überwältigt. Eine Frau in Rosa malte, aber in was für einer Umgebung. Das Atelier bestand aus Metallstangen und Glas, die Metallstangen in verschiedenen bunten Farben angestrichen. Es war umgeben von üppigen Bäumen und Büschen, einer traumhaften, dschungelhaften Wildnis, wie Sele begeistert feststellte. Auf einem Tisch stand ein riesiger Wiesenblumenstrauß, gelber Hahnenfuß und blauer Wiesenstorchschnabel. Woher kriegt sie so etwas mitten in New York? Sele kam sich vor wie in einem längst vergessen Garten der Kindheit, und die ganze Atmosphäre passte genau zu diesem Gefühl. Sie spürte eine Harmonie und ein Gefühl der geistigen Unbekümmertheit, das alles durchzog.
Neben der Malerin sah Sele eine Gestalt. Es war eine Skulptur, aus Marmor, vermutete sie, und sie war bemalt. Sie war durch und durch ein Stilbruch, aber ein ausgesprochen stilvoller. Anna sah ihre Gäste hereinkommen, drehte sich voll Freude schwungvoll in ihre Richtung, stolperte dabei über etwas, das auf dem Boden lag, streckte die Hände aus, um Halt zu suchen, fand ihn bei der Skulptur, und stürzte im nächsten Moment mit ihr zu Boden.