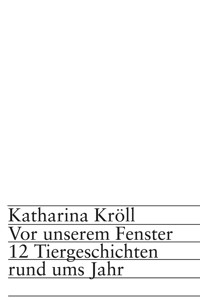9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pepa hat einen Autounfall und ist tot. Zumindest behauptet der Typ das, der neben ihr auftaucht. Sie glaubt ihm natürlich zuerst nicht, muss aber doch feststellen, dass alles immer seltsamer wird. Zum Beispiel, als sie schockiert auf ihre Leiche starrt. Sie trifft auf Leute, die sie vor mehreren tausend Jahren schon gekannt hat, wie der Typ erklärt, und die auch in ihrem gerade beendeten Leben eine Rolle gespielt haben. Meistens waren sie miteinander in kriegerische Angelegenheiten verwickelt, und auch in ihrem letzten Leben waren sie ziemlich gut darin, sich mit Intrigen und Fallenstellen nervös zu machen. Und nun sollten sie aus ihren bereits gelebten Leben lernen. Zum Beispiel, wie sie ihre reichlich vorhandenen Energien für andere Zwecke als Streit nutzen könnten. Im allgemeinen aber befanden sie sich in einer himmelblauen Sphäre, und einige Typen bemühen sich nach allen Regeln der Kunst, aus ihnen handliche Menschen zu machen, was nicht immer gelingt. Aber der Typ sagte: Das nächste Leben kommt bestimmt, und recht hat er, denn sonst könnte Pepa gar nicht von ihren Abenteuern erzählen. Auch nicht, dass über all die Jahrtausende die Liebe grandios triumphiert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Katharina Kröll
Tot sein ist auch nicht immer lustig
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZWEIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERUNDVIERZIG
FÜNFUNDVIERZIG
SECHSUNDVIERZIG
SIEBENUNDVIERZIG
ACHTUNDVIERZIG
NEUNUNDVIERZIG
FÜNFZIG
Die Autorin
Impressum neobooks
EINS
Katharina Kröll
Tot sein ist auch nicht immer lustig
Roman
Sie standen um sie herum und beobachteten sie gespannt, als sie langsam die Augen aufschlug. Links der Rote, dessen feuerfarbene Locken in eleganten Wellen gebändigt um seinen schönen Kopf wallten, neben ihm ihr Henker, in entspannter Freizeitkleidung, der sie um Verzeihung bittend innig ansah, daneben ihr Erzfeind. Er fixierte sie verkniffen und sah nach wie vor so aus, als wolle er sie umgehend umbringen. Auch der Physiker war da. Er betrachtete sie konzentriert, fuhr sich nachdenklich mit der Hand durch seine schwarzen Locken und murmelte „interessant“. Der schöne Herkules zwinkerte ihr zu, wie immer gut drauf. Die BK, unverfroren wie gewohnt, diesmal im Herzoginnengewand. Großpapa, vital und energiegeladen, der ihr enthusiastisch in die Augen schaute und seufzte, er brauche sie für seine Inspiration. Teresa, die unwillig forderte, sie solle ihr den Typ, der sich als ihr Engel bezeichnet, vom Leib halten. Und natürlich der Bürgermeister, römische Version. Ganz hinten Holly, an der Hand ihren Philosophen. Lisette, die sich gut gelaunt die brünetten halblangen Haare aus ihrer eigenwilligen Stirn strich und die Situation gelassen und überlegen betrachtete. Und die bezaubernde Fanni, die entzückt auf den prachtvoll gekleideten Ugo herabschaute.
Sie beschloss, ihre Augen lieber wieder zuzumachen.
Als sie das nächste Mal erwachte, saß Moritz neben ihr. „Pepa, Liebste!“, sagte er mit ergriffener Stimme und beugte sich über sie.
Weil ich immer darauf bestanden habe, sagte ich, dass die Geschichte gut ausgehen muss, auch wenn sie fürchterlich begann.
Heute zum Beispiel. Verdammt. Heute war nicht mein Tag. Zuerst rutschte ich auf den nassen Fliesen im Bad aus und erreichte hinkend meinen Kleiderschrank. Später knallte ich die Haustür hinter mir zu und merkte, dass ich nicht meinen Autoschlüssel in der Hand hielt, sondern den von Moritz. Dann konnte ich den Hausschlüssel nicht aus der Tasche meiner blauen Hose holen, weil die Tasche sehr eng war und der Schlüssel sich ganz nach unten geschoben hatte. (Ich hatte sie ganz neu, die Hose, und sie war um die Hüften wohl doch etwas knapp. Ich musste also den Reißverschluss öffnen und meine Hose ein Stück runterlassen, damit die Tasche Luft bekam und ich den Schlüssel fassen konnte). Dann sprang mein altes gelbes Auto nicht an. Ich musste also doch Moritz’ rotes Auto nehmen. Moritz schlief noch. Er konnte sich heute Zeit lassen. Dann aktivierte ich das Blitzlicht einer Radaranlage. Ich hatte es eilig. Und dann war ich tot. Zumindest der Typ, der neben mir im Chaos stand, behauptete das.
Ich sagte ja schon, heute war nicht mein Tag.
Ich bin Pepa, und es ist wirklich nicht einfach, Pepa zu sein. Meistens hat sich die ganze Welt gegen mich verschworen. Und wenn es mal nicht die ganze Welt ist, dann sind es meine lieben Nachbarn und andere beflissene Mitmenschen aus unserer Stadt. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann ist es der treffliche Moritz.
Moritz ist mein Liebhaber, Ehemann und Vater unserer drei Kinder, wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, mein entschiedener Gegner zu sein.
Moritz und ich verliebten uns heftig bei einem Gartenfest, das jedes Jahr auf dem ausgedehnten Grundstück seiner Familie stattfand.
In jenem Jahr waren ich und meine besten Freundinnen Lisette, Teresa, Fanni und Holly auch eingeladen. Man muss dazu sagen, dass dieses Ereignis, obwohl mitten im Sommer, immer ein Maskenfest war, ein sehr farbenprächtiges, und schon eine lange Tradition hatte. Moritz’ Vater hatte damit angefangen.
Ich verliebte mich also in den Mann mit der Pfauenmaske und er verliebte sich in das anmutige Fräulein mit dem goldenen Antlitz, und als wir beide nach vielen Tänzen und ausgelassenem Umhertollen unten am dunklen verwunschenen Teich unsere Masken von unseren erhitzten Gesichtern abnahmen, waren wir nicht einmal überrascht. Wir gestanden uns, dass wir schon immer wussten, dass wir zusammengehörten, aber wir waren noch völlig ahnungslos, was es damit auf sich hatte.
Als wir Freundinnen noch Kinder waren, hatten wir immer aufgeregt durch den Zaun gespickelt, wenn das Fest stattfand. Wenn Moritz uns erwischte, jagte er uns weg.
Diese Neigung, andere Leute von seinen Angelegenheiten fernzuhalten, zeigt er heute noch, indem er mich in seine kleine feine Firma, die er von seinem Vater übernommen hat, keinen Fuß setzen lässt. Ich möchte dort arbeiten. Ich möchte nichts lieber als das. Wobei arbeiten bedeutet: sehr viel arbeiten, denn ich möchte Chefin werden, zumal Moritz die Firma nur seinem Vater zuliebe weiterführt und täglich von dort sehr schlecht gelaunt nach Hause kommt.
Das war schon genügend Anlass für endlose Streitereien zwischen Moritz und mir. Wir hatten auch noch einige andere Themen, über die wir uns stritten.
Über die BK zum Beispiel, unsere Nachbarin von gegenüber, die meinen Ehemann mit etwas zu viel Aufmerksamkeit bedenkt. Früher nannte ich sie Blöde Kuh, natürlich nur für mich, aber dann hat mir Lisette, die außer Psychologin auch Bäuerin ist, erklärt, dass ich Kühen unrecht tue, denn Kühe seien nicht blöd. Darum begnügte ich mich mit der Abkürzung BK. Die Kühe werden mir das verzeihen, geht ja nicht gegen sie.
Und wir stritten auch über andere Frauen. Moritz ist von seinem Wesen her ein lebensfroher, leidenschaftlicher Mann, vergnügt und hemmungslos egoistisch, solange er sich mit seiner Malerei beschäftigen kann. Die anderen Frauen, also alle außer mir, sagte er, interessierten ihn nur als Modelle. Er war Maler, vor allem und in erster Linie Maler und legte seine ganze Vitalität in seine Bilder. Aber er wollte seinen Vater nicht gegen sich aufbringen, der sich frohgemut zur Ruhe gesetzt hatte, um sich genauso leidenschaftlich wie Moritz seiner Kunst zu widmen, nämlich der Erschaffung von riesigen Metallskulpturen. So dass er tagsüber schlechtgelaunt und nicht gerade mit glücklicher Hand die Firma leitete und abends und in seiner übrigen Freizeit malte.
Von meinem Vorschlag, in die Firma einzusteigen und sie zu leiten, wollte er gar nichts hören. Er meinte, wir würden uns nur streiten, über jede Kleinigkeit. Für mich sah das dann so aus, dass ich mit Moritz kaum noch Zeit verbringen konnte. Und ich fasste den Entschluss: Wenn schon nicht den Mann, dann auf jeden Fall die Firma.
Ich hätte natürlich am liebsten den Mann UND die Firma gehabt. Das mit dem Mann war klar, denn er gefiel mir meistens über alle Maßen. Und dass ich die Firma wollte, war für mich auch völlig logisch.
Als ich fertig war mit der Schule, hatte ich erst einmal genug vom Auswendiglernen und keine Lust, zu studieren. Ich ging nach Rom, wo ich über Bekannte einen Job als Aupair-Mädchen bekam bei einer jungen Familie mit drei kleinen Kindern. Der Signore, ein freundlicher, wahnsinnig in seine Frau verliebter Mann, und die Signora, eine entzückende Frau mit Po-langen Haaren und einem lieben Blick, hatten eine Firma für Tapeten, keine gewöhnlichen, sondern verzauberte Motive mit Blumen und Vögeln, wie im Paradiesgarten. Mein eigenes Zimmer war ebenfalls so phantasievoll ausgestattet und ich fühlte mich darin einfach wundervoll.
Ein Jahr lang hütete ich die lieben Kleinen, und das gefiel mir sehr gut. Immer, wenn ich Zeit hatte und ich nicht auf dem Rand meiner Lieblingsbrücke über den Tiber saß und meine Beine baumeln ließ, ging ich zu dem Signore und der Signora in die Firma und wollte alles wissen. Wie machst du das? fragte ich jeden, der mir über den Weg lief. Mein Italienisch war inzwischen ganz passabel und ich verstand eine ganze Menge an Fachausdrücken. Am meisten schaute ich dem Signore und der Signora zu, und die hatten auch nichts dagegen. Sie waren beide sehr lebhaft und kommunikativ und freuten sich, dass jemand so genau wissen wollte, was sie tun und gut können.
Danach kam ein neues Kindermädchen und ich jobbte noch eine Weile in der Firma der beiden, was bedeutete, dass ich allerlei Hilfsdienste ausführte. Ich hatte also weiterhin die wunderbare Möglichkeit, jeden zu fragen: Wie machst du das?
Genauso praktizierte ich das dann auch bei Moritz.
Ich hatte ihn über einen längeren Zeitraum gründlich und mit Vorbedacht ausgefragt, und dann wusste ich Bescheid. Und zwar allumfassend.
Ich wusste auch genau, wie man verschiedene Probleme besser lösen und wie man Hindernisse relativ leicht umgehen könnte. Ich hatte die besseren Ideen und das bessere Durchsetzungsvermögen. Kurzum: Ich würde die bessere Firmenchefin sein. Aber Moritz ließ mich nicht. Er war nach wie vor absolut dagegen.
Tante Emilia versprach mir ihre Unterstützung. Sie hatte in Moritz’ Familie die Rolle der Hausherrin und Ersatzmutter von Moritz und seinen beiden Geschwistern übernommen, nachdem ihre Schwester, die wirkliche Mutter, Hals über Kopf mit ihrem Tangolehrer durchgebrannt war und ihre Familie ohne viel Aufhebens zurückließ.
Allerdings war ihr Mann, den inzwischen alle Großpapa nannten, seit unsere Kinder das mit allen ihren in ausgeprägtem Maß zur Verfügung stehenden Dickköpfen so wollten, also er war seiner entflohenen Frau nicht einmal böse. Er widmete sich seiner edlen kleinen Firma und seiner voluminösen Kunst, die ihre begeisterten Abnehmer fand, und hatte dazwischen Muße für diese oder jene Liebschaft, bis er plötzlich eine junge Frau heiratete, die ihm durch Zufall in Tränen aufgelöst über den Weg gelaufen war und seinen ausgeprägten Beschützerinstinkt aktiviert hatte, den er in der Familie nicht ausleben konnte. Niemand wollte von ihm beschützt werden.
Die ungewöhnliche Tante Emilia verstand also meinen heißen Wunsch nach sinnvoller Tätigkeit und versprach, mich zu unterstützen. Wir versuchten mit vereinten Kräften, Moritz dazu zu überreden, zurückzutreten von seinem ungeliebten Job und uns beiden Frauen die Führung zu überlassen. Er wollte nicht.
Wir ließen uns eine unschuldige List einfallen, eigentlich mehr zum Scherz, indem wir ihn quasi überfielen in seinem Büro und sagten, wenn er uns die Firma nicht freiwillig übergebe, müssten wir leider Zwang anwenden. Wir wollten nur sein Bestes. Er amüsierte sich. Aber nur kurz. Später, nachdem alles geregelt war, lobten wir seinen klugen Verstand und gingen gemeinsam zum Mittagessen, das etwas frostig ausfiel.
Tante Emilia und ich zogen also in die Firma ein. Die versierten Facharbeiter waren sehr kooperativ und freuten sich, mit uns gut gelaunten, gut informierten und gut anzuschauenden Frauen zusammen zu arbeiten und waren angetan von unseren zielstrebigen Vorstellungen, nachdem der vorige Chef zwar die besten Absichten hatte, aber in Gedanken meistens ganz woanders war, was zu einigen Fehlentscheidungen führte, so dass die Firma zu jenem Zeitpunkt nicht so prächtig dastand.
Soweit zur Vorgeschichte. Tante Emilia und ich waren durchaus erfolgreich und Moritz hatte die großartige Gelegenheit, sich zu erholen, sich um seine geliebte Malerei zu kümmern und viel Zeit mit unseren munteren Kindern zu verbringen. Was konnte es für ihn Besseres geben. Aber mit seiner Einsicht war es nicht weit her.
Denn eines Abends eröffnete mein trefflicher Ehemann – wir wollten gerade anfangen, ein bisschen über seine Methode, den Abwasch zu erledigen, zu diskutieren (ich hatte ein paar interessante Verbesserungsvorschläge) – , also er eröffnete mir, dass er nun selbst wieder den Chefsessel einnehmen werde. Er habe sich bestens ausgeruht und sei zu neuen Taten bereit. Jetzt dürften wir beiden Frauen mal Pause machen und uns unserem eigenen Leben hingeben. Ich dürfte mich außerdem unseren lebensvollen Kindern widmen. Notfalls würde er den Wechsel genauso charmant erzwingen wie wir.
Dieser falsche Kerl. Tante Emilia und ich hatten unser tägliches Leben in der Firma genossen, waren richtig zufrieden mit unseren Erfolgen, alles lief prima, und auch die Kinder waren bestens versorgt. Es war sooo perfekt. Und dann das.
Ich gebe zu, dass mich Moritz’ Pläne meuchlings aus unserer so schön ausgepolsterten Bahn geworfen haben. Auf meiner letzten Fahrt in die Firma war ich in der Tat richtig wütend auf ihn und überlegte angestrengt, wie ich ihn doch noch umstimmen könnte.
Beim intensiven Nachdenken über dieses anspruchsvolle Problem hätte ich beinahe noch einen Unfall gebaut. Was war ich froh, dass ich gerade noch die Kurve gekratzt hatte und mich, zwar neben der Straße, aber heil auf der Wiese fand.
Ich verstand erst nach einer ganzen Weile, dass ich zwar unversehrt war, mich aber nicht mehr in meinem gewohnten Leben befand. Ich hatte gewissermaßen, ohne dass ich es zunächst merkte, die Sphären gewechselt. Ich war nicht nur aus der Firma und aus der Straße geflogen, sondern komplett aus meinem Leben.
Diese Tatsache fügte sich nahtlos in eine Reihe von schicksalsträchtigen Vorfällen ein, die sich in jenen Wochen in meiner Umgebung ereigneten.
Am Tag davor war ich noch sorgenvoll wegen meiner verhinderten Zukunft als Firmenchefin durch unsere reizvolle Stadt spaziert, die belebte Hauptstraße entlang mit den vornehmen alten Fachwerkhäusern, den Läden und Cafés, den Bäckereien und Metzgereien, alles überragt von der mächtigen Kirche aus dem 14. Jahrhundert, wobei ich bemerkenswert viele Leute traf, mit denen ich vertraut war.
Gute Freunde, gute Feinde. Bemerkenswert deshalb, weil es ein ganz normaler Werktag war. Hatten die nichts zu tun? Ich hatte leider auch nichts zu tun, weil Moritz mich ja nichts tun lassen wollte.
Bemerkenswert war auch, wie nachdrücklich ich daran erinnert wurde, dass sich die Dinge des Lebens schnell ändern können, ganz schnell.
Zum Glück wusste ich das meiste noch nicht bei meinem Rundgang durch die Stadt, sonst hätte mich noch eine Depression der ganz anderen Art überfallen als nur diejenige wegen der verlorenen Firma. Ich betrauerte bisher zutiefst den Tod von Teresa, der sich kürzlich ereignet hatte, und den von Lisette, wenige Tage darauf. Das war schon schlimm genug.
ZWEI
Es war ein windiger, aber sonniger Morgen im Frühling, die Äquinoktialstürme hatten die ganze Nacht um unser Haus gefaucht und ich schlüpfte genüsslich zu Moritz unter die Bettdecke, bevor ich aufstand. Moritz drückte seine Arme um mich und seinen schlafwarmen Körper an mich und flüsterte mir schlaftrunken ins Ohr: „Ich liebe dich!“ Keiner konnte das so wie er, mir zu sagen: Ich liebe dich. Gut, es war wohl auch nicht im Sinne der Erfindung unserer Ehe, dass das jemand anderer auf diese Weise tat. Ich genoss die Liebe mit ihm.
Als ich mich aus seinen Armen wand und aufstand, barfuß zum offenen Fenster hinüber lief, vor dem der Wind die weißen Vorhänge aufbauschte, und fröstelnd in den Garten hinaus schaute, fiel mir wieder ein, was für ein Tag heute war. Moritz und ich hatten ja nicht nur eine heiße Liebe, sondern ebenso heiße Streite. Wir stritten uns eifrig, heftig und regelmäßig. Und heute war einer der Höhepunkte unserer Auseinandersetzungen erreicht. Heute sollte ich Moritz seine Firma wieder zurückgeben, die ich mir so mühsam und listenreich erobert hatte. Es ist wirklich nicht leicht, Pepa zu sein.
Später düste ich äußerst verärgert durch die kurvenreiche enge Straße, die von unserem Haus auf dem üppig bewachsenen Hügel einem idyllischen kleinen Flusstal entlang hinüber zur Hauptstraße in die Stadt führte.
Die kommende Kurve liebte ich besonders. Sie war lang und führte eng um einen fast kreisrunden, zu dieser Jahreszeit mit farbenfrohen Blumenwiesen übergossenen Berg herum, auf dessen Gipfel ein einzelner prachtvoller ehrwürdiger Ahorn thronte. Einige alte Bäume säumten die Straße. Sie war eigen, diese Kurve, eigen wie die auffallende Erhebung, um die sie sich innig schmiegte. Sie war eine reizvolle Herausforderung und mein Herz klopfte jedes Mal vor Lust und Aufregung, wenn ich mich anschickte, sie rasant und dabei elegant zu nehmen. Ich hatte sie immer perfekter im Griff. Aber heute hatte ich nicht bedacht, dass ich wütend war, sehr wütend.
Verdammt.
Um ein Haar hätte ich einen Unfall gebaut. Ich bin so erschrocken, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich aus dem Auto gekommen bin. Aber egal, ich habe die Kurve wieder einmal besiegt. Ich stieß einen tiefen Seufzer aus: Es ist noch einmal gut gegangen. Eine Riesenerleichterung durchströmte mich. Ich hätte tot sein können! Ich schüttelte befreit den Kopf und atmete tief durch. So ein Wahnsinn! So ein verdammtes Glück! Das muss man erst einmal haben! Ich bin eben doch ein Liebling der Götter. Ich begann mich zu entspannen, fühlte mich unbeschwert, leicht und heiter. Ich wollte gerade anfangen, mich hemmungslos über diesen himmlischen Zustand zu freuen, als ich es sah.
Es war furchtbar. Da muss jemand schon vor mir mit voller Wucht gegen den Baum geprallt sein. Genau an dieser Stelle, die ich soeben noch ganz knapp umschifft hatte. Nicht weit von mir entfernt lag ein kaputtes Auto, das Dach eingedrückt, der Motorraum wie ein Riesenmaul weit aufgerissen. Genau vor der wunderbaren Eiche, einem der eindrucksvollsten Bäume in dieser Umgebung. Ich kenne mich mit Bäumen gut aus. Sie interessieren mich. Ich fühle mich wohl in ihrer Nähe. Sie beschützen mich. Es war unheimlich still. Die Farbe des Fahrzeugs war rot, und das kam mir noch nicht wirklich seltsam vor.
Ich ging umher, um die Zerstörung zu betrachten. Dabei fiel mir auf, dass ich mich mit meiner üblichen Leichtigkeit bewegte. Wie eine Feder. Meine Aktion hatte mir demnach nicht geschadet. Das einzige, womit ich auf all das um mich herum reagierte, war Verwirrung, die, zuerst diffus im Hintergrund, sich steigerte. Um mich zu überwältigen, als ich zwischen den Trümmern eine Frau auf der Wiese sah. Sie lag blutverschmiert nicht weit von dem kaputten Auto entfernt im leuchtend grünen Gras zwischen lila Wiesenschaumkraut, weißem Wiesenkerbel und gelbem Hahnenfuß.
Ich hielt zuerst die Luft an und stieß dann einen tiefen Seufzer aus.
Jemand berührte meine Schulter. Ich schaute mich flüchtig um und sah einen Typ hinter mir stehen. Gut. Er musste mir helfen, die Dinge zu erledigen, den Krankenwagen rufen, den Notarzt, die Polizei. Ich konnte meine Augen nicht mehr von der Frau abwenden.
Er schaute ebenfalls auf die Verunglückte herunter.
„So eine Bescherung!“, sagte er mit einer ausdrucksstarken Stimme, die verärgert klang.
„Was ist mit ihr?“, flüsterte ich und eine heftige Angst durchströmte mich.
Seine Stimme war jetzt weich und mitfühlend: „Sie ist tot.“
Nach einer ziemlich langen Weile flüsterte ich: „Die sieht mir ähnlich.“
Er nickte.
„Die sieht genauso aus wie ich.“
Er nickte wieder.
Ich geriet in Panik: „Ja und? Was ist hier los?“
Er hatte helle, ausgeprägte Augenbrauen, die er jetzt leicht zusammenzog. „Verstehst du das nicht?“, Dass er mich duzte, störte mich.
„Ich habe es kommen sehen“, er schüttelte den Kopf. Er wirkte missmutig.
„Verdammt noch mal, was reden Sie da. Die Frau braucht Hilfe, das ist doch jetzt mal das Wichtigste.“
„Die Frau bekommt Hilfe. Und im Übrigen kannst du mich duzen. Ich werde dir helfen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.“
Ich schnaufte.
„So eine Bescherung“, murmelte er wieder. Das sah ich selber. Er begann mir unheimlich zu werden.
„Hören Sie“, sagte ich, so kühl ich konnte, „das Beste ist, Sie verschwinden jetzt.“
Ich überlegte, wo ich mein Handy gelassen hatte. Auch meine Handtasche hatte ich nicht bei mir. Ich wollte sie aus dem Auto holen.
Aber ich fand mein Auto nicht.
Während ich suchend um mich blickte, kam mir alles immer seltsamer vor, einschließlich meinem Nebenmann, der sich überhaupt nicht einordnen ließ.
Auf jeden Fall ein Exzentriker. Der hatte mir hier gerade noch gefehlt. Mit seinen auffälligen blonden Locken, seiner sehr aufrechten großen Gestalt, seiner hellen sommerlichen Kleidung. Er sah gepflegt aus. Unter anderen Umständen hätte ich den Anblick durchaus genossen. Tintenfarbene intensive Augen, die mich unwillig anschauten, frisches, wohlgeformtes Gesicht, ein ausgeprägter Mund, der leicht zusammengekniffen war, so, als wollte er nicht aussprechen, was ihm auf der Zunge lag, was auch immer das war, keine Ahnung, ein ansehnliches energisches Kinn. Er schüttelte den Kopf und seufzte.
„Verschwinden Sie!“, sagte ich beunruhigt.
Er reagierte nicht darauf. Er blieb stehen, wo er war und sah mich jetzt freundlich an. „Könntest du mal versuchen, mir zuzuhören?“, fragte er. Ich schüttelte gereizt den Kopf.
„Es wird dir nichts anderes übrigbleiben“, sagte er gelassen und fügte hinzu: „Ich helfe dir. Ich bin ab jetzt dein Begleiter. Wir sind übrigens alte Bekannte, woran du dich im Moment vermutlich nicht erinnern kannst. Sehr gute Bekannte.“
„Hören Sie“, sagte ich streng, „lassen Sie mich in Ruhe. Auf so eine Hilfe kann ich wirklich verzichten.“ Ich fixierte ihn. Und als er keinen Fuß bewegte, um sich vom Acker zu machen, hätte ich am liebsten mit einem kraftvollen Stoß nachgeholfen. Aber ich traute mich nicht.
Er stand nur da und sah mich geduldig an. Dann blickte er kopfschüttelnd auf die Unglückstelle. „So eine Bescherung“, sagte er wieder.
Ich bekam Angst. Ich stand hier mitten in einem verwirrenden Schlamassel und dann kommt mir dieser komische Typ in die Quere. Ich starrte wieder auf die Frau, die vor mir in der Wiese lag. Im Gesicht hatte sie blutige Schürfwunden, in den schwarzen kinnlangen Haaren, direkt über dem dicken bis zu den Augenbrauen reichenden Pony klaffte eine Wunde, bei deren Anblick es mir schaudernd das Gesicht zusammenzog, die Beine in der langen blauen Sommerhose waren seltsam verbogen und die Hose hatte einen langen blutigen Riss. Eine der weißen Sandalen fehlte, die andere hing noch am Fuß, der in einem ungewöhnlichen Winkel abstand. Der Pullover könnte einmal weiß gewesen sein.
Der Pullover war einmal so schön, dachte ich betrübt, mit dem feinen Waffelmuster, ich hatte ihn so gemocht. „Ich hatte ihn gemocht?“, stöhnte ich nervös. „Wieso hatte ich ihn gemocht? Das ist doch gar nicht meiner? Der kann doch hier nicht so kaputt herumliegen? Das ist doch überhaupt nicht meiner!!! Und die weißen Sandalen, die ganz neu waren, wie sehen die aus? Das sind doch nicht meine!!! Und die blaue Hose, das ist nicht meine Hose! Nein!!“ Ich schaute an mir herunter. Ich hatte ein jadefarbenes Sommerkleid an, das ich noch nie gesehen hatte. Ich meinte mich zu erinnern, dass ich, als ich von zu Hause wegfuhr, blaue Hosen trug.
Ich schrie den Typ an: „Das alles hat doch mit mir gar nichts zu tun!“
„Nicht mehr“, sagte er. „Du kannst dich also beruhigen.“
Ich hatte überhaupt keine Lust, mich zu beruhigen. Andererseits, so gerne ich mich aufregte, merkte ich doch, dass das hier gerade keinen Spaß machte. Irgendetwas klemmte.
„Was heißt: nicht mehr? Was ist hier eigentlich los?“ Ich schaute den Typ aufgebracht an, und der Typ sagte:
„Ganz einfach: Du bist tot. Der Körper, der da liegt, war bis vor kurzem deiner. Du hättest deinen Versuch, wie schnell du durch die Kurve kommst, nicht austesten sollen, wenn du abgelenkt bist.“
Mir fiel nichts anderes ein, als laut und deutlich „verdammt!“ zu sagen. Der Typ lächelte, dann wurde er streng.
„Wenn du mir zuhören würdest, könnte ich dir erklären, was passiert ist. Als erstes musst du akzeptieren, dass ich ab jetzt dein Begleiter bin. Du kannst mich auch Engel nennen.“
„Engel?“, stotterte ich, und für einen Moment war ich belustigt, „Engel? Gibt’s die?“
Er lächelte nachsichtig. „Was ihr darunter versteht, ist ein bisschen schlicht. Aber geh einfach mal davon aus, dass da im endlosen Universum etwas existiert, das sich euch unter bestimmten Bedingungen als Engel zeigt.“ Er machte dabei eine knappe, entschlossene Bewegung mit seiner linken Hand. Ich wurde gereizt.
Engel? Dass ich nicht lache. Also so konnte er mir nicht kommen. Ein schöner Engel war das. Seit wann stehen Engel zwischen kaputten Autoteilen herum? Wenn ich mal sterben werde, hatte ich mir immer vorgestellt, möchte ich von einem weisen, heiteren, gescheiten Engel empfangen werden. Aber bestimmt nicht von einem, der sich auf einer Wiese herumtreibt. Ich hatte mir da auf jeden Fall den Himmel vorgestellt. Und noch war ich schließlich nicht tot. Am liebsten hätte ich gesagt: Engel sind keine Idioten. Oder umgekehrt. Aber ich war hier immer noch ganz allein mit ihm und fühlte mich unbehaglich.
Dabei sah er eigentlich nicht gefährlich aus. Ich murmelte: „Träume ich?“ Der Typ, der sich Engel nannte, sagte: „Man könnte es einen Traum nennen, so wie man das, was vorher war, auch einen Traum nennen könnte. Das kannst du einordnen, wie du willst. Ist egal.“
Er nervte. „Hier ist überhaupt nichts egal!“ Ich spürte Tränen in meinen Augen. „Ich geh jetzt heim. Zu Moritz“, schluchzte ich auf.
Der Typ sah mich mitfühlend an. „Das geht allen so, den meisten zumindest. Es handelt sich ja auch um eine ziemliche Veränderung. Und bei dir kam es noch dazu reichlich plötzlich.“ Dann fügte er hinzu, es klang resigniert: „Wie meistens bei dir.“
Ich konnte nicht sagen, dass die Dinge damit für mich klarer wurden. Ich trocknete meine Tränen mit dem Handrücken von den Augen und den Wangen und sah dann wieder an mir herunter.
Mein Kleid ging in einem schwingenden Rock bis knapp über meine Knie, das Kleidoberteil lag eng an, hatte einen runden Ausschnitt und keine Ärmel. Ich schaute hinunter auf meine nackten Beine, wunderschön, stellte ich fest (waren sie schon immer so schön?), und ausnehmend hübsche Füße, die in meinen geliebten weißen Slippern steckten. Ich bog den Kopf und sah den Ausschnitt an. Mein Dekolletee glänzte leicht und zeigte den Ansatz meiner hübschen Brüste, alles wie immer. Gefiel mir. Wie immer. Wenn das wirklich mein Engel war, und ich tot war, wie konnte ich dann Gefallen an meinem Aussehen finden?
Ich merkte, wie ich abdriftete. Der Typ sah mich freundlich an. Mir wurde die Sache immer rätselhafter und ich überlegte: Woher habe ich überhaupt einen Körper, wenn ich angeblich tot dort lag, und woher kommen das Sommerkleid und meine Slipper? Ich strich meine kinnlangen schwarzen Haare hinter die Ohren, und überlegte, warum ich eigentlich Ohren hatte, wenn meine eigenen angeblich ziemlich mitgenommen an der toten Frau hingen?
Ich wurde immer verwirrter. Und sagte mir, dass ich mich auf meinen merkwürdigen Begleiter, wer auch immer das war, vorübergehend und versuchsweise einlassen musste. Ich allein jedenfalls konnte das nicht bewältigen. Ich versuchte, ihn mit ruhiger Stimme zu fragen:
„Was ist eigentlich passiert?“
Er sah mich erleichtert an.
„Na endlich“, sagte er, „das war vielleicht eine schwere Geburt.“
„Geburt?“, fragte ich. „Ich dachte, ich sei tot.“
„Kommt aufs gleiche heraus“, sagte er.
„Worauf?“, fragte ich ungeduldig.
„Du bist gegen den Baum gerast.“
„Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich kann mich an nichts erinnern.“
„Ein Grund zur Freude. Denn angenehm ist das nicht, aber bei dir war es zum Glück schnell vorbei. Wie immer. Dein Motto: Schnell, schnell, schnell. Wie sich zeigt, nicht immer zu deinem Besten.“
Ich kam nicht dazu, mir Gedanken darüber zu machen, denn jetzt passierte an der Unfallstelle endlich etwas. Ein schwarzes sportliches Auto brauste von rechts heran, wurde langsamer und hielt am Straßenrand. Der Fahrer, ein junger Mann mit kurzen hellen Haaren und Sonnenbrille, stieg aus und wurde sichtbar blass. Ich kannte ihn, er wohnte in unserer Nachbarschaft. Er zog mit einer unsicheren Geste ein Handy aus der Tasche seiner graugrünen Jacke. Seine Beine in den blauen Jeans schwankten leicht. Seine Stimme klang gepresst.
„Der Arme“, sagte der Typ neben mir, „vermutlich sein erster Unfall. Zum Glück nicht sein eigener.“
Ich lief auf den jungen Mann zu und rief, er solle Hilfe holen. Er reagierte nicht auf mich, tat so, als sei ich Luft. Trottel.
Der Typ lächelte milde und sagte: „Er kann dich nicht sehen. Komm, wir setzen uns dort auf den umgesägten Baumstamm, von da aus können wir alles gut beobachten, oder ist dir lieber, wenn wir gleich verschwinden?“
Das Wort Verschwinden rauschte an mir ungehört vorbei. Weil ich mich in etwas anderes verkeilte.
„Er kann mich nicht sehen? Wieso denn das? Ich sehe ihn doch auch ganz deutlich, und mich auch und alles andere hier auch. Wieso kann er mich nicht sehen?“
„Weil du für ihn tot bist. Er sieht nur deinen toten Körper. Schau, jetzt hat er ihn entdeckt. Er ist schockiert, aber ich kann ihm leider nicht helfen.“
„Er sieht aus, als müsste er sich übergeben“, sagte ich und wäre am liebsten zu ihm hingelaufen, um ihn zu beruhigen. Er sah so jung und hilflos aus.
„Ich soll gegen den Baum gerast sein?“, fragte ich den Typ, der sich Engel nannte. Wir hatten uns inzwischen auf dem Baumstamm niedergelassen. Ich konnte mich immer noch an nichts erinnern.
„Dafür, dass du wütend warst, bist du bist zu schnell gefahren.“
Moritz fiel mir ein. Unser Streit. Ich war ein bisschen durcheinander. Aber zuerst musste ich etwas richtigstellen. „Zu schnell? Das ist übertrieben. Ich liebe Autofahren. Ich fahre gut. Ich fahre gerne ein bisschen zügig, wenn ich auf einer Straße allein bin, aber ich achte immer auf Sicherheit. Es ist ja auch nie was passiert.“
„Hm“, brummte der Typ, „wie man sieht. Aber lassen wir jetzt die Haarspaltereien. Jemand hat dich abgedrängt.“
„Was??“
Ich fing an zu zittern. Das konnte nicht sein. Ich war ganz allein gewesen, als ich in die Straße einfuhr. Daran konnte ich mich plötzlich wieder deutlich erinnern. Es war nur eine kleine Straße, die Verbindung zur Hauptstraße in die Stadt.
„Nachdem du ihn zuvor behindert hast. Du hast es gar nicht bemerkt. Du warst abgelenkt und darum unkonzentriert. Der andere kam dir geringfügig in die Quere, du musstest deinen Kurs ein bisschen korrigieren, und das war es.“
Ich war stinke sauer, wenn auch nicht mehr auf Moritz: „Was? Abgedrängt? Diese Sau. Und jetzt?“
„Bist du tot. Nach Erdendenken.“
„Ach ja, sagtest du schon. Und der andere? Wer war es überhaupt?“
„Lebt. Und wer es war, ist egal.“ Nach einigem Nachdenken fuhr er fort: „Na, so egal auch nicht, denn du sollst ja aus deinem Leben lernen.“
„Wie bitte? Hier soll ich was lernen? Wie das?“
Er lächelte kurz und sah mich dann wieder streng an: „Eure feinen Feindschaften ufern manchmal ein bisschen aus. Der andere, der übrigens auch kein Unschuldslamm ist, hatte dieses Ergebnis allerdings nicht geplant. Er war bereits nach links auf den Feldweg abgebogen und hinter dem ausladenden Gebüsch verschwunden, als du von der Straße abgekommen bist.“
„Lenk nicht ab“, sagte ich, „das heißt: Ich bin ermordet worden.“ Der Typ schüttelte den Kopf. Und jetzt bin ich angeblich tot. „Der kann sich auf was freuen!“ kündigte ich kampflustig an, während der Typ milde lächelte. Als mein Zorn sich etwas verzogen hatte, schaute ich ihn misstrauisch an: „Woher willst du das alles so genau wissen?“
Bevor er antwortete, waren Sirenen zu hören. Polizei, Notarztwagen und Krankenwagen bogen um die Kurve. Die kommen wohl ein bisschen zu spät, dachte ich nervös. Zwei Männer und eine Frau stiegen aus und sahen sich das Desaster an. Einer rannte sofort zu mir hin, also zu meiner Leiche, bückte sich zu ihr herunter und tastete vorsichtig an ihr herum. Dann richtete er sich wieder auf und seufzte. Ich fand, ein bisschen mehr Mühe hätte er sich schon geben können.
Ich stand auf, um besser sehen zu können, was der Polizist und seine Kollegin jetzt um mich herum machten. Der Typ sagte: „Du kannst ruhig näher hingehen, wenn dich das interessiert. Sie können dich nicht sehen.“
„Und wenn einer über mich stolpert oder wir zusammenstoßen?“
„Geht auch nicht. Sie sind sozusagen von einer anderen Welt.“
Das drang jetzt immer mehr zu mir durch. Ich war tot. Und ich war nicht nur tot, sondern ermordet worden.
Ich fragte den Typ, den ich wohl jetzt auch Engel nennen konnte (vorübergehend): „Wieso ermordet? Ich habe doch niemandem etwas getan!“ Mein Engel sagte, dass das einige Leute eben anders gesehen haben. Und dass ich ja nicht mit Absicht ermordet wurde. Mehr aus Versehen. Ich ärgerte mich: „Na komm, du als mein Engel müsstest doch wissen, was für ein guter Mensch ich bin.“
„Schon. Du hättest es vielleicht öfter mal zeigen sollen.“
Ich hielt mich zurück und beschloss, Einsicht zu demonstrieren, war vielleicht nicht so unklug: „Gut, ich werde darüber nachdenken.“ Alles musste ich ihm schließlich auch nicht auf die Nase binden.
Ich hatte mich wieder brav auf den Baumstamm niedergelassen. Ich musste mich als Leiche nicht länger so genau ansehen. „Nicht dass ich noch Alpträume bekomme“, murmelte ich. Und dabei erinnerte ich mich wieder an mein Bett, an Moritz an meiner Seite. Ich fand, es war jetzt genug hier.
„Und jetzt gehe ich wieder zurück“, sagte ich mit Entschiedenheit.
„Zurück? Wohin zurück?“
Mein sogenannter Engel hatte seinen rechten Fuß, der in einem weichen eleganten königsblauen Schuh steckte (ich betrachtete das schöne Stück entzückt, so etwas ähnliches, nur in anmutiger Frauenform, hätte ich auch gern, war aber nicht sicher, ob ich danach fragen sollte), auf den Baumstamm gestellt, seine Arme locker um das angewinkelte Knie gelegt und wirkte völlig entspannt.
Seine prachtvollen Haare lagen immer noch wohlgestaltet um seinen Kopf.
„Na, zu Moritz und den anderen eben.“ Wenn dort auf der Wiese alles abtransportiert sein würde, was wohl jetzt seinen Anfang nahm, da der Leichenwagen hielt und ein trostlos unschönes blechernes Etui herausgeschoben wurde, sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Irgendwann würde die Wiese wieder aufgeräumt sein und viel frisches grünes Gras und bunte Blumen üppig darüber wachsen, und kein Mensch würde mehr an die ganze Geschichte denken. Total schöne Aussichten.
Trotzdem wurde es mir etwas mulmig. Schließlich packten sie jetzt gewisse Überreste in den Sarg. Aber dann sagte ich mir: Was soll’s? Ich sitze hier und bin lebendig. Das ist die Hauptsache.
Ich sah meinen Engel erwartungsvoll an. Der sagte gelassen: „Meine Freundin, so schnell geht das nicht.“
„Wie meinst du das?“
„Ich will sagen, dass du jetzt nicht zurück kannst.“
„Wann dann?“
„In hundert Jahren vielleicht.“
DREI
Das saß. Ich fing an, schwer zu atmen. Dann sprang ich beunruhigt hoch: „Ich kann nicht zurück? Was willst du damit sagen? Ich bin doch schon hier. Ich verstehe das nicht.“
„Und wie stellst du dir das vor?“
„Na, ganz einfach. Zum Beispiel lege ich mich ins Gras, schlafe ein und wache in unserem Bett neben Moritz auf. Am liebsten in seinen Armen. Wahrscheinlich schläft er noch und hat gar nicht mitgekriegt, dass etwas passiert ist.“
Mein Engel fing an zu lächeln, hörte aber gleich damit auf, als er meinen Blick sah. „Was gibt es da zu lachen? Hier jedenfalls bleibe ich nicht.“
Mein Engel sagte freundlich: „Jetzt bist du erst mal tot und kannst dich wunderbar ausruhen und wirklich viel lernen. Das ist dann für dein nächstes Leben. Damit das nicht wieder so abrupt endet.“
Ich wurde trotzig. „Kann ich doch nichts dafür.“
Mein Engel schüttelte nachdrücklich den Kopf: „Wie oft bist du nach einer Meinungsverschiedenheit mit Moritz zu schnell in diese Kurve gefahren, und hast dabei wütend gedacht: Dem zeig ich’s.“
Ich schwieg. Dann interessierte mich aber doch: „Woher willst du denn das wissen?“
„Weiß ich halt. Also: Wie oft hast du das gedacht? Und noch dazu mit einiger Inbrunst?“
Ich ärgerte mich. Kann ich nicht einmal geheime Gedanken haben, ohne dass mir da gleich ein Engel dazwischen funkt?
„Na?“
„Da war ich halt wütend!“
Mein Engel fragte freundlich: „Was meinst du, was mit den Gedanken passiert, die deinen Kopf verlassen? Meinst du, die verschwinden in der blauen Luft? Das tun sie nicht. Kannst du dir vorstellen, dass sie Kraft und Energie haben? Dass sie versuchen, in irgendeiner Form in deinem Leben zu erscheinen? Darum ist es ganz nützlich, zu wissen, was du denkst.“
„Und wenn ich jetzt denke: Ich möchte zurück?“
„Manche Gedanken brauchen etwas mehr Zeit. Aus gutem Grund.“
„Was für ein Grund sollte das sein?“
Mein Engel grinste fröhlich: „Ich weiß: immer schnell, schnell, schnell. Für etwas anderes hast du gar keine Zeit. Aber wenn du nur kurz überlegst, was du so den ganzen Tag zu denken pflegst, ist es vielleicht ganz gut, wenn deine Gedanken nicht sofort Wirklichkeit werden. Da kämst du aus dem Bedauern und Bereuen gar nicht mehr heraus, von anderen Katastrophen ganz zu schweigen. Aber das behandeln wir alles noch in aller Ruhe. Falls dir das Wort Ruhe etwas sagt.“
„Behandeln wir? Wie meinst du das?“
Er legte mir sachte die Hand auf die Schulter. Ich schüttelte sie sofort ab. Ich wollte mich nicht beruhigen lassen. Ich wollte zurück. In mein Leben. Egal welche Gedanken ich hatte. Und überhaupt: Heißt es nicht, die Gedanken seien frei?
„Herrscht hier etwa Zensur?“, fragte ich ihn misstrauisch.
Mein Engel seufzte: „Wenn du mit Zensur meinst, dass jemand anders über dich bestimmt, dann herrscht hier keine Zensur.“
„Und warum darf ich dann nicht denken, was ich will?“
„Du darfst alles denken, was du willst. Der springende Punkt ist, dass du für jeden einzelnen noch so winzigen deiner Gedanken die Verantwortung übernehmen musst.“
„Moralapostel“, murmelte ich. Mit einem geheimen Vergnügen bemerkte ich, dass er sich darüber ärgerte. Stimmte ja auch. „Ich habe jetzt schließlich andere Sorgen“, sagte ich und schaute auf die Unglückswiese. Der Polizist und seine Kollegin waren immer noch am Messen und Schauen und Notieren und Fotografieren. Der Arzt und der Leichenwagen waren weggefahren.
„Ohne mich, ich meine, ohne meine Leiche ...“, und jetzt begann ich plötzlich zu zittern, die Verwirrung stürzte über mir zusammen, ich hatte immer noch das Gefühl, in einem seltsamen Film zu sein und jeden Moment konnte er zu Ende sein und ich konnte aufstehen und mit den anderen aus dem Kino rausgehen und vielleicht noch eine heimliche Träne aus dem Augenwinkel wischen, die mir den Blick getrübt hatte, und Moritz sollte nicht sehen, wenn ich ein bisschen sentimental wurde, und dann würden wir nach Hause fahren, noch ein gemütliches Glas Wein trinken, genüsslich über den schrecklichen Film lästern und ihn dann vergessen, und fröhlich ins Bett steigen, ich würde mich noch kurz an Moritz kuscheln und mich dann umdrehen, ein langgezogenes „Schööön im Bett“ seufzen, wie ich es meist vor dem Einschlafen mache, und mich dann den Träumen hingeben, mit der Gewissheit, dass die morgen früh, wenn ich die Augen aufschlug, vorbei waren. Aus. Fertig. Nicht mehr wahr.
Ich seufzte tief und merkte, dass der Alptraum noch da war, und dennoch: „... ohne mich, ich meine ohne meine Leiche sieht der Ort nicht mehr ganz so schrecklich aus.“
Ich weinte. Das Weinen ging in wildes Schluchzen über. Was hatte ich getan! Wie konnte ich nur gegen den Baum fahren! Da fiel mir ein, dass ich dieses Debakel jemand anderem zu verdanken hatte. Das Schluchzen hörte schlagartig auf. „Diese Sau!“ wiederholte ich aus tiefstem Herzen.
Mein Engel seufzte, es klang erleichtert.
„Na also, wird schon“, sagte er. Ich war nicht seiner Meinung.
„So“, sagte mein Engel freundlich, „da kommen dann noch Leute, die alles hier wegräumen und saubermachen, aber da willst du doch nicht wirklich zuschauen, oder?“
Ich schüttelte den Kopf. Jetzt, da meine ... Leiche – ich hatte noch Probleme bei dem Wort – nicht mehr da war, wollte ich auch nicht mehr hierbleiben. Ich fühlte mich plötzlich einsam ohne meine Leiche. Bisher hatten wir irgendwie noch zusammengehört, wenn auch auf etwas befremdliche Weise. Es war noch auf eine spezielle Art in Ordnung gewesen.
Aber jetzt, wo sie weg war? Ein ganz trostloses Gefühl. Ich war tieftraurig und verzweifelt. Ich war jetzt ohne mich, aber ich war doch hier, und gleichzeitig fehlte ich, und ich wusste nicht, wo ich war, wohin man mich bringen würde, und was sollte ich ohne mich machen, und warum hat der Arzt nicht versucht, mich wieder auf die Beine zu stellen, und wie sollte ich ohne mich weiterleben können, und was wird aus mir, um Himmels willen, was wird jetzt aus mir?
Mit zitternder Stimme fragte ich: „Was passiert jetzt mit mir?“
„Darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Das werden wir uns jetzt gemeinsam überlegen“, kündigte er an.
„Nein“, rief ich ungeduldig und erschöpft, „was mit mir wird, will ich wissen. Ich meine ... mit meiner ... Leiche!“ Ich fing an zu stottern. Meinem Engel schien das nicht so zu schaffen zu machen wie mir. Na ja, er hatte gut lachen, er war schließlich auch nicht tot. Obwohl ich ihm zugutehalten musste, er lachte natürlich nicht.
Vielmehr sah er mich mitfühlend an und sagte: „Deine Leiche wird noch einmal genau untersucht.“
O Schreck!
„In der Pathologie etwa?“
Ich hatte das in den Fernsehkrimis immer mit Gefühlen zwischen neugierig und abgestoßen angeschaut, ja, man konnte sagen, ich habe es als Unterhaltung durchaus genossen. Aber jetzt? Und das mit mir? Das war gar nicht mehr unterhaltsam. Das war einfach schrecklich. Der Gedanke warf mich noch mal um.
Ich klammerte mich an meinen Engel und flehte: „Kannst du das denn nicht verhindern?“
Er schüttelte den Kopf: „Wirklich nicht. Oder meinst du, da könnte so ohne weiteres ein Engel durchs Fenster fliegen und deine Leiche mitnehmen? Und selbst wenn: Was würdest du mit ihr machen wollen? Du bist jetzt tot, und das andere musst du hinter dir lassen, dieses Leben ist abgeschlossen. Das haben Leben so an sich. Das ist ganz normal. Daran ist überhaupt nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Du könntest anfangen, dich auf dein neues Leben zu freuen.“
Ich hatte Zweifel. „Gibt es hier überhaupt ein neues Leben? Und wo? Doch nicht hier auf der Unglückswiese? Und warum kann ich denn nicht einfach heimgehen, zu Moritz? Das sind vielleicht fünf, sechs Kilometer. Die mache ich glatt zu Fuß. Du müsstest dich also gar nicht mehr groß um mich bemühen. Du wärst wieder frei für andere, schwierigere Fälle.“
Er lachte wieder sein heiteres Lachen. Seine Augen, die jetzt in einem tiefgründigen irisierenden Grau leuchteten, sahen mich fröhlich an. Er steckte die Hände in die Taschen seiner hellen lockeren Hose. „Ich finde, du bist ein richtig schwieriger Fall. Andere brauche ich nicht. Ich bin mit dir ausgelastet.“
Er nahm mich leicht an der Hand.
„Und jetzt komm, hier auf dieser Wiese wollen wir wirklich nicht bleiben.“
Ich sperrte mich, blieb genau dort stehen, wo ich war, und wollte wissen: „Wohin gehen wir?“
„Es wird dir dort gefallen, das verspreche ich dir.“
„Und du bist sicher, dass ich nicht einfach nach Hause gehen kann?“ Ich sah um mich, sah auf die schmale Straße, die sich in altmodischen Kurven durch die Wiesen wand, ein paar knorrige Bäume am Rand, weiter unten der kleine zugewachsene Fluss, über den eine alte verwitterte bemooste Steinbrücke führte, die bewaldeten, sanft geschwungenen Hügel dahinter, alles sah so nah aus, so einfach, so unkompliziert, so alltäglich, wenn er, ich schaute meinen Begleiter missgelaunt an, wenn er nicht überall Schwierigkeiten sehen würde.
Er fragte: „Willst du wissen, was passieren wird, wenn du zuhause auftauchst? Niemand wird dich sehen. So ist nun mal der Tod.“
Ich schaute an mir herunter. „Der Tod?“, fragte ich.
„Oder nenne es Leben, wenn dir das lieber ist, eine Variante von Leben“, sagte er. Leben, meinte er Leben?
„Welches Leben denn?“, fragte ich verängstigt, und er sagte: „Lass dich überraschen.“ Das klang so freundlich und liebevoll und aufmunternd, dass ich schon so weit war, nachzugeben und ihm einfach zu vertrauen.
Da sah ich mein gelbes Auto heranbrausen. Ich wollte besorgt rufen: Moritz, fahr bloß nicht so schnell! Schon hielt er an, sprang aus dem Auto und stürmte auf die Wiese. „Moritz!“, schrie ich außer mir. „Moritz! Ich bin so froh, dass du da bist! Nimm mich mit heim!!!.“ Ich rannte auf ihn zu und stürzte mich in seine Arme.
Er bemerkte mich nicht. Er spürte mich nicht. Er sah mich nicht. Er nahm mich nicht wahr. Mich gab es für ihn nicht. Ich fiel laut weinend in mich zusammen, und im gleichen Moment ließ sich Moritz dicht neben mir auf die Knie sinken und begann aus tiefstem Herzen zu schluchzen.
VIER
Eine ganze Menge Leute waren es, die sich vor dem üppig von Rosen und Efeu und wildem Wein umwachsenen Eingangstor drängelten, als der Schlossführer, ein Kunsthistoriker, heraneilte, um sie einzulassen.
Er war noch in der nahen Stadt einkaufen gewesen und hatte sich verspätet, weil er mal wieder einige Leute getroffen und mit ihnen die letzten Neuigkeiten ausgetauscht hatte. Da hatte er auch erfahren, dass Pepa verunglückt war. Er kannte sie gut. Sie bummelte ab und zu mit ihren Freundinnen durch das Schloss und schaute sich aufmerksam die Gemälde an. Noch etwas außer Atem und mit routinierter Stimme begann er, während er sich die braunen verwehten Haare aus dem Gesicht strich:
„Sie befinden sich hier in dem berühmten Wasserschloss des Grafen Fuhlminter, übrigens ein weitläufiger Vorfahre des jetzigen Bürgermeisters. Es wurde nie ganz fertig gebaut, ein Trakt blieb unvollendet, weil Fuhlminter, der das Schloss seiner Maitresse Teresa schenken wollte, in dem Gebäude umgebracht wurde und danach niemand mehr einziehen wollte. Denn nun spukte es in den Gemäuern, was zahlreiche Zeugen bestätigten.
Das Schloss aus dem 16. Jahrhundert hatte seitdem verschiedene Besitzer. Seit kurzem gehört es der Stadt, die den unvollendeten Trakt fertig stellen möchte, und zwar nach alten Plänen, die in dem Schloss gefunden wurden. Entdeckt hatte sie eine junge Architektin, die dann von der Stadt für den Ausbau beauftragt wurde.
Noch bevor mit den Arbeiten begonnen werden konnte, verunglückte die Architektin tödlich.
Sie wurde von einer Brücke, die unter ihren Füßen einstürzte, mit in den Wassergraben gezogen, der das Schloss umrundet. Niemand hatte vorher bemerkt, dass die Brücke baufällig war, da der unfertige Trakt, zu dem sie führte, nie besucht wurde.
Auf jeden Fall geht es mit dem Ausbau vorerst nicht weiter.
Das Schloss war davor im Besitz des Inhabers und Gründers einer angesehenen kleinen und edlen Schuh-Firma aus der Gegend, der auch ein bekannter Künstler von überdimensionalen Metallskulpturen ist. Auch er sprach davon, dass in dem Schloss seltsame Dinge geschähen, was der Bürgermeister der Stadt für einen Vorwand hielt, um einen höheren Verkaufspreis zu erzielen, denn seitdem ist das Schloss in aller Munde und wird vermutlich eher von Unmengen von Besuchern heimgesucht als von Gespenstern.
Auf diesem Gemälde hier sehen Sie Fuhlminter und seine Frau, Anna Verena, genannt Pepa, aus dem berühmten Geschlecht der Varanesse. Die prachtvollen Kleider und der prunkvolle Hintergrund zeigen, dass Fuhlminter reich war und seinen Reichtum gerne zur Schau stellte. Direkt daneben das Gemälde der Maitresse, Teresa, die eine anerkannte Schönheit war und hochgebildet. Es handelte sich nach Zeitzeugenberichten um eine leidenschaftliche Liebe zwischen den beiden. Fuhlminter hatte offensichtlich völlig den Kopf verloren und sich gegen seine Frau Pepa gewandt.
Kurze Zeit später fand man ihn tot in dem breiten, von gelben Seerosen durchwachsenen Wassergraben, der das Schloss umgibt. Wer ihn umgebracht hatte, wurde niemals bekannt. Man vermutete, dass es der Bruder seiner Ehefrau war, Graf Moritz Varanesse, der mit seinem Schwager noch einige andere Rechnungen zu begleichen hatte. Hier nun das Bildnis von Moritz Varanesse und seiner Schwester Anna Verena, genannt Pepa. Moritz Varanesse war nie verheiratet. Er himmelte, wie allgemein bekannt war, seine Schwester an. Sie sehen, dass sowohl Fuhlminter als auch die beiden Varanesse und die Maitresse ausgesprochen schöne Menschen waren. Sie waren freundlich und im Allgemeinen auch barmherzig, was sie nicht davon abhielt, in ihrer weitverzweigten Familie jeweils diejenigen umzubringen, die sich nicht in die Machtpläne einfügten.”
FÜNF
Ich hämmerte mit meinen Fäusten aufgebracht auf der Wiese herum. Dass Moritz dort lag und weinte und ich nicht zu ihm hinkam, war zu viel. Ich protestierte immer lauter: „Nein, so geht das nicht, ich muss zu ihm!“ Ich stürzte auf meinen Engel zu: „Und du musst mir dabei helfen, wenn du wirklich mein Engel bist.“
Mein Engel sah mich kopfschüttelnd an und sagte trocken: „Was für ein rührendes Bild.“
Seine Stimme wurde schärfer: „Was seid ihr Menschen für Ignoranten. In den Zeiten, die euch geschenkt, ich wiederhole geschenkt werden, damit ihr euch LIEBEN könnt, streitet ihr euch. Verachtet ihr euch. Denkt ihr schlecht über die anderen. Lasst ihr sie nicht an euch heran. Benutzt ihr nicht euren gesamten Verstand, um euch GUTES zu tun, sondern um euch das Leben schwer zu machen.“
Ich sah auf Moritz herunter, wie er außer sich weiter schluchzte, und wurde in meiner Ohnmacht unglaublich wütend.
Ich schrie meinem Engel an, er mache sich noch lustig über mich. „Und du willst ein Engel sein! Ein Teufel bist du! Ja!“
Er zog die Augenbrauen zusammen und sah mich kühl an. „Du weißt nicht, was ein Teufel ist. Den gibt es hier nicht.“ Er schwieg.
Dann sagte er sehr laut: „Du hattest alles, um mit Moritz und einigen anderen Leuten glücklich zu sein. Und was hast du daraus gemacht? Wieso soll da plötzlich ein Teufel schuld sein? Was hast du aus all deinen Möglichkeiten gemacht? Und jetzt regst du dich auf und ich soll all das für dich ändern, was du selbst verbockt hast.“
Ich war derartig erstaunt darüber, dass ein Engel genauso wütend sein konnte wie ich, dass es mir die Sprache verschlug. Nicht etwa, dass er Recht hatte. Ganz und gar nicht. Mich hier in meinen tiefsten aller Schmerzen und meiner dunkelsten Verzweiflung so herunterzuputzen, das konnte ich mir nicht bieten lassen.
„Dann mache ich das eben ohne dich!“, sagte ich würdevoll und schwebte hochaufgerichtet davon, in Richtung auf mein gelbes Auto, in der festen Absicht, mit Moritz heimzufahren. Der war inzwischen aufgestanden und lief umher und betrachtete die ganze Misere auf der Wiese. Er schüttelte dabei den Kopf, als könne er nicht verstehen, was er dort sah.
Ich lief auf ihn zu und fasste ihn an, schüttelte ihn und rief: „Moritz! Schau doch her, hier bin ich. Du musst mich doch sehen. Nimm mich doch mal in den Arm. Moritz! Moritz!!!!!“
Er bemerkte nichts. Er tat so, als sei ich nicht da. So war er schon immer. Er hat sich schon immer nur für seine Malerei interessiert. Ich drehte mich zu meinen Engel um und rief gereizt: „Siehst du, dass ich Recht hatte? So war er schon immer!“
Mein Engel kam langsam auf mich zu. Er lächelte jetzt wieder freundlich und sah sogar ein bisschen mitfühlend aus: „Ich verstehe dich, mehr als du denkst. Ich will dir helfen, aber du musst das auch zulassen. Und jetzt musst du dieses Leben hinter dir lassen und von hier endlich verschwinden.“
Ich war am Ende. Ich hatte keinen Zugang mehr zu Moritz. Er sah mich nicht. Ich war für ihn nicht mehr da. „Das kommt mir alles so bekannt vor“, schluchzte ich. „Das habe ich ihm immer vorgeworfen: dass ich für ihn nicht da sei, dass er nur für seine Malerei lebte. Was würde ich jetzt darum geben, wenn ich ihm vorwerfen könnte, ich sei für ihn nicht da, und er würde sich beleidigt zurückziehen und wirklich für mich nicht mehr da sein. Ach, wäre das schön.“
Mein Engel nickte verständnisvoll, sein linkes Ohr zuckte, oder war es das rechte? Egal. Durch meine Tränen hindurch sah ich, wie Moritz zurück zum Auto schlurfte, einstieg und langsam davonfuhr. Ohne mich.
Mein Engel nahm mich an der Hand und sagte: „Komm, wir setzen uns jetzt wieder auf unseren Baumstamm und beraten, wie wir weiter vorgehen wollen.“
Ich schüttelte entschlossen den Kopf: „Ich will zurück.“
„Das geht im Moment nicht.“
Ich hätte ihm am liebsten mit meinen Fäusten auf die Brust gehämmert, wie ich es bei Moritz ab und zu, wenn ich mich sehr aufregte, getan hatte, wenn er mich absolut nicht verstehen wollte.
Aber mir dämmerte bei allem Unglück dann doch, dass das bei einem Engel vielleicht nicht ganz so passend war.
Ich hielt mich also zurück und sagte ergeben: „Und was jetzt?“
Ich ließ mich neben ihm auf dem Baumstamm nieder und seufzte tiefunglücklich: „Ich liebe ihn so!“ Mein Engel nickte zustimmend: „Und er dich. Das war schon immer so. Und wie oft habt ihr es nicht einmal bemerkt und euch stattdessen bekämpft.“
Ich sah ihn an. Was redete er da?
„Wie meinst du das? Schon immer?“
Er winkte ab. „Das ist im Moment noch zu viel für dich. Ich kann dir schon mal sagen, dass ihr euch seit einiger Zeit liebt. Seit einiger!“
Na ja, dachte ich betrübt, so lange ist es auch wieder nicht. Nicht einmal fünfzehn Jahre waren wir verheiratet.
„Für das vergangene Leben trifft das zu, und es hätte, nebenbei bemerkt, noch gute fünfzig Jahre länger dauern können, glückliche Jahre.“ Er hielt inne. Ich war gereizt. Dauernd musste er mir das wieder unter die Nase reiben. Dann fuhr er langsam fort: „Nach eurer Zeitrechnung seit zweitausendvierhundert Jahren ungefähr.“
Ich sah ihn an, als hätte er einen Sprung in der Schüssel. Vor lauter Staunen vergaß ich für einen Augenblick, dass ich tot war. „Wir lieben uns schon so lange, Moritz und ich? Das kann nicht sein. Das hätte ich doch gewusst. Das heißt ... Ich verstehe nichts.“
„Kommt schon noch“, sagte mein Engel beruhigend. „Ich habe mir einiges mit dir vorgenommen. Ich dachte nur nicht, dass du schon so bald hier auftauchen würdest. Aber ich müsste dich ja inzwischen kennen.“
„Und seit wann kennst du mich?“
Das würde er mir lieber ganz langsam und ganz in Ruhe erklären, meinte er. Aber jetzt sollte ich eine Pause haben.
„Ich brauche ein Bett“, seufzte ich erschöpft. „Ein schönes, weiches, warmes, gemütliches Bett.“
Fast wären mir wieder die Tränen gekommen. Mein Engel deutete mit der rechten Hand hinter sich.
Er hatte übrigens schöne Hände, mein Engel, stellte ich fest. Kräftig, gepflegt, zuverlässig, beruhigend. Ich folgte mit meinen Augen der Richtung seiner Hände und sah hinter mir, am Rand der Wiese, kurz bevor sie zu dem hohen, ebenmäßig runden Hügel mit dem einzelnen beherrschenden alten Ahorn auf dem Gipfel ansteigt, unter einigen ausladenden Linden, deren Knospen sich gerade geöffnet hatten, zwei komfortable Liegestühle, mit Kissen und Decken, eine in sonnenblumengelb, die andere in burgunderrot.
„Und ein Glas Wein“, seufzte ich sehnsüchtig.
„Freu dich erstmal über die Liege“, schlug mein Engel vor.
Ich wurde misstrauisch. „Sollen wir dort übernachten?“ „Ja“, sagte mein Engel, „wenn du nicht lieber an einen anderen Ort möchtest.“
Ich schüttelte den Kopf. Ich konnte mich noch nicht von der Wiese trennen. Was, wenn Moritz noch einmal zurückkommt und mich doch mit nach Hause nimmt? Aber ich sagte das nicht laut, mein Engel würde mich nicht verstehen. Auch andere Bedenken hatte ich.
„Und wenn mir kalt wird? Wenn es regnet?“ Ich schaute auf mein leichtes Kleid herab.
„Dir wird nicht kalt werden, und es wird nicht regnen“, sagte mein Engel bestimmt und fügte hinzu: „Du bist nicht mehr in eurer Dimension, hast du das noch nicht verstanden?“
Nein, habe ich nicht. Ich meine, das hier ist ja eine gewaltige Umstellung, da muss man sich doch langsam daran gewöhnen dürfen. Plötzlich tot sein, dass ist schließlich kein Pappenstiel. Mein Engel deutete freundlich auf die Liegen.
Ich bewegte mich also leicht schwebend hinter ihm her zu den Liegestühlen und beschloss, dass ich mich über nichts mehr wundern würde, nicht einmal darüber, woher diese so plötzlich kamen. Schließlich wunderte ich mich doch und ich fragte meinen Engel. Er sagte, die habe er hergeholt.
Ich wollte wissen, jetzt doch etwas verblüfft, woher er so etwas könne? Er zuckte mit den Schultern und sagte beiläufig: „Gehört zur Ausbildung.“
Inzwischen wurde mir wirklich alles zu viel und ich verlangte keine weiteren Erklärungen mehr. Ich ließ mich auf den sonnenblumengelben Liegestuhl nieder und hatte für einen Moment das himmlische Gefühl, als schwebte ich hinein. Er war überaus bequem. Mein Engel legte sich auf den burgunderfarbenen, streckte seine Beine mit den königsblau beschuhten Füßen aus und grunzte. Es klang genussvoll.
Ich wollte gerade anfangen, mir endlich Gedanken über meinen neuen Körper zu machen, der sich seltsamerweise ganz und gar vertraut anfühlte, als mir prompt die Augen zufielen, ganz wie auf der Erde. Bevor ich hinwegschwebte in noch geheimnisvollere Sphären, wollte ich wissen: „Bin ich jetzt im Himmel?“
Er murmelte: „Die Standardfrage. Kommt aber reichlich spät“, aber ich hörte ihn schon nicht mehr richtig und plötzlich war ich weg. In einem Traum. Ich war bei Moritz in unserem Haus, er lachte und sagte zu mir, ich saß neben ihm auf unserem bequemen Sofa, also er sagte: „Ich freue mich auf unseren freien Tag morgen. Ein ausgedehnter Spaziergang über die Wiese hinauf zu dem hübschen Hügel, weißt du, welchen ich meine? Den mit dem einzelnen Ahorn obendrauf, und dann auf der anderen Seite hinunter an den See, und dort ein kleines Essen auf der Terrasse unter den großen Bäumen! (Platanen, fügte ich automatisch hinzu, er kannte sich nie mit Bäumen aus.) Wir werden uns fühlen wie im Himmel.“ Ich fuhr hoch.
SECHS
Es war ein rosaroter Morgen. Ein paar jugendliche Wölkchen beobachteten mich. Ich schaute mich um. Wir waren immer noch am Rand der Unglückswiese, auf unseren Liegestühlen ausgestreckt, ich hatte mir die weiche Decke bis zum Hals hochgezogen, und mein Engel lag neben mir, ohne Decke, mit geschlossenen Augen.
Das irritierte mich. Es hätte mich ja jeder entführen oder mir sonst was antun, mich sogar umbringen können, während er schlief, bis mir langsam klar wurde, dass das letztere zumindest bereits geschehen war.
Ich brauchte davor also keine Angst mehr zu haben. Das hatte auch was.
Jetzt fiel mir meine Frage wieder ein. Ich berührte meinen Engel sachte am Ärmel seines hellen Pullovers. Er machte sofort die Augen auf. „Bin ich jetzt im Himmel?“
Er seufzte: „Interessiert euch Menschen, wenn ihr tot seid, nichts weiter, ob ihr im Himmel seid?“
„Na ja, der Himmel, ich meine, der Himmel, also ...“, ich kam ins Stottern. Ich schaute ratlos in das filigrane Geäst über mir. Ein paar Vögel hatten ein lebhaftes melodisches Gespräch miteinander.
„Na, was ist mit deinem Himmel?“ Was soll sein. Natürlich möchte ich in den Himmel kommen, wenn ich tot bin. Ich sagte ihm das.
„Und was genau stellst du dir darunter vor?“, fragte er interessiert.
Ich weiß nicht so recht, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber vielleicht auf einer ganz hohen Wolke sitzen, von oben auf die Welt herunter schauen, süßes Nichtstun, schauen, entspannen, nichts tun, weiter herunterschauen, wieder nichts tun, nichts tun.
„Bisschen einseitig“, sagte ich nachdenklich.
„Eben“, sagte er. „Was ihr euch unter Himmel vorstellt, ist vielleicht nicht ganz so himmlisch wie es zuerst klingt.“
Dann machte er eine lange Pause und fing langsam an: „Der Himmel ist nicht so langweilig und fade.“
Zuerst einmal, erklärte er mir, ich sei nicht im Himmel. „Noch nicht“, beruhigte er mich schnell, als er sah, wie ich erschrocken die Augen aufriss.
„Schau“, sagte er, „du bist jetzt in einer anderen Sphäre, nenn sie einfach Vor-dem-Himmel, wenn dich das beruhigt. Hier habt ihr die wunderbare Möglichkeit, eine ganze Menge zu lernen. Und wir sind eure Lehrer.“
Was? Lernen?
„Stell dir mal vor, ihr Menschen kommt alle sofort in euren Himmel. Das wäre ein Theater! Als allererstes würdet ihr neidisch schauen, was die anderen mehr oder besser haben. Die schönere Wolke zum Beispiel, die schönere Aussicht, die schönere Hautfarbe“, sein kurzes Lachen klang nachsichtig. „Und dann gäbe es Streit, negative Gedanken, was euch eben so alles auf der Erde plagt. Ihr würdet aus reiner Gewohnheit versuchen, euch gegenseitig auszubeuten, zu unterdrücken, umzubringen, Kriege zu führen. Was bitte soll das denn im Himmel! Was wäre denn das für ein Himmel?“
Er machte eine Pause, sah mich mit seinen kraftvollen Augen an, die jetzt in intensivem Türkisgrün leuchteten, und fuhr dann leidenschaftlich fort: „Ich will mich nicht über euch Menschen auf der Erde lustig machen. In vieler Hinsicht und von eurer Anlage her seid ihr großartig. Aber ich will auch sagen: Wenn ihr endlich kapieren würdet, dass jedes Leben genauso wertvoll wie jedesandere ist, dass auf eurer schönen Erde genug für alle da ist, und auch dafür sorgen würdet, dass alle genug bekämen für ein würdiges, sinnvolles, kreatives Leben in Freiheit, dann würdet ihr euch schon auf der Erde wie im Himmel fühlen.“ Er schwieg und sah mich vielsagend an. Als ob ich etwas dafür konnte.
Sein linkes Ohr wackelte leicht, was mich irritierte. Er fuhr heiter fort:
„Aber im Moment ist es eher so, dass ihr den Himmel gar nicht erkennen würdet, denn der Himmel muss zuerst einmal in euch selber, in eurem Denken aufscheinen, und davon seid ihr noch ganz schön weit entfernt, und das sollt ihr hier, also zwischen den Leben, und in euren verschiedenen Leben lernen, die alle ihre besondere Herausforderung haben.“
Er sah mich so an, als würde er an meiner Auffassungsgabe zweifeln. Er glaubte nicht daran, dass ich ihn verstand. Na ja, sollte er doch mal weiter reden, wenn er sich das alles so einfach vorstellte.
„Ihr habt einen vorzüglichen Verstand, ihr habt bewundernswerte Fähigkeiten, intelligente Gefühle, auch reichlich Mitgefühl, ihr habt eure weise Intuition und ihr habt euer brillantes Bewusstsein – all das hat, was ihr Gott, Natur oder wie auch immer nennt, euch mitgegeben, serienmäßig bei euch eingebaut. Ihr könntet das benutzen, und dazu ist es auch da, um für euch alle, die Betonung liegt auf ALLE, ein schönes Leben auf der überaus schönen Erde zu installieren. Ihr seid selbst schuld, wenn ihr diese Gaben nicht zu eurem und aller anderen Besten nutzt, sondern euch stattdessen genau mit diesen Mitteln schon mal die Hölle auf der Erde bereitet. Ihr tragt Verantwortung, für alles.“