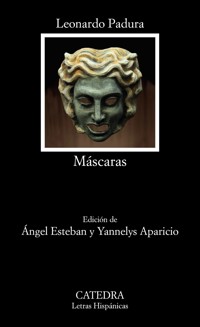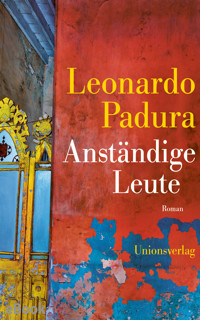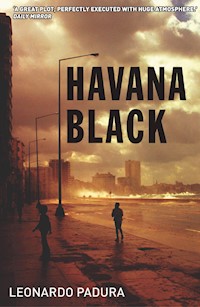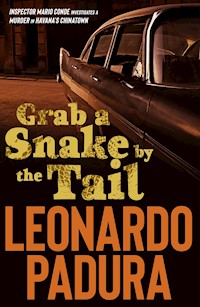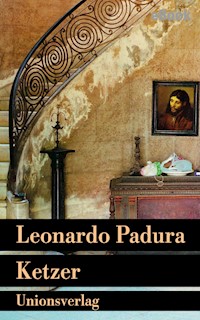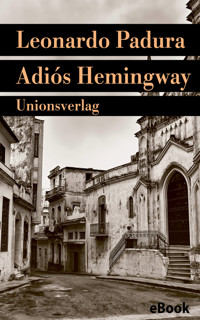9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein trockener, heißer Frühlingssturm fegt durch die Straßen Havannas, als Teniente Mario Conde der schönen Karina bei einer Autopanne hilft. Karina ist Jazzfan und spielt noch dazu selbst Saxofon – Mario Conde verliebt sich augenblicklich. Doch da wird er mit einer heiklen Untersuchung beauftragt: Eine junge Chemielehrerin an seiner ehemaligen Schule ist ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden worden, in der auch Spuren von Marihuana entdeckt werden. Mario Conde muss feststellen, dass nicht nur beim Parteikader, sondern auch im Bildungswesen die Kriminalität alltäglich geworden ist, dass Vetternwirtschaft, Drogenhandel und Betrug blühen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Mario Conde wird mit einer heiklen Untersuchung beauftragt: Eine junge Chemielehrerin wurde ermordet, in ihrer Wohnung wurden Spuren von Marihuana gefunden. Mario Conde muss feststellen, dass nicht nur beim Parteikader, sondern auch im Bildungswesen die Kriminalität alltäglich geworden ist, dass Vetternwirtschaft, Drogenhandel und Betrug blühen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Handel der Gefühle
Kriminalroman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
Havanna-Quartett »Frühling«
E-Book-Ausgabe
Mit 2 Bonus-Dokumenten im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 6 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel Vientos de cuaresma bei Tusquets Editores, Barcelona.
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia.
Originaltitel: Vientos de cuaresma (2001)
© Leonardo Padura Fuentes 2001
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Robert Polidori
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30487-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 10:49h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
HANDEL DER GEFÜHLE
1 – Aschermittwoch. Mit der Pünktlichkeit des ewig Wiederkehrenden fegte …2 – Die zwei Duralginas lagen ihm schwer im Magen …3 – Keine Angst, die beißen nicht … Nein …4 – An Morgen wie diesem gleicht das Telefonläuten immer …5 – Gestern habe ich überraschend einen Häusergiebel im Bezirk …6 – Da hast du ihn, Conde.«7 – Der Wind blies von Süden und trieb die …Mehr über dieses Buch
Leonardo Padura: Wie eine Romanfigur entsteht
Noemí Madero: Kriminalroman, Sozialroman: Das Havanna-Quartett
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Karibik
Für Paloma und Paco Taibo II.
Und wieder einmal, wie immer, für Dich, Lucía
Frühling 1989
ER kennt das Geheimnis und das Zeugnis.
Koran
1
Aschermittwoch. Mit der Pünktlichkeit des ewig Wiederkehrenden fegte ein trockener, staubiger Wind durch die Straßen des Viertels und wirbelte Schmutz und Beklemmungen auf. So als hätte die Wüste ihn geschickt, um an das Opfer des Messias zu erinnern. Der Staub aus den Steinbrüchen vermischte sich mit uralten Feindschaften, mit Groll und Angst und den Abfällen aus überquellenden Mülleimern. Die letzten welken Blätter des Winters schwebten zu Boden, und ihr Geruch verschmolz mit dem Todesgestank aus der Gerberei. Die Frühlingsvögel nahmen Reißaus, so als ahnten sie ein Erdbeben voraus. Der Nachmittag löste sich in einer Staubwolke auf, und das bloße Atmen wurde zu einem bewussten, schmerzhaften Akt.
Von seiner Haustür aus besah sich Mario Conde die Folgen des apokalyptischen Frühlingssturms. Menschenleere Straßen, verrammelte Türen, windschiefe Bäume. Ein wie durch einen furchtbaren, grausamen Krieg verwüstetes Viertel. Er stellte sich vor, dass hinter den fest verschlossenen Türen Hurrikane der Leidenschaft wüteten, so verheerend wie der Sturm draußen auf den Straßen. Und da fühlte er, wie sich in seinem Inneren eine vom heißen Wind belebte Woge aus Durst und Melancholie auftürmte. Er knöpfte das Hemd auf und trat auf den Bürgersteig. Er wusste, dass die Perspektivlosigkeit der kommenden Nacht und die Trockenheit seiner Kehle das Werk einer höheren Macht waren, die sein Schicksal zwischen unstillbarem Durst und unüberbrückbarer Einsamkeit bestimmen konnte. Das Gesicht dem Wind zugewandt, den Staub spürend, der auf seiner Haut brannte, kam ihm der Gedanke, dass etwas Bösartiges in diesem Sturm liegen musste, der jeden Frühling in Armageddon losbrach, um die Sterblichen an das dramatische Opfer des Gottessohnes in Jerusalem zu erinnern.
Er atmete tief ein, bis er merkte, wie seine Lungenflügel in Staub und Ruß versanken. Und als er meinte, seinem erwachenden Masochismus den nötigen Tribut gezollt zu haben, zog er sich wieder auf die Türschwelle zurück und entledigte sich endgültig seines Hemdes. Das trockene Gefühl in der Kehle verstärkte sich, während das Gefühl der Einsamkeit zur Gewissheit wurde, wenn auch nur schwer zu lokalisieren. Unaufhaltsam floss es durch seinen Körper, seine Blutbahnen. »Du bist ein alter Erinnerungsfetischist«, pflegte sein Freund, der dünne Carlos, zu ihm zu sagen; aber es ließ sich nicht vermeiden, die Fastenzeit und die Einsamkeit brachten ihn unweigerlich dazu, sich zu erinnern. Aufdringlicher und abartiger als jeder Durst nach vierzig Tagen Wüste wirbelte der Wind den schwarzen Staub und den Müll seiner Erinnerungen auf, das welke Laub seiner abgestorbenen Zuneigungen, die bitteren Gerüche seiner Schuldgefühle. Scheiß was auf den Wind, sagte er zu sich. Er durfte sich der melancholischen Stimmung nicht länger hingeben, und er kannte das Gegengift. Eine Flasche Rum und eine Frau – beides je schärfer, desto besser – waren das schnell und radikal wirkende Heilmittel bei einer so übernatürlichen wie übermächtigen Depression.
Den Rum zu besorgen sollte wohl kein Problem sein, sogar ganz legal, dachte er. Schwieriger würde es sein, ihn mit der Frau zu kombinieren, die er drei Tage zuvor kennen gelernt hatte und die der Grund für seinen Kater aus Hoffnung und Frustration war. Alles hatte am Sonntag angefangen, nach dem Mittagessen bei dem inzwischen gar nicht mehr dünnen Carlos, als er feststellen musste, dass Josefina mit dem Teufel im Bunde stand. Nur jener Schlachtermeister mit den infernalischen Fähigkeiten konnte die Sünde der Völlerei begünstigt haben, zu der die Mutter seines Freundes ihn und Carlos verleitete. Unglaublich, aber wahr: »Cocido madrileño, fast so, wie er sein muss«, hatte die alte Frau verkündet, als sie die beiden ins Esszimmer bat, wo bereits die Teller mit der Brühe und, würde- und verheißungsvoll, die Schüssel mit Fleisch, Gemüse und Kichererbsen auf sie warteten.
»Meine Mutter stammte aus Asturien«, erklärte sie, »aber den cocido machte sie immer auf Madrider Art. Geschmackssache, nicht wahr? Das Problem ist nur, dass außer gesalzenen Schweinsfüßen, Huhn, Speck, chorizo, morcilla, Kartoffeln, Gemüse und Kichererbsen auch noch ein großer Rinderknochen und grüne Bohnen hineingehören. Und das ist das Einzige, das ich nicht auftreiben konnte. Aber es schmeckt auch so ganz gut, oder?«
Ihre rhetorische, augenzwinkernde Frage rief bei den beiden Freunden einen leichten Schrecken hervor. Sie stürzten sich auf das Essen und nickten schon nach dem ersten Bissen. Ja, es schmeckte gut, auch wenn der Rinderknochen und die grünen Bohnen fehlten, was die Perfektionistin Josefina so sehr beklagte.
»Saugut, leck mich am Arsch«, sagte der eine.
»Hör mal, lass noch was übrig«, warnte der andere.
»Scheiße, das Stück chorizo war meins«, protestierte der Erste.
»Ich platze gleich«, stöhnte der Zweite.
Nach diesem unglaublichen Essen fielen Mario die Augen zu, und die Arme wurden ihm schwer. Sein Körper schrie förmlich nach einem Bett, aber der Dünne bestand darauf, sich zum Nachtisch vor den Fernseher zu setzen und das Baseballspiel anzusehen. Endlich einmal spielte La Habana eine ordentliche Saison, und die Verheißung des Sieges zog ihn zu jedem Spiel seiner Mannschaft, auch wenn es nur im Radio übertragen wurde. Er verfolgte den Kampf um die Meisterschaft mit einer Treue, zu der nur ein unverbesserlicher Optimist wie er fähig sein konnte. Und dabei hatte La Habana zum letzten Mal im Jahre 1976 gewonnen, damals, als sogar die Baseballspieler romantischer, aufrichtiger und glücklicher zu sein schienen.
»Ich hau ab«, sagte Mario Conde, nachdem er herzzerreißend gegähnt hatte. »Und mach dir bloß keine Illusionen, Alter, das Erwachen wird fürchterlich sein! Am Ende versieben die doch wieder die wichtigen Spiele. Denk ans letzte Jahr …«
»Es ist immer wieder schön, dich so enthusiastisch zu erleben, so voller Freude.« Carlos zeigte mit dem Finger auf seinen Freund. »Du alter Miesmacher! Aber diesmal gewinnen wir trotzdem!«
»Na, wenn du meinst … Aber sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Im Ernst, ich muss noch einen Abschlussbericht schreiben, den schieb ich schon seit Tagen vor mir her. Vergiss nicht, ich gehöre zur arbeitenden Klasse.«
»Erzähl keinen Scheiß, du, heute ist Sonntag. Hör mal zu, Junge, Valle und El Duque pitchen heute, die Sache ist so gut wie gegessen.« Er warf seinem Freund einen forschenden Blick zu. »Du lügst, du hast was anderes vor.«
»Schön wärs«, seufzte Mario.
Er hasste die friedvolle Stille der Sonntagnachmittage. Die beste Metapher, die sein Schriftstellerfreund Miki Cara de Jeva, »das Mädchengesicht«, seiner Meinung nach je geschaffen hatte, war die Bemerkung über jemanden gewesen, der »schwuler ist als ein langweiliger, schlaffer Sonntagnachmittag«.
»Schön wärs«, wiederholte er, stellte sich hinter den Rollstuhl, in dem der dünne Carlos seit fast zehn Jahren sein Leben fristete, und schob ihn ins Nebenzimmer.
»Warum kaufst du nicht ein Fläschchen und kommst heute Abend vorbei?«, schlug der dünne Carlos vor.
»Ich hab keinen Peso in der Tasche, Bär.«
»Nimm dir was aus dem Nachttisch.«
»Hör mal, ich muss morgen früh raus«, sträubte sich El Conde. Doch der Zeigefinger seines Freundes wies ihm unerbittlich den Weg zu dem Ort, an dem das Geld lag. Marios Gähnen ging in Lächeln über. Da wusste er, dass es keinen Zweck hatte, sich noch länger zu wehren. Besser, ich füge mich, oder? »Also, ich weiß nicht … Mal sehn, vielleicht komm ich später kurz vorbei. Vorausgesetzt, ich kann den Rum besorgen.« Noch gab er sich nicht ganz geschlagen, versuchte, etwas von seiner angekratzten Würde zu retten. »Ich geh dann mal.«
»Und kauf keinen Fusel, du«, warnte ihn Carlos.
Schon im Korridor, rief Mario ihm zu: »Die Orientales werden Meister!« Und er machte, dass er fortkam, um sich nicht die fälligen Beschimpfungen anhören zu müssen.
Er trat hinaus in den dunstigen Mittag, die Waage in der Hand und mit verbundenen Augen. Ich bin die Gerechtigkeit selbst, dachte er und wägte die Pflicht gegen die dringlichen Bedürfnisse seines Körpers ab: Abschlussbericht oder Bett. Doch er wusste, dass das Urteil bereits zu Gunsten einer Siesta nach Madrider Art (wie der cocido!) gefällt war, als er in die Calzada 10 de Octubre einbog. Und noch bevor er sie sah, spürte er bereits ihre Anwesenheit.
Das Experiment gelang fast immer. Wenn El Conde in einen Bus stieg, ein Geschäft oder ein Büro betrat, sogar im Halbdunkel eines Kinos probierte er es und freute sich, dass es funktionierte. Wie durch den Instinkt eines dressierten Tieres wurde sein Blick stets auf die schönste der anwesenden Frauen gelenkt, so als gehörte die Suche nach Schönheit zu seinen vitalen Bedürfnissen. Und auch jetzt hatte jener ästhetische Magnetismus, der seine Libido zu aktivieren im Stande war, nicht versagt. Eine Frau stand im gleißenden Sonnenlicht vor ihm, leuchtend wie die Erscheinung aus einer anderen Welt. Die Haare flammend rot, gelockt, duftig; Beine wie korinthische Säulen, in ausladende Hüften übergehend, bedeckt von einer abgeschnittenen, ausgefransten Jeans; das Gesicht von der Hitze gerötet, halb verdeckt von einer Sonnenbrille mit runden Gläsern, darunter ein Saugmund mit fleischigen Lippen voll sinnlicher Leidenschaft. Ein Mund für die verschiedensten Fantasien, Gelüste oder Bedürfnisse. Die sieht ja super aus, dachte er. Als wäre sie aus der Sonnenglut entstanden, heiß, wie geschaffen für archaische Begierden. El Conde hatte schon seit langem keine Erektion mehr auf der Straße gehabt. Mit den Jahren war er langsamer und kopflastig geworden. Doch nun spürte er plötzlich, dass in seinem Magen, direkt unter der rumorenden Masse des cocido madrileño, etwas in Aufruhr geriet, sich wellenartig abwärts bewegte und zwischen seinen Beinen unerwartet hart wurde. Die Frau lehnte am hinteren Kotflügel eines Autos. Als Mario seinen Blick noch einmal über die Langstreckenläuferinnenbeine und den etwas zu flachen Po wandern ließ, entdeckte er den Grund für ihr Sonnenbad auf menschenleerer Straße: ein platter Reifen und ein Wagenheber, der neben dem Bordstein lag. Verzweiflung wurde in ihren Augen sichtbar, als sie die Sonnenbrille abnahm und sich mit sensationeller Anmut den Schweiß von der Stirn wischte. Ich darf es mir nicht zu lange überlegen, beschwor er sich, um Trägheit und Schüchternheit zu überwinden, und als er neben ihr stand, nahm er all seinen Mut zusammen und sprach sie an.
»Soll ich dir helfen?«
Ihr Lächeln war jedes Opfer wert, selbst das des öffentlichen Verzichts auf eine Siesta. Ihr Mund öffnete sich breit und machte, wie Mario fand, jedes Sonnenlicht überflüssig.
»Wirklich?« Sie war einen Augenblick überrascht, aber nur einen einzigen. »Ich wollte zum Tanken fahren, und dann das …«, jammerte sie und zeigte mit ölverschmierten Händen auf den schwer verletzten Reifen.
»Sitzen die Schrauben fest?«, fragte er, nur um etwas zu sagen, und stellte sich bei dem Versuch, den Wagenheber geschickt anzubringen, ziemlich ungeschickt an. Sie hockte sich neben ihn, eine Geste, die ihre moralische Unterstützung ausdrücken sollte. Mario sah eine Schweißperle, die ihren Hals hinabrann und sich zwischen zwei kleinen, unter der verschwitzten Bluse garantiert nackten und wohlgeformten Brüsten verlor. Das riecht nach Femme fatale, warnte ihn die hartnäckige Ausbuchtung zwischen seinen Beinen, die er zu verbergen suchte. Wer hätte das gedacht, Mario Conde?
Wieder einmal musste er feststellen, dass seine schlechten Noten in den Fächern »Basteln und handwerkliche Fähigkeiten« gerechtfertigt waren. Eine halbe Stunde brauchte er für den Radwechsel. In diesen dreißig Minuten lernte er, dass Schrauben im Uhrzeigersinn angezogen werden und nicht andersherum, dass sie Karina hieß und achtundzwanzig Jahre alt war, Ingenieurin, getrennt, und dass sie bei ihrer Mutter wohnte, zusammen mit einem völlig durchgeknallten Bruder, einem Mitglied der Rockband Los Mutantes. Los Mutantes? Er lernte, dass man den Kreuzschlüssel mit dem Fuß bearbeiten muss und dass sie am nächsten Morgen, ganz früh, in ihrem Wagen mit einer technischen Kommission nach Matanzas fahren und bis Freitag in der dortigen Düngemittelfabrik arbeiten musste. Auch dass sie, kaum zu glauben, ihr Leben lang da drüben gewohnt hatte, in dem Haus gleich gegenüber (dabei war Mario in den letzten zwanzig Jahren fast täglich durch diese Straße gegangen), und dass sie mal was von Salinger gelesen und es »fabelhaft« gefunden hatte. Er war drauf und dran, sie zu korrigieren: nicht fabelhaft, sondern untergründig und berührend. Aber vor allem lernte er, dass ein Radwechsel zum Schwierigsten auf der Welt gehören kann.
Karina dankte ihm erleichtert, überschwänglich und konkret. Ob er mit ihr zur Tankstelle fahren wolle, anschließend könne sie ihn nach Hause bringen, schlug sie ihm vor. Guck mal, wie du schwitzt, sogar dein Gesicht ist ölverschmiert, sagte sie, das tut mir wirklich Leid. Und Mario spürte sein armes Herz mit jedem Wort der unerwartet aufgetauchten Frau heftiger schlagen. Dieser Frau, die lachen konnte und sehr langsam sprach, hypnotisierend sanft.
Am Ende des Nachmittags, nachdem er mit ihr an der Tankstelle in der Schlange gestanden und erfahren hatte, dass es Karinas Mutter gewesen war, die das geweihte Palmzweiglein hinter den Rückspiegel gesteckt hatte; nachdem sie bei ihm zu Hause Kaffee getrunken und sich ein wenig über Autopannen, über die Hitze und die Frühlingsstürme unterhalten hatten, verabredeten sie, dass sie ihn, sobald sie aus Matanzas wieder zurück war, anrufen und ihm Franny and Zooey zurückgeben würde. Es ist das Beste, was Salinger geschrieben hat, bemerkte Mario voller Begeisterung, als er ihr jenes Buch gab, das er noch nie jemandem geliehen hatte, seit es ihm gelungen war, es aus der Unibibliothek zu entwenden. Schön, dann könnten sie sich treffen und wieder mal miteinander plaudern. Okay?
El Conde hatte sie keine Sekunde aus den Augen gelassen, und auch wenn er zugeben musste, dass sie nicht so hübsch war, wie er gedacht hatte (ihr Mund war, ehrlich gesagt, vielleicht ein wenig zu groß, ihre Augenwinkel wirkten traurig, und im Po-Bereich war sie etwas flach, bemerkte er kritisch), so war er andererseits beeindruckt von der heiteren Art und ihrer unerwarteten Fähigkeit, nach dem Mittagessen, auf offener Straße unter einer mörderischen Sonne, seine flügellahme Männlichkeit auf Trab zu bringen.
Karina trank eine zweite Tasse Kaffee, und die nun folgende Enthüllung brachte Mario endgültig um den Verstand.
»Dieses Laster hab ich von meinem Vater geerbt«, sagte sie und sah ihm ins Gesicht, »er hat zu jeder Tages- und Nachtzeit Kaffee getrunken, literweise.«
»Und was hat er dir sonst noch vererbt?«
Sie lächelte und schüttelte den Kopf, so als wollte sie Gedanken und Erinnerung verjagen.
»Er hat mir alles beigebracht, was er wusste und konnte. Sogar Saxofon spielen.«
»Saxofon?« Mario schrie das Wort beinahe heraus. »Du spielst Saxofon?« Er konnte es kaum glauben.
»Na ja, ich bin alles andere als ein Profi. Aber ich kann das Sax blasen, wie die Jazzer es nennen. Mein Vater liebte Jazz und hat mit vielen bekannten Leuten gespielt. Frank Emilio, Cachao, Felipe Dulzaides … Die alte Garde eben.«
El Conde hörte ihr kaum noch zu, als sie von ihrem Vater sprach, von den Trios, Quartetten und Septetten, mit denen er gelegentlich gespielt hatte, von den fulminanten Auftritten im ›La Gruta‹, im ›Las Vegas‹ und im ›Copa Room‹. Und er brauchte nicht einmal die Augen zu schließen, um sich vorzustellen, wie Karina das Mundstück des Saxofons zwischen die Lippen schob und das Instrument zwischen den Knien tanzen ließ. Gibt es diese Frau wirklich?, fragte er sich zweifelnd.
»Und du, magst du Jazz?«
»Ob ich Jazz mag? Ich kann ohne ihn nicht leben«, antwortete er und breitete die Arme aus, um seiner unermesslichen Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Sie musste wegen dieser Übertreibung lächeln.
»Also, ich geh dann mal. Ich muss noch ein paar Sachen für morgen zurechtlegen.«
»Aber du rufst mich an, ja?« Marios Stimme klang beinahe flehend.
»Ganz bestimmt, sobald ich zurück bin.«
El Conde zündete sich eine Zigarette an. Er musste sich Mut anrauchen, bevor er zum entscheidenden Schlag ausholte.
»Was heißt eigentlich ›getrennt‹?«, stieß er wie beiläufig hervor. Er sah aus wie ein ziemlich unbegabter Schüler.
»Schlag im Wörterbuch nach«, erwiderte sie lächelnd und schüttelte den Kopf. Sie nahm die Autoschlüssel vom Tisch, stand auf und ging zur Tür. Er brachte sie hinaus. »Vielen Dank für alles, Mario«, sagte sie, und nach kurzem Zögern fragte sie: »Hör mal, du hast mir gar nicht gesagt, was du so machst, oder?«
El Conde warf die Kippe auf die Straße und lächelte nun ebenfalls. Er hatte das Gefühl, sich wieder auf sicherem Terrain zu bewegen.
»Ich bin Polizist«, sagte er und verschränkte die Arme vor der Brust, so als wäre diese Geste eine notwendige Ergänzung zu seiner Enthüllung.
Karina musterte ihn und biss sich auf die Lippen, bevor sie ironisch fragte:
»Bei der berittenen Polizei von Kanada oder bei Scotland Yard? … Ich habs ja gleich gewusst, du bist ein Lügner«, fügte sie hinzu. Sie lehnte sich gegen seine verschränkten Arme und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Auf Wiedersehen, Polizist.«
Als der Fiat Polska hinter der Kurve der Calzada verschwand, lächelte Teniente Mario Conde noch immer. Dann ging er ins Haus zurück und brach im Vorgefühl kommenden Glücks in Freudengeheul aus.
Und jetzt war es gerade erst mal Mittwoch, Aschermittwoch, auch wenn er die Stunden bis zur erneuten Begegnung mit Karina noch so oft zählte. Drei Tage hatten ihm genügt, um sich alles Mögliche vorzustellen: Heirat und sogar Kinder, davor, als Vorspiel sozusagen, Liebesakte im Bett, am Strand, in tropischen Wäldern und auf englischem Rasen, in Hotels unterschiedlicher Kategorie, Nächte mit und ohne Mond, in der Morgendämmerung und im Fiat Polska. Und dann sah er, wie sie, noch nackt, das Saxofon zwischen die Beine klemmte und das Mundstück anleckte, bevor sie eine honigsüße Melodie spielte, gedämpft und rau. Etwas anderes konnte er nicht tun, nur warten und sich etwas vorstellen. Und onanieren, wenn ihn das Bild von Karina mit dem Sax im Anschlag unerträglich stark erregte.
Entschlossen, sich der Gesellschaft des dünnen Carlos und einer Flasche Rum hinzugeben, zog El Conde sein Hemd wieder an, schloss die Tür hinter sich und trat in den Wind und den Staub der Straße hinaus. Trotz der heute beginnenden Fastenzeit, die ihn fertig machte und ihn deprimierte, gehörte er in diesem Augenblick zu der seltenen Spezies eines Polizisten, der kurz davor stand, glücklich zu werden.
»Und du willst mir also nicht sagen, was zur Hölle mit dir los ist, du?«
Mario Conde lächelte gequält und sah Carlos an. Was soll ich ihm sagen?, fragte er sich. Jedes der fast dreihundert Pfund des verkrüppelten Körpers vor ihm im Rollstuhl tat ihm in der Seele weh. Er fand es zu grausam, seinem Freund von einem möglichen Liebesglück zu erzählen, jenem Mann, dessen Vergnügungen für immer auf eine von Alkohol vernebelte Unterhaltung, eine üppige Mahlzeit und eine fanatische Begeisterung für Baseball beschränkt waren. Seit der dünne Carlos, der jetzt nicht mehr dünn war, in Angola eine Kugel in den Rücken verpasst gekriegt hatte und auf ewig an den Rollstuhl gefesselt blieb, hatte er sich in eine schwer wiegende Anklage verwandelt, in einen unendlichen Schmerz, den Mario mit einem schuldbewussten Stoizismus ertrug. Was soll ich ihm vorlügen? Muss ich auch ihm etwas vorlügen? Wieder lächelte er gequält. Er erinnerte sich, wie er langsam an Karinas Haus vorbeigegangen, sogar stehen geblieben war, um durch die Fenster zu spähen und die abwesende Frau vielleicht doch im Halbdunkel eines mit Farnkraut und roten und orangefarbenen, herzförmigen Malangablättern überladenen Wohnzimmers zu entdecken. Wie ist es möglich, dass ich sie nie gesehen habe, wo sie doch zu jenen Frauen gehört, die man schon von weitem wittert? Er trank sein Glas aus und begann schließlich:
»Ich wollte dich gerade anlügen.«
»Hast du das denn nötig?«
»Ich glaube, ich bin nicht so, wie du meinst, Dünner. Ich bin anders als du.«
»Hör mal, Kleiner, wenn du Scheiße reden willst, dann sag Bescheid.« Carlos hob die Hand, zum Zeichen, dass er nur eine Pause einlegen wollte, um einen Schluck Rum zu trinken. »Muss mich nur schnell drauf einstimmen«, fuhr er dann fort. »Aber vorher lass dir eins gesagt sein: Du bist nicht grade die Krone der Schöpfung, aber du bist mein bester Freund auf dieser Welt. Auch wenn du mich anlügst.«
»Ich hab da ’ne Frau kennen gelernt, Bär, und ich glaube …« Jetzt erst sah er dem Dünnen in die Augen.
»Leck mich am Arsch, du!«, rief Carlos grinsend. »Das war es also! Bist du eigentlich noch zu retten?«
»Red keinen Stuss, Dünner. Du müsstest sie mal sehen! Ich weiß nicht, vielleicht hast du sie ja schon mal gesehen, sie wohnt gleich hier um die Ecke, einen Block weiter. Karina heißt sie, ist Ingenieurin, hat rote Haare und sieht klasse aus. Und sie ist hier drinnen.« Er tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Stirn.
»Du bist ja völlig fertig, Mann … Mach mal halblang. Bumst du sie?«
»Schön wärs«, murmelte El Conde und setzte dabei sein verzweifeltstes Gesicht auf. Er goss sich Rum nach und berichtete dem Freund in allen Einzelheiten von seiner Begegnung mit Karina (die ganze Wahrheit, einschließlich der flachen Po-Ebene, obwohl er wusste, welche Bedeutung der Dünne einem strammen Hintern bei seinen ästhetischen Werturteilen beimaß). Auch von seinen Hoffnungen sprach er, sogar von dem pubertären Spähversuch heute Abend. Am Ende erzählte er seinem Freund immer alles, so glücklich oder schrecklich die Geschichten auch ausgingen.
Er sah, wie der Dünne sich vergeblich streckte, um an die Flasche zu kommen, und reichte sie ihm hinüber. Der Pegel des Inhalts verlor sich hinter dem Etikett. Mario schätzte, dass es ein Zweiliter-Gespräch werden würde. Aber um diese Uhrzeit Rum in La Víbora aufzutreiben war ein entmutigendes, hoffnungsloses Unterfangen. Er bedauerte das, denn wie er hier so im Zimmer des Dünnen saß, inmitten fast greifbarer Erinnerungen und alter, inzwischen verblasster Poster, und über Karina sprach, überkam ihn eine ruhige Gelassenheit, so wie früher, als sich ihre Welt ausschließlich um knackige Ärsche und pralle Titten drehte, vor allem aber um jene magische, faszinierende Öffnung, über die sie stets als etwas Fleischiges, Behaartes, Unergründliches sprachen, an das so schwer heranzukommen war (»Ach was, Mann, guck mal, wie die geht, wenn die noch Jungfrau ist, bin ich ’n Hubschrauber«, pflegte Carlos, der damals noch dünn war, immer zu sagen). Dabei spielte es keine Rolle, wem Po und Brüste, die Objekte ihrer Begierde, gehörten.
»Du änderst dich nie, Kleiner! Hast keinen blassen Schimmer, wer die Frau ist, aber bist schon so spitz wie ’n Straßenköter. Vergiss nicht, wies mit Tamara gelaufen ist …«
»Die kannst du doch nicht miteinander vergleichen, Alter.«
»Ach, Scheiße, du, du bist einfach … Und die wohnt wirklich gleich hier um die Ecke? Oder hat sie dich verarscht?«
»Nein, bestimmt nicht. Hör mal, Dünner, ich muss sie einfach kriegen! Entweder ich krieg sie, oder ich bring mich um, oder ich werd verrückt oder schwul.«
»Besser schwul als tot«, entschied der andere grinsend.
»Wirklich, Bär. Mein Leben ist ziemlich im Arsch. Ich brauch so ’ne Frau wie die. Stimmt, ich weiß eigentlich nicht, wer sie ist, aber ich brauch sie.«
Der Dünne sah ihn an, als wollte er sagen: Du bist wirklich nicht zu retten, du.
»Ich weiß nicht, aber ich hab das dunkle Gefühl, dass du wieder Scheiße redest … Und wie du dich immer im Kreis drehst! Du bist zum Beispiel Polizist, weil es dir passt. Oder passt es dir nicht? Dann lass es, Junge, und scheiß auf das Ganze! Aber komm mir hinterher nicht damit, dass es dir im Grunde ein Vergnügen war, den Arschlöchern und Schweinen das Leben schwer zu machen. So ein Gesülze hör ich mir nicht länger an. Und was dir mit Tamara passiert ist, mein Lieber, das war doch von vornherein klar! Frauen wie die waren noch nie was für Typen wie uns. Vergiss sie endlich! Immerhin kannst du dir sagen, dass du dich ausgetobt und sie anständig gefickt hast. Und scheiß was auf die Welt, Kleiner. Los, gib mir noch was zu trinken.«
El Conde sah die Flasche an. Er bedauerte sich selbst. Aber er brauchte es, das, was er selbst dachte, aus dem Munde des Dünnen zu hören. Hier bei seinem allerbesten Freund zu sitzen und über menschliche und göttliche Dinge zu reden, während draußen der Frühlingssturm den Dreck hochwirbelte und tief in seinem Inneren eine Hoffnung in Form einer Frau aufkeimte, tat ihm gut und hatte eine reinigende Wirkung. Was werd ich bloß machen, wenn mir der Dünne wegstirbt?, fragte er sich unvermittelt. Damit schnitt er den Faden durch, der ihn mit dem inneren Frieden verband. Er entschied sich für Selbstmord durch Alkohol und goss seinem Freund und sich selbst Rum nach. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass sie vergessen hatten, über Baseball zu reden und Musik zu hören. Besser, wir hören Musik, sagte er sich, stand auf und ging zu der Schublade mit den Musikkassetten. Wie schon so oft erstaunte ihn auch jetzt wieder das musikalische Geschmackschaos des Dünnen. Alles durcheinander, von den Beatles bis zu den Mustangs, von Joan Manuel Serrat bis zu Gloria Estefan.
»Was möchtest du hören?«
»Die Beatles?«
»Chicago?«
»Fórmula V?«
»Los Pasos?«
»Creedence?«
»Na gut, Creedence … Aber erzähl mir nicht wieder, dass John Fogerty wie ein Schwarzer singt. Ich hab dir ja schon gesagt, er singt wie ein Gott, stimmts?« Beide nickten, jawohl, ja, darauf konnten sie sich einigen: Der gute alte Fogerty sang wie ein Gott.
Die Flasche war schneller zu Ende als die lange Version von Proud Mary. Der dünne Carlos stellte das Glas auf den Boden und rollte zum Bett, auf dem sein Polizistenfreund saß. Er legte Mario seine schwammige Hand auf die Schulter und sah ihm in die Augen.
»Hoffentlich gehts diesmal gut, Bruder. Gute Menschen verdienen es, auch mal Glück im Leben zu haben.«
Er hat Recht, dachte El Conde. Der Dünne war der beste Mensch, den er kannte, doch das Glück hatte ihm den Rücken gekehrt. Dann aber wurde ihm das Ganze unerträglich pathetisch, und mit einem verunglückten Grinsen erwiderte er:
»Jetzt redest du aber Scheiße, Bruder. Gute Menschen sind schon lange ausgestorben.«
Er stand auf und war drauf und dran, seinen Freund zu umarmen, traute sich aber nicht. Es gab tausend Dinge, die zu tun er sich nicht traute.
Niemand kann sich die Nächte eines Polizisten vorstellen. Niemand weiß, welche Geister ihn heimsuchen, welche Glut ihn verzehrt, in welch einer Hölle er auf kleiner oder großer Flamme gebraten wird. Jedes Schließen der Augen kann zu einer grausamen Herausforderung werden und jene quälenden Phantome der Vergangenheit auferstehen lassen, die nie aus seiner Erinnerung verschwinden und Nacht für Nacht mit der unerbittlichen Beharrlichkeit eines Pendels zurückschlagen. Seine Entscheidungen und Irrtümer, sein selbstherrliches Verhalten und selbst die Schwächen seiner Gutmütigkeit belasten das gezeichnete Gewissen. Eine unbezahlbare Schuld für jede einzelne Niederträchtigkeit, die er in einer niederträchtigen Welt begangen hat. So besucht mich zum Beispiel José de la Caridad, jener schwarze Lkw-Fahrer, der mich bat, mich anflehte, ich solle ihn nicht in den Knast bringen, er sei unschuldig. Ich hab ihn vier Tage hintereinander verhört, er musste der Täter sein, kein anderer kam infrage; er beteuerte seine Unschuld, brach zusammen und weinte, doch ich schickte ihn hinter Gitter, wo er auf seinen Prozess wartete, der ihn für unschuldig erklärte. Manchmal erscheint mir Estrellita Rivero, das Mädchen, das ich vergeblich festzuhalten versuchte, bevor es den verhängnisvollen Schritt nach vorn tat und von Sargento Mateo, der dem flüchtenden Mann in die Beine schießen wollte, zwischen den Augen getroffen wurde. Oder es entsteigen Rafael und Tamara dem Tod und der Vergangenheit, Walzer tanzend wie vor zwanzig Jahren, er im Anzug, sie in einem langen weißen Kleid wie eine Braut, die sie wenig später sein würde. Keine süßen Träume begleiten die Nächte eines Polizisten, nicht mal die Erinnerung an die letzte oder die Hoffnung auf die nächste Frau. Denn jede Erinnerung und jede Hoffnung – die eines Tages ebenfalls Erinnerung sein wird – trägt den Fleck, den der tägliche Schrecken eines Polizistenlebens hinterlassen hat. Der letzten Frau bin ich begegnet, als ich den Mord an ihrem Mann untersuchte, die Betrügereien, Lügen und Erpressungsversuche, den Machtmissbrauch und die Angst jenes Mannes, der von der Höhe der Macht herab ein perfektes Leben zu führen schien; an die nächste Frau werde ich mich vielleicht im Zusammenhang mit einem Mord, einer Gewalttat oder einem Schmerz erinnern. Trüb sind die Nächte eines Polizisten, übel riechend und totenbleich. Schlafen, vielleicht träumen! Doch ich habe gelernt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, solche Nächte zu besiegen: die Bewusstlosigkeit, die am Tage ein wenig wie der Tod und am Morgen der Tod selbst ist, wenn die angebliche Freude über eine strahlende Sonne zur Qual für die Augen wird. Entsetzen über die Vergangenheit, Angst vor der Zukunft, das treibt die Nächte eines Polizisten dem Morgen entgegen. Jemanden verfolgen, festnehmen, verhören, unter Druck setzen, fertig machen, einlochen, anklagen, verurteilen, das sind die Verben, die die Erinnerungen eines Polizisten, sein gesamtes Leben bestimmen. Ich träume davon, andere, glückliche Träume zu träumen, etwas aufzubauen, etwas zu haben, etwas zu geben, etwas zu bekommen, etwas zu schaffen. Zu schreiben. Doch das sind alberne Hirngespinste für jemanden, der von Zerstörungen lebt. Deshalb ist die Einsamkeit eines Polizisten die furchtbarste aller Einsamkeiten. Sie bedeutet die Gesellschaft seiner Phantome, seiner Schmerzen, seiner Schuldgefühle … Wenn doch wenigstens eine Frau mit einem Saxofon ihr Lied spielen würde, um den Polizisten in den Schlaf zu wiegen! Aber nichts, Stille … Es ist Nacht. Draußen versengt der verfluchte heiße Wind die Erde.
2
Die zwei Duralginas lagen ihm schwer im Magen wie ein Schuldgefühl. El Conde hatte die Tabletten mit einer riesigen Tasse schwarzen Kaffees hinuntergespült, nachdem er festgestellt hatte, dass die letzten Reste der noch vorhandenen Milch geronnen waren.
Glücklicherweise hatte er im Schrank zwei saubere Hemden entdeckt, und er konnte sich den Luxus leisten, sich eins auszusuchen. Er entschied sich für das rostbraun-weiß gestreifte mit den langen Ärmeln, die er bis zu den Ellbogen hochkrempelte. Die Jeans, die er unter dem Bett hervorzog, hatte nach der letzten Wäsche erst rund vierzehn Kampftage hinter sich und konnte noch vierzehn weitere vertragen. Er steckte die Pistole in den Hosenbund, wobei er feststellte, dass er abgenommen hatte. Sorgen machte er sich deswegen jedoch keine: Er hatte weder Hunger noch Krebs. Außer einem Brennen im Magen war alles in Ordnung. Die Ringe unter den Augen waren nicht besonders dunkel, der beginnende Haarausfall schien nur langsam voranzuschreiten, seine Leber hielt immer noch tapfer stand, und die Kopfschmerzen ließen bereits nach. Heute war schon Donnerstag, morgen Freitag. Als er dem Wind und der Sonne entgegentrat, war er beinahe versucht, ein altes Liebeslied zu vergewaltigen: Tausend Jahre werden vergehn und noch viel mehr / ich weiß nicht, ob es Liebe gibt in der Ewigkeit / doch dort wird es sein wie hier …
Um viertel nach acht betrat er die Eingangshalle der Kripozentrale, begrüßte mehrere Kollegen, las sehnsüchtig die neuen Pensionsregelungen für das Jahr 1989 auf dem schwarzen Brett und rauchte die fünfte Zigarette des Tages, während er auf den Lift wartete, um sich bei dem Dienst habenden Offizier zu melden. Er hegte die wunderschöne Hoffnung, man möge ihm noch keinen neuen Fall übertragen, denn er wollte sich ganz auf einen einzigen Gedanken konzentrieren. Ja, in den letzten Tagen hatte er sogar wieder das Bedürfnis verspürt zu schreiben. Er hatte ein paar Bücher, die ihm stets halfen, seine Trägheit zu überwinden, wieder gelesen und in einem alten Schulheft, einem mit grün liniertem, gelblichem Papier, einige seiner Ideen notiert. Wie ein in Vergessenheit geratener pitcher, der in einem entscheidenden Spiel eingesetzt werden soll und sich warm spielt. Seine Wiederbegegnung mit Tamara vor ein paar Monaten hatte verloren geglaubte Erinnerungen und längst vergessene Gefühle in ihm geweckt. Auch Hassgefühle, die er für überwunden gehalten hatte, waren durch die unerwartete Konfrontation mit jenem wichtigen Teil seinerVergangenheit wieder hochgekommen. Er musste sich mit der Vergangenheit endlich aussöhnen, musste ihr den Prozess machen und sie ein für alle Mal bannen. Nun kam ihm der Gedanke, dass all das möglicherweise Material hergeben könnte für eine ziemlich anrührende Geschichte über die alten Zeiten, als sie alle noch sehr jung, sehr arm und sehr glücklich gewesen waren: der dünne Carlos, der damals noch dünn war, Andrés, der unbedingt Baseballspieler werden wollte, Dulcita, die noch nicht ins Ausland gegangen war, der Hasenzahn, der Geschichte studieren wollte, Tamara, die noch nicht mit Rafael verheiratet und so wunderwunderschön war; und er selbst natürlich, der davon träumte, Schriftsteller zu werden, nichts anderes als Schriftsteller, wenn er auf dem Bett liegend das Foto von Hemingway an der Wand betrachtete und in jenen Augen das Geheimnis des Blickes zu ergründen suchte, mit dem der alte Schriftsteller die Welt maß und sah, was andere nicht sahen. Sollte er jemals eine Chronik von Liebe und Hass, Glück und Enttäuschung schreiben, dann würde er sie Ein perfektes Leben nennen.
Der Lift hielt in der dritten Etage. El Conde wandte sich nach rechts. Die mit kerosingetränktem Sägemehl gefegten Böden glänzten, die Sonne flutete durch die hohen Fenster mit den Aluminiumrahmen und ließ den langen Korridor in hellem Licht erstrahlen. Das ganze Gebäude war so sauber und lichtdurchflutet, dass es gar nicht nach einer Kripozentrale aussah. El Conde stieß die doppelte Glastür auf und betrat das Büro des Dienst habenden Offiziers, der zu dieser frühen Morgenstunde die stürmischsten Momente des Tages erlebte. Offiziere lieferten ihre Berichte ab, Ermittler legten gegen irgendeine Maßnahme des Gerichts Widerspruch ein, Verbindungsleute nahmen Verbindung auf. Teniente Mario Conde, einen eingängigen Bolero auf den Lippen – Von meinem Leben geb ich Dir das Beste / arm wie ich bin / was sonst kann ich Dir geben – und eine Zigarette zwischen den Fingern, näherte sich dem Schreibtisch von Teniente Fabricio. Bei dem Lärm konnte er kaum verstehen, was der Beamte zu ihm sagte:
»Du sollst zum Mayor kommen. Frag mich nicht, was er will, ich hab keine Ahnung, hier ist die Hölle los. Du kriegst deine Fälle ja direkt vom Chef, wie du weißt, schließlich bist du sein Liebling.«
El Conde sah Fabricio eine Weile an. Der Teniente schien regelrecht unterzugehen in all dem Papierkram, dem Telefonklingeln und Stimmengewirr. Mario fühlte, dass seine Hände zu schwitzen begannen. Es war das zweite Mal, dass Fabricio ihn so behandelte. Nein, sagte er sich, ich bin nicht gewillt, mir diese Flegeleien gefallen zu lassen. Einige Monate zuvor hatte Mayor Rangel angeordnet, dass El Conde nach Abschluss seines eigenen Falles Fabricio bei der Untersuchung einer Serie von Diebstählen in verschiedenen Hotels Havannas ablösen sollte. Mario hatte sich vergeblich dagegen gewehrt – »Die Ermittlungen müssen endlich abgeschlossen werden«, hatte der Alte befohlen – und Fabricio entschuldigend erklärt, dass das nicht seine Entscheidung gewesen sei. Kurz darauf waren die Täter überführt, und El Conde wollte seinen Kollegen über das Ermittlungsergebnis informieren. Fabricio hatte zu ihm gesagt: »Freut mich, Conde, bestimmt kriegst du vom Mayor einen dicken Kuss dafür.« Mario hatte versucht, das Verhalten des Teniente zu entschuldigen, und schließlich hatte er ihm auch verziehen. Jetzt aber erinnerte er sich daran, dass er aus einem hitzigen, streitsüchtigen Viertel stammte, wo man unter allen Umständen die Fahne der Männlichkeit hochhalten musste. Andernfalls lief man Gefahr, seine Männlichkeit aberkannt zu bekommen und am Ende ohne Fahne und sogar ohne Fahnenstange dazustehen. Nein, in seinem Alter war er nicht mehr gewillt, so eine Bemerkung durchgehen zu lassen. Schon hob er den Zeigefinger, um einen Monolog zu beginnen, beherrschte sich aber noch einen Moment und wartete. Als sich das Büro geleert hatte, stützte er beide Hände auf die Schreibtischplatte, beugte sich vor, um Fabricio direkt ins Gesicht sehen zu können, und sagte:
»Wenn dir die Fresse juckt, brauchst dus mir nur zu sagen. Ich kann dich kratzen, wann du willst, wo du willst und wie du willst. Kapiert?« Daraufhin drehte er sich auf dem Absatz um und ging hinaus. Im Rücken spürte er die Pfeile, die dem anderen aus den Augen schossen. Was denkt der sich eigentlich!
Jetzt hat er mir den Morgen versaut, stellte er fest. Er hatte nun weder die Geduld noch Lust, auf den Lift zu warten, und stürmte die Treppen bis zum siebten Stock hinauf. Die Duralginas lagen ihm wie Steine im Magen. Es wird böse enden, dachte er. Scheiß was drauf, wenn ers nicht anders will …
Er betrat das Vorzimmer von Mayor Rangels Büro. Maruchi sah auf und nickte ihm einen Morgengruß zu, ohne ihre Tipparbeit zu unterbrechen.
»Was gibts, mein Schatz?«, fragte er die Sekretärin und ging zu ihrem Schreibtisch.
»Er hat in aller Herrgottsfrühe schon nach dir geschickt, aber du warst wohl schon von zu Hause weg«, antwortete sie und wies mit dem Kopf auf die Tür zum Büro ihres Chefs. »Ich weiß nicht, aber ich glaub, da wartet ’n dicker Hund auf dich.«
El Conde stieß einen Seufzer aus und zündete sich eine Zigarette an. Wenn der Mayor von einem »dicken Hund« sprach, fingen seine Hände an zu zittern. Die von oben steigen mir aufs Dach, Conde, Eile ist angesagt. Diesmal jedoch wollte Mario keinen Fall von jemand anderem übernehmen, das schwor er sich, selbst wenn es ihn den Job kosten würde. Er rückte seine Pistole zurecht. Immer wieder versuchte sie, aus dem Gürtel seiner Jeans zu rutschen, ganz besonders im Moment, da er ohne ersichtlichen Grund an Gewicht verlor. Er legte die Hand auf den Text, den die Sekretärin des Alten gerade abtippte.
»Sag mal, Maruchi, wie findest du mich?«
Die junge Frau lächelte ihn an.
»Willst du mir einen Heiratsantrag machen und dich vorher absichern?«
Jetzt musste auch El Conde über seine plumpe Frage lächeln.
»Nein, ich kann mich nur selbst nicht mehr leiden«, erwiderte er und klopfte mit dem Fingerknöchel behutsam an die Glastür.
»Los, mach schon, geh endlich rein.«
Mayor Rangel rauchte seine Morgenzigarre. An dem Geruch erkannte El Conde, dass es kein guter Tag für den Alten war. Es roch nach einem billigen, zu trockenen Stumpen, einem zu sechzig Centavos. Ein sicheres Zeichen für die schlechte Laune des Chefs der Kripozentrale, der ein säuerliches Gesicht machte. Doch abgesehen davon bewunderte El Conde die korrekt-soldatische Erscheinung seines Vorgesetzten. Die Uniform saß ihm wie immer wie angegossen und brachte die gebräunte Haut des Squashspielers und Gewohnheitsschwimmers zur Geltung. Der lässt sich nie gehen, dachte Mario.
»Man hat mir gesagt …«, begann er, doch der Mayor unterbrach ihn mit einer Handbewegung und wies auf einen der Stühle.
»Setz dich, setz dich! Für dich ist Schluss mit der Faulenzerei. Du hängst doch schon rund eine Woche ohne einen Fall rum, stimmts? Jetzt hast du einen.«
Der Teniente schaute aus dem Fenster. Hier oben war die Aussicht himmelblau. Nichts zu sehen von dem aufgewirbelten Laub und Müll auf der Straße. El Conde wusste, dass er keine Chance hatte. Der Mayor versuchte gerade, die Glut seiner Billigzigarre wieder zu beleben, und der Kummer über die für jeden Raucher quälende Übung spiegelte sich in seinem Gesicht wider. Auch er war an diesem Morgen nicht glücklich.
»Entweder die Welt geht unter oder es liegt ein Fluch auf uns oder die Menschen in diesem Land sind verrückt geworden. Hör mal, Conde, entweder ich werd alt oder alles verändert sich und keiner sagt mir Bescheid. Ich glaub, ich werde das Rauchen aufgeben, so gehts nicht weiter, sieh dir das an, sieh dirs genau an! Meinst du, dieser Schrott verdient die Bezeichnung ›Zigarre‹? Schau her, das Deckblatt ist verschrumpelter als der Hintern meiner Großmutter. So als würde man gerollte Bananenblätter rauchen, ehrlich! Noch heute mach ich einen Termin beim Psychologen, ich leg mich auf sein Sofa und sag ihm, er soll mir helfen, das Rauchen aufzugeben. Und gerade heute hätt ich ’ne gute Zigarre so nötig! Muss ja nicht gleich eine Rey del Mundo sein oder eine Gran Corona oder eine Davidoff, ich wär schon mit ’ner Montecristo zufrieden … Maruchi, bring uns Kaffee, bitte … Vielleicht krieg ich ja so den Geschmack von dieser Stinkrolle weg … Also, wenn das Kaffee ist, soll der liebe Gott mirs schriftlich geben … Aber zur Sache: Du musst dich sofort auf diesen Fall stürzen, Hals über Kopf. Und benimm dich, Conde! Keinen Mucks will ich hören, kein Geknurre, kein Gejammere. Und du trinkst mir keinen Schluck, kein gar nichts, verstanden? Ich will, dass du den Fall so schnell wie möglich löst. Hol dir Manolo zur Unterstützung oder wen du willst, du hast völlig freie Hand, aber beweg dich … Hör zu, Conde, das bleibt jetzt unter uns, hör genau zu: Da ist was im Busch, irgend ’n dicker Hund. Was genau, weiß ich nicht, aber es liegt in der Luft, ich spürs, und ich will nicht, dass wir auf dem falschen Fuß erwischt werden, beim Mäusemelken. Muss ’n ganz dicker Hund sein, dick und hässlich! Kommt von ganz oben, überall dicke Luft, hab ich so noch nicht erlebt. Da werden Köpfe rollen, das sag ich dir! Hämmer dir das gut ein, ja? … Frag mich nicht, ich weiß von nichts, kapiert? … Also gut, hier, das ist für dich. Die Unterlagen zu dem Fall. Brauchst es nicht gleich hier zu lesen, ich erzähl dir, worauf es ankommt. Eine Gymnasiallehrerin, vierundzwanzig Jahre, Parteimitglied, ledig. Ermordet. Erwürgt, mit einem Handtuch. Aber vorher windelweich geprügelt, eine gebrochene Rippe, zwei gebrochene Finger. Und vergewaltigt, von mindestens zwei Männern. Offenbar wurde nichts Wertvolles gestohlen, weder Wäsche noch Hi-Fi-Anlage oder Fernseher oder so was. Im Klo wurden Reste einer Marihuanazigarette gefunden. Na, sagt dir der Fall zu? Starker Tobak, was? Und ich, Antonio Rangel Valdés, will wissen, was mit der Frau passiert ist. Ich bin nämlich nicht zum Vergnügen seit dreißig Jahren bei der Kripo! Da muss ’ne riesengroße Sauerei dahinter stecken, so wie die umgebracht worden ist, mit Folter und Gruppenvergewaltigung und Marihuana … Scheiße, was für ’ne Zigarre hat man mir da bloß nur angedreht! Schlimmer als ’n Weltuntergang, ehrlich! … Und vergiss nicht, was ich dir gesagt hab: Benimm dich, sonst mach ich dir Feuer unterm Arsch …«
Mario Conde hielt sich viel auf seinen guten Riecher zugute. Seine einzige herausragende Eigenschaft, wie er fand. Und sein Riecher sagte ihm, dass der Alte Recht hatte: Das Ganze stank zum Himmel. Er wusste es in dem Augenblick, als er die Wohnungstür öffnete. Dem Szenarium, das sich ihm bot, fehlten lediglich das Opfer und seine Opferpriester. Auf dem Fliesenboden waren die Umrisse der ermordeten Lehrerin mit Kreide aufgezeichnet, ein Arm dicht am Körper, der andere angewinkelt, so als hätte sie sich an den Kopf gefasst; die Beine vor dem Bauch gekrümmt in einem vergeblichen Versuch, ihn zu schützen. Ein grausamer Anblick zwischen einem Sofa und einem umgestürzten Tisch.
Der Teniente schloss die Wohnungstür und sah sich nun den Rest des Zimmers an. Auf einem langen Möbel, das die gesamte Wand gegenüber dem Balkon einnahm, stand ein Farbfernseher, wahrscheinlich ein japanisches Fabrikat, und ein Kassettenrecorder mit doppeltem Kassettendeck. Er drückte die Taste eject, entnahm die Kassette und las auf dem Etikett: Seite A, Tina Turner, Private Dancer. Auf dem langen Regalbrett über dem Fernseher standen Bücher. Die interessierten ihn schon eher. Einige Lehrbücher für Chemie, Lenins Werke in drei Bänden, deren roter Einband verblasst war, eine Geschichte Griechenlands sowie ein paar Romane, die wieder zu lesen er sich niemals trauen würde: Doña Bárbara, Père Goriot, Mare Nostrum, Die Qualen der Shanti Andía, Cecilia Valdés und, ganz am Ende, das einzige Buch, das er gerne mitgenommen hätte: Poesía von Pablo Neruda. Das traf genau seinen gegenwärtigen Seelenzustand. Er schlug das Buch auf und las ein paar Verse.
Quítame el pan, si quieres
Nimm mir das Brot, wenn du willst,
Quítame el aire, pero
nimm mir die Luft, aber
no me quites tu risa…
nimm mir Dein Lachen nicht …
Er stellte das Buch wieder an seinen Platz zurück. Bei ihm zu Hause stand dieselbe Ausgabe. Sie scheint keine eifrige Leserin gewesen zu sein, dachte er, als er sich den Staub von den Händen wischte.
Er ging zum Balkon und öffnete die Lamellentüren. Licht drang ins Zimmer, und der Wind ließ ein Mobile aus Messingstäben klingen, das der Teniente erst jetzt bemerkte. Als er sich wieder umdrehte, sah er neben den Umrissen der Leiche einen blassroten Flecken auf den hellen Fliesen. Er stellte sich die junge Frau vor, wie sie in ihrem eigenen Blut dagelegen hatte, zusammengeschlagen, gequält, vergewaltigt und schließlich erwürgt. Warum haben sie dich umgebracht?
Er ging ins Schlafzimmer. Das Bett war unbenutzt. An einer Wand hing das Poster einer beinahe hübschen Barbra Streisand aus der Zeit von The Way We Were, an der Wand gegenüber ein riesiger Spiegel. El Conde ließ sich aufs Bett fallen und konnte nun sein vollständiges Spiegelbild bewundern. Eine tolle Sache, so ein Spiegel, was? Er öffnete den Wandschrank, und sein Riecher meldete sich wieder. Irgendetwas stimmte hier nicht. Die Garderobe war alles andere als üblich und alltäglich. Er befühlte die ausgezeichnete Qualität von Blusen, Röcken, Hosen, T-Shirts, Schuhen, Slips und Pullovern, alles made in fernen Orten.
El Conde ging zurück ins Wohnzimmer und trat auf den Balkon hinaus. Von hier hatte man einen hervorragenden Blick auf das Viertel Santos Suárez, das selbst vom vierten Stock aus ziemlich heruntergekommen, schmutzig und abweisend aussah. Auf den Dachterrassen der Nachbarschaft entdeckte er mehrere Taubenschläge sowie Hunde, die sich von der Sonne braten und vom Wind zerzausen ließen. El Conde sah elende Anbauten, die schuppenartig an Wohnungen klebten und als Behausung für ganze Familien dienten. Er sah offene Wassertanks, die dem Staub und dem Regen schutzlos ausgeliefert waren, und Bauschutt, der in irgendwelchen Ecken der Flachdächer herumlag, was bei dem Sturm gefährlich werden konnte. Als er direkt gegenüber ein kleines Gärtchen erblickte, das auf durchgesägten Butterkanistern angepflanzt worden war, atmete er erleichtert auf. Kaum zwei Kilometer weiter rechts, hinter Baumreihen, die die Aussicht verstellten, wohnten der Dünne und, gleich um die Ecke, Karina. Schlagartig erinnerte er sich wieder daran, dass heute schon Donnerstag war.
Er ging hinein und setzte sich so weit weg wie möglich von den Umrissen der Toten. Er schlug die Akte auf, die der Alte ihm gegeben hatte, und während er las, sagte er sich, dass es manchmal etwas für sich hatte, bei der Kripo zu sein. Wer war Lissette Núñez Delgado wirklich gewesen?
Im Dezember des Jahres 1989 wäre Lissette Núñez Delgado fünfundzwanzig Jahre alt geworden. 1964 wurde sie in Havanna geboren. Zu der Zeit war der neunjährige Mario Conde, in der Blüte seiner Kindheit, in seinen orthopädischen Schuhen mit anderen Jungen auf der Straße herumgelaufen und hatte sich – wie in den folgenden fünfzehn Jahren – nicht vorstellen können, eines Tages zur Kripo zu gehen und irgendwann einmal den Mord an dieser Frau zu untersuchen, die in einer damals modernen Wohnung im Stadtviertel Santos Suárez aufgewachsen war.
Zwei Jahre vor ihrem Tod hatte sie an der Pädagogischen Hochschule von Havanna ihr Chemie-Examen abgelegt und war (entgegen dem, was man in jener Zeit der Landschulheime und Lehrerstellen im Landesinneren erwarten konnte) ans Gymnasium von La Víbora gekommen. An derselben Schule hatte El Conde zwischen 1972 und 75 seine Oberstufenzeit erlebt und sich mit dem dünnen Carlos angefreundet. Dass sie ausgerechnet dort Lehrerin gewesen war, konnte möglicherweise sein Urteilsvermögen beeinträchtigen. Alles, was mit dieser Schule in Zusammenhang stand, weckte bei Mario entweder sentimentale Gefühle und Sympathie oder eine unüberwindbare Abneigung. Ich will nicht voreingenommen sein, ermahnte er sich; doch zwischen diesen beiden Extremen gab es nichts.
Lissettes Vater war vor drei Jahren gestorben, die Mutter wohnte nach ihrer Scheidung 1970 in der Siedlung Casino Deportivo, bei ihrem zweiten Mann, einem hohen Beamten im Bildungsministerium. Das erklärte sogleich, warum das junge Mädchen ihren Sozialdienst nicht außerhalb der Provinz Havanna abgeleistet hatte. Die Mutter war Journalistin bei Juventud Rebelde