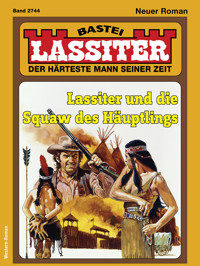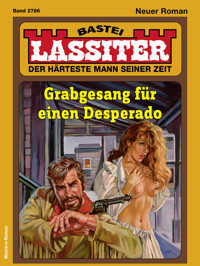2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf den Tag genau fünf Jahre nach seiner Verurteilung öffneten sich für Dick Wetham die Zuchthaustore. Drei Freunde erwarteten ihn. Sie hatten ein Pferd für ihn dabei. Am Sattelknauf hing ein Revolvergurt mit einem schweren, langläufigen 44er im Halter, im Scabbard steckte eine fabrikneue Winchester.
Einer der Kerle grinste und sagte: „Fünf Jahre, Dick. Hoffentlich haben sie dich nicht kleingekriegt oder bekehrt da drin.“ Er wies mit einer knappen Geste auf den riesigen Backsteinbau mit den vielen vergitterten Fenstern, der von hohen Mauern umgeben und mit Stacheldraht auf den Mauerkronen gesichert war.
Wethams Züge vereisten. „Sie haben es versucht, und manchmal war ich nahe daran, zu zerbrechen. Es war hart - höllisch hart. Aber der Gedanke an Quincannon hat mich durchhalten lassen.“ Aus der Tiefe seiner Augen stieg ein hässliches, bösartiges Funkeln. Seine Stimme war zuletzt von einer wilden, ungebändigten Leidenschaft verzerrt, und sein glitzernder Blick verlor sich für kurze Zeit in der Ferne, als würde er in bitteren Erinnerungen versinken.
Dick Wetham war voll Hass. Es war ein Hass, den die Jahre nicht zum Erlöschen zu bringen vermochten - ein Hass, der mit jedem Tag im Zuchthaus geschürt worden und höhergebrannt war wie eine verzehrende Flamme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hass, der in die Hölle führt
Western
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenHass, der in die Hölle führt
Western von Pete Hackett
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author (P.Haberl)
© 2012 der Digitalausgabe 2012 by AlfredBekker/CassiopeiaPress
www.AlfredBekker.de
Auf den Tag genau fünf Jahre nach seiner Verurteilung öffneten sich für Dick Wetham die Zuchthaustore. Drei Freunde erwarteten ihn. Sie hatten ein Pferd für ihn dabei. Am Sattelknauf hing ein Revolvergurt mit einem schweren, langläufigen 44er im Halter, im Scabbard steckte eine fabrikneue Winchester.
Einer der Kerle grinste und sagte: „Fünf Jahre, Dick. Hoffentlich haben sie dich nicht kleingekriegt oder bekehrt da drin.“ Er wies mit einer knappen Geste auf den riesigen Backsteinbau mit den vielen vergitterten Fenstern, der von hohen Mauern umgeben und mit Stacheldraht auf den Mauerkronen gesichert war.
Wethams Züge vereisten. „Sie haben es versucht, und manchmal war ich nahe daran, zu zerbrechen. Es war hart - höllisch hart. Aber der Gedanke an Quincannon hat mich durchhalten lassen.“ Aus der Tiefe seiner Augen stieg ein hässliches, bösartiges Funkeln. Seine Stimme war zuletzt von einer wilden, ungebändigten Leidenschaft verzerrt, und sein glitzernder Blick verlor sich für kurze Zeit in der Ferne, als würde er in bitteren Erinnerungen versinken.
Dick Wetham war voll Hass. Es war ein Hass, den die Jahre nicht zum Erlöschen zu bringen vermochten - ein Hass, der mit jedem Tag im Zuchthaus geschürt worden und höhergebrannt war wie eine verzehrende Flamme.
Plötzlich riss er sich los von seinen düsteren Überlegungen, er schaute wie ein Erwachender, es kam wieder Leben in seine Miene. Er sagte kehlig: „Es ist schön, dich zu sehen, Bill. Du hast meinen Brief also erhalten. Aber warum bringst du nur zwei Burschen mit?“
Er musterte die beiden abschätzend und sah zwei Kerle, die einen hartgesottenen, wenig vertrauensverweckenden Eindruck vermittelten, die dem äußeren Anschein nach aber im Großen und Ganzen seiner Vorstellung entsprachen.
„Ich habe vier Freunde von mir für den Ritt nach San Marcial gewinnen können, Dick. Ben Smith und Stuart Boddam habe ich schon in die Stadt vorausgeschickt, damit sie sich dort etwas umsehen und Quincannon auf deine Ankunft vorbereiten.“ Bill Haggan kicherte spöttisch. „Der verdammte Sternschlepper soll ruhig wissen, dass die bittere Stunde der Wahrheit für ihn nicht mehr fern ist.“
Dick Wetham schnallte sich den Revolvergurt um und band das Halfter am Oberschenkel fest. Er rückte den Colt zurecht, drückte den Knauf etwas nach außen, und dann zog er. Ansatzlos, gedankenschnell und glatt. Es war eine fließende Bewegung von Hand, Arm und Schulter. Mit dem Hochschwingen des Colts spannte er den Hahn, er schlug das Eisen an. Wie fest damit verwachsen lag es in seiner Faust.
Bill Haggan nickte anerkennend und schmunzelte beeindruckt: „Du hast es nicht verlernt, Dick. Was das Zaubern mit dem Sechsschüsser anbelangt, kann dir so schnell keiner das Wasser reichen.“
Wetham ließ den Hahn in die Ruherast gleiten, der Colt rotierte einmal um seinen Zeigefinger, er versenkte ihn im Futteral und lächelte geschmeichelt.
Einer sagte grinsend: „Mein Name ist McPherson - Cole McPherson. Wir kennen dich nur aus Bills Erzählungen, Wetham. Aber er hat wohl nicht übertrieben, als er dich als Akrobat mit dem Schießeisen beschrieb. Wenn du auch so gut triffst, wie du ziehst ...“
„Keine Sorge“, murmelte Wetham und zog das Gewehr aus dem Scabbard. Es war eine Winchester 73, erst ein halbes Jahr auf dem Markt, kinderleicht zu handhaben und sehr zielgenau. Er riegelte eine Patrone in den Lauf, hob das Gewehr an die Schulter und peilte ein imaginäres Ziel an. „Sehr gut“, lobte der alternde, hagere Bandit mit dem schmalen, hohlwangigen Raubvogelgesicht. Schulterlange, angegraute Haare fielen unter dem verschwitzten und verbeulten Stetson hervor. Ein unstetes, ruheloses Leben und die fünf Jahre in den Steinbrüchen hatten unübersehbare Spuren bei ihm hinterlassen. Tiefe Furchen zogen sich von seinen Nasenflügeln bis zu den Mundwinkeln. Eine helle Messernarbe auf der eingefallenen Wange bildete einen scharfen Kontrast zur sonnenverbrannten Haut.
Er senkte das Gewehr. In seinen pulvergrauen Augen irrlichterte es. „Morgen können wir in San Marcial sein. Reiten wir. Fünf Jahre lang habe ich diesen Tag herbeigesehnt wie sonst nichts auf der Welt. Die Hölle hat mich wieder ausgespuckt, Bill. Und nun gilt es, abzurechnen.“
Er stieß die Winchester in den Scabbard, warf sich in den Sattel und trieb das Pferd an. Dick Wetham war besessen von dem Gedanken an Rache. Mit diesem Gedanken war er Abend für Abend todmüde unter seine zerschlissene Decke gekrochen, mit ihm war er am Morgen wieder aufgewacht. Er hatte ihm geholfen, nicht durchzudrehen und zu verzweifeln unter der glühenden Sonne und den Peitschenschlägen der Aufseher. Jeder Schlag und jede Demütigung hatten seinem Hass neue Nahrung gegeben.
Mit jedem Schritt ihrer Pferde kamen sie San Marcial ein Stück näher. Und mit ihnen näherten sich Hass und Tod der friedlichen Stadt im Socorro County am Westufer des Rio Grande ...
*
Steve Quincannon, der Town Marshal von San Marcial, hatte seinen letzten Tagesrundgang hinter sich gebracht. Es ging auf den Abend zu. Die Sonne hing über dem westlichen Horizont. Von Osten kam schnell die Dämmerung. Die Schatten waren lang und begannen zu verblassen, das Land verlor seine Farben.
Steve bog in die Main Street ein. Es war die Stunde des Feierabends und San Marcial war ruhig. Auf der Straße war um diese Zeit kaum etwas los. Die Stadt war arglos. Niemand erinnerte sich des tödlichen Versprechens, das Dick Wetham vor fünf Jahren gegeben hatte. Dick Wetham war in Vergessenheit geraten. Und so ahnte niemand, dass sich das Verhängnis bereits auf stampfenden Hufen näherte, personifiziert in der Gestalt einiger Banditen, deren Lebenselexiere Hass, Gewalt und Terror waren.
Der einzige, der Wetham nicht vergessen hatte, war Steve. Und als er den Mann sah, der lässig am Stützpfosten des Vorbaudaches des Office lehnte, ahnte er sogleich das Unheil. Er verspürte eine jähe Anspannung.
Der Bursche war groß und wirkte abgerissen und verwahrlost. Staub haftete an seiner Kleidung. Er hatte sich den Stetson tief in die Stirn gedrückt, und so war von seinem stoppelbärtigen Gesicht nur der untere Teil zu sehen. Im ersten Moment durchfuhr wie ein Stromschlag der Name Wetham Steves Verstand. Im nächsten Augenblick aber wusste er, dass es sich nicht um den Banditen handelte. Steve stockte etwas im Schritt und schaute schnell in die Runde.
Der Fremde schien allein zu sein.
Steve beschleunigte seine Schrittfolge wieder. Als er an dem Fremden vorbei ins Office wollte, ließ dieser seine Stimme erklingen: „Sorry, Marshal, auf ein Wort.“
Es war eine klanglose Stimme ohne Höhen und Tiefen, weder freundlich noch auf irgendeine Art aggressiv. Dennoch brachte sie Steves Nerven zum Schwingen. Er blieb stehen, fixierte den anderen, und jetzt konnte er auch sein Gesicht sehen. Was er sah, gefiel ihm nicht. Bei dem Burschen handelte es sich um einen Sattelfalken, einen Langreiter, wahrscheinlich einen Gesetzlosen. In den Jahren als Marshal hatte Steve genug Menschenkenntnis erworben, um ihn richtig einzustufen. Und er dachte wieder an Dick Wetham.
„Was ist?“, fragte Steve.
Der andere lächelte und zeigte dabei die Zähne. „Ein schöner Ort, Marshal. Ruhig, friedlich und beschaulich. Früher soll San Marcial ein ziemlich wildes Nest gewesen sein. Haben Sie hier mit eisernem Besen gekehrt? Waren Sie die zähmende Hand hier?“
„Die Zeiten ändern sich eben“, versetzte Steve kühl. „Die Städte werden größer und zivilisierter. Die wilden Burschen sterben langsam aus, denn mehr und mehr zeigt man ihnen ihre Grenzen auf.“
„Ja, so scheint es“, erwiderte der Fremde. Sein Lächeln schien zu gefrieren. „Dennoch sollte man sich in solchen Städten nicht in Sicherheit wiegen, Marshal. Denn der eine oder andere wilde Hombre taucht überraschend wieder aus der Versenkung auf, um irgendwelche alte Rechnungen zu begleichen. Und dann ist es oftmals vorbei mit Ruhe, Frieden und Beschaulichkeit.“
Steve nickte gelassen. „Warum nennen Sie das Kind nicht beim Namen, Stranger? Sie schickt Dick Wetham, nicht wahr?“
„Nicht direkt“, dehnte der Bursche. „Wethams alter Freund Haggan meinte, wir sollten vorausreiten und dieses Nest - vor allen Dingen Sie, Marshal -, auf die Stunde der Abrechnung einstimmen.“
„Wir?“, entfuhr es Steve und seine Wirbelsäule versteifte jäh.
„Mein Freund Ben Smith und ich. Mein Name ist übrigens Boddam.“ Er deutete über die Straße, und als Steve den Kopf drehte, nahm er in der Mündung einer Gasse einen weiteren Burschen wahr, der vorher nicht dort gestanden hatte.
Ben Smith hatte die Hände flach hinter den Gurt mit dem tiefhängenden Halfter geschoben. Sein Gesicht war ausdruckslos. Um seinen Mund lag ein brutaler Zug. Eine unausgesprochene Drohung ging von ihm aus, etwas Gefährliches, ein Strom von Härte, Skrupellosigkeit und Gnadenlosigkeit.
Steve wandte sich Boddam wieder zu, als dieser erneut anhub. „Hatten Sie Wetham etwa aus Ihrem Gedächtnis gestrichen, Marshal? Rechneten Sie nicht mehr damit, dass er seinen Schwur erfüllt?“
„Wann kommt Wetham?“
„Morgen.“
Hinter Steve waren das Knarren von Stiefelleder, das leise Klirren von Radsporen und das Mahlen von Staub unter Ledersohlen zu hören. Ben Smith näherte sich mit schleppenden Schritten.
„Nun“, murmelte Steve, „dann sind wir ja gewarnt hier in der Stadt. Die Bürger San Marcials werden nicht dulden, dass ihr hier einen faulen Zauber abzieht. Sie werden euch geschlossen wie ein Mann gegenübertreten und euch mit Pauken und Trompeten zum Teufel jagen.“
Boddam lachte verächtlich auf. „Darauf würde ich mich nicht verlassen, Ouincannon. Es wird wohl eher so sein, dass sich eine ganze Reihe der ehrenwerten Gentleman hier in die Hosen machen und sich vor uns verkriechen.“
Hinter Steves Rücken lachte auch Ben Smith. Dann gab er zu verstehen: „Er spricht aus Erfahrung, Sternschlepper. Ich denke, du stehst ziemlich einsam und verlassen da, wenn es zum Treffen kommt. Es ist überall das selbe. Man wird dich daran erinnern, dass du derjenige bist, der für Ruhe und Ordnung zu sorgen hat. Sie bezahlen dich, damit du sie beschützt. Und sie machen keinen Finger krumm, wenn du für sie dein Fell zu Markte trägst. Es ist dein Job. Und das ist für sie die Rechtfertigung.“
Steve vollführte eine halbe Drehung. „Ich frage mich, woher Sie Ihre Sicherheit nehmen, Mister.“
„Ich war schon in vielen solchen Städten“, antwortete Smith fast sanft. Und dann fügte er klirrend hinzu: „Du wirst es selbst erleben, Quincannon. Morgen, wenn Wetham hier ist. Fang langsam an zu beten und komm mit dir ins Reine, Amigo. Denn deine Stunden sind gezählt.“
„Ich verstehe“, knurrte Steve. „Ihr seid vorausgeritten, um im Vorfeld die Menschen hier einzuschüchtern, zu verunsichern, sie ängstlich zu machen. Leider habe ich gegen euch Schufte nichts in der Hand. Ein Steckbrief scheint von euch in diesem Staat nicht zu existieren. Seid nur zurückhaltend und friedfertig, solange ihr in der Stadt weilt.“
Steve sprach es mit aller Entschiedenheit und setzte sich wieder in Bewegung. Er beachtete die beiden Banditen nicht mehr. Als sich die Officetür hinter ihm schloss, stieß Smith hervor: „Wir werden ihm seinen Hochmut austreiben. Ich sah schon ganz andere Burschen als ihn zerbrechen. Es ist nur eine Frage der Mittel. Komm, spülen wir uns den Staub aus der Kehle. Und dann sehen wir weiter.“
Sie lenkten ihre Schritte auf den Saloon zu.
*
Die Dunkelheit kam. Steve machte im Office kein Licht. Angie wartete mit dem Abendessen auf ihn. Er konnte sich nicht entschließen, nach Hause zu gehen. Er wollte alleine sein mit all seinen nagenden Gedanken. Auch wusste er nicht, wie er Angie beibringen sollte, dass über ihm das Damoklesschwert einer tödlichen Gefahr hing.
Er dachte daran, die maßgeblichen Männer der Stadt aufzusuchen, um mit ihnen über eine Bürgerwehr zu sprechen. Aber auch diesen Gedanken schob er beiseite. Ungute Ahnungen erfüllten ihn. Er wusste nicht, wie die Reaktionen ausfielen. Und tief in seinem Innersten fürchtete er sich davor, dass es so kommen könnte, wie der Bandit auf der Straße es prophezeit hatte.
Die Zeit schritt fort. Steves Gedanken bewegten sich im Kreis. Er spürte Verunsicherung, und das zermürbte seine Nerven und machte ihn gereizt. Aus dem Saloon war verschwommenes Stimmengewirr und Gelächter zu vernehmen. Boddam und Smith hatten also noch nicht begonnen, die Saat des Schreckens und der Angst in die Herzen und Gemüter zu streuen. Wahrscheinlich wollten sie nichts herausfordern. Möglicherweise wollten sie es auch ihm, Steve, überlassen, die Hiobsbotschaft in San Marcial zu verbreiten.
Plötzlich erklang lautes Kreischen, eine wütende Stimme schrie etwas, jemand lachte schallend. Schwerfällig erhob sich Steve. Er holte sein Gewehr, ging zur Tür und trat auf den Vorbau. Ein kühler Luftzug streifte ihn. Ein ganzes Stück die Straße hinunter lag eine Gestalt auf der Fahrbahn. Sie wurde vom Licht, das aus dem Saloon fiel, umflossen. Steve hörte den Mann hüsteln und ächzen, und nun kroch er auf allen vieren davon, auf den nachtschwarzen Schlund einer Gasse zu.
Steve seufzte. Er hatte den Mann erkannt. Er sprang vom Vorbau und schritt schräg über die Fahrbahn auf ihn zu. Der Mann lag nun im Maul der Gasse, röchelte und gurgelte, und bewegte sich nicht mehr, als hätte ihn sämtliche Kraft verlassen.
„Telly“, murmelte Steve bitter, als er ihn erreichte, „du hast dich also wieder sinnlos betrunken. Und sie haben dich wie so oft schon auf die Straße geworfen, als du ihnen lästig wurdest mit deiner Bettelei nach einem Brandy oder ein paar Cents.“
Der Betrunkene lallte unartikulierte Laute vor sich hin.
Steve beugte sich über ihn. „Es wird immer schlimmer mit dir, Telly. Ich muss dich wieder einmal zur Ausnüchterung ins Gefängnis stecken. - Du lieber Himmel, wie kann sich ein Mensch nur so sinnlos betrinken?“
Er packte Telly am Kragen der zerschlissenen, schmutzstarrenden Jacke, da lachte jemand leise hinter ihm, und dann sprang ihn eine spöttische Stimme an: „Quincannon der Samariter. Sieh an, sieh an. Liebe deinen Nächsten, wie? Du machst dem biblischen Grundsatz alle Ehre. Willst du dir damit einen Platz im Himmel erkaufen?“
Steve identifizierte diese Stimme auf Anhieb. Sie gehörte Ben Smith. Und Steve wusste, dass ihn die beiden Kerle beobachteten und überwachten.
Er nahm die Hand von Tellys Jackenkragen und versuchte, mit den Augen die Dunkelheit in der Gasse zu durchdringen. Es gelang ihm nicht.
Ben Smith sagte: „Es wird Wetham ein Leichtes sein, dir das Licht auszublasen, Quincannon. Du bist ziemlich unachtsam. Wir könnten dich jetzt kaltmachen. Du hebst dich gut ab gegen den helleren Hintergrund der Main Street. Aber keine Sorge: Wir wollen Dick Wetham nicht vorgreifen.“
Den Worten folgte wieder ein dumpfes, höhnisches Lachen.