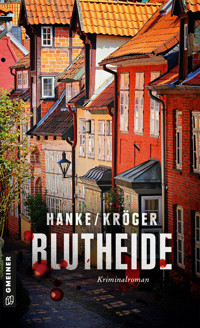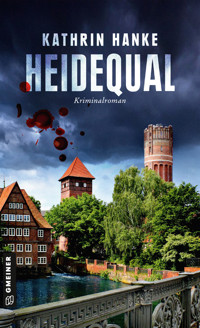Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Katharina von Hagemann
- Sprache: Deutsch
Mitten in den Vorbereitungen für das Lüneburger Stadtfest muss Katharina von Hagemann sich mit grausigen Funden auseinandersetzen: Menschliche Körperteile werden in und um Lüneburg entdeckt. Wer treibt hier sein sadistisches Spiel? Wird in der sonst so idyllischen Hansestadt jemand qualvoll zu Tode gefoltert? Ein Zufall bringt die Kommissarin auf eine verstörende Spur und lässt sie die verworrenen Zusammenhänge hinter diesem brutalen Fall erahnen. Doch kann sie ihn auch aufklären?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
K. Hanke / C. Kröger
Heidegrab
Der 2. Fall für Katharina von Hagemann
Zum Buch
Mit Albtraumgarantie Während die Vorbereitungen für das Lüneburger Stadtfest auf Hochtouren laufen, werden in Geo-Caching-Verstecken nacheinander abgetrennte Körperteile entdeckt. Alle stammen von demselben Opfer, dessen Identität jedoch nicht geklärt werden kann. Kommissarin Katharina von Hagemann und ihre Kollegen tappen völlig im Dunklen. Wird hier ein Mensch langsam und qualvoll zu Tode gefoltert? Hat die Studentengruppe um Moritz Bredenbeck, die gegen das Stadtfest hetzt, etwas damit zu tun? Warum ist die Tochter von Simon Minkwitz, einem Stadtfestverantwortlichen, verschwunden? Unverhoffte Unterstützung erhalten die Ermittler von Gerichtsmediziner Helge Conrad, der sie in die abgeschottete Geo-Caching Szene einführen kann, da er selbst diesem Hobby nachgeht. Doch sind Katharina von Hagemann und ihr Chef Benjamin Rehder überhaupt auf der richtigen Spur? Je weiter sie in den Ermittlungen vorankommen, desto mehr wird ihnen das tatsächliche Ausmaß dieses grausamen Falles vor Augen geführt …
Kathrin Hanke studierte in Lüneburg Kulturwissenschaften, bevor Sie als Werbetexterin ihre Brötchen verdiente. Heute lebt sie als freie Autorin mit ihrer Familie in Hamburg.
Claudia Kröger ist gelernte Verlagskauffrau und heute als freiberufliche Redakteurin und Texterin tätig. Sie wohnt mit ihrem Mann in der Nähe von Lüneburg.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © LP12inch / photocase.de
ISBN 978-3-8392-4482-1
Widmung
Für Piffi.
Kathrin Hanke
*
Für Andreas – weil das Leben mit dir voller Überraschungen ist.
Claudia Kröger
Zitat
»Hühte Dich und thu kein Böses nicht, So komstu auch nicht In s gericht«
Inschrift auf einem Richtschwert
Prolog:
Freitag, 7. Juni 2013,7 Tage vor dem Lüneburger Stadtfest
13.38 Uhr
Sie lag ausgestreckt auf dem Rücken. Normalerweise schlief sie ähnlich einer Katze zusammengerollt auf der Seite. In ihrem Kopf dröhnte es. Als hätte jemand von weit her einen tiefen Trompetenstoß hineingeblasen, der jetzt zwischen ihren Schädelknochen gefangen war und darin so schnell, wie es nur ein Schall vermochte, von einer Wand ihres Kopfes zur anderen geworfen wurde. Nur um ein ums andere Mal verzweifelt wieder abzuprallen, ohne den erlösenden Ausweg zu finden. Gleichzeitig schien ihr Kopf von außen in einem Schraubstock festzustecken, der übel machenden Druck auf ihre Schläfen ausübte.
Sie versuchte ihren Mund aufzusperren, in der Hoffnung, dass auf diese Weise der Trompetenstoß mitsamt der Übelkeit aus ihrem Schädel strömte. Es gelang ihr nicht. So sehr sie ihre Lippenmuskeln auch einsetzte, sie wollten sich nicht bewegen.
Nur langsam, erschwert durch das Dröhnen in ihrem Hirn, erkannte sie, dass ihre Lippen versiegelt waren. Versiegelt von einem fest haftenden Klebeband, das an ihren feinen Gesichtshärchen zerrte, wenn sie ihre Lippen um einen Millimeter spielen ließ. Sie konnte den Leim schmecken, der sich mit einem anderen eigentümlichen Geschmack in ihrem trockenen Mund mischte, den sie jedoch nicht einzuordnen wusste. Sie versuchte ihre Hand zu heben, um ihren Mund zu befreien, doch ihre Arme lösten sich nicht von ihrer Unterlage. Wie sie ihre Lippen nicht öffnen konnte, so ließen sich auch ihre Arme nicht anheben. Zwar fühlte sie die Kraftanstrengung ihrer regelmäßig im Fitnessstudio gestählten Muskeln, aber ihre Arme blieben liegen, wo sie waren.
Panik stieg in ihr hoch. Trotz des Klebebandes war es ihr möglich, auszuatmen, das Atemloch schien aber zu klein, um die Übelkeit – geschweige denn das Dröhnen ihres Kopfes − daraus zu entlassen.
Mit nach wie vor geschlossenen Augen tasteten ihre Sinne ihren Körper weiter ab. Auch auf ihrem Nasenrücken lag etwas auf, das sich einmal um ihren gesamten Kopf wand und nicht abschütteln ließ. Zweimal versuchte sie es. Für ein drittes Mal war sie zu schwach. Außerdem hatte das Kopfschütteln tausend kleine Zwerge, die in ihrem rechten Ohr zu sitzen schienen, wachgerüttelt. Zunächst etwas verschlafen wurden sie jetzt munterer und meißelten in ihrer Ohrmuschel herum, als gäbe es dort pures Gold zu finden. Begleitet wurde die Zwergenarbeit von regelmäßigen tiefen Paukenschlägen, die ihr Trommelfell zum Pochen brachten, sodass es zu zerspringen drohte.
Die Panik hatte nun vollends von ihr Besitz ergriffen, und ihr Herz bummerte wild, als wolle es einen Hundertmeterlauf gewinnen.
Was war mit ihrem Ohr los – und was war das für ein Ding auf ihrer Nase?
Eine Sauerstoffmaske vielleicht?
Hatte sie einen Unfall gehabt und erwachte gerade in einer Klinik? Oder war das Ganze nur ein mieser Albtraum?
Sie hatte oft Albträume, doch drehten sich diese meist um Babys, die anstelle von Rasseln scharfe Fleischermesser in ihren Fäustchen hielten und sie verfolgten. Wie kleine Racheengel sahen diese Babys aus. Manchmal auch wie Chucky, die Mörderpuppe. Normalerweise waren diese Träume jedoch nie so real wie dieser. Sie wusste dann stets, dass sie in einem Traum gefangen war, jetzt war sie sich nicht sicher.
Mach einfach die Augen auf, und alles ist gut, schoss es ihr durch den schmerzenden Kopf, und das Dröhnen verstärkte sich, obwohl der Gedanke allerhöchstens eine Zehntelsekunde durch sie hindurch gewandert und in ihrem pochenden Ohr hängen geblieben war.
Widersinnigerweise kam ihr in diesem Moment ihr mechanisches Kopfmassageteil in den Sinn, das aussah wie ein Handquirl, dessen Stäbe auseinandergebrochen sind. Oder wie eine mutierte Spinne mit dünnem Körper und vielen, viel zu langen Armen, die mich gefangen halten, einlullen, um mich besser in die Netzspeisekammer tragen zu können, wo ich darauf warten muss, ausgesaugt zu werden, dachte sie voller Grauen. Ein Schauer durchrieselte ihren Körper.
Aufwachen, wach endlich auf!, schrie alles in ihr, und mit einem angestrengten Ruck öffnete sie die Augen.
Was sie sah, war nichts.
Weiterhin absolute Dunkelheit.
Hatte sie die Augen gar nicht geöffnet?
War sie nach wie vor in ihrem Albtraum gefangen?
Oder war sie tatsächlich ein Unfallopfer und lag jetzt im Koma?
Sie hatte hier und da etwas über Komapatienten gelesen, die daraus erwacht waren und von ihrer Zeit der Abwesenheit aus dem eigentlichen Leben berichtet hatten. Besonders gut konnte sie sich allerdings nicht erinnern. Hatten diese Menschen von einer undurchdringlichen Dunkelheit erzählt, die sie in diesem Moment umgab? War da nicht eher von einem hellen Licht die Rede gewesen, das so lockend war, dass man ihm entgegeneilen wollte? Oder waren das die Berichte von Menschen gewesen, die dem Tod ins Auge geschaut hatten? Sie wusste es nicht mehr.
Sie versuchte, ihre Beine zu bewegen. Was war mit ihren Beinen? Sie spürte sie genauso wie ihre Arme, obwohl sie sie nicht auseinanderspreizen konnte – ihre Füße schienen an den Fesseln wie siamesische Zwillinge miteinander verbunden zu sein.
War sie gelähmt?
Hatte der Unfall, von dem sie inzwischen fest ausging, ihr Rückenmark durchtrennt?
Anwinkeln konnte sie die Beine. Also konnte sie die Befürchtung einer Lähmung beiseiteschieben. Aber was war dann mit ihr?
Langsam zog sie ihre Knie hoch, doch sie wurden abrupt gestoppt. So sehr sie sie weiter anziehen wollte, es ging nicht. Da war irgendein kalter, ebenmäßiger Widerstand. Eine Decke, ja, das war es: eine niedrige Decke aus glattem, massivem Holz. War Holz so kalt? Es konnte auch Stahl oder ein ähnliches Material sein. Sie wusste es nicht. Sie wusste nur, dass etwas ihre Beine stoppte. Lag sie etwa immer noch unter dem Auto, das sie vermutlich überfahren hatte, und nicht sicher in einem Krankenhausbett? Aber dann wäre die Decke über ihr nicht so glatt und kalt … Und warum konnte sie das überhaupt so genau an ihrer Haut spüren?
Mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass sie nackt sein musste.
Erneut breitete sich Panik in ihr aus. Ihr Herz begann wild zu hämmern, sodass sie es bis in den Hals spürte. Kalte Angst schnürte ihr obendrein die Kehle zu.
Wo war sie?
Warum kam ihr niemand zu Hilfe?
Die Erkenntnis schlug ein wie der unvorhergesehene Stich einer Wespe: Sie war tot, oder zumindest tot geglaubt, und lag gefangen in einem Sarg.
Zitat
»In frühester Zeit war das Abschneiden der Ohren eine Strafe für Knechte, denn sie beließ diesem die volle Arbeitskraft. Im Mittelalter war Ohrenabschneiden häufig mit der Landesverweisung verbunden. Bei Diebstahl war es Strafe und zugleich Kenntlichmachung. Auch bei Gotteslästerung und Tragen verbotener Waffen fand diese Strafe Anwendung. Meist wurde nur ein Ohr, häufig aber auch beide abgeschnitten. Die alten Gerichtsurteile lassen erkennen, daß es sich um eine meist an Frauen vollzogene Strafe gehandelt haben muß. Verhältnismäßig selten wurde sie an Männern vollzogen. Die Ursache dafür mag darin liegen, daß man Männer bei Diebstahl henkte. Das Ohrenabschneiden war, da es ja nur geringen körperlichen Schaden zurückließ, eine Strafe, die dem Missetäter als Warnung dienen sollte, künftig ein ordentliches, den Gesetzen entsprechendes Leben zu führen.«
(aus: Gustav Radbruch, Heinrich Gwinner: Geschichte des Verbrechens, Die Andere Bibliothek, Frankfurt am Main 1990)
1. Kapitel:
Montag, 10. Juni 2013,4 Tage vor dem Lüneburger Stadtfest
07.39 Uhr
Katharina von Hagemann stand am Fenster ihres Büros und schaute hinaus auf die noch verschlafene Stadt. Sie liebte es, diese frühe Stunde allein zu erleben, bevor der alltägliche Trubel im Kommissariat gegen acht Uhr begann. Sie beugte sich weiter vor und lehnte ihre Stirn an die kühle Fensterscheibe, um besser nach unten auf die Straßen blicken zu können. Ein wohliger Schauer überlief sie, als sie die vereinzelten Passanten beobachtete, die auf ihrem Weg zur Arbeit durch die Gassen liefen. Der eine oder andere huschte schnell in die Bäckerei, deren Schaufenster die junge Kommissarin von ihrem Platz aus sehen konnte, und holte sich sein Frühstück ab, während die Frühlingssonne langsam hervorkroch. Alles war angenehm ruhig und entspannt. Ein typischer Montagmorgen in Lüneburg. Hier im Stadtkern waren um diese Uhrzeit nur wenige Autos unterwegs. Der Berufsverkehr spielte sich auf den Ausfallstraßen ab, die auf die Autobahnen und in die nahe gelegenen Großstädte Hamburg oder Hannover führten.
Noch vor einigen Jahren hätte Katharina es nicht für möglich gehalten, dass sie diese Kleinstadtidylle einmal so zu schätzen wissen würde. Sie war ein Hamburger Großstadtkind und hatte in der Zeit, die sie beruflich nach München geführt hatte, den Trubel einer Metropole geliebt. Doch das hatte sich inzwischen komplett geändert. Wie so vieles in ihrem Leben.
Zwei Jahre lebte sie nun schon in Lüneburg und sie konnte sich besonders an Tagen wie diesen nicht vorstellen, das Heidestädtchen wieder zu verlassen. Hier war sie zur Ruhe gekommen, zum Vergessen. Fast jedenfalls. Nur noch selten suchten sie die Albträume heim, die ihr letzter Fall in München ihr beschert hatte. Dafür würde sie Lüneburg immer dankbar sein. Der Stadt und den Menschen, die sie hier kennengelernt hatte …
»Moin, schöne Frau! Darf man erfahren, wer der Glückliche ist, von dem du gerade träumst? Du hattest wohl ein romantisches Wochenende, wie?«
Erschrocken wirbelte Katharina herum und sah in das breit grinsende Gesicht von Kommissar Tobias Schneider.
»Mann, Tobi! Was machst du denn schon hier?«, fuhr sie den Kollegen an, konnte jedoch ein Lächeln nicht unterdrücken. »Kannst du nicht ganz normal Guten Morgen sagen? Auf nüchternen Magen sind deine dummen Sprüche noch schwerer auszuhalten als sonst.«
Tobias versuchte, beleidigt zu gucken, aber es gelang ihm nicht. Er war eine überzeugte Frohnatur, der ein schroffer Ton kaum etwas anhaben konnte. Schon rutschte ihm das schiefe Grinsen ins Gesicht, an das Katharina sich in den vergangenen zwei Jahren so gewöhnt hatte.
»Ich kann nicht anders, du kennst mich schließlich lange genug, Katharina. Und du hast doch selbst eben rausgeguckt: Heute wird ein traumhafter Frühlingstag, da muss ich einfach gut drauf sein, sogar an einem Montag!«
Tobias ließ sich schwungvoll auf seinen Schreibtischstuhl fallen und fuhr seinen PC hoch.
»Und, liegt irgendwas an?«, fragte er voller Motivation.
Katharina verließ ihren Platz am Fenster und setzte sich an ihren Schreibtisch.
»Nein, nichts. Überhaupt gar nichts. Eigentlich sollte man sich in unserem Job wohl darüber freuen, doch ehrlich gesagt wird mir allmählich langweilig. Und das fühlt sich ziemlich schlecht an. Seit fünf Tagen herrscht im Landkreis Katastrophenalarm wegen des Hochwassers. Nicht weit von hier haben viele Menschen Angst um ihre Existenz und schleppen Sandsäcke an den Deich, während ich jammere, dass ich nicht genug zu tun habe. Lieber würde ich Säcke wuchten, aber bisher wurden wir nicht dafür freigestellt. Warum auch immer.« Katharina seufzte, bevor sie sinnierend fortfuhr: »Das ist wirklich krass. Erst schüttet es wie aus Eimern, und dann strahlt eitel Sonnenschein vom Himmel, und die Elbe schwappt trotzdem über. Na ja, nützt nichts, wenn ich da draußen schon nicht helfen kann, komme ich wohl nicht drum herum, die Zeit zu nutzen, um meinen Schreibtisch aufzuräumen.«
»Hm, könnte nicht schaden«, stimmte Tobias ihr mit einem Zwinkern zu und ließ seinen Blick bedeutungsvoll über ihren Schreibtisch gleiten, der in der Tat ziemlich chaotisch aussah. Dann warf er ihr eine kleine Brötchentüte zu: »Zuerst wird gefrühstückt. Ich hab dir ein Franzbrötchen mitgebracht!«
Er biss von einem Croissant ab und sagte schmatzend: »Genieß es lieber, solange es noch ruhig ist. In ein paar Tagen geht das Stadtfest los, und wir haben Rummel ohne Ende, da ist immer irgendwas zu tun. Und wenn es nur eine schnapsgefütterte Rauferei ist, die ausartet.«
»Ach stimmt ja, das Stadtfest! Da hab ich überhaupt nicht mehr dran gedacht!«, erwiderte Katharina und schlug sich gegen die Stirn.
Tobias sah sie schelmisch von der Seite an: »Du bist noch immer keine richtige Lüneburgerin, sonst würdest du das Stadtfest nicht vergessen. Denn was eine echte Lüne…«
»Das liegt wohl eher daran, dass ich es noch nie miterlebt habe, du Schlaumeier«, unterbrach Katharina ihn augenzwinkernd. »In meinem ersten Jahr hatte ich gerade die Geschichte mit diesem Psychopathen hinter mich gebracht und bin kurz danach ein Wochenende an die Nordsee gefahren. Genau an dem Wochenende, als es stattfand. Und im vergangenen Jahr hat es gar kein Stadtfest gegeben, wenn ich mich recht erinnere, oder?«
Tobias runzelte die Stirn und überlegte: »Stimmt, jetzt wo du es sagst – da ist es aufgrund der Hansetage ausgefallen … Okay, entschuldige, Kollegin. Aber dieses Jahr kommst du nicht dran vorbei, so oder so! Außerdem gibt es ein paar Aktionen, bei denen für die Flutopfer gesammelt wird. Wegen deines schlechten Gewissens, meine ich. Es gibt also keine Ausrede für dich, das Stadtfest nicht zu besuchen«, grinste Tobias sie an. »Vorm Kaffeekochen kannst du dich übrigens auch nicht drücken, ich habe schließlich schon für die Brötchen gesorgt. Und beeil dich lieber, der Chef ist im Anmarsch – er sieht aus, als ob er einen starken Kaffee gebrauchen könnte.«
Katharina drehte sich um und sah, was Tobias meinte. Von ungetrübter Frühlingslaune war in Benjamin Rehders Gesicht an diesem Morgen nichts zu lesen. Der Hauptkommissar sah eher so aus, als seien ihm gleich mehrere Läuse auf einmal über die Leber gelaufen.
07.54 Uhr
Im ersten Augenblick glaubte sie, Lichtwesen zu sehen. Sie war nie wirklich esoterisch orientiert gewesen. Nur eben soweit, dass die Frauen aus ihren gesellschaftlichen Kreisen in ihr eine Gleichgesinnte gesehen und sie zu ihren Sitzungen eingeladen hatten.
Diese Sitzungen waren nichts anderes gewesen, als vormittags Tee mit Rum zu trinken, teures Gebäck aus dem Bioladen in sich hineinzustopfen und munter über Nicht-Eingeladene zu lästern. Oder über diejenige, die kurz ins Bad verschwunden war. Unter dem Siegel der spirituellen Lösungsfindung waren Probleme von anderen gewälzt worden, die so alltäglich daherkamen, dass sie ähnlich den eigenen waren. Aber es war nett und oft aufschlussreich gewesen. Außerdem hatte sie sich dadurch den Therapeuten gespart. Den besuchte sie erst regelmäßig, seit die Esoterik-Phase in ihren Kreisen abebbte und an dessen Stelle der Wellnesstrend Einzug hielt.
Sie sah keine Wesen wie Peter Pans Tinkerbell, die elfengleich durch ihr Bewusstsein flatterten. Hinter ihren geschlossenen Augen machte sie nur plötzlich Lichtpunkte aus. Da sie wusste, dass das nicht sein konnte, weil sie in diesem dunklen Kasten gefangen war, vermutete sie einfach, dass es Lichtwesen wären, die ihr den langsamen Tod so angenehm wie möglich gestalten wollten. Irgendeine der Frauen, ihr fiel nicht mehr ein, welche von ihnen, hatte davon einmal berichtet. Damals hatte sie es als versponnen abgetan und gemeint, die Frau wollte sich nur wichtig machen. Hier und in dieser Situation gab ihr die Idee jedoch Halt, und sie fühlte sich nicht mehr ganz so allein. Aus Dankbarkeit und um die kleinen Wesen nicht zu verscheuchen, öffnete sie ihre Augen nicht, sondern verfolgte deren Spiralflug. Sie drehten strahlende runde Kreise, die stetig ihre Form von klein auf groß änderten. Dabei sahen sie aus wie die funkelnden Gestirne am Himmel. Dann, mit einem Mal, empfand sie Schmerzen auf ihren Lidern und hatte das Gefühl, das gleißende Licht würde anfangen, die zarte Haut darauf zu verbrennen. Aus purem Reflex schlug sie die Augen auf, aber das Licht war noch da und machte sie zunächst auf ganz andere Art als die Dunkelheit blind. Da wusste sie, dass sie keine Lichtwesen gesehen hatte, sondern endlich in ihrem Sarg gefunden worden war. Trotz des Schmerzes erfüllte sie ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Sie war gerettet und musste nicht mehr im Dunkeln auf den Tod warten. Sie hatte nicht bemerkt, wie der Sarg geöffnet worden war. Hätte sie es nicht hören müssen?
Gern wollte sie etwas sagen, doch aus ihrem trockenen Hals drang kein Laut. Noch nicht einmal ein Krächzen. Daher drehte sie den Kopf zur Seite. In diesem Moment war das Glücksgefühl so schnell vorüber, wie es gekommen war, und machte erneut der Panik Platz, die seit ihrem ersten Aufwachen an diesem Ort zu ihrer ganz eigenen Welt gehörte.
Trotz ihres Dämmerzustands begriff sie sofort, dass die schemenhafte Gestalt, die sie nun ausmachte, nicht die ihres Retters war. Die Gestalt umflorte das Licht und gab ihm eine Aura von Kälte, die ihr Herz zu einem kleinen, festen Klumpen zusammenzog. Ohne die Kälte mitzunehmen, verflüchtigte sich langsam wabernd die Aura, und die schemenhafte Gestalt wurde zu einem Bild, das die feinen Härchen ihres Nackens, die ihr Mann früher einmal gern gestreichelt hatte, zu Berge stehen ließ: Sie hatte eine Henkersgestalt vor sich. So hatte sie sich den leibhaftigen Tod, den gefallenen Engel, vorgestellt. Holte er sie jetzt? Aber irgendwie … Es war alles so echt. So lebendig … auch sie selbst …
Die Gestalt trug ein rotes Hemd und darüber ein schwarzes Wams. Die ebenfalls schwarze weite Pluderhose wurde von einem schwarzen breiten Gürtel gehalten. Das Erschreckendste an der Gestalt war aber fraglos die rote Henkersmütze, die das gesamte Gesicht bedeckte und lediglich Schlitze für Augen und Mund besaß.
Der Henker rührte sich nicht, sondern betrachtete sie nur eingehend. Dann beugte er sich mit einem Ruck über ihr Gesicht, sodass sie seinen faulen Atem einatmen musste. Er atmete schwer. Mit einer Zärtlichkeit, die sie überraschte, griff er wortlos ihren Kopf mit behandschuhten Händen und drehte ihn seitlich von sich weg. Sie glaubte, er wolle ihr das Genick brechen, wusste allerdings nicht, ob das auf diese Weise überhaupt möglich war. Sicherheitshalber wehrte sie sich nicht. In diesem Moment hatte sie nichts gegen einen schnellen Tod einzuwenden, hätte dann schließlich das andauernde Grauen ein Ende und ihr Gefängnis seine Berechtigung. Noch im Kopfwegdrehen schloss sie die Augen und wartete klopfenden Herzens darauf, dass es mit ihr vorbei sein würde, doch die erleichternde Stille der Ewigkeit blieb aus.
Stattdessen spürte sie, wie ihr Folterknecht den Schraubstock um ihre rechte Schläfe lockerte und sich an ihrem noch immer vor Schmerz glühenden Ohr zu schaffen machte. Merkwürdigerweise hörte sie dabei nichts. Keinen schweren Atem. Gar nichts. Nur ein Rauschen, das aus ihrem Inneren zu kommen schien. Auf ihrem linken Ohr lag sie, darum war es verschlossen wie im letzten Winter von ihren puscheligen cremefarbenen Ohrenschützern, die aussahen wie zu groß geratene Puderquasten. Sie hatte sie damals getragen, weil sie gerade in Mode gewesen waren, eigentlich jedoch nie gemocht.
Nach dem Ohr war jetzt ihr Arm an der Reihe. Erst wurde er lang gezogen, dann heruntergedrückt. Sie verspürte einen kleinen Stich in der Armbeuge und seufzte vor Seligkeit, als sich daraufhin das ersehnte Nichts in ihrem Körper ausbreitete und ihre Sinne zum Versiegen brachte.
08.09 Uhr
Er war von Anfang an lieber allein unterwegs gewesen. Natürlich hatte er es auch einige Male innerhalb einer kleineren Gruppe gemacht, vor allem zu Beginn, doch das hatte er schnell wieder gelassen. Er war ein Einzelgänger. Ihn nervten die Besserwissereien mancher Teilnehmer und das arrogante Geprotze mit ihrem Hab und Gut. Stets ging es darum, wer die bessere Ausrüstung, das bessere GPS-Gerät und so weiter hatte. Für ihn kam es darauf nicht an. Am Ende zählte nur das Ergebnis. Zumindest sah er das so, hatte es immer so gesehen.
Lorenz Winters Herz wummerte vor Aufregung. Gleich hatte er den Startpunkt erreicht, und die Schatzsuche konnte beginnen, mit der er dieses Mal noch ein weiteres Vorhaben verband. Ein wichtiges. Er musste nur eben die große Willy-Brandt-Straße überqueren, in den Amselweg einbiegen, und schon würde er in einem herrlichen Naturschutzgebiet, den Lüneburger Ilmenau-Niederungen mit Tiergarten, ankommen. Er war hier früher oft mit seiner Frau spazieren gegangen, aber seit ihrem Tod hatte er die Gegend gemieden wie die Katze den Hund. Die Erinnerung an ihre harmonischen Spaziergänge war zu schmerzlich gewesen. Doch gestern hatte er beschlossen, sich diesem Schmerz zu stellen. Theresa war schon über fünf Jahre nicht mehr bei ihm, und er fand auch heute Morgen noch, dass es jetzt endlich an der Zeit war, seine Trauer zu überwinden. Dazu gehörten gleichwohl Schritte in die gemeinsame Vergangenheit, so schwer das auch fallen würde. Ein Phobiker sollte sich auch schonungslos seinem Panikauslöser stellen, um die Angst davor zu besiegen oder wenigstens zu lernen, damit zu leben.
Sachlich, wie er war, hatte er sich an seinen Computer gesetzt und im Internet gezielt nach GPS-Koordinaten zu einem Cache in den Ilmenau-Niederungen gesucht. Es hatte gedauert, doch dann hatte er ihn zu seiner eigenen Überraschung tatsächlich gefunden: den einzigen Cache in dieser Gegend. Er hatte das als Zeichen angesehen, dass dieser Umgang mit der Trauer um Theresa der richtige war.
Lorenz Winter war mit seinen 67 Jahren ein leidenschaftlicher Geocacher. Er hatte dieses Hobby nach dem Tod seiner Frau begonnen, um sich abzulenken, und seit seiner Pensionierung verging kaum eine Woche, in der er nicht unterwegs war, um einen Schatz, den Geocache, zu heben. Er war dafür sogar schon ein paarmal in Skandinavien gewesen, obwohl es in seiner Heimatregion Niedersachsen auch etliche gab. Doch er reiste gern und hatte bereits zu Jugendzeiten verschiedene Outdoor-Aktivitäten betrieben, weil er seit eh und je die Natur liebte. Mit dem Ingenieurstudium war seine Zeit dafür deutlich weniger geworden – und im Berufsleben dann erst recht. Er war Dozent an der Technischen Universität Hamburg-Harburg im Studiengang Umweltingenieurwesen gewesen. Dort hatte er damals auch Theresa kennengelernt. Sie war eine seiner Studentinnen gewesen, und sie hatten sich schon bei ihrer ersten Begegnung ineinander verliebt. Zu Beginn hatte er es kaum fassen können. Immerhin war er mehr als 20 Jahre älter als sie, doch Theresa hatte nicht locker gelassen, und kurz, nachdem sie ihre Doktorarbeit geschrieben hatte, hatten sie geheiratet.
Sie hatten viele wunderbare Jahre als liebende Eheleute miteinander verlebt und das Interesse an digitalen Karten und vor allem am Thema Global Positioning System geteilt. Hierüber hatten sie sich stundenlang bei ihren Spaziergängen unterhalten. GPS, das weltweit funktionsfähige Navigationssystem, war für sie ein faszinierendes Wunder innovativer Technologie. Lorenz war es daher nur konsequent erschienen, sich nach Theresas Unfalltod dem Geocaching zuzuwenden, anstatt sich ein anderes Hobby zu suchen.
Lorenz ließ den Amselweg hinter sich und trat in den Pfad, der in das Naturschutzgebiet hineinführte. Während er sein GPS-Gerät aus der Jackentasche holte und es einschaltete, wuchs die vertraute Spannung in ihm.
Er hatte schon ein paarmal versucht, Nicht-Geocachern diese Empfindung zu erklären, es dann jedoch bald aufgegeben. Nicht umsonst wurden solche Menschen in Geocachekreisen Muggels genannt. Lorenz mochte den Begriff nicht, zumal er aus den Harry-Potter-Büchern geklaut war, für die er nicht viel übrig hatte. Dennoch traf Muggels genau den Punkt; sie waren eben Außenstehende, die nichts verstanden.
»Wozu soll ich etwas suchen, von dessen Versteck ich bereits die Koordinaten kenne? Das ist doch total einfach, wo ist da der Kick?«, hatte ihn einmal ein Nachbar gefragt. Lorenz hatte sich eine Antwort darauf gespart und ihn stehen lassen.
Wie sollte man jemandem ein Hochgefühl erklären, der den Sinn der Schatzsuche – und nichts anderes war Geocaching – nicht begriff? Natürlich erschien es auf den ersten Blick simpel. Doch dieser Blick war trügerisch. Es war eine Sache, das Versteck eines Schatzes zu kennen. Die andere war es, dort hinzukommen und ihn auch zu finden. Das war schon bei den Piraten so gewesen. Nicht umsonst gab es unzählige Romane darüber.
Lorenz schaute auf sein GPS-Gerät und ging dabei gemächlich den Pfad entlang. Den Pfad, den er mit Theresa so oft gegangen war. Sie schien ihm in diesem Moment besonders nah, fast so, als würde sie neben ihm gehen. Dieses Gefühl war schön, und Lorenz war froh, dass er es heute gewagt hatte, seiner Trauer um die geliebte Frau ins Auge zu blicken. Vor allem durch die wohlbekannte Natur um ihn herum und das GPS-Gerät in seinen Händen fühlte er sich ihr sehr viel mehr verbunden als zu Hause auf seinem Sofa.
Er hatte auch ohne ständigen Blick auf das GPS-Gerät eine ungefähre Ahnung, wo der Cache versteckt war. Wenn er sich nicht irrte, musste es in der Nähe der kleinen hölzernen Bank sein, auf der Theresa mit ihm so gern eine Rast eingelegt hatte.
Tatsächlich stellte Lorenz etwa eine Dreiviertelstunde später voller Befriedigung fest, dass er sich nicht getäuscht hatte: Die im Internet angegebenen Koordinaten des Cacheverstecks stimmten mit dem Areal, auf dem auch die Bank stand, überein.
Da er es nicht eilig hatte und kein anderer Spaziergänger auf der Bank saß, ließ er sich nieder. Ihm war auf seinem Weg hierher niemand begegnet, was an einem frühen Montagmorgen nicht verwunderlich war, denn die meisten Lüneburger mussten um diese Zeit bereits ihre Brötchen verdienen.
Lorenz hatte sich in die Mitte der Bank gesetzt und seine Arme rechts und links weit über die Lehne ausgestreckt. Er legte seinen Kopf in den Nacken, schloss die Lider und ließ sich von den Sonnenstrahlen kitzeln, die es durch die sprießenden Baumwipfel zu ihm hinunter schafften. Sofort erschien vor seinem inneren Auge das lächelnde Gesicht von Theresa. Er musste unwillkürlich zurücklächeln. Dann änderte sich die Szenerie seines Kopfkinos, und das Lächeln gefror ihm auf den Lippen. Theresa lächelte ihn immer noch an, aber aus ihren Poren strömte jetzt Blut hervor, und das Strahlen ihrer Augen verlosch so langsam wie das Bild auf einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher, wenn man ihn abschaltete.
Lorenz riss die Augen auf und sprang von der Bank auf. Aus seinem Mund drang ein qualvolles Stöhnen. Schwer atmend ging er in die Knie. Er hatte mit heftigsten Gefühlsschwankungen gerechnet, als er sich entschlossen hatte, heute hierher zu kommen. Doch dass die Erinnerung sich auf lautlosen Sohlen anschleichen und dermaßen ungestüm die noch eben gefühlte Harmonie in einen solch beißenden Schmerz verwandeln würde, hatte er nicht erwartet. Erschöpft sank er auf den sandigen Boden vor der Bank. Jetzt oder nie, dachte er. Stell dich der Vergangenheit, stell dich deiner Schuld.
Er schloss erneut seine Lider und wehrte sich nicht länger gegen den Film, der sofort wieder in seinem Kopf aufflackerte und Theresas Tod vor ihm ablaufen ließ:
Es war ein Freitagabend, kurz vor 20 Uhr. Hand in Hand schlenderte er mit Theresa die dicht befahrene Reichenbachstraße entlang. Ihr Ziel war das Cinestar, damals Lüneburgs Filmpalast im Fährsteg auf dem Gelände einer ehemaligen Bundesgrenzschutzkaserne. Lorenz hatte den Kinoabend vorgeschlagen und Theresa, die nach einem langen Arbeitstag lieber zu Hause geblieben wäre, dazu überredet. Er hörte sich noch sagen: »Ach komm, Liebes, lass uns unser schönes Leben leben! Auf dem Sofa versauern, das können wir, wenn wir beide richtig alt sind! Aber bis dahin haben wir noch viel Zeit.« Wie furchtbar zynisch das aus heutiger Sicht erschien …
An der Kreuzung zur Bockelmannstraße blieben sie an der roten Ampel stehen, und Theresa begann den Refrain des Ampelmann-Liedes zu singen:
»Ampelmann, du zeigst mir immer an
ob ich gehen oder stehen kann.
Ampelmann, keiner weiß es genau,
fehlt dir nicht eine Ampelfrau …«
Für alles kannte seine Frau ein passendes Lied und entzückte ihn mit ihrer klaren Stimme auch noch nach Jahren. Lorenz wollte Theresa bei dem Wort Ampelfrau an sich ziehen, um ihr ins Ohr zu flüstern, wie glücklich er war, kein einsamer Ampelmann zu sein, doch just, als er sich zu ihr hinüberbeugte, löste sich ihre Hand mit einem Ruck aus seiner, und er musste voll Entsetzen zusehen, wie ein aufgemotzter roter Opel Kadett sie auf seiner Motorhaube in die Richtung mitriss, aus der sie gerade gekommen waren. Der Wagen fuhr in extremen Schlangenlinien, warf Theresa ein paar Meter weiter ab und brauste davon, ohne dass Lorenz das Autokennzeichen wahrnehmen konnte. Das alles geschah in Bruchteilen von Sekunden. Wie er später erfahren sollte, hatte keiner der vielen Unfallzeugen das Kennzeichen ausmachen können. Es war schlammverspritzt gewesen, unkenntlich.
Theresa lag am Straßenrand in einer großen Blutlache, wie ein verwundetes Tier. Als er bei ihr ankam, hatte einer der Zeugen bereits einen Rettungswagen gerufen, dessen Sirenen schon durch Lüneburg dröhnten. Langsam zog Lorenz Theresas Kopf auf seinen Schoß. Dass er mitten in dem vielen Blut hockte – ihrem Blut –, bemerkte er nicht. Genauso wenig, dass sie längst ihr Leben ausgehaucht hatte, als er voller Schmerz in ihre weit geöffneten, starren Augen schaute. Entsetzt ließ er seinen Blick über die geliebte Frau schweifen, und nur zäh drang es in sein Bewusstsein, dass Theresa von einer Sekunde auf die andere in das Totenreich hinübergewechselt hatte. Ihre Beine waren unnatürlich verdreht wie bei einer verhedderten Marionette, und ihr Rumpf durch die zertrümmerten Rippen eingefallen. Sein Blick langte wieder an ihrem Gesicht an. Zärtlich drückte er ihre Augen zu und wiegte ihren Oberkörper hin und her, wie man es mit einem Baby tat, um es zum Einschlafen zu bringen. Doch mitten in der Bewegung hielt er inne. Dort, wo ihr Ohr hätte sitzen müssen, klaffte ein dunkles blutiges Loch. Das war der Augenblick, in dem Lorenz zu schreien begann. Zuerst war es nur ein kehliger Laut, der aus den Tiefen seines Rachens hervorquoll wie das Blut aus dem Körper seiner Frau. Dann manifestierte es sich in Worte: »Es ist meine Schuld«, schrie er immer und immer wieder, bis ihn ein gnädiger Notarzt an den Schultern fasste und mit sich in den Ambulanzwagen führte, um ihm eine Beruhigungsspritze zu geben. Das Medikament bekämpfte zwar seinen Schockzustand, aber es nahm ihm nicht das Schuldgefühl, das von diesem Moment an dumpf und stetig durch seine Seele dröhnte: Hätte er Theresa nicht zu einem Kinoabend gedrängt, wäre sie noch am Leben. Ab jetzt würde auch er ein Ampelmann sein.
Noch immer saß Lorenz auf dem vom Morgentau feuchten Boden am Fuß der Bank. Schweiß lief ihm von der Stirn, und er musste sich schütteln. Ihm war, als ob er aus einem bösen Traum erwacht war. So minutiös wie eben hatte er das Unglück bisher noch nie in seinem Kopf abgespult. Sonst hatte er stets nur Bruchstücke davon wieder und wieder erlebt. Noch einmal schüttelte er sich, bevor er seine Umgebung voll wahrnahm. Er sah auf seine Armbanduhr. Es war 9.30 Uhr durch − gut eine halbe Stunde hatte er bereits an diesem Ort verbracht.
Er blickte zur Bank hinauf. Daneben stand eine in Holz eingefasste Tonne, in der Spaziergänger ihren Müll loswerden konnten, um das Naturschutzgebiet nicht zu verschmutzen. An die Seite der Mülltonne, die zur Bank gewandt war, war ein etwa tellergroßer Stein gedrückt. Darunter schien ein Loch zu sein – zumindest blitzte ein dunkler Rand unterhalb des Steins hervor. Lorenz runzelte die Stirn. Hatte er etwa das Cacheversteck gefunden?
Er fühlte sich zu schwach zum Aufstehen, deswegen robbte er auf Knien zur Tonne. Dann duckte er sich unter die Bank und wuchtete den Stein weg, unter dem sich tatsächlich ein Loch auftat, das unter die Tonne führte.
Normalerweise bevorzugte Lorenz Rätselcaches oder wenigstens Multicaches, doch als er im Internet gezielt nach einem Cache in den Lüneburger Ilmenau-Niederungen gesucht hatte, war er nur auf diesen traditionellen und in der Regel recht simplen Cachetyp gestoßen. Es war ihm egal gewesen, da er dieses Mal einen anderen Grund für seine Schatzsuche gehabt hatte, aber dass es so einfach sein würde … Bestimmt war hier ein Newbie am Werk gewesen. Solche Cacheanfänger hatten es eben noch nicht drauf.
Lorenz ließ seine Hand in das Loch gleiten und stieß schon bald auf eine Plastiktüte, in der sich etwas Hartes befand. Er zog die Tüte aus dem Loch, öffnete sie und schaute hinein.
In der durchsichtigen Tüte lag eine gelbe Brotdose, aus der ein ahnungsloser Finder nicht hätte schließen können, dass es sich um einen Cache handelte. Er als Geocacher wusste allerdings, dass so eine Dose ein häufig benutztes Cachebehältnis war. Er nahm sie heraus und klappte sie auf.
Die Dose war schmutzig. Den roten Schlieren auf ihrem Boden nach zu urteilen, hatte sie noch kurz zuvor als Aufbewahrungsbox für Kirschen oder ähnlich dunkelrotes Obst gedient. Es war nur ein einzelner Gegenstand darin, ein umgedrehtes Polaroidfoto, das ebenfalls rote Flecken aufwies. Wer macht denn heutzutage noch Polaroids und legt sie dann in einen verschmutzten Cachebehälter, fragte sich Lorenz verärgert – so etwas war ihm bisher nicht untergekommen. Was ihn aber mehr verblüffte, war das Fehlen eines Logbuches. Ein Logbuch war das einzige Muss eines Caches. Es war eine Art Gästebuch, in dem Informationen über den Gründer des Caches standen, und die jeweiligen Cachefinder trugen sich darin ein, bevor sie den Cache wieder in sein ursprüngliches Versteck legten, damit der nächste Schatzsucher ihn finden konnte.
»Diese Newbies, also wirklich …«, murmelte Lorenz in sich hinein, während er das Foto aus der Dose herausklaubte und umdrehte. Was er sah, raubte ihm den Atem, und trotzdem konnte er seinen Blick nicht davon abwenden. Erst allmählich tat sich ihm die Erkenntnis auf, dass es sich in der Dose vermutlich nicht um den Fruchtsaft einer roten Obstsorte handelte. Als hätte er sich daran verbrannt, warf er das Foto von sich und sah paralysiert zu, wie es langsam auf den sandigen Boden hinab segelte.
Er merkte, wie ihm die Tränen die Wangen hinunterliefen. All die Tränen, die er seit Theresas tragischem Ende nicht zugelassen hatte. Er hatte getobt, zerstört, gesoffen und geschrien, doch geweint hatte er bisher nicht. Er hatte erst dieses grausame Foto mit dem blutverschmierten abgetrennten Ohr darauf sehen müssen.
Dann verlor Lorenz Winter das Bewusstsein.
09.37 Uhr
»Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, Chef, oder?« Tobias sah Hauptkommissar Benjamin Rehder ungläubig an. »Wir sollen eine Demo überwachen? Sollen wir uns dafür etwa auch in Uniform schmeißen, die wir als Kripo-Beamte gar nicht besitzen, oder wie haben die da oben sich das gedacht? Demonstrationen gehören doch überhaupt nicht zu unserem Aufgabenbereich!«
Ben blickte in seinen bereits zum dritten Mal geleerten Kaffeebecher. Auch der kräftige Koffeinschub hatte seine Laune nicht heben können. Im Gegenteil. Inzwischen war sie auf ihrem absoluten Tiefpunkt angelangt. Nachdem er das Büro betreten hatte, das er sich mit Katharina und Tobias teilte, wenn er sich nicht in sein eigenes kleines Zimmer im Kommissariat zurückzog, hatte Katharina ihm seinen ersten dampfenden Kaffee gebracht. Außerdem hatte sie ihm auf einem Teller ein halbes Franzbrötchen auf den Tisch gestellt, das er jedoch noch nicht angerührt hatte. Die Nachricht von Präsidiumsleiter und Kriminalrat Stephan Mausner am frühen Morgen war ihm auf den Magen geschlagen – auch weil er geahnt hatte, wie sein Team auf die frohe Botschaft reagieren würde.
Ben hatte Tobias und Katharina direkt nach seiner Ankunft an den Besprechungstisch gebeten, um dem bevorstehenden Gespräch den notwendigen offiziellen Touch zu verleihen. Insgeheim hatte er gehofft, das erwartete Gemaule dadurch zu verringern – das war ihm allerdings von vornherein nicht gelungen. Wahrscheinlich, weil er selbst ziemlich empört über Mausners Anweisung war. Natürlich hatte er das seinem Vorgesetzten deutlich zu verstehen gegeben, aber der hatte nicht mit sich reden lassen und Ben mit einer wedelnden Handbewegung ungeduldig aus seinem Zimmer geschickt, als sein Telefon geklingelt hatte.
»Ihr sollt nicht in vorderster Front mit den uniformierten Kollegen stehen, sondern nur den Einsatzleiter unterstützen«, erklärte Ben seinen zwei Kollegen. »Lediglich durch eure Anwesenheit. Mehr nicht. Mausner will vor den Demonstranten einfach Präsenz zeigen. Ihr kennt ihn doch. Er macht sich beim Bürgermeister gern lieb Kind. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Und du kannst mir glauben, Tobi: Mir passt das genauso wenig wie dir«, sagte er zu Tobias gewandt, der ihn aus verständnislosen Augen ansah.
»Mit einem kleinen Unterschied«, erwiderte Katharina anstelle ihres Kollegen. »Du kannst dich als Leiter unseres Teams in dein Büro verkrümeln und wichtigen Papierkram vorschieben, während Tobi und ich aufmarschieren dürfen – und nur ein paar Kilometer weiter Menschen das Wasser bis zum Hals steht!«
Genervt stand sie von ihrem Stuhl auf, griff sich ihren und Tobis Kaffeebecher und steuerte den Kaffeevollautomaten an, der glänzend auf der Anrichte an der Wand thronte. Auf halbem Weg blieb sie stehen, wandte sich um und fragte ihren Chef nicht gerade freundlich: »Du auch noch?«
Als Ben den Kopf schüttelte, drehte sie sich wieder um, trat an die Anrichte und setzte die Maschine in Gang. Sie war ihr Einstand gewesen. Gleich, nachdem sie in Lüneburg mit den beiden Kollegen ihren ersten Fall gelöst hatte, war sie nach Adendorf in den nächsten Technikmarkt gefahren. Mit der Investition hatte sie weniger ihr neues Team als sich selbst beglücken wollen, denn der Kaffee aus dem Automaten auf dem Kommissariatsflur war nicht zu trinken. Inzwischen hegten und pflegten sogar die beiden Männer das gute Stück. Keiner wollte mehr auf den deutlich gestiegenen Kaffeegenuss verzichten. Während Katharina für sich und Tobias Nachschub holte, herrschte Schweigen. Jeder von ihnen wusste, dass das laut röhrende Mahlwerk jegliche Kommunikation im Keim erstickte. Nachdem Katharina an den Besprechungstisch zurückgekehrt war, ergriff Ben wieder das Wort, schaute dabei jedoch keinem seiner Mitarbeiter in die Augen, sondern starrte hingebungsvoll auf die Tischplatte, als gäbe es dort ein Kunstwerk zu bewundern.
»Ihr wisst selbst, dass wir im Moment keinen akuten Fall bearbeiten. Und Mausner weiß das ebenfalls. Daher seine klare Ansage: Geschlossenheit und Präsenz zeigen, auch wenn es nicht zu unseren eigentlichen Aufgaben gehört.«
»Der liebe Herr Kriminalrat …«, maulte Tobias. »Seine kreativen Ideen sind mir die liebsten. Warum freut er sich nicht, dass wir weder Mord noch Totschlag auf dem Tisch haben, und lässt uns in Ruhe mal Däumchen drehen?«
Katharina lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und schaute aus dem Fenster. Schicksalsergeben zuckte sie mit den Schultern und meinte mehr zu sich als zu den beiden anderen: »Was soll’s, ändern können wir es eh nicht. Und wenn ich mir das Wetter ansehe, da bin ich doch an der frischen Luft besser dran, als hier vor lauter Langeweile meinen Schreibtisch aufräumen zu müssen. Noch lieber wär ich allerdings im Hochwassergebiet. Schließlich brauchen die jede Hand, und ich hab’ zwei gesunde davon. Aber daraus wird scheinbar nichts«, betonte sie ein weiteres Mal. Dann quälte sie sich ein Grinsen ab und suchte Bens Blick: »Also, Chef – schieß los, ich kann’s kaum erwarten.«
Ben sah erleichtert auf. Sie saßen schon so lange zusammen und diskutierten über Mausners Entscheidung, nun lenkte sein Team endlich ein. Ben wusste: Katharina war die härtere Nuss seiner beiden Mitarbeiter. Sie war charakterlich weitaus stärker als Tobias, und wenn die junge Kommissarin sich nicht mehr auflehnte, würde Tobias es ebenfalls nicht länger tun. Beinahe musste er siegessicher schmunzeln, verkniff es sich aber gerade noch rechtzeitig, um Katharina nicht zu verärgern. Stattdessen sagte er: »So ist es richtig, diese positive Einstellung lobe ich mir, Frau Kollegin! Da sollte sich so manch einer mal ein Beispiel dran nehmen.« Er schielte zu Tobias hinüber.
»Jaja, schon gut, ich hab’ verstanden«, kam es mürrisch zurück, »Kriminalkommissar Tobias Schneider meldet sich höchst motiviert zum Streifendienst.«
»Also«, begann Ben sachlich, »dann geht ihr gleich los zur Überwachung der Demo und …«
»Wer demonstriert da überhaupt und wogegen?«, unterbrach Katharina ihn. »Hat es was mit dem Hochwasserschutz zu tun?«
Ben nahm seine Jacke vom Stuhl und griff in die Innentasche. Er holte einen zusammengefalteten Zettel hervor und blätterte ihn auf. »Nein, damit hat es gar nichts zu tun. Da wird mal nicht gegen, sondern für etwas demonstriert. Vordergründig zumindest. Die Gruppe nennt sich ›PRO HANSE‹. Laut Mausner besteht sie vorwiegend aus Studenten, sowohl von der Lüneburger Uni als auch aus Hamburg. Die jungen Leute kämpfen mit recht harten Bandagen für eine stärkere Beachtung der Hansehistorie.«
»Bitte wie?« Tobias sah irritiert von seinem Kaffeebecher auf. »Lüneburg ist doch seit 2007 wieder anerkannte Hansestadt, also was wollen diese Studis denn?«
»Mehr weiß ich auch nicht«, resignierte Ben. »Scheinbar war das genau der Stein des Anstoßes. Sie wollen, dass das Hanseatentum hier in der Stadt stärker beachtet und aktiver gelebt wird.«
»Nee, schon klar.« Tobias schüttelte den Kopf. »Ich hätte auch an der Uni studieren und mich nicht an der Fachhochschule für die Kommissarslaufbahn fit machen sollen. An der Uni hat man offensichtlich mächtig viel Freizeit. Mal ehrlich, sonst kommt man ja wohl nicht auf so einen Quatsch!« Er sah Katharina an. »Oder siehst du das anders?«
Katharina wollte sich dieser Diskussion nur zu gern entziehen. Sie war einige Semester zur Uni gegangen, um Jura zu studieren. Nicht weil sie eine juristische Laufbahn angestrebt hatte, sondern weil es schlicht die Erwartung ihres Vaters an sie gewesen war. Er hatte sich das schön zurecht gestrickt: Katharina sollte erfolgreich Jura studieren, im Anschluss ein paar Jahre Praxiserfahrung sammeln und dann in seine Kanzlei in Hamburg einsteigen. Später würde sie diese selbstverständlich übernehmen, am besten mit einem adäquaten Gatten an ihrer Seite. Wie immer, wenn Katharina daran dachte, stieg Wut in ihr hoch. Wie gut, dass sie noch rechtzeitig den Absprung geschafft und zur Polizei gewechselt hatte. Damit hatte sie es sich damals zwar endgültig mit ihrem Vater verscherzt, aber sie wollte keinen anderen Job der Welt haben. Selbst an Tagen wie diesem nicht.
»Ist doch völlig egal«, lenkte sie daher ab. »Wo und wann genau soll die Demo stattfinden?«, fragte sie, an Ben gewandt.
»Ab 10.30 Uhr. Sie wollen vor der Handelskammer Am Sande starten und durch die Innenstadt ziehen.« Er sah auf seine Armbanduhr. »Ihr könnt im Prinzip gleich losgehen. Meldet euch bei Bernd Richter, dem Einsatzleiter, der ist informiert. Sobald wir etwas anderes auf den Tisch bekommen, kann ich euch sofort abziehen.«
»Na, da will ich doch fast hoffen, dass irgendwer irgendwo so schlechte Laune hat wie ich inzwischen, das aber nicht so gut im Griff hat«, unkte Tobi. »Okay, ich geb’s zu, der war nicht gut. Aber das ist nun mal mein Job. Ein Bäcker will schließlich Brötchen backen und keinen Fisch angeln.« Er schnappte sich seine ausgewaschene Jeansjacke, zog sie über das braune St. Pauli-Shirt mit dem Totenkopf und hielt die Bürotür auf. »Bitte schön, Frau Kollegin, dann wollen wir mal.«
Katharina stand ebenfalls auf und holte sich ihre Lederjacke, die sie sich locker um die schmalen Hüften schlang. Dann ging sie zurück an den Besprechungstisch, an dem Ben nach wie vor saß, und stellte mit hochgezogener Augenbraue fest: »Ich habe also tatsächlich recht gehabt, du bleibst hier im Büro. Wahrscheinlich auch eine Anweisung von Mausi, wie?«
Ben nickte dazu nur.
»Na, dann wirst du bestimmt Zeit haben, dir selbst ein Brötchen zu holen. Ach ja, und viel Spaß beim Papiere ordnen – wir gehen inzwischen das schöne Wetter genießen«, sagte Katharina schnippisch, schnappte sich das unangetastete halbe Franzbrötchen von Bens Teller und schloss sich Tobias an, der an der Tür auf sie wartete.
Als Katharina und Tobias auf dem Flur verschwunden waren, überlegte Ben kurz. Er würde die Zeit tatsächlich für überfälligen Schreibkram nutzen. Dafür brauchte er allerdings unbedingt noch einen Kaffee. Er nahm seinen Becher, füllte ihn unter dem Dröhnen der Maschine und ging in sein Büro. Als er die Mappe hervorholte, in der er Unerledigtes aufbewahrte, und sah, was da an Papierwust auf ihn zukam, stöhnte er innerlich. Katharina hatte es auf den Punkt gebracht: lieber draußen bei einer langweiligen, unsinnigen Demonstration Anwesenheit zeigen, als sich mit diesem lästigen Kram herumschlagen. Aber auch er musste sich den Anweisungen von Kriminalrat Mausner fügen und im Kommissariat die Stellung halten. Er blätterte den Papierberg durch und hatte sich gerade überlegt, mit welchem der unliebsamen Dinge er beginnen sollte, als sein Telefon klingelte.
09.43 Uhr
»Hallo? Hallo, hören Sie mich? Können Sie mich verstehen?«
Lorenz Winter öffnete die Augen und blinzelte ins Sonnenlicht. Zunächst nur schemenhaft nahm er eine Frau wahr, die neben ihm kniete. Sie sah ein bisschen aus wie Theresa … nein, doch nicht. Er richtete sich langsam auf, und der Schleier vor seinen Augen hob sich, sodass sein Blick klarer wurde. Die Frau berührte ihn unsicher an der Schulter.
»Sind Sie verletzt? Soll ich einen Notarzt rufen?«, fragte sie sanft. Winter registrierte, dass sie Joggingkleidung trug. Wo war er?
Was war passiert?
Als er sich umsah, kam die Erinnerung mit einem Schlag zurück. Das Foto!
»Mir geht es gut«, versicherte er schwächer als gewollt der Joggerin, die ihn ängstlich beobachtete. »Wirklich, ich brauche keinen Arzt, aber danke …«
Die Frau schien nicht überzeugt. »Ich weiß nicht, Sie sind sehr blass …«
»Bitte lassen Sie mich.« Winter schüttelte ihren Arm ab und nahm alle Kraft zusammen, um auf die Füße zu kommen. Er hoffte, dass die hilfsbereite Frau nicht merkte, wie seine Beine zitterten, denn er wollte nur, dass sie weiterging.
»Glauben Sie mir, ich bin in Ordnung. Das war nur … ich bin nur gestolpert. Vermutlich … also vermutlich habe ich zu viel getrunken«, versuchte Lorenz Winter es mit einer Notlüge, die ihr Ziel nicht verfehlte. Das zuvor besorgte Gesicht der Joggerin verzog sich zu einem widerwilligen Stirnrunzeln, und sie reagierte spöttisch: »Am frühen Morgen? Na bravo, und da mache ich mir Gedanken …« Sie erhob sich, setzte ihre Kopfhörer wieder auf, warf ihm noch einen abfälligen Blick zu und machte sich in leichtem Laufschritt davon. Lorenz Winter wartete, bis sie um die nächste Ecke verschwunden war. Dann setzte er vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um auf wackeligen Beinen heil bis zur Bank zu gelangen. Wo war das Foto abgeblieben? Und die Brotdose – der Cache? Er wusste nicht, wie lange er bewusstlos gewesen war. Möglicherweise hatte vor der hilfsbereiten Frau jemand anderes bei ihm angehalten, das Foto entdeckt und sonstwas damit angestellt. Aber er musste es unbedingt noch einmal sehen, musste es haben. Irgendwie war er überzeugt, es sei seins und für ihn persönlich hier hinterlegt worden.
Winter sah auf die Uhr. Er war nur ein paar Minuten weggetreten gewesen, zum Glück. Die Situation war ihm im Nachhinein unsagbar peinlich. Was musste die Joggerin von ihm denken? Auf die Schnelle und in seiner leichten Verwirrung war ihm nichts Besseres eingefallen als die Ausrede mit dem Alkohol. Nun ja, es war nicht mehr zu ändern. Wenigstens kannte er sie nicht und würde sie wohl auch nicht wieder treffen.
Mühsam beugte er den Oberkörper vor, um unter die Bank zu sehen. Tatsächlich – dort lag das Foto, das er in seiner Panik fallen lassen hatte. Der leichte Wind hatte es dorthin geweht. Die blutverschmierte Seite des Polaroids war nach oben gekehrt. Ungefähr einen halben Meter dahinter, fast schon unterhalb eines Buschs, sah er die Brotbox. Hatte er sie ebenfalls weggeschleudert? Er konnte sich nicht daran erinnern.
Lorenz Winter blickte sich vorsichtig um. Inzwischen waren die Lüneburger Ilmenau-Niederungen nicht mehr so einsam wie noch in der Früh, als er hierhergekommen war. Nun gingen die Leute mit ihren Hunden Gassi oder trieben Sport wie die Frau, die ihm helfen wollte. Meistens handelte es sich um Hausfrauen, Studenten oder Pensionäre wie ihn selbst, nur dass er eben keinen Hund hatte. Vor einer Weile hatte er tatsächlich überlegt, sich einen anzuschaffen, sich am Ende jedoch dagegen entschieden. Er wollte sich an nichts und niemanden mehr binden. Nicht nur, weil er Angst vor einem erneuten Verlust hatte. Es lag vor allem an Theresa. Lorenz hatte das Gefühl, er würde sie verraten, wenn er sich einen Ersatz suchte. Selbst wenn es nur ein unvollkommener wäre …
Lorenz schüttelte sich, um die trüben Gedanken zu vertreiben, dann schaute er sich noch einmal um. Als er sicher sein konnte, allein zu sein, ging er auf dem sandigen Boden in die Knie und zog das Foto sowie die Box unter der Bank hervor. Ohne einen weiteren Blick darauf zu werfen, steckte er beides in die kleine Tasche, die er auf seinen Touren stets dabei hatte. Darin entdeckte er eine Flasche Wasser. Nach mehreren kräftigen Schlucken fühlte er sich merklich besser und etwas gestärkt. Auch sein Verstand wurde klarer.
Nach wie vor kniend straffte er die Schultern und nahm allen Mut zusammen. Warum sollte er bis zu Hause warten? Nochmals griff er in die Tasche und zog das Polaroid wieder hervor. Langsam drehte er es um, senkte seinen Blick darauf, und schon sprang ihm das Bild des blutigen Ohrs entgegen. Winter schluckte heftig und kämpfte den aufsteigenden Würgereiz mit ganzer Kraft hinunter. Durch tiefe Atemzüge versuchte er zu verhindern, dass der grausige Anblick ihm ein weiteres Mal das Bewusstsein raubte. Nach einer Weile hatte er sich soweit im Griff, dass er aufstehen konnte. Dabei hatte er nur einen einzigen Gedanken: Er musste handeln. Er musste wissen, was es mit dem abgetrennten, blutverschmierten Ohr auf dem Foto auf sich hatte. War es tatsächlich Theresas? Nach so vielen Jahren?
Das Foto in der einen öffnete er mit der zitternden anderen Hand das Reißverschlussfach an der Außenseite seiner Tasche und ließ seine Finger hineingleiten. Er zog sein Handy heraus. Einige Sekunden hielt er es nur in seiner Hand. Dann wählte er die Nummer der Polizei.