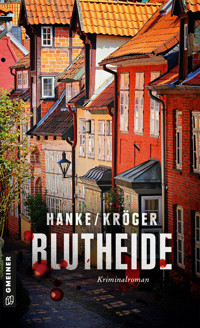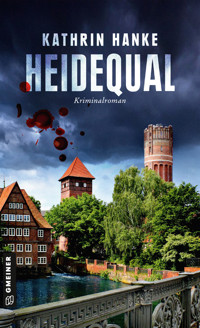Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Katharina von Hagemann
- Sprache: Deutsch
Zunächst sind es Tiere, die in Lüneburg und Umgebung von einem Pfeil durchbohrt aufgefunden werden. Dann wird eine junge Frau bei der Bardowicker Mühle entdeckt - auch sie wurde durch einen Pfeil getötet. Ist sie ein versehentliches Opfer? Oberkommissarin Katharina von Hagemann und ihre Kollegen bekommen die grauenhafte Antwort präsentiert, kaum, dass ihre Ermittlungen beginnen: Innerhalb weniger Tage werden zwei weitere Morde verübt. Auch bei diesen Opfern ist ein Pfeil die Tatwaffe und der Fundort in der Nähe von Mühlen. Was für ein Täter ist hier auf der Jagd? Wird es weitere Tote geben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kathrin Hanke
Totenheide
Der 9. Fall für Katharina von Hagemann
Zum Buch
Gnadenlose Jagd Der Frühling ist mau. Das Verbrechen in und um Lüneburg herum scheint stillzustehen. Eigentlich eine wünschenswerte Situation für die Polizei, doch Oberkommissarin Katharina von Hagemann und ihre Kollegen langweilen sich. Zudem haben sie ausreichend Zeit, um sich mit ihrem nicht immer einfachen Privatleben zu beschäftigen, was die Situation nicht unbedingt besser macht. Dies ändert sich schlagartig, als innerhalb weniger Tage drei Leichen aufgefunden werden – alle in der Nähe von Mühlen und alle sind durch die gleiche Tatwaffe gestorben: einen tödlichen Pfeil. Was für ein Täter ist hier auf der Jagd? Ist es vielleicht sogar eine ganze Jagdgruppe? Wird es weitere Tote geben? Rätsel geben auch die Pfeile auf, die denen aus dem Mittelalter nachempfunden sind. Der Fall wird zu einem rasanten Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kommissaren und Bogenschützen. Doch wer ist die Katze und wer die Maus?
Kathrin Hanke wurde in Hamburg geboren. Nach dem Studium der Kulturwissenschaften in Lüneburg machte sie das Schreiben zu ihrem Beruf. Sie jobbte beim Radio, schrieb für Zeitungen, entschied sich schließlich für die Werbetexterei und arbeitete zudem als Ghostwriterin. Ihre Leidenschaft ist jedoch das reine Geschichtenerzählen, wobei sie gern Fiktion mit wahren Begebenheiten verbindet. Daher arbeitet sie seit 2014 als freie Autorin in ihrer Heimatstadt. Kathrin Hanke ist Mitglied im Syndikat, der Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur, sowie bei den Mörderischen Schwestern.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieses Buch wurde gefördert durch das Neustart Kultur Stipendienprogramm 2021 der VG WORT.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Parchem Kreativ / shutterstock
ISBN 978-3-8392-7416-3
Widmung
Für Rabea
Ein paar wenige Worte vorweg
Wer die Heidekrimis kennt, weiß, dass es eine zeitlich fortlaufende Reihe ist – in jedem Band wird ein in sich geschlossener Kriminalfall erzählt, das Privatleben der Ermittler entwickelt sich jedoch von Buch zu Buch weiter. So, wie im echten Leben. Angefangen hat die Reihe mit dem 1. Band Blutheide, der im Jahr 2011 spielt. Totenheide ist nun der 9. Band und inzwischen befinden wir uns in 2021. Noch beim Vorgängertitel Heidewut, dem 8. Fall für Katharina von Hagemann und ihre Kollegen, hatte ich gehofft, Corona würde bald nicht mehr unser Leben bestimmen und es entsprechend nicht thematisiert. Leider habe ich mich geirrt und die Pandemie hat uns nach wie vor in ihren Klauen und so hat sie nun doch Einzug in diesen Band gefunden. Ich habe mich dabei bemüht, ihr nur einen kleinen Raum zu geben und lediglich das beschrieben, was derzeit zu unserem Alltag gehört, wie zum Beispiel das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz, um nach wie vor unbeschwert zu unterhalten. Und genau das wünsche ich jetzt: unbeschwerte und vor allem spannende Lesestunden.
Herzlichst,
Ihre
Kathrin Hanke
Zitat
»Sie wissen nicht, dass sie nur die Jagd und nicht die Beute suchen.«
(Blaise Pascal)
Prolog Donnerstag, 29.04.2021
04.56 Uhr
Das bearbeitete Eibenholz lag in der Hand, wie es sollte – einfach perfekt. Und es sah auch perfekt aus. Der Bogen war selbst hergestellt, aus einem Drittel des auf Zug belastbaren und elastischen Splintholzes und zwei Dritteln des druckfesten und harten Kernholzes. Schon bei Ötzi hatten sie einen Bogen aus dem Holz der Eibe gefunden, und trotz aller technischer Versuche und Erfindungen war das Holz der Eibe unter den traditionellen Bogenschützen noch immer ein heiß begehrtes Material. Es besaß dieselben Eigenschaften wie moderne Kompositbögen – hart, schwer und fest und dabei gleichzeitig biegsam und zäh. Im Mittelalter, in dem Pfeil und Bogen eine alltägliche Waffe und auch ein herkömmliches Jagdinstrument gewesen waren, war der Bedarf an diesem wunderbaren Holz dermaßen hoch gewesen, dass die nur langsam wachsende Eibe, die unter optimalen Bedingungen bis zu 3.000 Jahre alt werden kann, in Mitteleuropa nahezu ausgerottet gewesen war. Schon deshalb waren alte Eiben heutzutage relativ selten – in Deutschland stand der Baum darüber hinaus unter Naturschutz. Der Hochsitz hier war hingegen aus bereits morschem, splitterndem Nadelgehölz errichtet, und beim Hinaufsteigen war eine Sprosse der anscheinend lieblos und schnell zurechtgezimmerten Leiter gebrochen. Wie konnte jemand nur so mit Holz verfahren? Bestimmt niemand, der mit der Natur in Einklang lebte. Dabei war neben den Holzeigenschaften doch auch die Bauweise entscheidend. So schmeichelte dieser Langbogen aus Eibe hier nicht nur der Hand, er war auch extrem zugstark. Ebenso waren die handgefertigten Pfeile, die im an der Wand des Hochsitzes angelehnten ledernen Köcher steckten, nicht nur schön anzusehen. Sie waren akribisch gebaut, auf den Bogen und den Schießstil abgestimmt, und gleich würden sie ihre Treffsicherheit zum ersten Mal unter Beweis stellen, an der sicherlich nichts auszusetzen war. Die Pfeile waren aus Fichtenholz, das natürlich nicht einfach aus dem Sägewerk stammte. Zum einen, um deren Flugeigenschaft durch möglicherweise mindere Qualität nicht unnötig zu gefährden, vor allem aber, damit das Holz nicht zurückverfolgt werden konnte. Möglich war schließlich alles. Deshalb bestanden die Pfeile leider auch nicht aus dem besonders gut geeignetem Holz der Sitka Fichte. Diese in Alaska beheimatete Fichtenart war zwar auch in Deutschland verbreitet, sie stand in der Regel jedoch nicht einfach im privaten Garten herum wie die gemeine Fichte und war dementsprechend fast ausschließlich über den Holzhandel zu beziehen. Und genau das war eben nicht infrage gekommen. Dies war ein kleines Manko, aber durchaus zu verkraften.
Es knackte. Ganz, wie geplant. Der Moment war also tatsächlich optimal gewählt: Pünktlich wie eine Eieruhr trat er jetzt, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, aus den ihn zuvor verbergenden Bäumen hervor und hinaus auf das ungeschützte Feld. Blitzschnell war der Bogen in der richtigen Position, die Sehne gespannt, und keine Sekunde später strauchelte der Getroffene und fiel leblos auf das morgentaufeuchte Feld. In diesem Moment senkte sich der wabernde Nebel und bedeckte das Übungsopfer mit einer trägen Sanftheit, wie es eine liebende, noch schlaftrunkene Mutter nicht besser gekonnt hätte.
Zitat
»Oftmals habe ich nachts im Bette
Schon gegrübelt hin und her,
Was es denn geschadet hätte,
Wenn mein Ich ein andrer wär.
Höhnisch raunten meine Zweifel
Mir die tolle Antwort zu:
Nichts geschadet, dummer Teufel,
Denn der andre wärest du!
Hilflos wälzt ich mich im Bette
Und entrang mir dies Gedicht,
Rasselnd mit der Sklavenkette,
Die kein Denker je zerbricht.«
(Frank Wedekind)
Kapitel 1 Freitag, 30.4.2021
13.02 Uhr
Oberkommissarin Katharina von Hagemann steuerte mit schweren Schritten auf die Kantine im Lüneburger Behördenzentrum zu, in dem die Fäden der Lüneburger Verwaltung zusammenliefen. Hier, im Haupthaus, waren nicht nur diverse Einheiten der Polizei ansässig, sondern ebenso weitere Verwaltungsfachbereiche, wie die Landesschulbehörde, das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung oder auch die Heilfürsorgestelle. Sie selbst arbeitete im keine zehn Meter entfernten Gebäude gegenüber, in welchem neben dem Zentralen Kriminaldienst, wozu auch ihr Fachkommissariat »Mord/Totschlag, Brand und Sexualdelikte« zählte, ebenso der Einsatz- und Streifendienst angesiedelt war.
Eigentlich aß die Kommissarin mittags, wenn überhaupt, lieber außerhalb. Dann machte sie entweder gleich noch ein paar andere Besorgungen oder ging mit mindestens einem ihrer Teampartner essen – mit ihrem Vorgesetzten Hauptkommissar Benjamin Rehder in irgendeines der vielen kleinen Lüneburger Bistros zum Mittagstisch, mit der jüngeren Kommissarin Vivien Rimkus zu einem der Bäcker, um beim Schlendern durch die Innenstadt ein Brötchen zu verdrücken oder mit Kommissar Tobias Schneider, der seit seiner Rückkehr nach einem langen Krankenhausaufenthalt aufgrund eines schweren Unfalls bei ihnen im Team den Innendienst schob, mittwochs auf den Wochenmarkt vor dem Rathaus auf eine Currywurst mit Pommes. Gerade zu diesem Marktimbiss gingen sie auch häufig alle vier gemeinsam. Als Tobi nach seiner unfreiwilligen Auszeit wieder halbtags bei ihnen anfing, hatte er zunächst nichts mehr vom Imbiss wissen wollen. Das war nun bereits über ein Jahr her. Bevor er verunglückt war, war Junk-Food seine Leib- und Magenspeise gewesen. Während seiner Genesung, und auch danach, hatte er hingegen sehr auf gute Ernährung geachtet. Einige Monate nach seiner Rückkehr in ihr Team für Mord und weitere Kapitalverbrechen hatte er jedoch irgendwann vorgeschlagen, dem Imbiss mal wieder einen Besuch abzustatten. Er hatte gemeint, er vermisse ihr Ritual, gemeinsam am Stand zu stehen und zwischen dem Geruch von Frittierfett und einem kräftigen Happen Currywurst mit seinen Kollegen über alles Mögliche zu plaudern. Seitdem war Tobi an Markttagen wieder regelmäßig dort anzutreffen. Gestern war er grad wieder dort gewesen, und Ben und Katharina hatten ihn begleitet. Vivien war die ganze Woche bereits bei einer Fortbildung in Lüchow, die aufgrund der leichten Lockdown-Lockerungen zu deren großer Freude stattfand, und würde erst am Montag wiederkommen. Tobi hatte heute Morgen einen Kontrolltermin beim Arzt gehabt und sich deswegen gleich den Rest des Tages freigenommen, und Ben hatte eine private Mittagessenverabredung. Mit wem, wusste Katharina nicht. Sie nahm an, mit irgendeiner Frau, da er ihr ausgewichen war, als sie ihn gefragt hatte. Wenn sie es genau nahm, hatte er ihr gar keine richtige Antwort gegeben, nur gemurmelt »kennst du nicht« und dann das Thema gewechselt. Genau diese Reaktion zeigte ihr merkwürdiges Verhältnis zueinander, denn im Grunde erzählten sie sich alles. Außer wenn es um ihre privaten Beziehungen zum anderen Geschlecht ging. Katharina wusste, dass das nicht daran lag, weil sie am Ende Kollegen waren, die eine gewisse Distanz zueinander wahrten. Und es lag auch nicht daran, dass sie seit einigen Jahren mit seinem Zwillingsbruder Bene zusammen war. Gerade das würde dafürsprechen, sich auch das Privateste vom Privatesten zu erzählen, da sie alle ein herzliches Verhältnis zueinander hatten. Es lag schlicht und ergreifend daran, dass es zwischen Ben und ihr Schwingungen gab, wie sie manchmal zwischen einer Frau und einem Mann vorkamen, sie sich diese aber verboten. Zumindest Katharina tat dies, seit es ihr überhaupt bewusst war. Und Ben auch, da war sie sich nahezu sicher. Im Stillen fragte sich Katharina manchmal, was zwischen ihnen beiden sein würde, wenn sie nicht mit seinem Bruder zusammen wäre. Allerdings bliebe Benjamin Rehder dann immer noch ihr Vorgesetzter und Kollege. Sie war einmal, vor Jahren, eine Beziehung mit einem Kollegen eingegangen. Das war noch während ihrer Zeit in München. Maximilian war Staatsanwalt gewesen und sie hatten bei diversen Fällen zusammengearbeitet, sich verliebt, und dann waren sie sogar zusammengezogen. Bei ihrem letzten gemeinsamen Fall hatten sie es mit einem Serienmörder zu tun bekommen, der Prostituierte regelrecht abschlachtete. Katharina konnte den Täter gemeinsam mit ihrer damaligen Teampartnerin und zugleich besten Freundin Helena überführen – es war kein anderer gewesen als Maximilian selbst. Allein der Gedanke, dass sie mit diesem Monster freiwillig Haus und Bett geteilt hatte, ja, sich sogar in es verliebt und fast geheiratet hatte, ließ sie auch jetzt wieder erschauern. Wie hatte sie sich nur so in einem Menschen irren können? Sie, die sonst bekannt war für ihr gutes Bauchgefühl. Schnell schob sie die Erinnerung an Maximilian weg. Und auch ihre Gedanken an ihre widersprüchlichen Gefühle zu Ben. Seit letztem Jahr hatten diese deutlich zugenommen, was sicherlich auch daran lag, dass es mit dessen Bruder nicht mehr so gut lief. Sie vertraute ihrem Freund einfach nicht mehr, und deswegen war der Wurm in ihrer Beziehung eingezogen, von dem sie jedoch hoffte, er würde sich in Nichts auflösen. Auf jeden Fall konnte es so, wie es aktuell war, nicht weitergehen, und sie musste dringend aus dieser verfahrenen Situation herausfinden. Bene tat so, als sei nichts. Im Gegenteil war er sogar ihr gegenüber aufmerksamer als je zuvor, und gerade das machte sie noch argwöhnischer. Schon seit Monaten nahm sie sich vor, mit ihm über ihre Beziehung zu sprechen, doch immer wieder verschob sie es auf morgen. Ähnlich, wie Scarlett O’Hara in Vom Winde verweht. Sie hatte den Roman von Margaret Mitchell als junges Mädchen verschlungen und auch den Film zum Buch stets geguckt, wenn er im Fernsehen lief. Meist um die Weihnachtszeit herum. Sie hatte sich stark mit der 16-jährigen Scarlett, die ihr auf der einen Seite verletzlich und auf der anderen so stark erschien, identifiziert, und anscheinend war von Scarletts Motto etwas in ihr hängen geblieben. Katharina schüttelte innerlich den Kopf über sich: Sie war keine 16 mehr und sah die Romanfigur mit ihren 44 Jahren nicht mehr mit einem verklärten Blick. Heute war Freitag. Sie würde früh aus dem Büro kommen und dann ins Wochenende gehen. Bene war heute etwas länger unterwegs. Das hatte er ihr am Morgen erzählt, allerdings hatte er ihr nicht gesagt, was er vorhatte. Aber sie hatte auch nicht gefragt. Da sie also vor ihm zu Hause sein würde, wollte sie es dort noch ein bisschen nett herrichten, vielleicht ein paar Kerzen anzünden wie er es gern mochte, schöne Musik auflegen und etwas Fingerfood parat stellen. Und dann würde sie endlich mit ihm reden. Hoffentlich ohne in einen Streit zu geraten, sondern wie sie es früher regelmäßig getan hatten: vernünftig, reflektiert und auch liebevoll. Wobei Katharina vor sich selbst zugeben musste, dass dies eher auf Bene als auf sie zugetroffen hatte. Sie würde sich heute Abend zusammenreißen und ihre Gefühle unter Kontrolle haben müssen, wenn sie Antworten von ihm haben wollte. Selbst wenn diese ihr nicht gefallen sollten. Sie würde es einfach wie in einer Vernehmung machen, professionell, neutral, und den Grundsatz »im Zweifel für den Angeklagten« beherzigen.
Katharina war bei der Kantine angekommen. Sie drückte die Tür auf und sah sich um. Es war kein einzelner Tisch mehr frei. Sie würde sich irgendwo dazusetzen müssen. Das hatte sie schon geahnt, war jedoch dennoch nicht nach draußen zum Mittag gegangen, weil sie allein keine Lust dazu verspürt hatte und einfach nur schnell was in den Magen bekommen wollte. Wenn sie hier drinnen keinen Platz mehr fand, würde sie in den Außenbereich ausweichen. Hierfür hatte sie sich sicherheitshalber ihre Jacke übergezogen, da die Temperaturen für Ende April in diesem Jahr ziemlich niedrig waren und zudem ein unangenehmer Wind ging. Aber es regnete nicht und richtig angezogen konnte man es draußen gut aushalten.
Während die Kommissarin durch den Raum ging, grüßte sie hier und da die ihr bekannten Gesichter und stellte sich in der Reihe zur Essensausgabe an. Die warmen Gerichte waren heute allesamt nicht nach ihrem Geschmack, und so nahm sie sich aus dem gekühlten Regal einen fertig angerichteten Caesar Salad. Nachdem sie gezahlt hatte, suchte sie sich mit den Augen einen Platz. An einem der hinteren, unter normalen Umständen für acht Personen ausreichenden, unter Corona-Bedingungen aber nur für vier Personen zugelassenen Tische machte sie noch einen freien Stuhl aus. Sie ging dorthin, fragte die drei bereits essenden uniformierten Kollegen: »Ist der Platz noch frei?«, und setzte sich, nachdem der älteste von ihnen meinte: »Na klar, für eine hübsche Kollegin doch immer.«
Katharina zog ihre Mund-Nasen-Maske ab und hob dabei eine Augenbraue hoch. Natürlich wusste sie, dass es nett und zugleich auch scherzhaft von dem Kollegen gemeint war, aber sie war gerade nicht in der Stimmung, charmant auf seinen Spruch einzugehen. Gerade nervte es sie einfach nur, in dieser Art auf ihre Weiblichkeit reduziert zu werden. Ein wenig wunderte sie sich über ihre Reaktion, denn sonst hatte sie sich nicht so, doch die drei Sitzenden schienen diese gar nicht bemerkt zu haben. Alle drei lächelten ihr freundlich zu, und so rang sie sich jetzt ebenfalls ein Lächeln ab. Nur weil sie schlechte Laune hatte, musste sie diese schließlich nicht an den Männern auslassen.
Sie setzte sich und begann zu essen.
»Und, wie ist es bei euch so, ich hoffe, alles ruhig?«, sprach der ältere sie an.
Katharina nickte nur. Zum einen, weil sie sich gerade ein Salatblatt in den Mund gesteckt hatte, zum anderen, weil ihr gerade nicht der Sinn nach Small Talk stand. Darum richtete sie ihren Blick auch sofort wieder auf ihren Teller, doch der Kollege schien in Plauderlaune: »Bei uns auch. Eigentlich ja ganz schön, dass es im Kreis Lüneburg gerade so ruhig zugeht.«
»Du musst ja auch keinen Bericht schreiben«, schaltete sich nun sein Sitznachbar ein.
»Da hast du recht, aber beschwer dich mal nicht. Der, den du noch auf dem Tisch hast, wird wohl nicht so lang werden«, erwiderte der Angesprochene.
»Heute schreib ich den ja sowieso nicht. Erstens ist bald Schichtwechsel, und ich hab Feierabend, und zweitens müssen wir da ja wohl noch was klären«, entgegnete der erste.
»Auch wieder wahr«, gab der ältere zu und fuhr fort: »Allerdings glaube ich nicht, dass wir da noch etwas klären werden. Ich meine, am Ende handelt es sich nur um einen erlegten Bock auf einem Feld bei Bleckede und überbordenden Jagdeifer. Ich schätze, da wollte jemand schneller sein als seine Jagdkollegen, deswegen hat er einen Tag vor der Saison einen erlegt. Und was ist schon ein Tag?«
»Wenn man es genau nimmt, sind es wahrscheinlich zwei Tage zu früh. Zumindest datumstechnisch, wenn es sich um einen Schmalspießer handelt wie in unserem Fall. Die dürfen, wie uns der Förster erklärt hat, erst ab dem 1. Mai in Niedersachsen gejagt werden. Und an das Datum sollte sich jeder halten. Das gibt es schließlich nicht umsonst. Sonst ist es Wilderei, und das müssen wir verfolgen«, ließ sich nun der dritte Tischnachbar von Katharina vernehmen, die dem Gespräch unfreiwillig zuhörte.
»Schmalspießer, Jagdzeiten, Schonzeiten – da soll noch einer durchsteigen«, murmelte der Uniformierte genervt, der das Protokoll schreiben musste.
»Mein Opa war Jäger«, begründete der Kollege sein Wissen.
»Dann erklär mir doch mal, warum einer seine erlegte Beute einfach liegen lässt. Er hat noch nicht einmal ein Stück mitgenommen«, forderte der ältere auf.
»Naja, der Förster, der den Bock gefunden hat, glaubt ja, dass da ein Wilderer unterwegs gewesen ist, der irgendwie gestört wurde.«
»Und was glaubst du?«, fragte derjenige, der das Protokoll aufsetzen musste.
»Ich weiß nicht, kann sein, dass der Förster recht hat, wobei er ja auch meinte, dass er bisher nichts von Wilderern in seinem Forst bemerkt hat.«
»Dann wäre seine erste Wilderei also gleich in die Hose gegangen«, kommentierte wieder der ältere.
Der Kollege mit dem jagenden Großvater nickte. Gab dann jedoch zu bedenken: »Vielleicht war es auch gar kein Wilderer. Immerhin hat der Jäger Pfeil und Bogen benutzt, das ist schon ziemlich außergewöhnlich. Möglicherweise waren es Jugendliche, die sich irgendetwas beweisen wollten.«
»Andererseits machen Pfeil und Bogen kaum ein Geräusch. Schon gar nicht wie ein Gewehr. Das könnte wiederum für einen Wilderer sprechen. Hat der Förster ja auch gemeint«, warf der Mann, den Katharina im Stillen den Protokollanten getauft hatte, ein.
»Schon«, meinte der Kollege nachdenklich, »aber das war ja kein Sportpfeil von einer Armbrust oder so, der in dem Bock steckte, sondern so einer, wie die Leute sie zum Beispiel auf Wikingermärkten mit sich herumtragen. Ich kenn mich da nicht mit aus, aber das sah mir irgendwie nicht nach Wilderer aus. Also, ich finde das alles komisch. Das passt einfach nicht.«
»Ob Wilderer, Jugendliche oder Wikinger: Komisch ist vor allem, dass wir absolut keine Spuren gefunden haben. Auf der anderen Seite hat der Jäger vielleicht auch gar nicht auf dem Hochsitz gesessen. Wer weiß das schon«, sagte der ältere jetzt, legte Messer und Gabel auf seinen leer gegessenen Teller und stand auf. Seine beiden Kollegen, die ebenfalls ihre Mahlzeit beendet hatten, taten es ihm gleich.
»Noch ein gutes Mittagessen, man sieht sich«, wünschte der Mann Katharina, und auch seine Kollegen verabschiedeten sich von ihr. Dann trugen alle drei ihre Tabletts zum Rollband, das es direkt in die Küche transportieren würde, und Katharina war froh, wieder allein mit sich zu sein.
Bei mir wildert auch gerade jemand herum, und dies schon ziemlich lange, viel zu lange, dachte Katharina bei sich, während sie sich ein weiteres Salatblatt in den Mund schob. Wut kroch in ihr hoch. Eine Wut, die sie einfach nicht in den Griff bekam und die sie nervte. Manchmal verspürte sie sie nicht. Das waren die Momente, in denen sie abgelenkt war – beim Sport oder wenn sie einen kniffligen Fall auf dem Tisch hatte. Zurzeit hatte sie keinen komplizierten Fall zu bearbeiten. In einer Wohneinrichtung hatte es vor ein paar Tagen eine Messerattacke gegeben, doch der Täter war eindeutig, und sie hatten ihn sofort vorläufig, wie es so schön korrekt hieß, festnehmen können. Außerdem hatten sie es im Lüne Holz bei der Erbstorfer Landstraße mit einer Brandstifterin zu tun bekommen. Die Frau hatte mit einer Schwedenfackel an drei Stellen kleinere Brände entfacht, konnte jedoch gestoppt und ebenfalls festgenommen werden. Es hatte sich herausgestellt, dass die Frau nicht nur alkoholisiert gewesen war, sondern ebenso Selbstmordgedanken hatte, und deswegen war sie nahezu direkt in die Psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Dann waren da noch andere schnell geklärte Fälle gewesen, die Katharina und ihre Teamkollegen nicht besonders gefordert hatten. Im Grunde müsste das die Kommissarin freuen, doch das tat es nicht, weil sie auf diese Weise viel zu viel Zeit hatte, sich mit ihrem Privatleben zu beschäftigen, und das war im Augenblick alles andere als ein Vergnügen. Sie musste ihren Plan wirklich durchziehen und heute mit Bene reden, damit sie endlich aus diesem blöden Gedankenkarussell herauskam. Egal wie, ob glücklich oder traurig, aber alles war besser als diese zermürbende Fantasterei über das, was sein könnte. Das Schlimmste daran war, dass sie selbst die Schuld trug. Anders als in ihrem Berufsleben, hatte sie es bisher vermieden, den Indizien, die sie hatte, nachzugehen, sodass daraus knallharte Beweise oder eben auch eine Entlastung werden konnten. Früher wäre sie da anders gewesen, aber seit sie mit Bene zusammengezogen war, hatte sie Furcht davor, dass ihr mühsam errichtetes Beziehungskartenhaus wieder zusammenbrach. Und genau aus diesem Grund hatte sie sich auch lange gegen ein Zusammenleben gesträubt. Dabei taten sie es noch nicht einmal richtig. Sie hatten beide eigene Wohnungen, jedoch waren die im selben Haus auf demselben Stockwerk.
Katharina betrachtete die letzten Salatblätter auf ihrem Teller. Ein innerer Ruck ging durch sie hindurch. Zackig legte sie ihr Besteck ab, legte sich ihre Maske um, rückte ihren Stuhl ab, stand auf, griff sich ihr Tablett und brachte es zum Rollband. Während sie zuschaute, wie das Band ihr Tablett mitsamt Teller, restlichem Salat und Besteck von ihr weg beförderte, um in der Küche gereinigt und wieder einsatzfähig gemacht zu werden, fasste sie ihren Entschluss: Heute würde sie es sich nicht wieder anders überlegen und in ihrem Leben mal wieder ordentlich saubermachen – es war längst überfällig.
*
13.37 Uhr
Ben sah der attraktiven Frau ihm gegenüber direkt in die Augen, doch diese verzog keine Miene. Im Gegenteil hielt sie seinem Blick stand. Während es in Bens Kopf ratterte, was er ihr antworten sollte, wusste er, dass er nach außen hin äußerst selbstsicher wirkte. Diese Coolness, wie Tobias Schneider es gern augenzwinkernd nannte, hatte er sich über seine Dienstjahre hinweg bei den vielen Zeugenbefragungen und Verhören angeeignet. Schon während seiner Ausbildung hatte er Vernehmungstechniken und damit einhergehend seine eigene Körpersprache zu beherrschen und richtig einzusetzen gelernt, doch erst in den langen Praxisjahren hatte er sie vervollkommnen können. Auch privat hatte er sich intensiv mit menschlichem Verhalten und Körpersprache beschäftigt. Er selbst fand es höchst interessant, und für seinen Beruf war das Wissen hierzu sowieso nützlich. Denn persönlich empfand Hauptkommissar Benjamin Rehder sich überhaupt nicht als cool, was vielleicht auch daran lag, dass er den Begriff nicht mochte und sich in diesem Moment auf seinem Bistrostuhl im Außenbereich des Café Zeitgeist alles andere als cool oder lässig oder etwas anderes in diese Richtung fühlte. Er war verunsichert. Nicht mehr und nicht weniger, vor allem, weil er mit ihrer Frage überhaupt nicht gerechnet hatte.
Doreen hatte schon länger auf ein Treffen gedrängt. Ben hatte immer wieder Ausflüchte gefunden, sich jedoch letztes Wochenende endlich durchgerungen. Er war allein im Kurpark gewesen. Nach einem gemütlichen Spaziergang hatte er sich auf eine Bank gesetzt, den Kopf zurückgelegt, seine Augen geschlossen und die Aprilsonne, die an diesem Tag endlich einmal geschienen hatte, in sein Gesicht strahlen lassen. Als er dann allerdings erst ein leises, schmerzerfülltes Stöhnen und im Anschluss Geraschel direkt vor sich gehört hatte, hatte er sich schnell aufrecht gesetzt und die Augen geöffnet, sodass er zunächst nur helle Flecken sah, dann aber den Hinterkopf eines älteren Mannes ausmachen konnte, der mit dem Rücken zu ihm vor seinen ausgestreckten Beinen hockte. Gerade als Ben »Kann ich Ihnen helfen?« fragen wollte, war der Mann ächzend hochgekommen. Er hatte sich suchend umgeschaut und war dabei Bens Blick begegnet. Wohl um zu zeigen, was er zu seinen Füßen getan hatte, hatte der Alte seinen Arm gehoben und einen deutlich gefüllten Kotbeutel in der Luft hin und her geschwenkt. Daraufhin hatte er sich mit einem Kopfnicken verabschiedet und sich abgewendet. Während er den Kurparkweg entlangging, hatte er einmal durchdringend gepfiffen, und gleich darauf war ein großer hellbrauner Hund, Ben hatte auf einen Rhodesian Ridgeback getippt, mitsamt hinter sich her schleifender Leine aus dem Gebüsch gestürmt. Weshalb auch immer war Ben sofort der Spruch »Wer A sagt muss auch B sagen« in den Sinn gekommen – der ältere Mann hatte sich mitsamt dem Hund ebenso für dessen Erziehung, aber auch fürs Kotaufsammeln entschieden, obwohl er möglicherweise nicht gewusst hatte, was auf ihn zukommen würde.
Wie ein Schlager-Ohrwurm, den man einfach nicht wieder loswird, hatte der Spruch noch in Bens Kopf herumgespukt, als er wieder zu Hause war. Am Ende hatte es dazu geführt, dass er sich entschloss, auch endlich »B« zu sagen. Kurzerhand hatte er sich an seinen Laptop, gesetzt und Doreen, die in Hannover lebte, per E-Mail den Vorschlag gemacht, sich unter der Woche mittags auf einen Salat bei ihm in Lüneburg zu treffen. Für ihn war das »B« sagen, nachdem sie sich inzwischen wochenlang nur geschrieben hatten. Er schlug Lüneburg vor, da er wusste, dass sie derzeit Urlaub hatte. Und er schlug ein Mittagessen vor, da er dies für ein erstes Treffen unverbindlicher fand als einen gemeinsamen Abend. Doreen sagte nahezu sofort zu.
Benjamin Rehder hatte sich schon vor ein paar Wochen die mobile Dating-App auf sein Smartphone heruntergeladen und bereits eine handvoll interessante Frauenkontakte geknüpft, die er auch pflegte. Allerdings bisher nicht durch persönliche Treffen, sondern den Messenger der App. Auch Doreen hatte er über diese App kennengelernt, und das, was und wie sie es schrieb, gefiel ihm von allen Kontakten am besten. Inzwischen schrieben sie sich täglich. Mal war es nur ein schneller Morgengruß, meist aber mehr. So hatte er sich trotz der Distanz und obwohl sie sich noch nie gesehen hatten, Doreen schnell nahe gefühlt und ihr gegenüber fast schon ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er sich nach wie vor auch mit anderen Frauen über die App schrieb und sogar weiterhin auf der Suche war. Er beruhigte sein Gewissen nur mit der festen Annahme, dass Doreen ebenfalls mit anderen Männern Kontakt hatte. Weshalb sonst lud man sich eine Dating-App runter? Darüber ausgetauscht hatten sie sich auch jetzt bei ihrer Mittagessenverabredung nicht. Was sie jedoch voneinander fast von Anfang an wussten, war, wonach sie suchten, und das war nicht das schnelle Abenteuer, wofür diese App, die sie beide nutzten, vor allem bekannt war, sondern einen festen Partner. Beide wollten sie nicht mehr allein durchs Leben gehen. Natürlich hätte Ben sich zu diesem Zweck auch in einem der vielen und von ihrem Ruf her deutlich seriöseren Partnerportale im Internet anmelden können, doch die waren in der Regel nicht kostenlos. Er hielt sich zwar nicht für geizig, da er sich jedoch bei der Online-Partnersuche erst einmal ausprobieren wollte, hatte er sich zunächst für die unentgeltliche und, wie er sich angelesen hatte, unkomplizierte und dadurch schnell und gut zu handhabende mobile Version entschieden, die zudem die weitverbreitetste war. Zu Beginn hatte er sich mit der Methode der App nicht wohlgefühlt – man bekam einfach nur das Bild von einem möglichen Partner präsentiert, und wenn es einem gefiel, wischte man einmal über die Oberfläche seines Smartphones nach rechts. Wenn nicht, nach links. In diesem Fall landete die Person, die hinter dem Foto ja durchaus real war und sich ebenfalls auf der Suche nach einem Partner für was auch immer mutig präsentierte, einfach im virtuellen Papierkorb. Keine schöne Vorstellung. Und noch unschöner war es, sich vorzustellen, dass man selbst auch von vielen direkt in den Papierkorb verbannt wurde.
Während er sich über die einzelnen Dating-Plattformen schlau gemacht hatte, hatte Benjamin Rehder irgendwo gelesen, dass über die App, die er sich schlussendlich genau deswegen auch heruntergeladen hatte, weltweit pro Minute über eine Million Mal gewischt wurde. Und alles in der Hoffnung auf ein Treffen mit dem oder der Richtigen. »Swipe«, wurde so ein Wisch international genannt. Auch das hatte er gelesen, wobei er davon ausging, dieses Wort niemals benutzen zu müssen, da er nicht vorhatte, sich über seine Aktivitäten auf der App zu unterhalten. Er hatte es noch nicht einmal seinem besten Freund Alex erzählt. Nicht, weil Ben sich für die Art seiner Suche nach einer Partnerin schämte. Inzwischen war das Anbandeln über eine Dating-App durchaus gesellschaftsfähig, vor allem in Zeiten von Corona, in denen es kaum eine andere Möglichkeit gab, neue Menschen kennenzulernen. Nein, Ben hatte mit niemandem darüber geredet, weil er nicht gefragt werden wollte, ob er schon jemanden kennengelernt hatte. Das wurde er von seiner Familie und Freunden sowieso immer mal wieder, und es nervte ihn. Wie würde es dann erst sein, wenn sie wüssten, dass er auf der Suche war? Seine Mutter würde wahrscheinlich jeden Tag anrufen und Alex jeden zweiten. Katharina würde sich zurückhalten und sicherlich nicht penetrant nachfragen, aber ihn ständig von der Seite mustern.
In letzter Zeit hatte Ben sie fast nur im Job und nur selten privat gesehen, bis auf das gemeinsame Joggen. Noch nicht einmal zu den Eltern war sie die vergangenen Male zum Familientreffen gekommen, dabei war der letzte Sonntag im Monat inzwischen zu einer Art Tradition geworden. So lud seine Mutter nicht mehr jeden extra ein, sondern es wurde abgesagt, wenn man nicht konnte. Auch die Uhrzeit war klar. Alle wussten, dass um 13 Uhr das Mittagessen auf dem Tisch stand und es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen gab. Im Sommer ließ Bens Vater es sich zudem nicht nehmen, später zum Abend »noch etwas auf den Grill zu schmeißen«, wie er es immer nannte. Selbst Juliane und Alex waren mit ihrem kleinen Michel in der Regel dabei, obwohl sie im Grunde nicht zur Familie gehörten und es momentan in Pandemiezeiten nicht erlaubt war, sich so ohne Weiteres in größeren Gruppen zu treffen. Sie taten es dennoch. Anfangs mit einem mulmigen Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, zumal Katharina und Ben aktive Polizisten waren und sein Vater ein pensionierter. Alex und Ben kannten sich von klein auf, und Juliane, die von allen nur Julie genannt wurde, war nicht nur die Jugendfreundin von Bene, sondern auch die Mutter ihres gemeinsamen Kindes Leonie – gefühlt gehörten beide zur Familie. Leonie hatte seit einigen Monaten einen festen Freund, und ihre Eltern bekamen sie nur noch selten zu Gesicht, obwohl die fast 18-Jährige in beiden Wohnungen ihr eigenes Zimmer hatte. Zu den sonntäglichen Familientreffen kam sie jedoch regelmäßig. Schon allein deshalb war es merkwürdig, dass Katharina, die außergewöhnlich gut mit der Tochter ihres Freundes auskam und jede Gelegenheit ergriff, diese zu sehen, letzten Sonntag nicht dabei gewesen war. Sie hatte sich entschuldigen lassen. Nicht über Bene, sondern über Julie.
Irgendetwas schien zwischen seinem Bruder und Katharina im Argen zu sein. Ben hatte schon seit letztem Jahr so ein Gefühl. Es hatte angefangen, nachdem die beiden zusammengezogen waren. Fast zeitgleich hatten Katharina und er begonnen, zweimal die Woche gemeinsam zu joggen. Das taten sie noch immer. Zu Beginn hatte Ben dabei den Eindruck gehabt, Katharina suche auch über das Joggen hinaus seine Nähe, doch bereits nach ein paar Wochen hatte er sich selbst für verrückt erklärt. Immerhin war sie schon lange mit seinem Bruder zusammen, und der war so ganz anders als er selbst, obwohl sie eineiige Zwillinge waren. Seiner Meinung nach konnte ihn keine Frau als Mann interessant finden, die sich zu seinem Zwilling hingezogen fühlte. Dennoch hatte Ben sich bei dem Gedanken ertappt, und das auch nicht erst seit dem letzten Jahr, dass er in Katharina mehr als seine Quasi-Schwägerin und überaus sympathische Mitarbeiterin sah. Ben fühlte sich in Katharinas Anwesenheit einfach wohl und aufgehoben wie bei keinem anderen Menschen. Hinzu kam, dass er sie attraktiv fand – sie zog ihn auf eine körperliche Weise an, die er sich verbot. Wenn sie an einem Fall dran waren, dann vergaß er dieses Gefühl fast. Es war dann überlagert von der überaus guten Zusammenarbeit zwischen ihnen und dem Willen, einen Täter zu überführen. Seit einem guten Vierteljahr hatten sie jedoch Fälle auf dem Tisch gehabt, die relativ schnell und auch unspektakulär aufzuklären gewesen waren … Ein Gutes hatte es jedoch, dass im Büro wenig los war: Sein Team freute sich jeden Tag, dass es pünktlich in den Feierabend gehen konnte. In den ersten Tagen hatte der Hauptkommissar dies auch getan. Er hatte sich regelmäßig zum Abend etwas Schönes gekocht und sich dabei Zeit gelassen, viel gelesen, und seiner Joggingrunde zweimal die Woche mit Katharina war kein Täter in die Quere gekommen. Allerdings war es genau dieses gemeinsame Joggen gewesen, das ihm eines Abends gezeigt hatte, wie allein er doch war.
Eigentlich fühlte er sich schon immer ganz gut mit sich selbst. Seine Ex-Frau Simone hatte ihm sogar häufig vorgeworfen, dass er ein Eigenbrötler sei, und neben vielem anderen hatte dieser Charakterzug von ihm wohl auch zur Trennung geführt. Nachdem er jedoch von dieser bestimmten Joggingrunde mit Katharina nach Hause gekommen war, hatte er eine Leere in sich gespürt, die ihn deprimierte. Keiner, der ihn begrüßte, und vor allem niemand, der sich über ihn freute. Um die Leere zu übertönen, hatte er sich laut Musik angemacht, doch auch das hatte nicht geholfen. Dann hatte sein Telefon geklingelt, und nach einem Blick auf das Display hatte sein Herz einen großen Hüpfer gemacht, und alle Leere war auf einen Schlag verschwunden. Auf dem Display hatte Katharinas Name gestanden. Er hatte den Anruf angenommen, und obwohl sie ihn nur noch einmal daran erinnern wollte, dass sie am nächsten Tag ein bisschen später ins Büro kommen würde, da sie einen Zahnarzttermin hatte, fühlte Ben sich glücklich, nachdem sie wieder aufgelegt hatten. Und dann hatte seine Fantasie ihn für einen Moment fest im Griff gehabt, denn die wollte ihm weismachen, dass Katharina ihn ganz bewusst nicht beim Joggen an ihren Zahnarzttermin erinnert hatte, damit sie ihn danach noch einmal kurz anrufen konnte. Ben hatte diesen Gedanken kaum zu Ende gedacht, da hatte er bereits innerlich mit dem Kopf geschüttelt und fast selbst über sich lachen müssen, weil er so dachte, wie zuletzt als verliebter 15-Jähriger. Sofort hatte er sich wieder leer gefühlt, und der glückliche Moment war verflogen. Sein Blick war auf seinen Laptop gefallen. Einer spontanen Eingebung folgend, war er herangetreten, hatte ihn aufgeklappt, die Suchmaschine aufgerufen und sich ohne Umschweife über Dating-Möglichkeiten informiert. So hatte das alles angefangen, und jetzt saß er hier mit Doreen, die nach wie vor seinen Blick unbeirrt erwiderte.
Ben verscheuchte Katharina aus seinem Kopf und konzentrierte sich ganz auf seine Antwort. Er wusste, dass die Worte, die er gleich sagen würde, auf die Goldwaage gelegt werden würden. Das wollte er umgehen, und so wählte er den Satz, der alles offenließ, aber Doreen nicht vor den Kopf stoßen würde: »Oha, dein Angebot schmeichelt mir, und ich habe alles erwartet, aber das sicher nicht. Ich muss darüber nachdenken, das verstehst du bestimmt.«
Doreen lächelte vielsagend und erwiderte ruhig: »Natürlich. Ich bin ja auch mit der Tür ins Haus gefallen und, um ehrlich zu sein, hätte ich an deiner Stelle genauso reagiert. Ich hoffe aber, du verstehst, dass ich dir das nicht schreiben wollte. Irgendwie fand ich das nicht angebracht. Deswegen habe ich übrigens so auf ein schnelles Treffen gedrängt. Aber nun ist es raus. Was meinst du, wie lange du brauchst?«
»Für eine Antwort?«, vergewisserte sich Ben und winkte der Kellnerin.
Doreen nickte ein weiteres Mal.
»Puh, ich muss das erst einmal sacken lassen«, entgegnete Ben. »Gib mir das Wochenende. Montag sag ich dir Bescheid.«
»Dann bin ich gespannt auf Montag«, erwiderte Doreen und nestelte in ihrer Handtasche herum, was Ben veranlasste zu sagen: »Lass mal, ich lade dich ein.«
»Danke«, meinte sie und erhob sich. Ben tat es ihr gleich, um sie ordentlich zu verabschieden, wobei er gar nicht genau wusste, wie er dies tun sollte. In diesem Moment kam die Kellnerin, und Ben nutzte die Gelegenheit, um Doreen nur kurz und flüchtig an sich zu ziehen und »Komm gut nach Hause« zu murmeln.
»Bis Montag«, sagte Doreen nur, wandte sich von ihm ab und ging.
Der Kommissar sah ihr nachdenklich hinterher, wurde dann jedoch von der Kellnerin ins Hier und Jetzt zurückgeholt, indem diese fragte: »Wollten Sie die Rechnung?«
Für einen kurzen Augenblick überlegte er. Dann schüttelte er den Kopf. Während er sich wieder setzte, sagte er: »Nein, ich möchte gern einen Aquavit.«
*
14.09 Uhr
Ihr Geruch hing noch in der Wohnung, als es klingelte. Er war nach wie vor nackt und entspannte sich im Bett. Hatte sie etwas vergessen? Er erwartete sonst niemanden. Vielleicht war es ein Paketbote, der für einen Nachbarn etwas abgeben wollte. Das war schon ein paarmal vorgekommen, schließlich bestellten die Menschen in diesen Pandemie-Zeiten gerade wie die Bekloppten. Er selbst bekam keine Post hierher, da dies nur seine Dienstwohnung war. Richtig lebte er im grünen Speckgürtel von Hamburg. Deswegen hätte die Wohnung hier in Lüneburg auch nicht Not getan, denn die Distanz Hamburg-Lüneburg war gefühlt ein Katzensprung, zumal er den Zug nahm, in dem er dösen oder auch arbeiten konnte. Ganz, wonach ihm gerade war. Die Linie RB31 des Metronoms fuhr täglich im Stunden-Takt zwischen den beiden Hansestädten hin und her und brauchte knapp 50 Minuten. Zu bestimmten Zeiten fuhr auch der ICE, der nur ungefähr eine halbe Stunde benötigte. Mit dem Auto dauerte es deutlich länger, vor allem in den Stoßzeiten. Darüber hinaus achtete er darauf, das Fahrrad und die Öffentlichen dem Auto vorzuziehen, wenn es einigermaßen komfortabel für ihn war, schließlich war er auch zu den Fridays for Future-Demos gegangen, als es noch möglich gewesen war. Jetzt hatte er aber einen guten Grund, seine Zeit in erster Linie in der Lüneburger Wohnung zu verbringen, und der hatte gerade eben wieder mächtig Spaß gemacht.