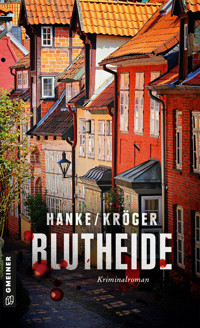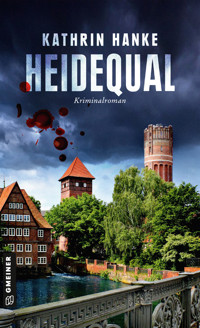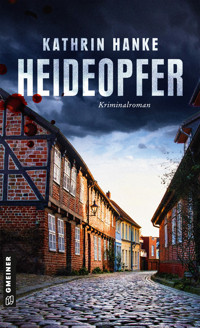Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Wahre Verbrechen im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Als einer der ersten überhaupt in Deutschland beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dem, womit Menschen in der Regel nichts zu tun haben wollen - Blut, Urin, Kot, Mord, Totschlag, Einsamkeit. Zum Großteil reinigt er Orte, an denen Menschen gestorben sind, aber auch für Messiewohnungen oder Fäkaliennotfälle wird er gerufen. Dirk Plähn ist staatlich geprüfter Desinfektor oder besser gesagt: Tatortreiniger. In diesem Buch erzählt der erste und echte Tatortreiniger des Nordens Geschichten aus seinem Berufsalltag, aufgeschrieben von der bekannten Krimi- und True Crime-Autorin Kathrin Hanke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Kathrin Hanke / Dirk Plähn
Mein Leben als Tatortreiniger
Schmutzige Geschichten
Zum Buch
Echt wahr! Als staatlich geprüfter Desinfektor hat Dirk Plähn einen Beruf, den die meisten von uns nur aus dem TV kennen: Dirk Plähn ist Tatortreiniger. Ein echter, denn er ist in keine Filmrolle geschlüpft, ihn gibt es wirklich! In diesem Buch erzählt Dirk Plähn durch die Feder der bekannten Krimi- und True Crime-Autorin Kathrin Hanke wahre Geschichten aus seinem Berufsleben – mal sind sie auf ihre Art lustig, mal nachdenklich stimmend, mal skurril und immer unglaublich, aber doch genauso passiert. Ob bizarre Tatortreinigungen von Leichenwohnungen, kuriose Erlebnisse in Messiewohnungen oder ganz normalen Haushalten, in denen jedoch mit herkömmlichem Putzen nichts auszurichten ist, weil ein Rohrbruch den Keller zur Jauchegrube gemacht hat, die zum Himmel stinkt: Dirk Plähn weiß, dass es nichts gibt, was es nicht gibt und nimmt gerade deswegen das Leben mit Humor. Manchmal bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig …
Dirk Plähn ist waschechter Hamburger. Nach einer Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker arbeitete er im Abriss und etlichen anderen Gewerken des Handwerks, bis er um die Jahrtausendwende herum den Weg in die Selbständigkeit nahm. Bereits hierfür setzte er sich mit Oberflächenverschmutzungen durch Viren und Bakterien auseinander. 2009 sah er in »Welt der Wunder« einen Bericht über Tatortreiniger in den USA – und war fasziniert. Seitdem ist er als einer der ersten Tatortreiniger Deutschlands unterwegs.
Kathrin Hanke wurde in Hamburg geboren. Nach dem Studium der Kulturwissenschaften in Lüneburg machte sie das Schreiben zu ihrem Beruf: Sie jobbte beim Radio, schrieb für Zeitungen, entschied sich schließlich für die Werbetexterei und arbeitete zudem als Ghostwriterin. Ihre Leidenschaft ist jedoch das reine Geschichtenerzählen, wobei sie gern Fiktion mit wahren Begebenheiten verbindet. Daher arbeitet sie seit 2014 als freie Autorin in ihrer Heimatstadt. Kathrin Hanke ist Mitglied im Syndikat sowie bei den Mörderischen Schwestern.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/Illustrationen: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Dirk Plähn und Peter H / Pixabay
ISBN 978-3-8392-7672-3
Wie alles begann
Wie wird man Tatortreiniger? Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und die bestimmt nicht allgemein beantwortet werden kann. Jeder hat da seine eigene Geschichte. Meine fing im September 2009 an.
Nach meiner Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker, einigen weiteren Jahren als Angestellter im Abriss und anderen Handwerksgewerken hatte ich beschlossen, dass ich lieber mein eigener Chef bin. So bin ich bereits seit Anfang der 2000er als Selbstständiger unterwegs. In der Regel vor allem in ziemlich großen Büros. Und zwar als Reiniger. Noch ohne »Tatort« davor. Trotzdem beschäftigte ich mich auch damals schon mit Viren und Bakterien. Ist ja klar. Ob PCs, auf deren Bildschirme geniest, oder Tastaturen, auf die gehustet wurde und so weiter: Alles muss sauber gemacht werden. Ordentlich sauber, denn es geht gerade in Büros nicht nur um die runden Kreise, die regelmäßig von Kaffeebechern auf den Schreibtischen hinterlassen werden, sondern eher um den »unsichtbaren« Schmutz. Während ich das hier gerade erzähle, hat Covid19 in unserer Welt schon seit einiger Zeit Einzug gehalten, und inzwischen wissen die Leute, wie wichtig das richtige Händewaschen und auch Desinfizieren ist. Damals war das noch nicht so wirklich gang und gäbe. Ein bisschen Seife, die Hände kurz abgespült, fertig. Wenn überhaupt. Seinerzeit, in 2009, gab es etliche Studien dazu, wie die Leute sich nach dem Toilettengang die Finger waschen, und ich hab’ sicherlich nicht alle, aber auf jeden Fall sehr viele aufmerksam gelesen. Das macht echt Gänsehaut, und wenn ich die Studien beiseitegelegt hatte und wieder am Großraumbüroreinigen war, mochte ich gar nicht darüber nachdenken, wenn ich in der Keramikabteilung angelangt war. Gut, was Frauen da so treiben, kenne ich nur vom Hörensagen, aber wie Männer sich dort aufführen, weiß ich natürlich. Zumindest am Pinkel- und danach am Waschbecken. Schnell den Latz auf, rausholen, das Pissoir anpeilen, mal mehr, mal weniger zielsicher losstrullern, manchmal noch abschütteln, auf jeden Fall aber zurückstecken, Latz wieder zu und eilig wieder rausgehen. Händewaschen gilt für viele als überbewertet – zumindest vor Corona – und spätestens am Türgriff werden dann ein paar mehr Bakterien und Viren freundlich weitergereicht …
Na ja, auf jeden Fall habe ich sieben Jahre lang in diesem Metier gearbeitet, manchmal auch noch nebenbei für zehn Euro Stundenlohn irgendwo im Haushalt mitgeholfen und mich zudem hin und wieder als Eisenflechter auf dem Bau verdingt. Und alles, damit überhaupt ein paar Taler reinkommen und ich wenigstens Brot und Butter bezahlen kann. Sprich: 2009 ist nicht unbedingt mein Jahr gewesen. Die diversen Jobs hatten mich ausgelaugt, aber an Urlaub inklusive Entspannung ist nicht zu denken. Selbst das davon träumen versage ich mir. Und jetzt kommt mein Vater ins Spiel. Er spendiert mir doch tatsächlich einen Ägypten-Urlaub. Tschakka! Danke, Papa!
Am Flughafen kauf ich mir für den Flug eine leichte Lektüre: Die Welt der Wunder – Ausgabe 03/09. Kaum im Flieger lehne ich mich gemütlich zurück, um sie zu studieren, und bleibe gleich auf der vierten Seite hängen. Da geht es auch ums Reinigen, aber um das von Tatorten in den USA! Wie abgefahren ist das denn? Jede gelesene Zeile bummert mein Herz mehr. Alter Schwede, kommt es mir Absatz für Absatz in den Sinn, dieser Bereich des Saubermachens ist in Deutschland bestimmt eine Nische – genau das Richtige für dich! Dann landen wir in Ägypten. In Ermangelung eines Smartphones, die es damals so gut wie noch nicht für Normalos wie mich gibt, kann ich im Urlaub nicht recherchieren, und Internet in Hotels ist auch noch eher selten. Doch der Gedanke, mich als Tatortreiniger selbstständig zu machen, bewegt mich die gesamte Urlaubszeit.
Nach zwei Wochen Ägypten und jeder Menge Gedankenmacherei zu meiner beruflichen Zukunft setze ich mich zu Hause erst einmal vor meinen Computer und mein Festnetztelefon (das man damals natürlich noch nicht so genannt hat, aber für die Jüngeren unter uns benenne ich das jetzt eben mal so ausdrücklich, damit wir uns alle verstehen) und recherchiere. Nicht eine Stunde, nicht einen Tag, sondern lang und länger – Berufsberatung beim Amt zum Thema Tatortreinigung gibt es damals noch nicht in Deutschland. Nee, im Ernst. Zum Beispiel rufe ich auch bei der Industrie- und Handelskammer an, und die wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Auch mit mir nicht. Der Typ am anderen Ende der Leitung hält mich definitiv für einen Spinner oder sogar für was Schlimmeres, denn bei meiner Fragerei schüttelt er so doll den Kopf, dass ich es durchs Telefon hören kann. Eigentlich ja ein ganz gutes Zeichen, wenn man vorhat, sich selbstständig zu machen. Schließlich ist es nicht schlecht, als einer der Ersten mit einem interessanten Angebot auf den Markt zu gehen. Sozusagen nahezu konkurrenzlos.
Blöd ist nur die Tatsache, dass ich deshalb auch so gut wie kein Infomaterial heranbekomme, was die spezielle Art des Reinigens eines Tatorts angeht. Aber im guten WorldWideWeb werde ich dann doch fündig. Wenigstens das! Mein Englisch kann ich dabei gleich auffrischen, denn es sind amerikanische Seiten, die mich zumindest in der Theorie über die besondere Arbeit mit dem Tod und Leichnamen aufklären. Ich fang ganz vorn an und nicht erst mit meinem eigentlichen Interesse. Schließlich steht die Tatortreinigung am Ende einer Ereigniskette … So beginne ich bei meinem Schlaumachen mit der Beschaffenheit von toten Körpern und deren Zersetzungsprozess. Denn eines ist mir von Anfang an klar: Man wird nicht immer nur zu frischen Leichen oder ihren Absonderungen gerufen, sondern manchmal auch weitaus später, wenn die Fäulnis schon so richtig stark vorangeschritten ist. Ich tummle mich also auch auf den Homepages der wenigen, dafür recht groß angelegten Body Farmen. Schon mal davon gehört? Wenn nicht: Body Farmen sind Gelände, auf denen wissenschaftliche Studien über den Verwesungsprozess von Leichen gemacht werden. Wenn ich das Geld hätte, würde ich einmal über den großen Teich fliegen – vier von den sechs oder sieben Body Farmen weltweit befinden sich nämlich in den USA. Die bekannteste ist die Body Farm der University of Tennessee. Durch seine Besuche dort hat zum Beispiel der Krimiautor Simon Beckett sein Wissen über Tote und wie sie wieder zu Erde werden, erweitert und verfestigt. Ein bisschen neidisch bin ich darauf schon, aber es nutzt nichts, ich muss mir alles von zu Hause aus aneignen. Deswegen habe ich mir meine eigene kleine Body Farm gebastelt, um ausprobieren zu können, mit welchen Mittelchen ich den Tod am besten wegschrubbe. Beim Schlachter meines Vertrauens besorge ich mir zu diesem Zweck kurzerhand ordentlich viel Schweineblut – Schweineblut deshalb, weil es dem menschlichen Blut ziemlich nahe kommt. Zu Hause verteile ich die rote Suppe dann überall. Auf der Tapete, dem Holzfußboden, Kacheln, Glas, Möbeln und allem, was mir noch so einfällt. Schon allein das Betrachten war für mich Ansporn genug, auch alles wieder wegzubekommen. Was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Allerdings in mühseliger Klein- und Schrubbarbeit und mit der Unterstützung einer ganzen Armee der verschiedensten Reinigungsmittel – von harter Chemie über Öko bis hin zu Omas selbstgemixten Haushaltsrezepten. Aber ehrlich, probieren geht in diesem Fall wirklich über studieren, denn ich muss selbst sehen, wie was wo am besten wirkt. Natürlich ist das kein Tagesjob, sondern ein Projekt über Wochen. Es geht mir ja ums Austesten, wie und worauf Blut und anderes Geglibber nach bestimmten Zeitintervallen anspringt. Besuch habe ich in dieser Phase keinen. Ich lasse einfach niemanden rein. Besser ist besser. Ach ja, und während ich bei mir daheim die Sauerei beseitige, nutze ich die Zeit, in der ich darauf warte, dass so manche Spritzer und Lachen eintrocknen und sich aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit verändern, um mir meine eigene Tatortreiniger-Webseite und auch gleich in diesem Zug Visitenkarten zu gestalten. Denn eines weiß ich inzwischen sicher: Das ist mein nächster Job! Dennoch kann ich ihn nicht von heute auf morgen umsetzen. Ein Baustein fehlt mir noch zu meinem Glück, und den zu finden dauert wieder ein paar Monate – ich brauche einen Betrieb in der Nähe, bei dem ich infektiöses Material entsorgen kann. In Hamburg werde ich irgendwann fündig, und inzwischen sind die Leute dort gute Freunde. Kein Wunder, ich sehe sie ja auch nunmehr seit Jahren regelmäßig.
Während der Planungs- und Findungsphase meiner neuen Selbstständigkeit habe ich dummerweise keine großartige Zeit mehr, um darüber hinaus meinen anderen diversen Jobs nachzukommen. Das ist so bei mir. Habe ich ein Ziel, dann verfolge ich es und gebe mehr als 100 Prozent, um es zu erreichen. Mein Ziel heißt seit Wochen, Tatortreiniger zu werden, und deswegen mache ich aus der Not eine Tugend, räume auch bei mir erst einmal auf und verticke nach und nach jede Menge Zeugs das ich nicht mehr brauche über eBay & Co, damit ich wenigstens meine Miete bezahlen kann und Essbares im Kühlschrank habe. Nach einer Weile greife ich zu weiteren Sparmaßnahmen und ziehe um. Ich lande in einer kleinen, dafür aber günstigen Absteige, die in der ersten Etage eines ehemaligen Lagers so tut, als sei sie eine Wohnung. Eigentlich ist es nur eine Bretterbude. Die Dusche befindet sich direkt neben der Küche und ist so eng wie eine Sonnenbank. Da soll sich mal einer drin waschen! Um dem ganzen noch die Krone – oder besser gesagt das Herzchen – aufzusetzen, befindet sich die Toilette draußen auf dem Hof. Die sieht bei meinem Einzug aus wie Rotz und ich muss hier erst mal ordentlich putzen – was tut man nicht alles als Saubermann mit einem Ziel vor Augen. Allerdings wird dieser Ausblick in eine rosige, desinfizierte Zukunft immer wieder von dem der Gegenwart gestört, denn das Panorama, das sich mir aus dem Fenster meines Holzbretterbuden-Wohnzimmers bietet, ist das einer schmutzig-weißen Fabrikwand geschmückt mit einer Horde mehr oder minder funktionsuntüchtiger Fahrzeuge. Das ist nicht etwa Kunst am Bau, sondern das Außenlager meines gegenüberliegenden Nachbarn – eine Kfz-Werkstatt. Mehr als deprimierend. Das einzig Gute an meiner neuen Bude ist der Ansporn, bald wieder Geld zu verdienen, das nicht mit Hilfe von eBay auf mein Konto kommt. Womit, weiß ich wenigstens, und mit jedem Tag mehr bin ich mir sicherer, das richtige Ziel zu verfolgen. Ein bisschen müssen mein immer weniger werdendes altes Zeugs und eBay aber noch herhalten. Immerhin ist es für einen guten Zweck, denn das Geld, das nicht für den alltäglichen Gebrauch notwendig ist, investiere ich risikobereit in die nahe Zukunft: Ich setze es direkt um in Schutzanzüge, Desinfektions- und Reinigungsmittel, Handschuhe, Atemfilter – eben in das, was man meiner Recherche nach als guter Tatortreiniger so braucht. Zu guter Letzt frage ich noch einen Kumpel, ob er mitmachen möchte, denn zu zweit, denke ich, bringt alles doch etwas mehr Spaß. Den einsamen Wolf zu spielen, ist nichts für mich. Falsch gedacht, wie sich später herausstellen sollte – zwischen mir und meinem Kumpel hat das gemeinsame Arbeiten jedenfalls nicht hingehauen. Das kommt vor, ist schade, aber in unserem Fall besser. Darum ziehe ich inzwischen allein durch die Gegend, es sei denn, ich habe gerade wieder jemanden an meiner Seite, der ein Praktikum macht. In meinen Anfängen hatte ich noch keine Praktikanten, dafür aber praktische Erfahrungen mit Schweineblut, eine Internetseite, Visitenkarten und eben diesen Kumpel.
Im Juli 2010 geht es dann tatsächlich los. Wir haben unseren ersten und dann auch gleich den zweiten Einsatz. Unglaublich. Meine ganze Vorarbeit hat sich wirklich und wahrhaftig gelohnt, und wäre es nicht zu makaber gewesen, hätte ich sicher an meinem ersten Tatort zu lauter Musik einen Freudentanz aufgeführt.
Mit den Aufträgen geht es so weiter. Schlag auf Schlag. Glück muss man haben. Zeitgleich kommt die Serie Der Tatortreiniger mit Bjarne Mädel raus und ich – auch das echt unglaublich – werde gefragt, ob ich mit auf dem Promotion-Parkett tanzen will. Ich will, denn am ersten Tatort hatte ich mir das ja selbst verboten. Ich mache mich also irgendwohin in die Sternschanze auf. Da, im Hamburger Szene-Viertel, fahren die Leute ja immer ziemlich gut auf Neues ab. Es wird die erste Staffel vom Tatortreiniger vorgeführt, und danach stehe ich, sozusagen als frischer Experte, gewappnet mit ein bisschen Equipment aus meinem Fundus, dem interessierten Publikum Rede und Antwort. Das macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch mir selbst etwas Öffentlichkeit ein. Darum lässt dann auch die Presse nicht lang auf sich warten – und schwups erscheint der erste Artikel über mich und mein Saubermann-Tun in der gedruckten Zeitung. Mann, ist das abgefahren!
Im Oktober 2010 ist es dann soweit wieder ganz gut um meine Finanzen gestellt, dass ich endlich aus der mistigen Bruchbude aus und in eine Wohnung, die auch den Namen verdient hat, einziehen kann. Den Luxus einer Garage kann ich allerdings vergessen, genauso wie die Anschaffung eines optimalen Tatortmobils – muss halt mein altersschwacher Pkw noch ein bisschen länger für meine Touren herhalten. Immerhin habe ich einen fahrbaren Untersatz, sodass ich einigermaßen zügig zu meinen Einsatzorten düsen kann. Ein bisschen umständlich und manchmal nervig ist das Hin- und Hergeschleppe meines Tatortreinigungsmaterials aus meiner neuen Wohnung im ersten Stock herunter und nach getaner Arbeit wieder hoch. Aber ich nutze mein Auto auch privat und das dann doch lieber ohne das ganze Zeugs darin.
Inzwischen sind ein paar Jahre vergangen und ich möchte beruflich nichts anderes machen als Tatortreinigung. Ich verdiene zwar nach wie vor keine Reichtümer, kann aber einigermaßen überleben, obwohl das Finanzamt es ja auch von den Armen nimmt. Darüber hinaus machen einen diese ganzen Steuervor- und -nachzahlungen völlig irre und können durchaus über Monate zermürben, wenn die Auftragslage mau ist. Also: Ums Geld geht es nicht, aber der Job bringt mir enorm viel Befriedigung, und das Schönste an ihm ist, dass ich ihn mir allein aufgebaut habe. Die Mühe hat sich absolut gelohnt.
Wozu doch damals die Welt der Wunder gut war … Übrigens hat das Magazin zehn Jahre später in der Ausgabe 11/19 ein weiteres Mal über Tatortreinigung berichtet. Um genau zu sein, erzähle ich darin auf etlichen Seiten über den Job als Tatortreiniger in Deutschland. So schließt sich der Kreis.
Der Container
Wohncontainer haben es in sich, und ganz dicht sind sie anscheinend auch manchmal nicht. Zumindest nicht, wenn so eine einfache Behausung – offiziell »niedrigschwellige Unterkunft« genannt – etwas länger eine Leiche beherbergt. Davon kann ich mich selbst überzeugen.
Es ist November und entsprechend ungemütlich kalt bei uns im Norden, als ich in eine dieser Hamburger Wohncontainersiedlungen gerufen werde, in denen Obdachlosen wenigstens für eine gewisse Zeit ein Dach über dem Kopf auf vier Wänden zur Verfügung gestellt wird. Zuvor ist eine ganze Weile leider keinem Bewohner der Siedlung aufgefallen, dass sie einen ihrer Nachbarn schon längere Zeit nicht gesehen haben. Ob es an der Fluktuation in solchen Unterkunftsansammlungen liegt, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass der Mann in seinem Einzelwohncontainer schon eine erhebliche Zeit tot ist, als er gefunden wird, und ich gerufen werde, um den Container für den nächsten Bewohner wieder herzurichten.
In der Hoffnung, zu zweit schneller zu arbeiten und entsprechend schneller wieder zu Hause zu sein, habe ich mir meinen damaligen Kollegen geschnappt und bin mit ihm in die Siedlung. Gut ausgerüstet und in voller Montur gehen wir rein in den Container. Vor dem Geruch des Todes sind wir durch unsere Masken über Mund und Nase geschützt, aber nicht vor dem Anblick, da unsere Schutzbrillen leider nichts verschleiern, sondern im Gegenteil das Wesentliche in das Auge des Betrachters rücken. Das sind in diesem Moment wir, die Tatortreiniger, die alles wieder schick machen sollen.
Zwar ist der letzte Containerbewohner »nur« in der Matratze verstorben, wie wir in unserer Branche manchmal sagen, und was nichts anderes heißt als einfach eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht, doch das hat er mit einer ordentlichen Hinterlassenschaft getan. Gut, der Raum an sich ist okay: Keine überall verteilten Blutspritzer oder sonst ein Schmodder auf den Wänden oder den wenigen umstehenden Möbeln, wie es gern einmal bei einem Tötungsdelikt der Fall ist. Dafür, und das sehe ich sofort, hat es das Unterbett im wahrsten Sinne des Wortes in und unter sich. Der verstorbene und natürlich bereits abtransportierte Mann ist komplett durch seine Matratze hindurchgesickert, nachdem sich sein toter Körper verflüssigt hat. Und zwar bis nach unten durch auf den Containerfußboden! Das sehe ich, da unter der Matratze das an den Rändern hervorgequollen war, was einst oben drauf war. Kurz frage ich mich, was der Bestatter da wohl noch groß abtransportiert hat bis auf trockene Haut und Knochen, dann kremple ich mir innerlich die Ärmel hoch. Ursprünglich hatte ich nur mit der Entsorgung der Matratze und der Desinfektion des Containerinneren gerechnet, jetzt gehe ich davon aus, dass die Reinigung des Fußbodens noch ein bisschen mehr Zeit als geplant benötigen wird, weil da einiges abzuschrubben sein wird. Aber, hey, das ist okay, denke ich, das ist dein Job und du hast ihn dir ausgesucht. Und dieser Job ist nur getan, wenn ich meinen Auftragsort sauber und keimfrei hinterlasse. Darunter geht nichts. Und in diesem Containerfall ist es im Grunde eine Routinearbeit. Dachte ich, wurde jedoch zügig eines Besseren belehrt.
Gemeinsam mit meinem Kollegen mache ich mich an die Arbeit. Zunächst kommt die Matratze zur Entsorgung raus. Erst als ich wieder reinkomme und sehe, was wir da freigelegt haben, verfluche ich innerlich die Menschen, die nicht schon früher nach ihrem Nachbarn geschaut haben. Wäre der Tod des Mannes nicht so lange unentdeckt geblieben, dann hätte er sich nicht dermaßen in seine Einzelteile aufgelöst und ich müsste meine Verabredung für den Abend nicht nach hinten verschieben. Wobei, natürlich geht es in diesem Moment nicht um mich oder meinen Kollegen, der ebenso noch etwas vorhat. Mir geht es um den Mann, der sowohl Gevatter Tod als auch dem Desinteresse seiner Umgebung zum Opfer gefallen ist. Ich weiß nicht, woran der gute Mann verstorben ist, ich weiß nur, dass er es einsam getan hat und dies vermutlich schon vorher war, wie so viele in unserer Ellenbogengesellschaft, die, aus welchem Grund auch immer, »nicht mithalten« können. Aber ich will hier jetzt nicht abschweifen und auch kein gesellschaftliches Fass aufmachen.
Ich konzentriere mich auf den Containerfußboden. Eine einzige Matsche wie aus dem besten Splatter-Film hat sich hier breitgemacht. Ehrlich, dem, was auf dem Containerfußboden vor mir liegt, ist nicht nur mit einem Schrubber beizukommen – es hatte viel zu lange Zeit, sich wie Efeu in den Boden einzuarbeiten, festzusetzen und selbst die kleinste Ritze für sich zu entdecken. Wir haben es hier trotz eines natürlichen Todes definitiv nicht mit normalen Umständen zu tun.
Normale Umstände sind für uns Tatortreiniger die Begleiterscheinungen, die die Totenstarre mit sich bringt. Darauf sind wir sofort gedanklich eingestellt, wenn das Diensttelefon klingelt und wir gerufen werden.
Bei der Totenstarre versteift sich die Muskulatur. Im Gegenzug lockern sich wiederum andere Körperteile, wozu auch der Schließmuskel gehört. Dieser öffnet sich wie ein Schleusentor, sodass Urin und Kot freie Bahn haben. Meist in die Hose und in diesem Fall dann später auch in die Matratze. Wäre der Containerbewohner früher aufgefunden worden, hätten wir es also lediglich mit dieser Art Hinterlassenschaft von ihm zu tun bekommen.
Zurück zur Totenstarre. Wenn sich diese nach etlichen Stunden wieder auflöst setzt die sogenannte Autolyse ein. Das bedeutet nichts anderes, als dass sich der tote und entsprechend nicht mehr mit Sauerstoff versorgte Körper auflöst. Verantwortlich dafür sind bestimmte Enzyme. Durch die Autolyse verflüssigen sich unter anderem die inneren Organe und zersetzen sich. Dies dauert ein paar Tage, und in diesen Tagen braucht man gar nicht näher an den Leichnam herangehen, die Nase erschnüffelt dann auch von weiter weg, dass der Verwesungsprozess eingesetzt hat.
Der Geruch des Todes, wie er ja gern poetisch bezeichnet wird, entsteht etwa ein bis zwei Tage nach dem Todesfall durch die einsetzende Fäulnis im Inneren des Körpers – das hört sich dann nicht mehr so poetisch an – und geht mit der Autolyse nahezu Hand in Hand. Aber das war es noch nicht, wie wohl jeder von uns weiß.