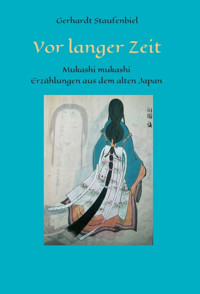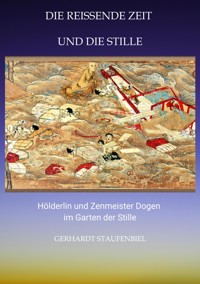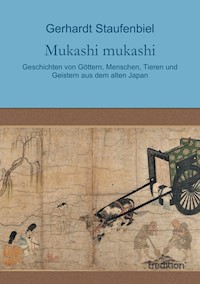6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Weh mir, wo nehm ich wenn es Winter ist die Blumen! Für Hölderlin ist unser Zeitalter die Zeit der Götternacht. Er sucht nach dem sinnspendenden Heiligen und findet die Antwort in der heimatlichen Natur, die es neu zu sehen und zu lernen gilt. Damit ist Hölderlins Dichtung unvermutet aktuell. Am Leitfaden der späten Gedichte 'Nachtgesänge', besonders 'Hälfte des Lebens', wird die vielfältige Gedankenwelt eines der größten Dichter deutscher Zunge lebendig. Seine Dichtung ist reine Musik des Herzens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hölderlin: Worte wie Blumen
Von Gerhardt Staufenbiel
Προζ εαυτον
Lerne im Leben die Kunst, im Kunstwerk lerne das Leben, Siehst du das eine recht, siehst du andere auch.
Friedrich Hölderlin
Hölderlin: Worte wie Blumen
Auf der Suche nach der Ganzheit
Meditationen über Hölderlins Dichtung
Von Gerhardt Staufenbiel
1. Auflage, 2021
© Gerhardt Staufenbiel - Alle Rechte vorbehalten.
Verlag und Druck:
Tredition
Halenreie 40 – 44
22359 Hamburg
978-3-347-24843-4 (Paperback)
978-3-347-24844-1 (Hardcover)
978-3-347-24845-8 (e-Book)
Anmerkung zur Rechtschreibung:
In den Zitaten wird die jeweils originale Rechtschreibung verwendet, die von der heutigen abweicht.
Inhaltsverzeichnis
1. Wege des Wanderers
2. Einleitung
Teil ILehrerin der Menschheit
3. Hälfte des Lebens
3.1 Apriorität des Individuellen
3.2 Lehrerin der Menschheit
3.3 Sinnlichkeit und Schönheit
3.4 Die neue Mythologie
3.5 Des Menschen Maß
3.6 Die heimatliche Natur
3.7 Die Götternacht
3.8 Dialektik: Heroisch – idealisch – naiv
3.9 Dialektik: Heimkunft
3.10 Exkurs: Platons Symposion
Teil IINachtgesänge
4. Nachtgesänge
4.1 Du edles Wild – Chiron
4.2 Die Meisterin und Mutter
4.3 Prometheus: Technik
4.4 Exkurs: Das Hohe Lied
4.5 Adonischer Vers
5. Hälfte des Lebens: Innigkeit
5.1 Zu-Neigung
5.2 Gelbe Birnen und wilde Rosen
5.3 Die Schwäne
5.4 Heilig nüchtern
6. Hälfte des Lebens: Winter
6.1 Weh mir!
6.2 Der Winter
6.3 Wo nehm ich die Blumen
6.4 Schatten der Erde
6.5 Klirrende Fahnen
7. Lebensalter
8. Der Winkel von Hardt
8.1 Winkel und Quadrat
9. Ausklang
10. Danksagung
1. Wege des Wanderers
In den homerischen Hymnen werden die Geschichten von Apollo und Hermes erzählt.
Als Apollo im Beisein aller Götter geboren war, zerriss er sofort seine goldenen Windeln und entstieg der Wiege. Laut rief er: „Mein seien Bogen und Leier!“ Sprach‘s und schritt herrscherlich davon. Aber es gab weder Leier noch Bogen.
Hermes wurde in aller Stille in einer verborgenen Höhle inmitten der unberührten Natur geboren. Seine Mutter, die Nymphe mit den goldenen Zöpfen, legte ihn in eine schlichte Getreideschwinge. Hermes hielt es nicht lange in der Schwinge. Heimlich schlich er davon. Kaum hatte er die Höhle verlassen, da begegnete ihm als glücklicher Fund eine Schildkröte und er formte daraus die Leier.
Er flocht sich riesige Sandalen aus Reisig und schnallte sie verkehrt herum an seine Füße. Dann ging er rückwärts, um die Rinder des Apollo zu stehlen. Doch die Spur führt Apollo direkt zu Hermes. Nur zu gern tauschte er die Rinder, die er ohnehin nicht mochte, gegen die Leier. Manchmal scheinen wir rückwärts zu gehen, aber hinterher betrachtet, führt die Spur dennoch geradewegs ins Ziel.
Hermes freut sich über jeden noch so kleinen Fund und die vielen bunten Blumen an seinen verschlungenen Wegen. Ihm ist der Weg wichtiger als das Ziel. Schöpferisch spielend wie ein Kind, kommt er dennoch ans Ziel. Unterwegs aber hat sich ihm eine weite, bunte Landschaft erschlossen.
Möge uns Hermes auf verschlungenen Pfaden durch Hölderlins Dichtung geleiten. Auch wenn wir manchmal scheinbar das Ziel aus den Augen zu verlieren oder rückwärts zu gehen scheinen: die Funde am Wegesrand entschädigen tausendfach für die Mühe.
Doch nun, nun müssen Worte wie Blumen entstehen!
2. Einleitung
Im Dezember 1803 schrieb Hölderlin einen Brief an seinen Verleger Wilmans in Frankfurt. Der hatte ihn gebeten, einige Gedichte für seinen geplanten Musen Almanach für das Jahr 1805 mit Liebes- und Freundschaftsgedichten zu schicken.
Ich bin eben an der Durchsicht einiger Nachtgesänge für ihren Almanach.
Ich wollte Ihnen aber sogleich antworten, damit kein Sehnen in unsere Beziehung kommt.
Die neun Nachtgesänge, die Hölderlin an Wilmans gab, sollten die letzten von ihm selbst zum Druck gegebenen Gedichte werden.
Unsere Zeit ist für Hölderlin die Zeit der Götternacht, der Abwesenheit des Heiligen, die bis heute andauert. Dem Dichter bleibt nur, wach zu bleiben in der Nacht und das Heilige, das kommen wird, zu erwarten. Darum wohl nennt er die geplante Folge der Gedichte für den Almanach die Nachtgesänge. Es sind Gesänge aus der Nacht der Geschichtszeit, in der Hoffnung auf das neue Licht, das kommen wird.
Hölderlin wollte keine schwärmerischen Gedichte zur Unterhaltung der besseren Gesellschaft schreiben. Seine Gesänge sollten ‚Lehrerin der Menschheit‘ sein. Menschheit ist nicht die Gesamtheit der Menschen, es ist das, was den Menschen eigentlich erst zum Menschen macht, seine Humanität. Zugleich sollten sie helfen, eine neue, unmittelbar sinnliche Religion zu bilden.
Obwohl Hölderlin ein hochgelehrter Mann war, der die Bibel im hebräischen Original las und der die griechischen und römischen Klassiker bestens kannte und übersetzte, nennt er unsere Kultur ‚kinderähnlich‘. Zur Goethezeit, der Lebenszeit Hölderlins, bestand nahezu die gesamte Bildung aus Anlehnungen an das Altertum, besonders der griechischen Antike. Auch unsere Religion ist ein Überbleibsel aus Griechenland und dem vorderen Orient. Für Hölderlin, den studierten Theologen, der nach den Regeln des Tübinger Stifts ein Amt als Pastor hätte annehmen müssen, war die Religion an ihr Ende gekommen. Die antiken Heilandsgötter Herakles, Dionysos und Christus - drei Brüder im Geiste – sind verschwunden. Nur noch die alten Geschichten werden erzählt, aber sie selbst sind hinweggegangen, wenig bekümmert um uns‘.
Ruhelos zog Hölderlin von Ort zu Ort und suchte leidenschaftlich und voller Liebe nach dem Eigenen, unabhängig vom griechischen Vorbild. Das Eigene, das Hölderlin sucht, ist nicht sein persönliches Eigentum, es ist das Eigene des ‚Vaterlandes‘ und darüber hinaus auch das Eigene der Menschheit überhaupt.
Das Eigene ist das Offene, die Freiheit des Blickes und des Herzens fern jeder Enge und Eingeschränktheit. Das Eigene ist das Vaterländische, das, was uns von den Griechen unterscheidet, und das unser zu Hause bildet. Die Griechen sind unser Vorbild, weil sie gelernt hatten, im Einklang mit ihrer Natur zu leben und das ihnen Eigene zu gestalten. Darum brauchen wir sie, so Hölderlin, um von ihnen zu lernen.
Aber unsere Natur, unser Klima, das die Menschen formt und bildet, ist anders als die Natur Griechenlands oder der Wüsten des vorderen Orients, in der unsere Religionen entstanden sind. Das Vaterländische hat nichts mit einem Nationalismus oder einer Enge einer deutschen Leitkultur zu tun. Es ist das Besondere unserer Natur, die uns formt.
Der deutsche Dichter sitzt unter schützenden Wolken im Schatten von Eichen, der Dichter der antiken Welt saß in der Glut der Sonne unter Palmen. Die Natur selbst erzieht den Menschen zu seinem jeweils Eigenen. Aber allen gemein ist es, dass die Natur selbst den Menschen erzieht, so unterschiedlich sie sich an verschiedenen Orten und Klimazonen auch zeigen mag.
Die Natur ist ‚älter als die Zeiten und über die Götter‘. Die Menschen haben sie bisher nicht gesehen, denn ihr Blick war vom Dasein der Götter gefangen. Aber die Götter haben lediglich in ‚Knechtsgestalt‘ den Acker gebaut. Die Natur selbst ist das Heilige. Sie, die alles hervorbringt und wieder zurücknimmt. Auch die Götter, die ihre Zeit haben, um dann wieder zu verschwinden.
Darum tut es Not, dass wir – nicht nur zu Hölderlins Zeiten, sondern gerade auch heute, in Zeiten der Orientierungslosigkeit, der Umweltzerstörung und der Vergewaltigung der Natur – auf sie selbst hören. Denn der Mensch steht der Natur nicht gegenüber, er ist ein Teil von ihr. Wenn die Natur stirbt, sterben auch wir. Und die Götter sind noch eher verschwunden als der Mensch.
So wurde Hölderlin nicht nur der Dichter der Deutschen. Weltweit werden seine Gesänge gelesen und rezitiert, sogar im fernen Japan und in China. In Italien ist erst kürzlich eine komplette Ausgabe seiner Werke in italienischer Sprache erschienen.
Hölderlin war gerade einmal um die dreißig Jahre alt, als er sein gewaltiges Hauptwerk schuf. Mit 36 Jahren verstummte er und lebte dann noch einmal über dreißig Jahre als Wahnsinniger im Tübinger Turm, dem Haus des Schreinermeisters Zimmern unweit des Tübinger Stifts, in dem er studiert hatte. Hölderlin war nun wieder zurückgekehrt zu seinem Ursprung.
Ob seine späteren Werke Erzeugnisse der Krankheit waren oder ob es sich um die höchsten Kunstwerke deutscher Sprache handelt, war lange umstritten. Heute ist diese Frage müßig, denn auch so genannte Schizophrene sind in der Lage, große Kunstwerke zu schaffen. Sicher war Hölderlins Sprache immer komplexer geworden. Er war hochbegabt und hochsensibel. Darum ging es ihm um absolute Reinheit seiner Gedanken, frei von persönlichen Wünschen. Hölderlin dachte in Bildern und seine bildhafte Sprache wurde immer dichter. Wenn ein Psychiater ohne nähere Kenntnis von Hölderlins Werk Gedichte aus der Spätzeit liest und sie nicht versteht, dann ist das kein Beweis für Hölderlins Krankheit, sondern für mangelndes poetisches Verständnis des Psychiaters.
Hölderlin arbeitete an ganz neuen Ideen für seine Dichtung, er wollte einen völlig neuartigen Gesang schaffen. So sind seine großen späten Gedichte unvollendete Fragmente, die mitten im Arbeitsprozess liegen blieben. Hölderlin hatte keine Zeit mehr, die geplanten Werke zu vollenden. Immer wollte er das Einfache sagen, aber seine Ideen waren zu unzeitgemäß und neu.
Erst in den letzten Gedichten der Nachtgesänge und später im Turm gelingt ihm der ‚einfache Gesang‘. Aber seine Zeitgenossen hielten gerade diese Gedichte für das Werk eines Wahnsinnigen. Ver-rückt war Hölderlin sicher. Aber was ist normal in verrückten Zeiten wie der Zeit Hölderlins mit aufkeimenden Hoffnungen, Revolutionen, die im Blut versanken, den napoleonischen Kriegen und der sich ankündigenden Selbstgenügsamkeit des Biedermeier?
Wir begeben uns auf eine Abenteuerreise in Hölderlins Bilder- und Gedankenwelt und versuchen, seinen Ideen zu folgen. Dabei tauchen wir in ein komplexes Gedankengebäude ein, das bunt und farbig ist ‚wie das Land, das wechselt wie Korn‘. Damit wir uns nicht in den Weiten der hölderlinschen Bilder- und Gedankenwelt verlieren, soll das kleine Gedicht ‚Hälfte des Lebens‘ aus den Nachtgesängen der Ariadnefaden sein, der uns durch das Rankengewirr leiten mag und zu dem wir immer wieder zurückkehren. Auch die Nachtgesänge werden uns immer wieder auf unseren Wegen leiten und führen.
Wir besuchen dabei nicht nur die deutschen Wälder, sondern auch das Meer der Griechen und die Wüsten Palästinas.
Hölderlins Zeitgenossen hielten ihn für geisteskrank, weil sie seine Sprache nicht mehr verstanden. Aber fast alle zeitgenössischen Lyriker verdanken Hölderlins Dichtung wesentliche Impulse.
Rainer Maria Rilke schrieb in einem Brief an Norbert von Hellingrath der um 1909 Hölderlin neu entdeckte und herausgab:
… sein Einfluß auf mich ist groß und großmüthig wie nur der des Reichsten und innerlich Mächtigsten es sein kann.
Erst kürzlich, im Jahr 2016, ist in einem Wiener Antiquariat ein Hölderlinband aus dem Besitz von Georg Trakl aufgetaucht. Auf der ersten Seite hat Trakl mit Bleistift ein Gedicht notiert mit dem Titel ‚Hölderlin‘. Trakls Gedicht klingt wie ein Echo der einfachen Sprache von Hölderlins späten Gedichten aus dem Turm.
Der Wald liegt herbstlich ausgebreitet
Die Winde ruhn, ihn nicht zu wecken
Das Wild schläft friedlich in Verstecken,
Indes der Bach ganz leise gleitet.
So ward ein edles Haupt verdüstert
In seiner Schönheit Glanz und Trauer
Von Wahnsinn, den ein frommer Schauer
Am Abend durch die Kräuter flüstert.
G. T.
1911
Das gesamte Spätwerk von Martin Heidegger wäre ohne die intensive Begegnung mit der Dichtung Hölderlins nicht in der Form entstanden. So hat Heidegger Vorlesungszyklen über Hölderlin gehalten. Sein Entwurf der Philosophie des Gevierts, des „Spiegel-Spiels“ von Himmel und Erde, Göttlichen und Sterblichen wäre ohne Hölderlin nicht denkbar.
Heute, mehr als 170 Jahre nach seinem Tod möge Hölderlins Dichtung wieder zur Lehrerin der Menschheit werden, damit „geistiger das weit gedehnte Leben“ werde.
Mich selbst fesselt Hölderlins Dichtung seit nun weit mehr als vierzig Jahren und bereichert mein Leben – meine Hälfte des Lebens! Ich verneige mich vor ihm in tiefer Ehrfurcht und Dankbarkeit.
Teil I
Lehrerin der Menschheit
Darum hoff ich sogar, es werde, wenn das Gewünschte
Wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst,
Und gefunden das Wort, und aufgegangen das Herz ist,
Und von trunkener Stirn höher Besinnen entspringt,
Mit der unsern zugleich des Himmels Blüte beginnen,
Und dem offenen Blick offen der Leuchtende sein.
Gang aufs Land
3. Hälfte des Lebens
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
klirren die Fahnen.
,Hälfte des Lebens‘ ist eines der letzten Gedichte, das Hölderlin selbst in einer Sammlung von neun Gedichten, die er ‚Nachtgesänge‘ nannte, zum Druck gegeben hatte. Hölderlins Zeitgenossen hielten das Gedicht für das Werk eines Irrsinnigen, der nicht mehr in der Lage war, die klassische Form eines Gedichtes in Hexametern zu gestalten. Christoph Theodor Schwab und Ludwig Uhland, die 1826 einen ersten Hölderlin-Gedichtband herausgaben, übergingen die Nachtgesänge, also auch ‚Hälfte des Lebens‘, weil sie sie für Produkte der Geisteskrankheit hielten. Das Gedicht erschien erst wieder in der von Schwab 1846 besorgten Hölderlin-Gesamtausgabe, allerdings wurde in dieser Version „Birnen“ durch „Blumen“ ersetzt; diese Version wird auch in der Werkausgabe von 1906 in der Rubrik „Aus der Zeit des Irrsinns“ präsentiert.
Als ich das kleine Gedicht zum ersten Mal las, traf es mich wie ein Blitz! In unglaublich dichter Form rufen eindringlich sinnliche, fast naive Bilder die unterschiedlichsten Emotionen hervor. In der ersten Hälfte das idyllische Bild der Schwäne und einer wohlig tiefen Innigkeit, im zweiten Teil fast brutal die klirrende Kälte, Sprachlosigkeit und Isolation des Winters, die das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Ein weiteres Gedicht, das nur als Entwurf existiert, hat mich ähnlich getroffen und viele Jahre immer wieder bewegt. Es war der späte Entwurf, der mit ‚Griechenland‘ überschrieben ist. Ich verstand kein Wort, aber das Gedicht zog mich magisch an. Es war die reine Musik. Immer und immer wieder las ich es, aber es wollte sich nicht erschließen. Ein Psychiater hatte sich mit dem Text befasst und ihn als ein typisches Beispiel des Sprachverfalls eines Geisteskranken verstanden. Nach fast fünfzehn Jahren las ich den Text wieder einmal und plötzlich öffnete sich mir das Gedicht. Es war ein absolut klares und logisches Denken. In knapper und verdichteter Form schrieb Hölderlin eine Summe seines Denkens nieder. Für mich war das wie ein Erleuchtungserlebnis.
Oh ihr Stimmen des Geschicks, Wege des Wanderers!
Denn an der Schule Blau, wo Geist von lang her toset,
Tönt wie der Amsel Gesang
Der Wolken heitere Stimmung, gut
Gestimmt vom Dasein Gottes, dem Gewitter.
Und Rufer, wie Hinausschauen, zur
Unsterblichkeit und Helden;
Viel sind Erinnerungen.1
Wie anders war da doch ‚Hälfte des Lebens‘. Fast kindlich naiv singen treffende Worte direkt ins Herz. Auf dem Blatt mit dem Entwurf für das Gedicht ‚Gang aufs Land‘ schieb Hölderlin neben den unvollendet gebliebenen Schluss die Worte:
Singen wollt ich leichten Gesang, doch nimmer gelingt mirs,/ denn es machet mein Glük nimmer die Rede mir leicht.
Hier, in diesem kleinen Gedicht ‚Hälfte des Lebens‘ war ihm das Einfache geglückt!
Später habe ich einmal ‚Hälfte des Lebens‘ in einem Seminarhaus im bayerischen Voralpenland besprochen. Es war ein strahlender Wintertag und die Sonne stand tief am Himmel in einem kalten, klaren Licht. Am Vormittag hatten wir den ersten Teil des Gedichtes interpretiert. Dann, nach einer kurzen Pause, trafen wir uns wieder, um den zweiten Teil zu lesen. Urplötzlich zogen sich Gewitterwolken zusammen und ein heftiger Schneesturm mit Donner und Blitz brach herein. Dahinter strahlte noch die Wintersonne durch stürmische und dichte Schneeschauer. Blitze fielen mitten im Schneegestöber, und der Donner krachte direkt über dem Haus. Alle erstarrten vor Schreck und in Faszination angesichts des Wintergewitters. Das Gewitter wirkte wie ein winterlich – feuriger Gruß vom Dichter selbst.
Das Gewitter dauerte nur wenige Minuten. Danach strahlte wieder die Wintersonne von einem eisblauen Himmel. Aber eine Teilnehmerin brach in bittere Tränen aus: „Diese Verse beschreiben genau mein eigenes Leben! Alles ist sprachlos und kalt!“
Das ist es: Diese einfachen Bilder treffen unmittelbar - ohne den Verstand zu einer Deutung zu benötigen - direkt ins Herz. In dem ‚Weh mir‘ spricht kein ‚lyrisches Ich‘ wie die Literaturwissenschaft gerne formuliert. Es spricht der Dichter, der leidet. Liest man den Text so, wie Hölderlin es gewollt hat, dann trifft er unmittelbar ins Herz und ICH leide voller Empathie mit. Das lyrische Ich ist ein Gespenst, das niemals leiden kann. Verwundert steht der Rezensent außen vor und betrachtet dieses merkwürdige Etwas, das da ein Leiden formuliert. Kierkegaard hat das trefflich in seinem ‚entweder Oder‘ beschrieben:
Was ist ein Dichter? Ein unglücklicher Mensch, der tiefe Qualen in seinem Herzen birgt, dessen Lippen aber so geformt sind, daß, indem der Seufzer und der Schrei über sie ausströmen, sie klingen wie eine schöne Musik … Und die Rezensenten treten hinzu, die sagen: Ganz recht, so soll es sein nach den Regeln der Ästhetik. Nun, versteht sich, ein Rezensent gleicht einem Dichter ja aufs Haar, nur hat er nicht die Qualen im Herzen, nicht die Musik auf den Lippen. Sieh, darum will ich lieber Schweinehirt sein aufAmagerbo und von den Schweinen verstanden sein, als Dichter sein und mißverstanden von den Menschen.
Marie Luise Kaschnitz las das Gedicht als eine Schilderung von Seelenzuständen:
Die Landschaft, die ich beim Lesen der ersten Strophe vor Augen hatte, die des Bodensees nämlich mit ihrer nachsommerlichen Fülle von Blumen und Früchten, beglückte mich, das winterliche Bild der sprachlosen Mauern erregte in mir eine Wollust der Einsamkeit, das Klirren der Drähte an den leeren Fahnenstangen war dazu die passende Musik.
Erst in späteren Jahren verstand ich recht eigentlich die schmerzliche Frage und Klage des Gedichts, ich bezog sie auf das Alter, das jedem jungen Menschen als ein halber Tod erscheint und dessen Schrecken ich durch die Vision einer nicht mehr von Blumen und schönen Tieren belebten, grauen Winterlandschaft vollkommen ausgedrückt fand.
Noch später las ich das Gedicht wieder anders, nämlich als tödliche Furcht vor einem krankhaften und doch auch jedem gesunden Menschen bekannten Seelenzustand der inneren Verödung und Kälte, in dem die Dinge ihre Farben, ihren Duft und ihre Stimme verlieren.
Diese Furcht vor einer ewigen, nur von kalten metallischen Geräuschen noch erfüllten Gefühllosigkeit weiß der Dichter, der vorher die Liebestrunkenheit und die heilige Nüchternheit seines lebendigen Lebens in so herrlichen Bildern darstellte, auch im Leser und Hörer zu erwecken, nicht nur durch die Wahl seiner Worte, sondern auch durch die Folge seiner Vokale …Auf den ersten Blick ist das Gedicht scheinbar eine naive Naturschilderung. Die gelben Birnen, die wilden Rosen, die Schwäne zeichnen das idyllische Bild einer Sommerlandschaft. Aber Birnen reifen nicht zu der Zeit, wenn die wilden Rosen blühen. Und trunken von Küssen sind die Schwäne nicht in einer naiven Natur.
Sie spiegeln einen seelischen Zustand des Menschen, der sie sieht. Der zweite Teil ist auch keine einfache Naturschilderung mehr. Er beginnt mit einem Klageruf: Weh mir! Er fährt fort mit einer flehentlichen Frage: Wo nehm ich die Blumen. Die Frage schaut voraus in die Zeit, wenn es Winter ist. Offenbar wird sie gestellt in einer Zeit, in der noch keine winterliche Kälte herrscht. Es ist keine Naturschilderung, sondern die Beschreibung eines inneren Zustandes.
Wie die Betrachtung von Marie Luise Kaschnitz zeigt, kann man die Verse unterschiedlich verstehen. Nicht nur, dass verschiedene Menschen eine unterschiedliche Deutung haben. Ja, derselbe Mensch kann in unterschiedlichen Phasen seines Lebens das Gedicht anders lesen und verstehen.
Das Gedicht will nicht als ein Objekt wissenschaftlicher Forschung betrachtet werden. Dann können vielleicht interessante Beobachtungen über den Herrn Hölderlin und seine Seelenzustände gewonnen werden, oder es wird als Gattung der Literatur katalogisiert. Aber nicht als wissenschaftliches Forschungsobjekt entfaltet das Gedicht eine solche Anziehungskraft, dass eine Fülle von Büchern darüber geschrieben wurden und es vielfach musikalisch vertont wurde. Es sind die Bilder, die unmittelbar ansprechen und das Herz berühren. Ich habe mit deutschen Hausfrauen, russischen Juden und japanischen Buddhisten über das Gedicht gesprochen und diskutiert. Alle sind tief berührt, wenn auch jeder eine eigene Sichtweise entwickelt. Wichtig ist das Gespräch mit dem Gedicht und mit Hölderlin, einem Gespräch, in dem wir sehr viel über uns selbst erfahren.
Paul Celan sagte einmal:
Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs. Wer es schreibt, bleibt ihm mitgegeben. Aber steht das Gedicht nicht gerade dadurch, also schon hier, in der Begegnung - im Geheimnis der Begegnung? Das Gedicht will zu einem Andern, es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu.2
3.1 Apriorität des Individuellen
Dem Gedicht ist der Autor „mitgegeben“. Es ist nicht gleichgültig, WER es geschrieben hat. Immer schwingt die Biografie und die Lebenssituation des Autors mit. Andernfalls ist das Gedicht nicht authentisch. Aber der Dichter schreibt keine Gedichte, damit wir etwas über seine augenblickliche Gemütslage oder sein Leben erfahren. Dann würde er eine Autobiografie verfassen. Der Dichter will nicht das Individuelle mitteilen, er versucht, Allgemeingültiges zu sagen. Auf einem Blatt mit dem Entwurf zu einem Gedicht, das mit den Worten beginnt: ‚Vom Abgrund nämlich haben wir angefangen…‘schreibt Hölderlin auf den oberen Blattrand:3
Die Apriorität des Individuellen über das Ganze
In der Philosophie Kants ist das a priori das, was der Erfahrung vorausgeht, aber nicht daraus abgeleitet werden kann. Im antiken aristotelischen Denken ist das a priori das Vorausgehende, dem etwas anderes folgt, z.B. Ursache und Wirkung. Die individuelle Erfahrung geht jedem Allgemeinen voraus.
In den gewaltigen Entwurf seiner Poetologie, die mit den Worten beginnt: ‚Wenn einmal der Dichter des Geistes mächtig ist‘, schreibt Hölderlin von der Seele, die allen gemein und jedem zu eigen ist:
Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist, wenn er die gemeinschaftliche Seele, die allen gemein und jedem eigen ist, gefühlt und sich zugeeignet, sie vestgehalten, sich ihrer versichert hat …. wenn er eingesehen hat, dass ein notwendiger Widerstreit entstehe zwischen der ursprünglichen Forderung des Geistes, die auf Gemeinschaft und einiges Zugleichsein aller Thiele geht, und zwischen der anderen Forderung, welche ihm gebietet, aus sich heraus zu gehen …4
Es wären sicher ein eigenes Buch und lange Studien nötig, um diesen komprimierten und schwierigen Text angemessen zu deuten und zu verstehen. Der Text, der sich über viele Seiten hinzieht, zeigt, dass Hölderlin seine Dichtung aus einer tiefen philosophischen Reflexion gestaltet, dass er aber das ihm Eigene am besten eben in der Dichtung und nicht in seiner Philosophie sagt.
Der Geist und die Seele sind All-Gemein und individuell zugleich. Auf der einen Seite besteht das Bestreben nach Innigkeit und Eins - sein, auf der anderen ist die Trennung in einzelne Individuen ein notwendiger Prozess. Jeder Mensch sehnt sich nach den Wonnen der Innigkeit. Aber selbst die innigste Verbindung, z.B. von Mutter und Kind muss sich lösen in der Vereinzelung und Trennung. Das idyllische Eins-Sein des Sees und der Schwäne im Gedicht muss notwendig in die Trennung übergehen.
Hölderlin denkt das Individuelle als das Apriori. Will der Dichter authentisch sein, muss er zuvor eine eigene, individuelle Erfahrung machen. Dann erst kann er das Ganze und das All-Gemeine gestalten. Das Individuelle ist zugleich all-gemein. Der Dichter will keine Autobiographie schreiben, er will das All-Gemeine gestalten. Im Gedicht ‚Heimkunft‘ etwa schildert er die Rückkehr von seiner Hauslehrerstelle in der Schweiz in sein schwäbisches Heimatland. Dort erwähnt er die Flüchtlinge, die ‚Landesleute‘, die nach dem Frieden von Lunéville5 aus den linksrheinischen Gebieten zurück in die Heimat kommen.
Aber wenn wir das Augenmerk nur auf die Heimkehr des Dichters und der Flüchtlinge richten, übersehen wir das Allgemeine. Alle Menschen sind auf der Heimkehr in die eigentliche Heimat, in die ungetrennte Innigkeit mit der Natur und der Welt sind. Diese Innigkeit, gestaltet Hölderlin in der ersten Strophe von ‚Hälfte des Lebens‘. Dort geht es nicht um sein persönliches Erlebnis. Es geht darum, dass wir alle uns nach dieser Innigkeit sehnen. Diese Sehnsucht ist All-Gemein.
Wir werden dem Gedicht nur dann gerecht, wenn wir in den Dialog eintreten. Es steht hier und will gelesen werden. So ist es ein Gespräch. Es braucht das Gegenüber, es spricht zu ihm und mit ihm. Dann erfahren wir nicht nur etwas über den Dichter, sondern gerade auch über uns selbst. Dazu müssen wir uns auf das Gedicht einlassen und die Saiten in uns klingen lassen, die gleich oder ähnlich gestimmt sind.
Der Dichter schreibt, weil ihn der Stoff an-spricht, in diesem Fall der See mit den Schwänen. Hölderlin hatte bei seinem Aufenthalt in Kassel auf der Flucht vor den napoleonischen Truppen zusammen mit Susette Gontard im Wilhelmshöher Schlosspark den frisch angelegten See, den die Kassler den Lac nennen, besucht und dort die Schwäne gesehen. Sicher hat er dort die innige Verbindung mit der geliebten Susette Gontard erlebt und sich selbst und Susette in den Schwänen wiedererkannt. Dieses Bild hat sich ihm tief eingeprägt und er hat es mehrfach in seiner Dichtung verwendet. Wenn wir das Gedicht lesen, sind wir unmittelbar von diesem Bild angesprochen. Und das, obwohl wir den Wilhelmshöher Lac vielleicht niemals gesehen haben oder wenn wir niemals von Hölderlins Liebe zu Susette Gontard gehört hätten. Aus dem persönlich Erlebten des Dichters wird etwas, das alle Menschen unmittelbar anspricht, es wird all - gemein. Dieses All - Gemeine spricht sich im Gedicht dem Leser oder Hörer zu. So entsteht ein Dialog zwischen dem Dichter und seinem Leser.
Der Dichter hat sein Eigenes im Gedicht geformt und der Leser seinerseits liest das Gedicht aus seiner eigenen Lebenssituation heraus. Das ist keine subjektive Interpretation, das ist der Dialog mit dem Dichter, der immer nur aus der eigenen Gestimmtheit und dem eigenen Leben heraus geführt wird.
Hölderlin hat intensiv die Dialoge Platons studiert. Nicht nur, um sie als Werke der Philosophie zur Kenntnis zu nehmen. Sie haben sein Werk tiefgreifend geprägt. Besonders wichtig war für Hölderlin das ‚Symposion‘, das Gastmahl. Er hatte die Schrift auf seinem Pult liegen und studierte intensiv für seine eigenen Werke den „Wechsel der Töne“. Auch der Name für die geliebte Diotima stammt aus dem Symposion Platons. Dort lehrt Diotima den Sokrates das Wesen des Eros.
In der ‚Friedensfeier‘6 schreibt Hölderlin:
Viel hat von Morgen an,
Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,
erfahren der Mensch.; bald sind wir aber Gesang.
Wir unterhalten uns nicht von Zeit zu Zeit im Gespräch, wir – die Menschen – SIND ein Gespräch. Wir sind, was wir sind, weil wir ein Gespräch sind. Im Gespräch sprechen die Menschen miteinander und übereinander. Selbst der Einsiedler, der sich aus der Welt zurückzieht, bleibt im Gespräch. Auch die Verweigerung ist eine Art der Gesprächsführung.
Aber sie sind ein Gespräch nur, weil sie auch hören können. Das Hörenkönnen ist die Voraussetzung für ein Gespräch. Wir müssen uns auf das Wort, das wir hören, einlassen, es zulassen und soweit wie möglich vom eigenen absehen. Beide Seiten des Gespräches werden sich im Gespräch ändern, wenn sie wirklich aufeinander hören.
Dabei besteht immer die Gefahr, dass wir uns ver-hören. Der Dichter hört auf das, was sich ihm zu-sagt, der Leser hört auf das Wort des Dichters. So ist es ganz wichtig, dass das dichterische Wort rein und ohne Fehl gesagt wird. Wählt der Dichter die falschen Worte, so ist das Gespräch, das wir sind, in der Gefahr, in eine falsche Richtung zu führen. Die Sprache ist ‚der Güter gefährlichstes‘.7
Platon schildert in seinem Dialog Ion, wie der Dichter, von einer göttlichen Kraft ergriffen, das Werk schafft. Der Rhapsode, der die Dichtung vorträgt, wird seinerseits von dieser Kraft, die nun in dem Werk geborgen ist, erfasst und überträgt die göttliche Energie auf seine Zuhörer. Das tut auch der Interpret und Ausleger der Dichtungen. Wenn der Rhapsode oder der Interpret nicht wirklich von der magnetischen Kraft erfüllt ist, sondern nur so tut, als sei er es, so bricht die ‚göttliche Kraft‘ und wird nicht übertragen. Es wird eine falsche Begeisterung erzeugt, die in die Irre führt.
Die scheinheiligen Dichter
Ihr kalten Heuchler, sprecht von den Göttern nicht!
Ihr habt Verstand! ihr glaubt nicht an Helios,
Noch an den Donnerer und Meergott;
Tot ist die Erde, wer mag ihr danken? -
Getrost ihr Götter! zieret ihr doch das Lied,
Wenn schon aus euren Namen die Seele schwand,
Und ist ein großes Wort vonnöten,
Mutter Natur! so gedenkt man deiner.
Sokrates verwendet zur Erklärung das alte Bild von eisernen Ringen, die von magnetischer Kraft zusammen gehalten werden. Der erste Ring hat Berührung mit dem ‚göttlichen Magnetismus‘. So ergriffen überträgt er diese magnetische Kraft auch auf den entferntesten Ring einer Kette. Die Kette bricht in dem Augenblick auseinander, wo der Magnet entfernt wird oder einer der Ringe nicht magnetisch ist. Das Bild der Eisenringe hatte Platon aus den Kabiren Mysterien der Insel Samothrake entlehnt.8 Die Eingeweihten der Mysterien vom mythischen Orpheus bis hin zu Alexander dem Großen trugen eiserne Ringe, die sie zu einer Einheit verbinden sollte, die von den Kabiren, den geheimnisvollen Gottheiten der Mysterien, ausging.
Der Rhapsode Ion kommt eben von einem Wettbewerb für den Heilgott Asklepios, als ihn Sokrates trifft. Die Übertragung der ‚göttlichen Kraft‘ im Gesang bewirkt eine Art von Heilung, die der Vortrag des Gesanges vermitteln soll. Darum ist es so wichtig, dass der Sänger nicht nur so tut, als sei er von der Be-Geisterung ergriffen.
Das kleine Gedicht ‚Hälfte des Lebens‘ mit seinen sinnlichen Bildern scheint naiv, aber es ist einer hohen denkerischen Reflexion entsprungen. Lange Zeit war sich Hölderlin nicht sicher, ob er seinen Lebensunterhalt als Professor für Philosophie oder als Dichter erwerben sollte. Er war aus Jena unter ungeklärten Umständen abgereist und hatte eine Stelle als Hofmeister beim Bankier Gontard in Frankfurt angenommen. Dort lernte er Susette Gontard kennen und lieben, dort arbeitete er weiter an seinem ‚Hyperion‘. An den Freund Niethammer,9 der später zusammen mit Fichte das philosophische Journal herausgab, schrieb er in einem Brief:
Ich vermisse Deinen Umgang. Du bist noch heute mein philosophischer Mentor, und Dein Rat, ich möge mich vor Abstraktionen hüten, ist mir heute so teuer, wie er mir früher war, als ich mich darein verstrickte …
In den philosophischen Briefen will ich das Prinzip finden, das mir die Trennung, in denen wir denken und existieren, erklärt, das aber auch vermögend ist, den Widerstreit verschwinden zu machen, den Widerstreit zwischen dem Subjekt und dem Objekt, zwischen unserem Selbst und der Welt, ja auch zwischen Vernunft und Offenbarung…
…ich werde meine Briefe „Neue Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen“ nennen.
Hölderlin plante ‚philosophische Briefe‘, die aber nie veröffentlicht wurden. Er will darstellen, wie die Trennung in Subjekt und Objekt, zwischen uns und der Welt aufgehoben wird in einer großen Innigkeit, in der alle Trennung verschwindet.
Die erste Strophe unseres Gedichtes zeigt diese Innigkeit in Vollkommenheit. Aber die Innigkeit kann nicht für immer bestehen. Hölderlin entwickelt in Frankfurt seine poetische Dialektik,10 nach der es ein notwendiger Prozess ist, dass die Innigkeit, wenn sie zu groß geworden ist, zerbrechen muss und die Trennung entsteht. Das ist ein Prozess, der uns in unserem Leben ständig und fortlaufend begleitet. Der Embryo muss die geborgene Innigkeit im Mutterleib verlassen. Die innige Verbindung zwischen Mutter und Säugling bricht, wenn der werdende Mensch das Gegenüber als Fremdes erkennt. Spätestens in der Pubertät erlebt jeder den Kampf, der einer notwendigen Trennung vorausgeht. Aber die Sehnsucht nach Innigkeit bleibt für immer bestehen.
In dem Brief an Niethammer erwähnt Hölderlin, dass er über die ‚ästhetische Erziehung des Menschen‘ schreiben will. Das ist eine Grundidee, die sich durch das gesamte Leben des Dichters zieht. Er will Lehrer der Menschheit sein, indem er die Menschen zu höherem ästhetischen Sinn bildet. Es ist kein Zufall, dass er diese Idee gegenüber Niethammer erwähnt, der ja zum Initiator der humanistischen Bildung in Deutschland werden sollte.
3. 2 Lehrerin der Menschheit
Die Idee der Erziehung des Menschen durch Poesie taucht schon früh in der Studienzeit Hölderlins am Tübinger Stift auf. Dort teilte er seine Studierstube mit Hegel und Schelling.
Es war seltenes geschichtliches Zusammentreffen, dass drei Geistesriesen mehrere Jahre ihre Studierstube geteilt haben. Im Oktober 1788 zieht Hölderlin zusammen mit Hegel ins Tübinger Stift ein; Schelling wird, gegen anfängliche Bedenken, im Herbst 1790 im Alter von erst 15 Jahren aufgenommen. Er bleibt fünf Jahre lang Stubengefährte Hegels und Hölderlins.
In Hegels Papieren findet sich ein Dokument in der Handschrift Hegels, das in einem schwärmerischen Ton verfasst ist, der auf Schelling deutet. Es enthält aber auch Hölderlins Idee von der Poesie als Lehrerin der Menschheit. Man kann sich vorstellen, wie die drei Zimmergenossen zusammen saßen und Pläne für den Umbau der Welt zu einem Reich Gottes schmiedeten. Das Reich Gottes im biblischen Sinne ist nicht ein jenseitiges Reich, in das die Menschen nach ihrem Tod gelangen. Es ist die reale politische Struktur eines Staates auf Erden, in dem Gott selbst oder ein direkter Stellvertreter die Regierung ausüben. Wird das Reich Gottes verwirklicht, so herrscht kein Mensch mehr über den anderen und Löwe und Rind weiden gemeinsam auf der Wiese.
Die drei Zimmergenossen hatten sich geschworen, gemeinsam das Reich Gottes auf Erden wieder zu verbreiten. Sollten sie sich aus den Augen verlieren, so wollten sie sich für immer an dem Losungswort „Reich Gottes“ wiedererkennen. In einem Brief an Hegel, den Hölderlin im Juli 1794 aus Waltershausen schrieb, wo er als Hofmeister bei Charlotte von Kalb tätig war, schrieb Hölderlin:
Lieber Bruder!
Ich bin gewiß, dass du zuweilen meiner gedachtest, seit wir mit der Losung – Reich Gottes! voneinander schieden. An dieser Losung würden wir uns nach jeder Metamorphose, wie ich glaube, wiedererkennen.
Ich bin gewiß, es mag mit Dir werden, wie es will, jenen Zug wird nie die Zeit in Dir verwischen. Ich denke, das soll auch der Fall sein mit mir. Jener Zug ist’s doch vorzüglich, was wir aneinander lieben.
Im Januar 1795 schrieb Hegel an Schelling:
Das Reich Gottes komme, und unsere Hände seien nicht müßig im Schoße!
… Vernunft und Freiheit bleiben unsere Losung und unser Vereinigungspunkt die unsichtbare Kirche.
Es ist kein Wunder, dass sich die drei mit einem biblischen Losungswort verbinden, denn das Tübinger Stift war zwar eine Bildungsanstalt für Hochbegabte, aber es war vor allem die Bildungsstätte für Theologen, die später im Land eine Pfarrstelle annehmen sollten.
In dem Papier, das heute als Systementwurf des deutschen Idealismus bezeichnet wird, spricht wohl Schelling und Hegel verfasst die Mitschrift, während Hölderlin zuhört. Es entwirft einen Gesamtplan für alle künftige Philosophie, angefangen von der Philosophie der Physik bis hin zur völligen Befreiung der Menschheit von jedem Zwang. In Anlehnung an Kant heißt es:
Die Idee der Menschheit voran will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas mechanisches ist, so wenig als es eine Idee einer Maschine gibt. Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee.
In der kantischen Philosophie ist eine Idee nicht aus der Erfahrung ableitbar, sie ist in der ‚reinen Vernunft‘ enthalten. In der Realität gibt es weder Freiheit noch Unsterblichkeit noch Gott. Dennoch bestimmen diese Ideen unser Denken und Handeln. Sie sind eine Art Leitbild, dem wir nachstreben. Die Existenz Gottes oder einer reinen Gerechtigkeit ist mit den Mitteln der reinen Vernunft nicht nachweisbar, weil sie in der überprüfbaren Realität nicht vorkommen. Aber ich bin berechtigt, seine Existenz anzunehmen. Dann wird er mein Handeln positiv beeinflussen.
Die Idee der Menschheit ist als erste Idee allem voran in der Vernunft enthalten. Menschheit ist im Sprachgebrauch der damaligen Zeit nicht die Menschheit insgesamt, es ist die Idee einer höheren Menschlichkeit, einer Humanitas. Die Humanitas existiert auch nur ansatzweise in der Realität. Sie wird immer wieder in Machtstrukturen mit Füßen getreten. Die Menschheit in diesem Sinne setzt absolute Freiheit voraus, die ein Staat nicht gewähren kann, denn die Freiheit des Einen begrenzt die eines Anderen. Im kühnen Schwung fährt der Redner des Papiers fort:
Wir müssen also auch über den Staat hinaus! – Denn jeder Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; u. das soll er nicht; also soll er aufhören. Ihr seht von selbst, daß hier all die Ideen, vom ewigen Frieden u.s.w. nur untergeordnete Ideen einer höhern Idee sind.
Die höchste Idee, die allen anderen Ideen zu Grunde liegt, ist die Idee der Menschheit. Wenn die Menschen in einer wahren Menschlichkeit angekommen sind, dann ergibt sich der ewige Frieden von allein ohne weiteres Zutun. Nicht der Friede ist die Voraussetzung der Menschheit. Wenn die Menschheit verwirklicht ist, indem alle Menschen in dieser Humanitas angekommen sind und sie selbst werden, mit sich selbst, den Anderen, der Welt und mit Gott in inniger Einheit verbunden sind, kann nur noch der ewige Frieden sein.
Dann herrscht ewige Einheit unter uns. Nimmer der verachtende Blik, nimmer das blinde Zittern des Volkes vor seinen Weisen und Priestern.
Dann erwartet uns gleiche Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unterdrückt werden, dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister! – Ein höherer
Geist vom Himmel gesandt, muß diese neue Religion unter uns stiften, sie wird das letzte, gröste Werk der Menschheit seyn.
Diese Vorstellung von der ewigen Freiheit der Menschen ohne staatliche Ordnung ohne Bevormundung durch ‚Weise und Priester‘ ist die biblische Idee vom Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es keine Herrschaft der Starken über die Schwachen, dann gibt es kein Weinen und Geschrei mehr, dann herrscht ewige Einigkeit. Beim Propheten Jesaja heißt es:11
Denn, wohlan, ich schaffe
den Himmel neu, die Erde neu,
nicht gedacht wird mehr des Früheren,
nicht steigts im Herzen mehr auf,
sondern entzückt euch, jubelt
fort und fort.
Wolf und Lamm weiden wie eins,
der Löwe frißt Häcksel wie das Rind,
und die Schlange, Staub ist nun ihr Brot;
nicht übt man mehr Böses,
nicht wirkt man Verderb
auf alle dem Berg meines Heiligtums.
Das biblische Reich Gottes ist nicht das Jenseits, auf das die Christen hoffen. Es ist der reale Gottesstaat auf Erden, konkret lokalisiert in Jerusalem. Hier herrscht kein Mensch über den anderen, weil JHWH selbst als König auf dem Thron sitzt.
Es ist immer die Frage, wie das Reich Gottes entsteht. Bei Jesajas verkündet JHWH selbst, dass er Himmel und Erde neu schaffen und sein Reich gründen wird. Aber das ist ganz offensichtlich im Laufe der Geschichte niemals eingetreten.
So denkt die jüdische Kabbala, dass es einer ungeheuren Anstrengung des Menschen bedarf, um das Reich Gottes zu verwirklichen. Im Bild denkt man, dass Himmel und Erde mit einer Kette miteinander verbunden sind. Am himmlischen Ende zieht JHWH, am irdischen muss der Mensch ziehen. Aber damit genug Kraft ausgeübt wird, müssen alle Menschen in Innigkeit miteinander verbunden gleichzeitig mit aller Kraft an der Kette ziehen. Wenn in der Utopie das eines Tages geschehen wird, dann verbinden sich Himmel und Erde und das Reich Gottes wird wirklich. Obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass einmal alle Menschen gleichzeitig an der Himmelskette ziehen, muss dennoch jeder für sich mit aller Kraft ziehen, um das Reich Gottes herbeizuholen.
Um das Reich Gottes zu verwirklichen, müssen zuvor die Menschen erzogen, gebildet werden, damit sie dieses Ideal verwirklichen können. Alle totalitären Revolutionen sehen den Menschen als viel zu unvollkommen an, um das große Ideal zu verwirklichen. Also müssen sie erzogen oder besser um-erzogen werden, notfalls mit Gewalt. Wer nicht umerzogen werden will, der ist es nicht wert, in das Reich Gottes einzutreten, man kann ihn gnadenlos beseitigen.
Auch der Sprecher des Papiers sieht dieses Problem. Die Menschen müssen gebildet werden, damit sich das Reich Gottes verwirklichen kann. Aber sie werden nicht mit Gewalt, sondern mit der Idee der Schönheit gebildet. Das Ziel, die Menschlichkeit aller Menschen zu erreichen gelingt nur mit der „Idee der Schönheit – das Wort im höheren platonischen Sinn genommen“.
Schelling bezieht sich hier sicher auf Platons Idee von der Schönheit, wie er sie im Gastmahl, dem Symposion schildert. Dieser Dialog war für die drei Freunde wohl der wichtigste Platons. Hölderlin hatte das Symposion später immer auf seinem Pult liegen, wenn er dichtete und philosophierte. Auch seine poetische Dialektik, die er später in der Frankfurter Zeit entwickelte, ist von Platons Symposion beflügelt. Sokrates berichtet, wie ihn einst die weise Seherin Diotima über den Eros belehrte. Eros ist der Trieb zu zeugen. Der Getriebene sucht aber das Schöne und nicht das Hässliche, in dem er zeugen kann. Dabei wird ihn der Eros immer höher treiben in der Lust zu zeugen bis hin zur Schau der reinen Idee. Dieser Weg von der Sehnsucht nach schönen Leibern bis hin zur Schau des Schönen an sich ist ein Stufenweg der Entwicklung hin zum Geistigen.
Menschen ohne ästhetischen Sinn sind unsere Buchstabenphilosophen. Die Philosophie des Geistes ist eine ästhetische Philosophie. Man kann nichtgeistreich seyn ohne ästhetischen Sinn. Hier soll offenbar werden, woran es eigentl. den Menschen fehlt, die keine Ideen verstehen. - und treuherzig genug gestehen, dass ihnen alles dunkel ist, sobald es über Tabellen und Register hinausgeht.
Dieser ästhetische Sinn für Schönheit, der den Buchstabenphilosophen und den Verwaltern von Tabellen und Registern abgeht, muss erst gebildet werden. Die Methode zu dieser ästhetischen Bildung zur sinnlichen Schönheit ist die Dichtung:
Die Poesie bekommt dadurch e höhere Würde, sie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war – Lehrerin der (Geschichte) Menschheit12denn es gibt keine Philosophie, keine Geschichte mehr, die Dichtkunst allein wird alle übrigen Wissenschaften und Künste überleben.
Mit diesem Anspruch, dass seine Dichtung Lehrerin der Menschheit sein soll, schreibt Hölderlin seine Gedichte. Er ist weit entfernt davon, leichte Unterhaltung für das geneigte Publikum vorzulegen. Sein Anspruch ist kein geringerer, als eben dem Volk als Lehrer der Menschheit zu dienen.
3. 3 Sinnlichkeit und Schönheit
In dem ‚Systementwurf‘ ist zugleich auch schon vorgezeichnet, wie die Poesie als Lehrerin der Menschheit beschaffen sein muss: Sie muss sinnlich‘ sein. Nicht nur die Poesie muss sinnlich sein, auch die ‚neue Religion‘ und die Philosophie.
Zur gleichen Zeit hören wir oft, der große Haufen müsse eine sinnlicheReligion haben. Nicht nur der große Hauffen, auch der Phil. bedarf ihrer. Monotheismus der Vern. u. des Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft u. der Kunst, dis ists, was wir bedürfen!
Der ästhetische Sinn, den der Philosoph der Zukunft benötigt, ist ein Sinn für Schönheit. Schönheit im griechischen Sinn, wie sie die drei Freunde denken, ist die Ästhetik. Griechische Ästhetik ist keine Lehre über ästhetische Prinzipien, nach denen ein Kunstwerk gestaltet werden muss, damit es als schön gilt. Schön ist nur, was unmittelbar sinnlich ist.
Ästhetik und Schönheit sind für die Griechen zugleich Wahrheit. Wahrheit heißt im altgriechischen Alētheia - ἀλήθεια. Die Lethe Λήθη ist ‚die Vergessen‘13, das Verbergen. Das Alpha am Wortanfang, ein Alpha privativum, bewirkt eine Verneinung oder Umkehrung des Wortes. A-letheia: Un-Verborgen, Un-Vergessen. Indem die Dinge im Licht ihres Anwesens erscheinen und sinnlich wahr-genommen werden, sind sie in ihrer UN-Verborgenheit oder Wahrheit anwesend. Sie ‚scheinen‘, das heißt, sie erscheinen so, dass man sie sehen kann.
Aber Schönheit kann auch verbergen. Schon Heraklit sagt, dass Schönheit derart den Blick bannt, dass sich das Wesentliche hinter der Schau verbergen kann. Der Mantel, mit dem in Ephesus die unscheinbare Statue der Aphrodite eingehüllt wird, bannt den Blick so sehr, dass sich das Göttliche hartnäckig entzieht. Man sieht nur noch die Außenseite, den Kosmos, den Schmuck, der den Blick bannt und von der Wahrnehmung des Eigentlichen ablenkt.
Für Platon ist wahre Schönheit nicht in der sinnlichen Wahrnehmung und in den schönen Leibern zu finden. Wahre Schönheit gibt es nur in der Schau der reinen Ideen, die aber in der realen Welt nicht zu finden sind. Aber die sinnliche Schau auf die schönen Leiber kann auf den Stufenweg der Wahrheit bis hin zur Schau des Schönen an sich führen.
Später wird für Descartes das Misstrauen gegenüber der sinnlichen Wahrnehmung zum Prinzip seiner Philosophie. Descartes hatte beobachtet, dass es Menschen gibt, die im Krieg einen Arm oder ein Bein verloren hatten, die aber dennoch Schmerzen in den verlorenen Gliedern spürten. Die Sinnlichkeit - so seine Folgerung - gaukelt uns Dinge als wirklich vor, die überhaupt nicht existieren. Durch sinnliche Wahrnehmung ist keinerlei Erkenntnis zu gewinnen! Möglicherweise ist die Wahrnehmung meiner selbst auch nur eine Sinnestäuschung. Die einzige Sicherheit des Denkens ist das Zweifeln, denn auch das Denken kann Täuschungen unterliegen. Aber wenn ich zweifele, muss da etwas sein, was zweifelt. Also muss ich existieren.
Hölderlin, der nach seiner Zeit in Jena inzwischen in Frankfurt im Hause des Bankiers Gontard Hauslehrer war, schreibt in einem Brief an Niethammer, dass er viel Zeit zu philosophischen Studien habe und dass er ausführlich Kant und Reinhold14 studiere. Aber:
Die Philosophie ist eine Tyrannin, und ich dulde ihren Zwang mehr, als dass ich mich ihm freiwillig unterwerfe. In den philosophischen Briefen will ich das Prinzip finden, das mir die Trennung, in denen wir denken und existieren erklärt … (und) den Widerstreit verschwinden … machen. Wir bedürfen dafür ästhetischen Sinn.
Die Philosophie ist eine Tyrannin, aber sie zieht Hölderlin immer wieder in den Bann. Seine Dichtung ist ohne seine philosophischen Reflexionen, die kaum wahrgenommen werden, nicht denkbar. Das ist kein Wunder, denn sie sind in einer schwierigen Sprache geschrieben, die kaum für die Öffentlichkeit gedacht war. Eher klärt Hölderlin mit seinen philosophischen Notizen seine eigenen Gedanken. Das, was er zu sagen hat, sagt er in seinen Gedichten, nicht in seinen philosophischen Texten. Aber er hat eine Neigung, sich zu sehr in abstrakten Gedanken zu verfangen. Schon Niethammer hatte ihn immer wieder davor gewarnt:
Ich vermisse Deinen Umgang. Du bist auch heute noch mein philosophischer Mentor, und Dein Rat, ich möge mich vor Abstraktionen hüten, ist mir heute so teuer, wie er mir früher war, als ich mich darein verstricken ließ, wenn ich mit mir uneins war.
Hölderlin will sich nicht in ‚Abstraktionen‘ verlieren. Seine Dichtung muss sinnlich und unmittelbar durch den Sinn für Schönheit erfassbar sein.
Das unmittelbar sinnliche Gedicht ‚Hälfte des Lebens‘ wird so zum höchsten Geist, es lehrt ‚Menschheit‘, es stellt die höchsten Ideen sinnlich dar. Jeder, der das Gedicht liest, kann es ganz unmittelbar verstehen. Und es rührt nicht nur das ästhetische Empfinden an, es will uns zu einer Verwirklichung unserer eigenen Menschlichkeit führen.
Hölderlin wollte dem Vaterland dienen. Er wollte mit seiner Dichtung Menschheit lehren. Aber die Geschichte verläuft anders. Die Französische Revolution geht im Blut der Guillotine unter. Napoleon wird der neue Kaiser und Herrscher und das Bürgertum ist dabei, sich im Biedermeier einzurichten. In tiefer Verzweiflung schreibt Hölderlin im Dezember 1801 an seinen Freund Böhlendorff15 vor seiner Abreise nach Südfrankreich einen Brief:
Und nun lebe wohl, mein Teurer! bis auf weiteres. Ich bin jetzt voll Abschieds. Ich habe lange nicht geweint. Aber es hat mich bittere Tränen gekostet, da ich mich entschloss, mein Vaterland noch jetzt zu verlassen, vielleicht auf immer. Denn was habe ich Lieberes auf der Welt? Aber sie können mich nicht brauchen!
Das Nicht-gebraucht-werden ist nicht nur Hölderlins Schicksal. Auch sein Freund Böhlendorff scheitert und irrt einige Jahre durch Deutschland, bis er sich selbst das Leben nimmt. Hölderlins Freund Sinclair stirbt jung in Wien im Bordell. Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte, starb früh und unvollendet. Ja, eine ganze Generation von jungen, hoffnungsfrohen Menschen scheitert an ihren Hoffnungen eines Neuanfangs. Die deutsche Klassik wird zur Romantik und zum Biedermeier. Überspitzt kann man wohl sagen, dass die deutschen Romantiker entweder jung sterben oder zum Katholizismus übertreten.
Die Klage über das Nicht-Gebraucht-werden ergreift unser Herz unmittelbar, weil es für jeden Menschen wichtig ist, eine Aufgabe in der Gemeinschaft zu haben. So etwa, wenn jemand ganz plötzlich seine Arbeit verliert oder in den ‚Ruhestand‘ geschickt wird, weil er nicht mehr gebraucht wird und nun keine Aufgaben mehr hat.
Im Brief an Böhlendorff klingt schon der zweite Teil von ‚Hälfte des Lebens‘ an.
Sprachlos und kalt stehen die Mauern.
Im Winde klirren die Fahnen.
3. 4 Die neue Mythologie
Im Systementwurf formuliert der Redner Schelling (?) die Idee einer neuen Mythologie.
Zuerst werde ich hier von einer Idee sprechen, die soviel ich weiß, noch in keines Menschen Si gekoen ist – wir müssen eine neue Mythologie haben, diese Mythologie aber muss im Dienste der Ideen stehen, sie mus e Mythologie der Vernunft werden.
Ehe wir die Ideen ästhetisch d.h. mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse u. umgek. ehe d. Mythol. vernünftig ist, muss sich der Philosoph ihrer schämen.
Eine neue Mythologie wird nötig, weil die alten Götter verschwunden sind. Es ist die Zeit der zunehmenden Götternacht. Die alten Götter Griechenlands sind verschollen und nur noch Ruinen künden von der einstigen Größe. Es sind nicht nur Ruinen aus Stein, auch geistige Ruinen, denn auch die alten Dichtungen und philosophischen Werke sind nur in fragmentarischen Trümmern erhalten.
In der Goethezeit wird das antike Griechenland mit seiner Kunst und seiner Mythologie als Vorbild für die Erneuerung der abendländischen Kultur gesehen. Die neuere deutsche Literatur ist immer noch von diesem griechischen Vorbild geprägt. Die ältere Literatur ist kaum noch gegenwärtig. Die Sagen aus dem Artuskreis, der Wigalois, der Parsifal oder gar der Simplizissimus sind höchstens noch dem Namen nach bekannt.
Die griechische Mythologie mit ihren Göttergestalten und Mythen und die Tragödien haben die deutsche Klassik geprägt. Die Vorstellung von der griechischen Antike war das Bild eines glückseligen Paradieses, in dem Götter und Menschen miteinander verkehrten. Oft schien es, als könne man Menschen und Götter nicht voneinander unterscheiden. Athena zeigt sich dem Telemach, dem Sohn des Odysseus in der Gestalt des väterlichen Freundes Mentor. In der Ilias trifft Diomedes auf Glaukos, der in seiner goldenen Rüstung so strahlt, dass er wie ein Gott erscheint. Diomedes fragt vorsichtshalber nach, ob ihm ein Gott gegenüber steht, denn er möchte nicht gegen Götter kämpfen.
Auch die ‚normalen‘ Sterblichen verkehren im Fest mit den Unsterblichen, wenn auch nicht leibhaftig. Ein Beispiel für dieses festliche Miteinander gibt der homerische Hymnus an den delischen Apollo.
Der Hymnus schildert ein Fest auf der Insel Delos zu Ehren von Apollo. Die Menschen strömen auf prächtig geschmückten Schiffen zur Insel. Die Zeit der Festgesandtschaft vom Schmücken der Schiffe bis zur Heimkehr vom Fest war eine Friedenszeit, ähnlich wie die Zeit der Olympischen Spiele. Niemand durfte während der Dauer der Festgesandtschaft getötet werden, auch Todesurteile wurden ausgesetzt. Daher verbrachte Sokrates nach seiner Verurteilung zum Tod durch den Schierlingsbecher noch dreißig Tage im Gefängnis, weil diese Zeit in die Festgesandtschaft fiel.
Die Menschen sind festlich gekleidet und geschmückt und versammeln sich, um der Götter in Gesang und Tanz zu gedenken.
Wer aber dort das vereinte Volk der Ionier träfe,