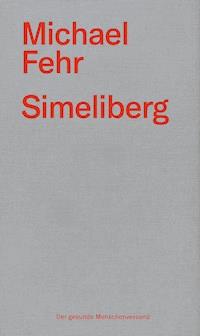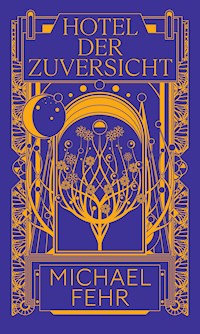
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der gesunde Menschenversand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einfacher Mann geht die Strasse entlang, kommt an einem Hotel vorbei und wird vom Pagen auf einem verworren gemusterten Teppich in ein ausserordentliches Zimmer geflogen: Willkommen im "Hotel der Zuversicht"! Hier treten sie alle auf, die Geschäftsmänner und Wissenschaftler, die Erfinderinnen, Privatdetektive und Spioninnen, der Modeschöpfer und die Gräfin, Schulkinder, Tanten und Verlobte, Hunde und Katzen, die Gutsherren, Räuber und Polizisten, der Seiltänzer, die Sängerin und die Rezeptionistin. Mit kräftigen und bildhaften Strichen skizziert Michael Fehr seine Figuren und Szenen und lädt die Leser:innen in eine Welt ein, in der andere Regeln gelten. Ob als traumhafte und magische Geschehnisse oder in beziehungsreichen Konflikten - immer beleuchten die 48 Erzählungen existenzielle Zustände des Menschseins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Michael Fehr
Hotel der Zuversicht
1. Auflage, 2022
ISBN 978-3-03853-181-4
© Der gesunde Menschenversand GmbH, Luzern
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Barbara Berger
Gestaltung: Patrick Savolainen, Affolter/Savolainen
Druck: Pustet, Regensburg
Der Verlag bedankt sich für die Unterstützung bei: Kultur Stadt Bern, SWISSLOS / Kultur Kanton Bern, Burgergemeinde Bern
Der gesunde Menschenversand wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
www.menschenversand.ch
MICHAEL FEHR HOTEL DER ZUVERSICHT
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Hotel der Zuversicht
The movement of shadows
Potremtlek Langtang
Merkur Stahl und Lorbeer Hesse
Meteorologe Lavendel Wellington
Die ganze Nacht in den Rostenharzschen Ateliers
Kleines zweistöckiges Haus
Krieg
Mantra und Mandel
Migräne
Besuch Hannibal Nagelkants bei den Grosseltern
Schwarze Kassetten
Washington-Schule für Elixiere
Pink Fuck
Die Bedrohungslage
Luthar Ginsbergs schriftstellerische Lesungen
Leuchtende Gesichter
Flug TP1105 nach Singapur
Ein Mädchen wie Honig
Der schlechteste Gitarrist der Stadt und der beste Gitarrist der Stadt
Einige Leute und etwas Gravierendes
Ums Haus herum ist still
Sarah
Ruin einer Gärtnerei
Der Stördoktor und der gerechteste Kempelzer
Der Brooklyn-Zug
Ein Mann und eine Gruppe von Kristallklötzen
Es ist der letzte Sommertag dieses Jahres
Die Torte
Frauen klauen
Qualm
Der Demonstrationszug unter dem Befehl unserer Mutter
Radon nimmt Hunde und Penelope dreht die Musik auf
Grassuppe
Auf dem Trottoir
Die Rekruten und der Räuberhäuptling
Herbert und Mefisto an den Klarinetten
Ein wissenschaftliches Experiment
Das Problem des Zoos
Die Verbringung des Schweizer Goldes durch Costalena Rauch
Die Verfolgung des verdächtigen Seiltänzers
Der hundertjährige Holzboden
Mademoiselle La Rouge
Schichtkrebse
Silberblaues Interieur eines antiquierten Palasthotels
Zwei Frauen, ein Bankvorsteher und ein Friseur
Die Verlobte
Ein übergrosser Tropfen Wasser
HOTEL DER ZUVERSICHT
Einem einfachen Mann, der nur die Strasse entlanggehen will, wird, als er an einem Hoteleingang vorbeikommt, vom Pagen, der in einer etwas überzeichneten Lässigkeit am Eingang auf einem verworren gemusterten Teppich herumsteht, versichert, dass man für ihn ein ausserordentliches Zimmer gebucht und die Rechnung bereits im Voraus beglichen habe. Der einfache Mann bleibt stehen. Der Page trägt eine enge rote Samtjacke und eine Pluderhose aus schwarzer Seide.
Der einfache Mann: «Meinen Sie mich?» Der Page: «So wahr ich auf diesem Teppich stehe. Ich kann Sie hinfliegen. Steigen Sie auf.» Der einfache Mann betritt den Teppich. Der Page: «Nun legen Sie sich auf den Rücken.» Der einfache Mann tut wie geheissen. Der Page legt sich neben ihn auf den Rücken. Schon flattert der Teppich und schwingt sich in die Luft.
Der einfache Mann denkt sich noch, dass er immer glaubte zu wissen, dass man auf einem fliegenden Teppich sitzt, nicht liegt. Dann aber vergisst er den Gedanken, weil er sich rückhaltlos mit der Frage beschäftigt findet, wie es ihm denn in aller Welt gelingen sollte, auf dem Rücken liegend nicht vom Teppich zu fallen und zu Tode stürzen zu müssen.
Der Teppich bewegt sich fürchterlich schnell und wie eine einzige flache, glatte Lebendigkeit. Der Page hebt immer wieder den Kopf, um auf dem Rücken liegend über den Teppichrand hinaussehen und sich in der Stadt orientieren zu können. Der Page: «Blöd aber auch, ich habe vergessen, wo sich Ihr Zimmer befindet.»
Der einfache Mann hat einfach nur Angst und versucht sich auf dem Rücken liegend mit den Fingern beider Hände in den Borsten des Teppichs zu verkrallen, der sich bewegt wie eine gesengte Sau, und hört nicht hin. Der Page: «Zum Glück, jetzt weiss ich es wieder.»
Und plötzlich steht der Teppich senkrecht in der Luft und gibt den Blick frei auf die Stadt, die aus der Luft besehen dieselben Farben, dieselben Muster und dieselbe Struktur wie der Teppich zu haben scheint.
Dann sticht der Teppich wie ein Raubvogel hinab. Der einfache Mann glaubt fest daran, in seinen schnellen Tod zu rasen. Da findet er sich vom Teppich geworfen auf glasiert hellblauem Mosaikboden wieder. Er steht auf, steht auf dem blauen Mosaikboden.
Das Zimmer um ihn herum besteht lediglich aus filigranen Mauerbögen und einem Kuppeldach. Nicht mehr so spektakulär wie vorhin im Fluge, aber er hat dennoch Blick über die gemusterte Stadt. Er sieht den Teppich mit dem Pagen davonfliegen.
Der einfache Mann wüsste nicht, auf welche Weise er das Zimmer allein wieder verlassen könnte, geschweige denn, welche Dauer man für seinen Verbleib hier vorgesehen hat. Aber der blaue Boden verströmt eine solche Zuversicht, dass er nicht anders kann, als sich dieser hinzugeben und sich wieder hinzulegen.
Schon geht sein Atem ruhig.
Schon ist er eingeschlafen.
THE MOVEMENT OF SHADOWS
Auf einem kleinen Schloss wohnt ein erwachsener Sohn immer noch bei seiner Mutter. Im Erdgeschoss befinden sich ein einziger Saal, dessen Wände über und über mit kurzen, bis hin zu beachtlich langen Orgelpfeifen verkleidet sind, angrenzend eine kleine Kammer, ausgestattet mit der Technik zur Bedienung der Orgel, und auf der anderen Seite eine kleine, rustikale und blitzblanke Küche. Im Obergeschoss, welches wegen der höchsten Orgelpfeifen in einiger Höhe über dem Erdgeschoss angelegt ist, kommen einige weitere kleine Kammern hinzu. Damit hat es sich dann aber auch, grösser ist das Schloss nicht.
Im Erdgeschoss in der Kammer mit der Ausrüstung zur Bedienung der Orgel sitzt der Sohn zusammengekrümmt und mit hängenden Schultern so trübselig an der Orgeltastatur, dass sein Kopf nur wenig über den auf der Tastatur herumdrückenden Fingern hängt. Er studiert herum und probiert herum, singt dazu. Die Tür ist geschlossen. In der Kammer klingt die Orgel zwar immer noch voll und wuchtig. Gegenüber dem Dröhnen und Brausen der schrillen bis hin zu dumpfen und erschütternden Orgelpfeifen nebenan im Saal verhält es sich mit dem Klang der Orgel in der Kammer aber so, dass die eigene Singstimme immerhin nicht vollkommen vom begleitenden Orgelspiel zugedröhnt und weggefegt wird.
Der Sohn drückt die Tasten und singt:
«This is the movement of shadows I’m feeling.»
Es ist ein wirklich einfühlsames Lied, an dem er arbeitet, aber es will ihm einfach nicht bis zum Ende einfallen. Der Schluss fällt ihm nicht ein, obwohl doch zu einem guten Lied ein verdammt guter Schluss gehört. Er haut mit der einen Hand zweimal auf die Tastatur. Die Orgel antwortet, indem sie zweimal knurrt.
Der Sohn springt von seinem Schemel auf, reisst die Tür auf, rennt im Saal zum Kamin, der in gewissem Abstand von der Wand entfernt gebaut ist, mit einem freistehenden, säulenartigen Schlot, was nötig ist, da die Wände ja besetzt sind von den Orgelpfeifen, reisst ein halb verkohltes Scheit aus dem Kamin, rennt den Wänden entlang und lässt dabei das Holzscheit in der ausgestreckten Hand die Säulen der Orgelpfeifen entlangrattern und ruft dazu:
«Verflucht, verdammt, verreckt!»
Da betritt auf einmal die Mutter den Saal:
«Was ist denn in dich gefahren?»
Der Sohn hält inne, schmeisst das Holzstück auf den Boden:
«Nichts, mir fällt nichts ein, ich bin schlecht.»
Die Mutter geht in die Küche:
«Folge mir!»
Der Sohn folgt.
In der Küche füllt die Mutter zwei bauchige Kristallgläser randvoll mit Burgunderwein.
«Wir nehmen einen Schluck Burgunder. Wir müssen ein ernstes Gespräch führen.»
Die Mutter reicht dem Sohn ein Glas. Beide trinken.
Der Sohn: «Was für ein Gespräch?»
Die Mutter: «So kann ich nicht schreiben.»
Der Sohn: «Was willst du denn schreiben?»
Die Mutter bringt einige Seiten Papier zum Vorschein:
«Da.»
Der Sohn betrachtet die Seiten, klemmt die Augen zusammen, macht ein verdutztes Gesicht.
«Das kann ich nicht lesen. Wer soll das denn lesen können, die Schrift ist unleserlich krakelig und zittrig.»
Der Sohn gibt die Seiten zurück und betrachtet die Mutter etwas eingehender.
«Und was fällt dir eigentlich ein, seit Tagen mit kohlenschwarzem Gesicht herumzulaufen?»
Die Mutter nimmt einen Schluck Burgunder, stellt das Glas ab, fährt mit dem Zeigefinger über die Stirn, zeigt dem Sohn die kohlenschwarze Fingerkuppe.
«Ich beschäftige mich damit, Briefe zu schreiben, und zwar von Hand. Ich will im Obergeschoss in meiner Kammer Briefe von Hand schreiben, und wenn ich sage von Hand, dann meine ich von Hand. Ich will poetische Briefe mit diesem meinem eigensten Finger verfassen. Wenn aber im Erdgeschoss unablässig die Orgel dröhnt und faucht und rasselt, versetzt die Bestie mein armes, liebes, eigenes Kämmerlein im Obergeschoss meines eigenen Schlosses ins Zittern und ich zittere auf meinem lieben Stuhl und der Tisch zittert und das Papier zittert und die Folge davon ist, dass meine Briefe ganz und gar unleserlich geraten. Aber ich will von den Holzscheiten im Kamin die verkohlten Enden abbrechen und zerbröseln und in die Hände spucken und mir mit Spucke und Kohle das Gesicht schwärzen. Oben an meinem lieben Tisch lecke ich den Zeigefinger ab und schwärze ihn an meinem schwarzen Gesicht und schreibe Briefe. Ich bin nicht länger bereit, dein Orgelspiel hinzunehmen, es schadet meinen Bedürfnissen und meinem Vorhaben.»
Der Sohn: «Aber bisher störte es dich doch nie. Wenn dich mein Orgelspiel stört, dann stört mich vielleicht auch dein schwarzes Gesicht.»
Die Mutter: «Wie kommst du dazu, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Mein Gesicht ist doch gar nicht zu sehen, während die Orgel aber im ganzen armen Schloss rauscht.»
Der Sohn: «Aber ich sehe doch dein Gesicht, wie du hier vor mir stehst.»
Die Mutter: «Aber ich sehe es nicht, und es ist mein Gesicht und ich will es geschwärzt haben und von Hand Briefe schreiben, und ich nehme deinen Radau nicht länger hin. Ich schliesse die Kammer mit der Orgeltechnik ab und von heute an wirst du nicht mehr Orgel, sondern Flügel spielen.»
Die Mutter nimmt einen Schluck Burgunder, rauscht dann aus der Küche durch den Saal, schliesst auf der anderen Seite die Tür und schliesst sie mit dem dazugehörigen Schlüssel zweimal ab und zieht den Schlüssel ab.
Da geht in der Küche quietschend ein Gewinsel los. Der Sohn kommt erniedrigt aus der Küche in den Saal gekrochen. Jedes Vorwärtskommen bereitet ihm unendliche, trauernde Mühe.
«Aber ich will nicht Flügel spielen, bitte lass mich niemals auf dem Flügel spielen. Es tut weh, es tut mir so grauenhaft weh, wie du mich demütigst.»
Der Sohn weint untröstlich und kriecht im Saal herum.
«Ich will einfach nicht auf dem Flügel spielen, er ist böse und klingt wie die Missgeburt einer Orgel.»
Die Mutter geht zum Kamin, geht in die Knie, greift hinein, zerbröselt verkohlte Holzstücke, spuckt in die Hände und schmiert sich kohlrabenschwarz das Gesicht ein.
«So ist es recht. Das dürfte eine schaurige Schwärze ergeben, gleich werde ich nach oben gehen und etwas wunderbares Briefliches aufschreiben.»
Der Sohn: «Liebe Mutter, es ist schlimm.»
Die Mutter: «Mach Schluss mit dem Gewinsel, ich habe dir diesen tollen Flügel installieren lassen.»
In der Mitte des Saals steht ein schwarzer Flügel fast gänzlich zugedeckt von einem alten, abgewetzten, burgunderfarbenen Bühnenvorhang, und auf dem in seiner ganzen Schwere über den Flügel drapierten Vorhang stehen Kerzenleuchter, so dass sich der Flügel fliessend in das Bild des Saals integriert und gar nicht auffällt, obwohl er ziemlich genau in der Mitte steht.
Die Mutter zündet die Kerzen an und setzt sich an den Flügel.
Der Sohn liegt kraftlos und ermattet irgendwo im Saal am Boden.
Die Mutter beginnt zu spielen.
«Es ist ein grossartiges Lied, an dem du arbeitest. Du brauchst nur noch einen echt guten Schluss.»
Die Mutter spielt und singt:
«This is the movement of shadows I’m feeling.»
Die Mutter spielt die Begleitung der Melodie einfühlsam auf dem Flügel und dazu macht sie wahnsinnig gute klangliche Verzierungen in den perlenden, hohen Tonlagen des Flügels und am Ende spielt sie auch noch einen verflucht guten Schluss – genau den Schluss, den sich der Sohn vorgestellt hat, der ihm aber nicht einfallen wollte. Der Sohn merkt auf. Dass sein eigenes Lied so unerwartet zu einem so grossartigen Schluss kommt, belebt ihn in seiner Hingabe an die Trauer und Mutlosigkeit dermassen, dass er aufsteht.
Der Sohn: «Lassen wir es gut sein. Lass mich auf dem Flügel spielen, dann spiele ich eben Flügel.»
Die Mutter: «Siehst du, es ist doch gar nicht so schlimm.»
Zufrieden und mit einem ganz nach ihren Bedürfnissen tiefgeschwärzten Gesicht verlässt sie den Saal.
Der Sohn setzt sich an den Flügel, spielt und singt:
«This is the movement of shadows I’m feeling.»
POTREMTLEK LANGTANG
Als der Geschäftsmann Potremtlek Langtang in seinem Haus unvermittelt stirbt, hinterlässt er sein Geschäft mit dem klingenden Namen «Langtang Investitionen International» und seine drei Rassewachhunde.
Die drei Hunde bugsieren den Leichnam ihres ehemaligen Ernährers zur Kellertür, öffnen die Tür, werfen den Leichnam die Kellerstiege hinab, schliessen die Tür und verschwenden keinen weiteren Gedanken daran. Mögen im Keller die Ratten den Leichnam holen.
Die Rassewachhunde übernehmen das Geschäft. Sämtliche Investitionen werden per Computer getätigt und sämtliche Benefits per Computer eingeheimst. Die Hunde müssen nur sorgfältig verhindern, dass sie sich jemals in die Bedrängnis bringen, dass sie jemanden persönlich treffen oder ein Telefongespräch führen müssten.
Die Hunde lassen sich raue Mengen rohes Fleisch an die Haustür liefern, das sie nachts hereinzerren und über das sie sich dann hermachen, wenn sie die Lust überkommt.
Die abgenagten Knochen verteilen sie im Haus, weniger interessante Exemplare werfen sie die Kellerstiege hinab, denn das haben sie sich gemerkt, dass sich auf diesem Weg Dinge bis auf Weiteres von der Bildfläche zum Verschwinden bringen lassen.
MERKUR STAHL UND LORBEER HESSE
Zwei einstige Freunde, Merkur Stahl und Lorbeer Hesse, der erste ein gewaltiger Mann, der zweite ein eher schäbigerer, schrillerer, allerdings auch eigentümlich präzise wirkender Mann, haben sich mit der Zeit aus den Augen verloren, erkennen sich aber sofort wieder, als sie sich vor der Brasserie über den Weg laufen, in der sie sich einst regelmässig zusammen mit anderen Freunden zu einer Tischrunde trafen, um französische Schinkenbrote zu essen und belgisches Bier zu trinken.
«Was für ein Zufall! Kann es denn wahr sein? Lorbeer! Mein Freund!» «Merkur! Was für eine Freude! Was für ein Zufall! Dass wir uns gerade hier über den Weg laufen! Unmöglich.»
Die Freunde umarmen sich und klopfen sich auf die Schultern.
«Nun bleibt uns fast nichts anderes übrig, als auf ein Bier hineinzugehen. Sag, hast du Zeit?» «Aber selbstverständlich, ich habe gerade überhaupt nichts anderes zu tun.» «Dann lass uns schleunigst hineingehen, lass uns sehen, ob es unseren Tisch noch gibt.»
Merkur und Lorbeer betreten die Brasserie. Drinnen gibt es viel abgenutztes, aber sauber gehaltenes Holz, einige Spiegel an den Wänden und natürlich kann man durch die grosszügigen Fenster das Treiben draussen auf der Strasse betrachten. Den Tisch, an dem sich die Freunde einst zusammenzufinden pflegten, gibt es noch und er ist frei. Merkur macht eine Handbewegung, die aussieht, als würde er dem Tisch zuwinken.
«Setzen wir uns an unseren Tisch.»
Sie setzen sich. Lorbeer streicht mit der Hand über die saubere Tischplatte. Ein gutes Gefühl. Er kann es nicht lassen und klopft Merkur noch einmal anerkennend auf die Schulter.
«Ich vergass mit der Zeit ganz, was für ein unzimperlicher Mensch du bist, wirklich bemerkenswert gewaltig.» «Ja, manche Dinge ändern sich nicht, wie du siehst. Sag, wollen wir lieber Tee als Bier trinken?» «Warum Tee, ich will lieber Bier.» «Ganz wie früher, lass uns Bier bestellen.»
Merkur ruft durch die Brasserie: «Zwei belgische Biere an unseren Tisch, bitte, und zwei französische Schinkenbrote.»
«Wie geht es dir, Merkur?» «Gut, danke, es geht mir gut. Ich kann nichts anderes sagen, es geht mir gut, aber wie geht es dir?» «Sehr gut, danke, ich bin mittlerweile Konstrukteur, und ich darf dazu sagen, ein herausragender Konstrukteur. In manchen Betätigungsfeldern gelte ich als Mass der Dinge.» «Nein, wirklich wahr?» «Doch, es stimmt.» «Kannst du mir ein Beispiel geben, damit ich mir etwas darunter vorstellen kann?» «Beispielsweise meine neuste Konstruktion ist eine Bombe.» «Ja, das glaube ich dir, aber was ist es denn?» «Nein, ich meine es nicht sinnbildlich, ich meine, es ist wirklich eine Bombe.» «Nein, das ist ja verheerend.» «Aber nein, du brauchst kein schlimmes Gesicht zu machen, es ist nicht schlimm. Hör zu, es ist eine formidable Bombe. Du musst dir vorstellen, es gibt das Problem, dass etwas im Meer versinkt, ein in Brand geratenes Boot beispielsweise oder ein in Brand geratenes Flugzeug.»
Bier und Schinkenbrote werden auf den Tisch gestellt. Die Freunde nehmen einen Schluck Bier. Lorbeer ergreift sein Schinkenbrot zur Veranschaulichung. Er bewegt das Schinkenbrot an der Tischkante vorbei nach unten, so dass es für Merkur auf der anderen Seite vom Tisch aussieht, als würde das längliche Brot in Not geraten versinken.
«Ein Boot oder ein Flugzeug versinkt im Meer, das Boot sinkt oder das Flugzeug, nun befindet sich aber meine besondere Bombe an Bord.»
Lorbeer legt das Brot auf den Teller zurück und zeigt mit spitzen Fingern, wie von allen Seiten das Wasser mit voller Kraft gegen den Rumpf drückt und eindringt.
«Das Wasser dringt von allen Seiten ein. Nun muss sich die gesamte Besatzung einfach möglichst nahe an der Bombe einfinden, ganz im Unterschied zu gewöhnlichen Bomben. Bei meiner Rettungsbombe müssen sich alle möglichst nahe an der Bombe zusammenkauern. Das Wasser dringt ein.»
Nun behilft sich Lorbeer mit ein wenig Bier. Er kippt ein wenig Bier über das Brot, das Bier schäumt und rinnt über das Brot. Merkur schaut mit grossen Augen zu.
«Nun wird die Bombe zur allerseitigen Rettung gezündet, und was passiert?» «Ich weiss nicht, es ist deine Bombe.» «Ja, es ist eben meine ganz besondere Bombe, die Hesserettungsbombe. Die Bombe wird gezündet und hat so viel Kraft, dass sie ganz einfach das bedrohliche Wasser nach allen Seiten wegdrückt. Deshalb muss die Besatzung warten, bis sie im bedrohten Rumpf auf Grund läuft, denn sobald die Bombe sämtliches Wasser im Umkreis mit voller Kraft verdrängt, wird der Raum von einfacher Luft eingenommen.»
Lorbeer nimmt das Brot, schiebt es über die Tischkante. Es fällt zu Boden.
«Der bedrohte Rumpf würde fallen, bis er am Meeresgrund aufschlagen würde. Das wäre gefährlich, deswegen muss die Besatzung warten, bis sie auf Grund läuft, bevor die Bombe gezündet wird. Wird sie gezündet, verdrängt sie also das Wasser, die Besatzung kann aussteigen, und wenn nun von oben beispielsweise aus Hubschraubern Seile in die Tiefe gelassen werden, kann sich die Besatzung ganz einfach retten, indem sie an den Seilen hinaufklettert. Dann werden die Seile eingezogen, die Hubschrauber gewinnen Höhe, die Kraft der Bombe ist verbraucht. Mit voller Kraft schlägt das Meer zurück, erobert sich seinen Raum zurück. Wassermassen schlagen aufeinander, Gischt spritzt hoch hinaus.» «Unglaublich, unmöglich.»
Lorbeer hebt sein Brot vom Boden auf und beisst hinein.
«Doch, es ist zwar ungewöhnlich, aber möglich mit den modernen Erkenntnissen der Konstruktionsbranche und mit einem schnellen Kopf.»
Lorbeer kaut mit langsamer, runder, malmender Kieferbewegung und tippt sich mit einem Finger an die Schläfe. Merkur beisst in sein Schinkenbrot. Kaum ist der Bissen im Mund, ist er auch schon verschluckt.
«Ich muss einen Schluck Bier nehmen, unglaublich.» «Ja, und ausserdem habe ich eine wahnsinnig biegsame Leiter konstruiert.» «Wozu?» «Stell dir vor, wir würden alle zusammensitzen in unserer früheren Tischrunde, genau an diesem Tisch, und ich würde die Geschichte meiner Bombe erzählen und alle Freunde könnten die Geschichte kaum glauben und würden dasitzen mit grossen Augen, weiten Nasenlöchern und offenen Mündern, und ich wäre umgekehrt so fasziniert vom Kreis der offenen Münder, in die ich hineinsehen könnte, bis nach hinten zum Gaumen und den Rachen hinab, dass ich nicht mehr an mich halten könnte. Ich würde über den Tisch kriechen und einem unserer Freunde in den Mund hinein, um weiter hinab in den Rachen sehen zu können, um zu sehen, wohin der Rachen führt und was es noch weiter unten zu sehen gäbe. Ich wäre so fasziniert, dass ich meine eigene Sicherheit ausser Acht lassen würde. In der Feuchtigkeit der Mundhöhle würde ich ausrutschen und in den Rachen hinabfallen, ich würde feststecken und könnte mich von allein nicht mehr befreien. Nun bräuchte nur jemand anderes von unseren Freunden meine besonders flexible Hesseleiter dem Freund in den offenen Mund zu schieben, in dessen Schlund ich verschwunden wäre. Die Leiter würde sich hinten am Rachen gemäss ihrer besonderen Biegsamkeit nach unten in den Rachen verbiegen und mir entgegenkommen. Ich könnte die unterste Sprosse ergreifen, mich daran hochziehen und dann Sprosse für Sprosse aus dem Rachen in die Mundhöhle emporsteigen und am Ende gesund und munter aus dem Mund unseres Freundes wieder herausspringen.»
Merkur kann es nicht lassen und klopft dem alten Freund so schwungvoll auf die Schulter, dass es diesen schüttelt.
Und Merkur ruft durch die Brasserie: «Mein alter Freund Lorbeer Hesse und ich benötigen bitte zwei weitere Schinkenbrote und zwei Biere an unseren Tisch. Wir haben unglaubliche Dinge zu besprechen.»
Und bis Bier und Brote an den Tisch gestellt werden, lässt Merkur Stahl nicht mehr davon ab, Lorbeer Hesse auf die Schulter zu klopfen.
METEOROLOGE LAVENDEL WELLINGTON
Eine Schulklasse besucht im ewigen Schnee und Eis den Meteorologen Lavendel Wellington. Die Schulkinder tragen weisse Fellmäntel mit Kapuzen. Auch der Lehrer trägt einen weissen Fellmantel mit Kapuze. Das Wetter ist glücklicherweise weiss wie Schnee und Eis. Aber es schneit nicht, so dass die Klasse weithin die Landschaft betrachten kann. Vor dem lavendelfarbenen Zelt des Meteorologen wartet die Schulklasse auf das Erscheinen Lavendel Wellingtons.
Wellington tritt in lavendelfarbener Plastikkleidung aus dem durch mehrere Überlappungen des Zeltmaterials gut verschlossenen Zelteingang hervor, aus dem er sich gewissermassen herausschälen muss um herauszukommen. In der Hand hält er mit festem Griff einen lavendelfarbenen Plastiksack, den er vor der Schulklasse auskippt. Kleine Konfitüregläser mit entsprechend kleinen Metalldeckeln kullern heraus.
Lavendel Wellington: «Willkommen, liebe Schulkinder.»
Die Schulkinder: «Guten Tag, Meteorologe Wellington, danke Ihnen, dass wir Sie besuchen dürfen. Wir sind sehr neugierig.»