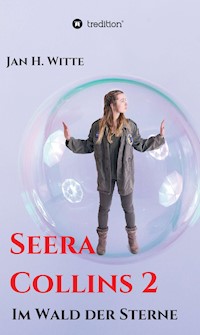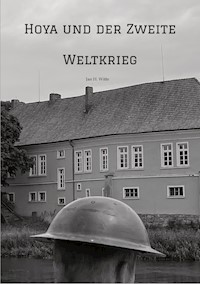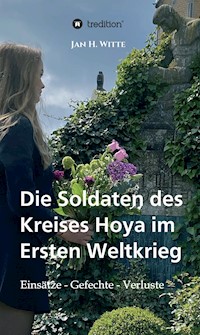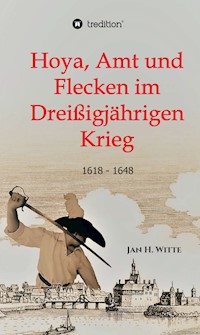
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mord und Totschlag, Plünderung und Pest, das ist die landläufige Charakteristik des Dreißigjährigen Krieges. Doch wie wirkte sich das Kriegsgeschehen zwischen Martfeld und Schweringen, zwischen Eystrup und Asendorf im Detail aus? Wie kam der Krieg an die Weser und wer kämpfte hier eigentlich wann gegen wen? Was lässt sich nach Ablauf von vier Jahrhunderten noch zu den Geschehnissen in Hoya und Umgebung herausfinden? Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Fragen findet sich in den im Niedersächsischen Landesarchiv erhaltenen Akten und Urkunden. Der dort verwahrte Schriftwechsel eröffnet einen durchaus spannenden Blick auf Akteure und Geschehnisse, die längst dem Vergessen anheimgefallen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für Christa - ohne die sich Hoyas Geschichte niemals wird erzählen lassen.
Jan H. Witte
Hoya, Amt und Flecken im Dreißigjährigen Krieg
1618 - 1648
© 2019 Jan H. Witte
Autor: Jan H. Witte
Umschlaggestaltung, Illustration: Julius F. Witte und Jaqueline Schwania
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
978-3-7497-7652-8 (Paperback)
978-3-7497-7653-5 (Hardcover)
978-3-7497-7654-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
Für Stadt und Amt Hoya ist bislang weder eine Chronik vorhanden, noch liegt eine zusammenfassende Übersicht zum Geschehen im Dreißigjährigen Krieg vor. Die ausgezeichnete Darstellung in der Chronik Schweringens (1989) lässt die Geschehnisse im übrigen Amtsgebiet notwendig unbeleuchtet. Anlässlich der vierhundertjährigen Wiederkehr des Kriegsausbruchs - und des vierhundertjährigen Jubiläums des aus dem Jahre 1621 belegten hoyaer Bürgerschießens - bietet es sich daher an, eine Gesamtbetrachtung der Regionalgeschichte für den Zeitraum von 1618 bis 1648 zu entwerfen.
Die für diesen Zweck herangezogenen Archivalien weisen sowohl einen erheblichen Umfang wie auch einen unerwarteten Detailreichtum auf. Das Archivgut besteht vor allem aus den Beständen des Niedersächsischen Landesarchivs in Hannover (NLA HA). Diese Schriftstücke, die ursprünglich in der damals für Hoya zuständigen herzoglichen Kanzlei in Celle empfangen bzw. gefertigt und aufbewahrt wurden, sind zwar oftmals nur noch unvollständig vorhanden, teilweise beschädigt und generell nur mühsam zu entziffern. Dennoch stellen sie aber – da die eigene Registratur in Hoya durch Krieg und Brand verloren ging – die einzige ergiebige Geschichtsquelle dar. Der Verfasser hat allerdings aufgrund der Fülle des Materials nur die im Quellenverzeichnis angegebenen Akten (die aufgrund ihrer Aktentitel einen Bezug zu Hoya ergeben) ausgewertet, so dass sich aus anderen Archivalien durchaus noch weitere Details zum hier verfolgten Thema ergeben dürften.
Um die hier aus Literatur und Quellen zusammengestellten Informationen besser in den Verwaltungskontext des frühen siebzehnten Jahrhunderts einzuordnen, ist der eigentlichen chronologischen Darstellung der örtlichen Geschehnisse ein knapper Abriss der lokalen Herrschafts- und Amtsstruktur sowie der wichtigsten damals handelnden Personen vorangestellt.
Hoya, im November 2019
Dr. Jan H. Witte
Inhaltsverzeichnis
A. Territorium und Verwaltungsstruktur
1. Territoriale Zugehörigkeit des Amtes Hoya
2. Verwaltungsstruktur in Flecken und Amt
a) Der Flecken Hoya
b) Das Amt Hoya
3. Regierende Fürsten
B. Der Böhmisch-Pfälzische Krieg
1. Die Lageentwicklung bis Ende 1622
2. Mobilmachung, Dezember 1622
3. Verstärkung im Anmarsch, Januar 1623
4. Bruchhausen geht verloren
5. Das Amt Hoya wird besetzt
6. Lüneburg-Cellesche Armeestruktur
7. Besetzung durch Kaiserliche, Herbst 1623
8. Neue Besetzung durch Kaiserliche, 1624
9. Die Besatzung zieht ab, Januar 1625
C. Der Dänisch-Niedersächsische Krieg
1. Auftakt der zweiten Kriegsphase
2. Die Dänen kommen, Juni 1625
3. Das Wüten der Pest, Dezember 1625
4. Einnahme Hoyas durch kaiserliche Truppen, September 1626
5. Rückeroberung Hoyas durch die Dänen, November 1626
6. Herzog Georg kommt, November 1626
7. Dänische Raubzüge, Mai 1627
D. Der Niedersächsisch-Schwedische Krieg
1. Hoya unter kaiserlicher Besatzung
2. Hoyas verlorene Kostbarkeiten
3. Beschwerden gegen den neuen Amtmann
4. Zuständigkeitsstreit
5. Die Schweden kommen, Juni 1630
6. Hoya unter schwedischer Besatzung
7. Ersuchen um Abgabenstundungen
8. Unstimmigkeiten zwischen Celle und Stockholm
E. Der Schwedisch-Französische Krieg
1. Kaiserliche und schwedische Einfälle
2. Hoyaer Widersetzlichkeiten, März 1637
3. Der Kontributionsstreit, April 1637
4. Durchzug fremder Völker, Juli 1637
5. Die weitere Befestigung des Schlosses, 1638
6. Die Grafschaft wird „excarnifiziert“, 1640
7. Neuer Kontributionsstreit, 1641
8. Wie die Schafe ohne Hirten, 1642
9. Untersuchungen gegen den Amtmann, 1644
10. Das Kriegsende, 1648
11. Die Amtsvisitation von 1653
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
A. Territorium und Verwaltungsstruktur
1. Territoriale Zugehörigkeit des Amtes Hoya
Nach dem Ableben des letzten Grafen von Hoya, Otto VIII., fiel die Grafschaft Hoya 1582 als sogenanntes „eröffnetes Lehen“ weitgehend (einige Landesteile gingen auch an Hessen) an die „welfischen“ Herzöge zu Braunschweig-Lüneburg. Das Territorium der Grafschaft Hoya wurde dabei verwaltungstechnisch aufgesplittert, da das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg durch vielerlei Erbteilungen ebenfalls in mehrere staatsrechtlich voneinander unabhängige – aber weiterhin miteinander verwandte – Fürstentümer zerfallen war, von denen jedes einen Teil der Grafschaft Hoya erhielt. Diese „Teilherzogtümer“ (deren regierende Fürsten sich aber sämtlich stets als „Herzog zu Braunschweig-Lüneburg“ bezeichneten) bestanden im hier interessierenden Zeitraum aus dem Fürstentum Lüneburg-Celle (mit der Residenz in Celle und den größeren Städten Lüneburg, Winsen, Uelzen und Gifhorn), dem Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel (mit dem Regierungssitz in Wolfenbüttel und den Städten Braunschweig und Helmstedt), dem Fürstentum Calenberg (zu welchem die Festung Hameln gehörte und dessen Residenz zunächst das Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge, dann ab 1634 die Stadt Hannover war) und dem Fürstentum Göttingen-Grubenhagen (mit den Städten Einbeck, Osterode, Herzberg, Northeim, Münden und Göttingen). Bei Kriegsbeginn 1618 handelte es sich faktisch allerdings nur um zwei welfische Fürstentümer, nämlich Lüneburg-Celle und Braunschweig-Wolfenbüttel, da Calenberg und Göttingen-Grubenhagen durch erneute Erbfolgen zu dieser Zeit gemeinsam von Wolfenbüttel aus regiert wurden. Erst im weiteren Laufe des Krieges „zerfiel“ dieses letztgenannte Fürstentum erneut in Braunschweig-Wolfenbüttel einerseits und Calenberg (mit Göttingen und Grubenhagen) andererseits.
Die großen und gut befestigten (Hanse-)Städte Braunschweig, Hannover und Lüneburg waren zwar in staatsrechtlicher Hinsicht unselbständige „Landstädte“ und damit Teil des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg. Rein faktisch agierten die Städte aufgrund ihrer militärischen und wirtschaftlichen Stärke aber ganz unabhängig von der Politik des jeweiligen Fürsten (weshalb diese ihre Residenzschlösser auch nur in den kleineren Städten wie Celle, Wolfenbüttel oder Neustadt errichten konnten). Die Städte gerieten auch regelmäßig in diverse Konflikte mit „ihren“ Fürsten, die, wie etwa im Jahre 1605 zwischen der Stadt Braunschweig und ihrem Landesherren in Wolfenbüttel, zu offenem Krieg führen konnten.1 Im Dreißigjährigen Krieg gelang es zumindest Braunschweig und Hannover (ebenso wie der Stadt Bremen) auch jeglichen Eroberungsversuch der wechselnden Kriegsparteien abzuwehren.
Die Niedergrafschaft Hoya mit den Ämtern Hoya, Alt- und Neu-Bruchhausen, Liebenau und Nienburg kam aufgrund des Rezesses vom 10. August 15832 (mit dem sich die welfischen Fürsten und andere Anspruchsteller über die Teilung der Grafschaft Hoya einigten) an das Fürstentum Lüneburg-Celle.3 Damit wurden diese fünf Ämter hinfort von Celle aus regiert.
Die obere Grafschaft mit den Ämtern Diepenau, Ehrenburg, Bahrenburg, Harpstedt, Siedenburg, Steyerberg, Stolzenau und Syke fiel dagegen zunächst an die calenbergischwolfenbüttelsche Linie und 1584 an die wolfenbüttelsche Linie allein. Durch die Teilung der Besitzungen der 1634 ausgestorbenen wolfenbüttelschen Linie fiel die obere Grafschaft dann 1635 an Herzog Wilhelm von Harburg (einem Teilfürstentum des Fürstentums Lüneburg-Celle) und nach dessen Tod 1642 an Herzog Friedrich IV. von Lüneburg-Celle (womit die gesamte Grafschaft Hoya wieder in einer Hand vereinigt war). Als dieser 1648 starb, ward die obere Grafschaft von Celle und Calenberg gemeinsam verwaltet. Sodann wurde sie 1682, mit Ausnahme der Ämter Ehrenburg und Syke, an Calenberg übergeben. Endlich kam es 1705 zu einer Vereinigung der Fürstentümer Celle und Calenberg zum so zustande gekommenen Kurfürstentum (später Königreich) Hannover.
Innerhalb des Deutschen Reiches waren sämtliche Fürstentümer und freien Reichsstädte seit dem Augsburger Reichstag von 1500 wiederum in zehn Reichskreise unterteilt worden. Deren Aufgabe bestand u.a. in der Aufstellung der sogenannten Reichsarmee (durch entsprechende Truppenstellung, was in der Praxis aber selten gelang), der Vereinheitlichung des Münzwesens (Einführung des Reichstalers) und der gemeinsamen Rechtsdurchsetzung (etwa zur Vollstreckung der Urteile des Reichskammergerichts gegen „uneinsichtige“ Landesherren). Die Fürstentümer des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg (Lüneburg-Celle und Braunschweig-Wolfenbüttel) gehörten gemeinsam mit Holstein, Mecklenburg, Hamburg, Bremen und Lübeck dem Niedersächsischen Reichskreis an. Die alte Grafschaft Hoya gehörte dagegen zum Westfälischen Reichskreis.
Für das Amt Hoya bedeutete diese Kreiseinteilung einen entscheidenden Nachteil: Das Amt Hoya gehörte zwar ab 1582 staatsrechtlich zum Fürstentum Lüneburg-Celle. Reichspolitisch waren die Gebiete der alten Grafschaft Hoya, da die Kreisgrenzen nach dem Anfall der Grafschaft an die Welfen nie geändert wurden, aber anders als das Fürstentum Lüneburg-Celle weiterhin dem Westfälischen Reichskreis zugeordnet (zu dem außerdem das Fürstbistum Verden und u.a. die Reichsstädte Köln und Dortmund sowie die Fürstbistümer Münster, Osnabrück, Paderborn, Minden und die Grafschaften Diepholz und Schaumburg gehörten). Soweit also der Niedersächsische Reichskreis seine Kreisgrenzen verteidigen wollte, war das Amt Hoya „außen vor“. Rein faktisch behandelte der Niedersächsische Reichskreis dabei die Weser als westliche Kreisgrenze (obwohl auch Hassel und Eystrup offiziell zum Westfälischen Reichskreis gehörten). Diese politische Nuance der unterschiedlichen Reichskreis-Zugehörigkeiten war offensichtlich auch den kriegsführenden Parteien durchaus bewusst, was sich daran zeigt, dass die westlich der Weser liegenden Teile des Amtes Hoya auffallend häufiger Okkupationen und Übergriffen ausgesetzt waren (und auch weniger entschieden verteidigt wurden) als die östlich des Flusses liegenden Gebiete.
1 Otto Heinemann, Geschichte von Braunschweig und Hannover, Band 3, Gotha 1892, S. 22.
2 Wilhelm von Hodenberg, Hoyer Urkundenbuch. Band 1, Hausarchiv, Hannover 1855 („Hoyer UB I“), Urkunde (UR) Nr. 983.
3 Unklar ist insoweit die Erläuterung im Landesarchiv Hannover zum Bestand NLA HA Hann 74 Hoya, Amt Hoya, wonach die untere Grafschaft lediglich mit den Ämtern Bruchhausen, Liebenau und Nienburg an die Cellesche Linie, die obere Grafschaft mit den Ämtern Hoya, Diepenau, Ehrenburg, Bahrenburg, Harpstedt, Siedenburg, Steyerberg, Stolzenau und Syke an die calenbergisch-wolfenbüttelsche Linie kam.
2. Verwaltungsstruktur in Flecken und Amt
a) Der Flecken Hoya
Der Ort Hoya wird im hier interessierenden Zeitraum durchgehend als „Flecken“ oder „Weichbild“ bezeichnet. Er verfügte gegenüber den kleineren Landgemeinden über bestimmte Privilegien, die von Zeit zu Zeit erneut wurden, wobei von Anfang an zwischen den Rechten des Adels, der „Freien“, der Bürger und der (einfachen) Einwohner unterschieden wurde. Erhalten geblieben sind entsprechende „Privilegia“ aus der Grafenzeit (von 1576) sowie deren Bekräftigungen durch die Fürsten von Lüneburg-Celle in den Jahren 1606, 1608 und 16104. Weitere herzogliche Privilegien datieren sodann aus den Jahren 1636, 1653, 1667, 1697 und 1734.5
Die Eigenverfassung des Fleckens Hoya wurde entweder nicht niedergeschrieben oder ist zumindest nicht erhalten geblieben. Jedenfalls amtierten während des Dreißigjährigen Krieges stets zwei Bürgermeister gleichzeitig.6 Auch vor dem Krieg gab es (erste Nennung im Jahre 15757) zwei gleichzeitig amtierende Bürgermeister. Daneben bestand ein nicht näher definierter „Stadtrat“, dessen Verfassung gleichfalls undeutlich bleibt. Die Bürgermeister und der Rat beriefen sich gegenüber der durch den Amtmann vertretenen staatlichen Obrigkeit (also letztlich gegenüber ihrem Herzog in Celle), häufig auf die ihnen verliehenen Privilegien, wobei es durchaus zu diversen Reibereien zwischen Flecken und Amt hinsichtlich der zwischen ihnen geltenden Kompetenzabgrenzungen kam.
Namentlich überliefert sind einzelne Bürgermeister. So amtierten vor 1633 die Bürgermeister Geberhard von Gehrden und Dittrich Meyer als „Collegen“. Später (ab 1637) finden sich, wiederum gleichzeitig, die Bürgermeister Heinrich Precht und Harm Beste, deren diverse Querelen mit dem Amtmann sich im Schriftwechsel erhalten haben. Die Ratsmitglieder – und auch die Größe des Rats - des Fleckens Hoya bleiben weitgehend unbekannt. Nur einmal, im Jahre 1637, wird ein Schreiben der Bürgerschaft namentlich unterzeichnet. Dort finden sich die beiden Bürgermeister und fünf weitere Namen, bei denen es sich wohl um Ratsmitglieder gehandelt haben dürfte.8
Das genaue Aussehen des Fleckens und des Schlosses Hoya sind gleichfalls nur ansatzweise bekannt. Es existiert ein Ortsplan, der von schwedischen Truppen wohl während des Krieges angelegt worden war. Im Schwedischen Reichsarchiv wird er mit dem Erstellungsjahr 1648 angegeben, ist selbst aber nicht datiert (Abbildung 1). Da die schwedischen Truppen Hoya bereits im Jahre 1634 besetzten und wahrscheinlich spätestens im Jahr 1649 wieder verließen, wird es wohl wenig sinnvoll gewesen sein, eine zu militärischen Zwecken angefertigte Lagekarte erst kurz vor dem Abzug der Truppen in Auftrag zu geben. Zudem sind die ebenfalls im Stockholmer Reichsarchiv erhaltenen Pläne der Festungen Nienburg und Minden9 sowie andere Karten gleichfalls einheitlich mit der Jahreszahl 1648 versehen. Insoweit erscheint es doch zweifelhaft, ob der hoyaer Ortsplan tatsächlich erst 1648 gefertigt worden ist. Es wäre wohl eher denkbar, dass die Skizze bereits zu Beginn der schwedischen Besatzungszeit aufgenommen, aber erst im Nachhinein mit dem Jahr des Kriegsendes im Archiv datiert worden ist.
Der Flecken soll bei Kriegsbeginn - laut einer noch während des Krieges verfassten brieflichen Nachricht der hoyaer Bürgermeister - über dreihundert Feuerstellen (Häuser) verfügt haben, von denen aber in den Jahren 1637 und 1641 jeweils nur noch 53 bewohnt waren.10 Alle anderen „Häuser seien weggerissen und verbrannt“. In den in der gleichen Akte erhalten gebliebenen Listen über die zu leistenden Zwangsabgaben von 1641 sind sechzig hoyaer Familiennamen verzeichnet, von denen 47 abgabenpflichtig waren. Bereits im Hoyaer Lagerbuch von 1583 finden sich 208 zum Flecken Hoya gehörige Familiennamen, die wohl mit einer entsprechenden Anzahl von Feuerstellen gleichzusetzen sein dürften.11 Insoweit wird man für das Jahr 1618 also wohl durchaus von 250 bis 300 ortsansässigen Familien ausgehen können.
b) Das Amt Hoya
(1) Verfassung
Die Ämter entwickelten sich beginnend im 13. Jahrhundert teilweise parallel zu den bestehenden „Gogerichten“, teilweise gründeten sie sich auf diese. Über den Entstehungsprozess gibt es jedoch nur geringe Kenntnisse. Seit dem 16. Jahrhundert setzte sich die Bezeichnung Amt durch, die Unterbezirke der Ämter wurden als Vogteien bezeichnet. Der Ämterbildungsprozess war im 16. Jahrhundert nach der Reformation in seinen Grundzügen abgeschlossen. An der Spitze der Ämter stand ein Amtmann, der vom Herzog eingesetzt wurde. Zum Amt gehörte der so genannte Amtshof, der ursprünglich vom Amtmann selber verwaltet, seit dem 17. Jahrhundert jedoch meist verpachtet wurde. Unterstellt waren die Ämter der herzoglichen Finanzverwaltung, der Rentkammer in Celle. Die Ämter nahmen die herzoglichen Herrschaftsrechte wahr und waren an der Erhebung landesherrlicher Steuern beteiligt.12
Das Amt sorgte auch selbst für eine gewisse Rechtsetzung. Erhalten geblieben ist eine Zusammenfassung solcher Gesetzgebung mit dem Aktenbetreff „Verzeichnis von Gesetzen und Verordnungen über die Rechte und die Amtsführung des Amtes Hoya“ von 1690.13 Dabei handelt es sich um eine Art Findbuch zu Rechtsbestimmungen mit den Jahresangaben 1579 bis 1704, so dass dieses Buch also auch nach dem Jahre 1690 noch fortgeführt worden sein muss. Die genaueren Einzelheiten - der dort nur stichwortartig genannten Regelungen - werden sich, da jeder verzeichnete Rechtsakt auf eine andere Seitenzahl als Fundstelle verweist, in einzelnen nicht erhaltenen „Gesetzbüchern“ befunden haben. Allein der stichwortartige Verweis erhellt aber bereits, wie „von Amts wegen“ eine Vielzahl von Sachverhalten des täglichen Lebens geregelt worden ist.
So finden sich hier etwa diverse Strafbestimmungen, beispielsweise unter der Jahreszahl 1591 der Eintrag: „Pagina (Seite) 329, wer Zeuneund Knicke bestielt oder bey dem es in Hoya gefunden wird, soll an den Pranger ½ tag gestellt und daruff des Weichbildes Hoya verwiesen werden“. Gemeint sein dürften damit wohl „Zäune“ und „Hecken“. Wo genau sich der Pranger befand, bleibt leider unklar. Daneben sind prozessuale Vorschriften enthalten. Unter der Jahreszahl 1585 findet sich eine zivilprozessuale Regelung: „Wer Bier borget an jemand der nicht zahlen kann oder wer liederlich ist, soll beym Gericht mit der praetension14 nicht angenommen werden“.
Ebenso finden sich Baugenehmigungen („Herzog Ernst und Herzog Christian haben Reineke Seger in Hoya eine Haußstedte zu bebauen erlaubt, 1591“) und andere „verwaltungsrechtliche“ Normen: “Copulationen sollen zwischen 9 und 10 Uhr Morgens vollzogen werden, die Hochzeitsgäste sollen nach 10 Uhr des Abends nicht sitzen und keiner mit dem Degen tanzen“(1600).
Hinzu kommen erbrechtliche Vorschriften: „Das hereditas von der Schwerdseite auf die Schwerdseite im Flecken Hoya wider falle, ohngeachtet proximinores von der Spiel-Seite vorhanden“. Mit „Schwertseite“ werden die väterlichen Verwandten und mit „Spielseite“ diejenigen der mütterlichen Seite bezeichnet.
Abbildung 1: Ortsplan Hoya ca. 1640 (Schwedisches Reichsarchiv SE/KrA/0414/0021/0050).
Das „hereditas“ umfasste das Erbe an Immobilien.15 Endlich finden sich Ordnungsvorschriften: „Garde Brüder16 und Bettler abzuschaffen oder zu inhaftiren“ (1597).
Auch die „Wehrpflicht“ der Untertanen wird – wenn auch nur rudimentär – in diesem Verzeichnis von Gesetzen und Verordnungen zumindest erwähnt. Unter der Jahreszahl 1597 findet sich in der Rubrik „Baurrecht und Onera Hoya“ die Bestimmung: „Ein jeder soll sich und sein Hausgesinde mit Gewehr versehen auch zur Musterung und Rüstung parat halten“. Hintergrund dieser Aufbietung einer Einwohnerwehr im Jahre 1597 wird die damals drohende Invasion des Fürstentums Lüneburg-Celle durch ein (eigentlich in den Niederlanden kämpfendes aber auch bis nach Goldenstedt und Ehrenburg plündernd ausgreifendes) spanisches Heer gewesen sein.17 Unter der Jahreszahl 1604 ist nochmals knapp vermerkt: „Alle Unterthanen sollen ihr Gewehr parat halten“ und zur Jahreszahl 1612: „Johan Sanders zu Bücken ist zum Land-Haubtmann bestellt, um dieUnterthanen durchgehends im Gewehr zu exercieren“. Erstaunlicherweise finden sich aber in den folgenden Jahren, also gerade zu Beginn des Dreißigjährigen Krieg, keine entsprechenden Bestimmungen mehr in diesem Verzeichnis. Dafür stammt aber die älteste erhaltene Königsplakette des heute Bürgerschießen genannten damaligen hoyaer Vogel- oder Scheibenschießens aus dem Jahre 1621, diejenige in Nienburg und Bücken (Papageien) sogar aus den Jahren 1581 und 1607. Dieses Königsschießen wird sicherlich auch den zuvor notierten Wehrübungen entstammen. Ältere Plaketten sind vielleicht einfach aus dem Grunde nicht vorhanden, weil diese zuvor noch nicht „in Mode“ gekommen waren.
(2) Amtsterritorium
Das Amt Hoya bestand zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus den Flecken Hoya und Bücken sowie den Vogteien Asendorf, Eitzendorf, Eystrup, Hassel, Hoyerhagen, Magelsen, Martfeld, Oiste, Schweringen und Wechold. Letztlich entspricht das zugehörige Gebiet also weitgehend der heutigen Samtgemeinde Grafschaft Hoya einschließlich der Gemeinden Asendorf, Martfeld und Oiste.
1641 werden in einer Abgabenliste des Amtes (in dieser Reihenfolge und Schreibweise) die „Flecken“ Hoya und Bücken sowie die Ortschaften „Oldenbücken, Stendern, Holtorff, Warpe, Heltzendorff, Windthorst, Nohrtholz, Deendorf, Calle, Schwering, Asendorff, Riethaußen, Martfeldt, Lütken Borstell, Magelßen, Eitzendorff, Oiste, Hoyerhagen, Wechold, Heesen, Mehringen, Ubbendorf, Hilgermissen, Wiebergen, Hingste, Boyen, Hassel und Eißdorf“ genannt.18 Ein Überblick über die Grenzen des Amtes Hoya und der benachbarten Ämter ergibt sich aus der Abbildung 2.
(3) Verwaltungsaufbau
Der Verwaltungsaufbau sah als Vertreter der fürstlichen Regierung im Amt Hoya den sogenannten Amtmann (oder in der damaligen Schreibweise „Ambttman“) vor, der im Amtshaus,19 bzw. vor dem Bau desselben wohl auf dem Schloss,20 einen kleinen Verwaltungsapparat mit Amtsschreibern, Amtsdienern und Amts- oder Fußknechten unterhielt. In den noch erhaltenen Akten wird (als Aktentitel) noch zu Regierungszeiten der hoyaer Grafen bereits ein Amtmann zu Hoya erwähnt,21 so dass die Amtsverfassung bereits in der alten Grafschaft bestand und von den lüneburgischcelleschen Fürsten offenbar ohne Änderungen übernommen worden ist. Unterhalb der Amtsebene waren Vögte bzw. Untervögte in den einzelnen dem Amt zugehörigen Ortschaften als Regierungsvertreter tätig. Im Flecken Hoya wird der Voigt, anders als in den anderen Ortschaften, zumindest bis 1637, als „Hausvoigt“ bezeichnet.22
Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, und noch mindestens bis zum Jahr 162323, war Asmus von der Myll amtierender Amtmann in Hoya.24 Ihm folgte noch 1623 Henning Riebe25 und im Zeitraum von 1626 bis 1628 Balthasar Gödemann,26 der anschließend als Amtmann in Lüchow fungierte.27 In den Jahren 1629 bis 1645 diente dann Johann Locke als Amtmann in Hoya. Sein Nachfolger war - bis über das Kriegsende hinaus - Heinrich von Drebber, der dieses Amt mindestens bis 1655 bekleidete.28 Hinsichtlich Heinrichs von Drebber ist zudem bekannt, dass er zuvor als Voigt in Langenhagen tätig war und von dort zum Amtmann in Hoya befördert wurde.29 Ansonsten ist bislang schlicht ungeklärt, wer exakt zu welcher Zeit als Amtmann in Hoya fungierte.
Auf der höheren Verwaltungsebene findet sich ein „Drost“ (später als „Landdrost“ bezeichnet), der, teils wohl als eine Art von Mittelbehörde mehrere Ämter zu beaufsichtigen, teils auch neben dem Amtmann einen eigenen Geschäftskreis zu verwalten hatte. Das Amt des Drosten bestand ebenfalls bereits in gräflicher Zeit. So verpflichteten sich Dietrich Balke, Drost in Hoya, der hoyaer Hauptmann Johann Hoyer, der hoyaer Burgvogt Asche von Binnen und der Hoyaer Amtmann Johann Sanders im Jahre 1575 gegenüber Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, diesem im Falle des Todes des Grafen Otto das Amt Hoya zu übergeben.30 Die Drosten wurden zuweilen auch als Oberamtmann, Oberhauptmann oder Amtsrat bezeichnet.31 In Hoya finden sich während des Dreißigjährigen Krieges als Drosten die Namen Levin von Hodenberg (1606-1624)32, Johann von Behr (1627), Dietrich von Behr (1629 und 1631),33 Frantz-Dietrich von der Borg (1637) und schließlich Hans Adam von Hammerstein (1644).
Weder für die Zuständigkeitskreise der Amtmänner noch der Drosten lassen sich aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (oder vorangegangener Zeiträume) genauere gesetzliche Grundlagen finden. Es gab damals offenbar weder eine einheitliche Amtsordnung noch eine sonstige eindeutige Regelung der Verwaltungsverfahren und Kompetenzabgrenzungen. Aus den Akten ergibt sich jedenfalls, dass sowohl die Drosten wie auch die Amtmänner jeder für sich oder auch mittels gemeinsamer Unterschrift die Korrespondenz mit der Regierung in Celle führten. In den Jahren 1622/1623 unterzeichneten der Drost Levin von Hodenberg und der Amtmann, zunächst Asmus von der Myll und dann Henning Riebe, sämtliche nach Celle abgehenden Schreiben gemeinschaftlich. Später meldete der Amtmann Johann Locke, 1629, nachdem er den FrantzDietrich von der Borg (von dem aber unklar ist, ob er zu dieser Zeit schon als Drost fungierte, da sein Vorgänger Dietrich von Behr noch 1629 und 1631 als Drost von Hoya genannt wird) mündlich verständigt hatte, allein über wesentliche hoyaer Vorgänge nach Celle, während der selbe Amtmann 163734 ausdrücklich nur „in Abwesenheit des Herrn Drosts“ dorthin berichtete. Die Bürgermeister Hoyas schrieben im selben Jahr 1637 „an Frantz-Dietrich von der Borg, Herr Drost zur Hoya, it zo sich aber zu Zell ( Celle) aufhaltend.“ Im Februar 1638 berichtete35 dann dieser Drost Frantz-Dietrich von der Borg, obwohl der Amtmann Johann Locke gleichfalls noch in Hoya tätig war, wieder selbst über die kriegswichtigen Vorgänge aus Hoya an seine Regierung in Celle.36 In der weiteren Korrespondenz des Amtes Hoya mit der herzoglichen Regierung findet sich darüber hinaus auch die Bezeichnung eines Großvoigts, der wiederum mehreren Ämtern vorgesetzt gewesen sei.37 So findet sich ein Bericht über die Plünderung Hoyas aus dem Jahre 1627, gerichtet an „Herrn Johann Behren, braunschweigisch-lüneburgisch geheimbten Rath und Großvoigt zu Zelle, Drost auf Ahlden zur Hoya und Drakenburg.“38 Im Jahre 1629 wird sein Bruder Dietrich von Behr als „Herr Dietrich Behren, braunschweigischlüneburgisch geheimbten und Commerzrath, auch Großvoigt zur Zelle, Drost auf Hoya“ bezeichnet.39 Unklar bleibt dabei, ob die Bezeichnung „Großvoigt“ allein als zusätzliche Titulierung eines verdienten Drosten oder als eigenes Amt, verbunden mit erweiterten Kompetenzen zu verstehen ist und welche Ämter zu welchen „Drosteien“ in welchen Zeiträumen zusammengefasst waren. Zudem findet sich ab 1643 anstelle des für bestimmte einzelne Ämter zuständigen Drosten jetzt die Bezeichnung „Landdrost“ für die gesamte Grafschaft, Hoya,40 was sich wahrscheinlich daraus begründet, dass mittlerweile (1642) aufgrund weiterer Erbfolge die gesamte Grafschaft wieder „in einer Hand“ vom Fürstentum Lüneburg-Celle aus regiert wurde.
(4) Amtsstruktur
Mit Übernahme der Grafschaft Hoya erließ Herzog Wilhelm der Jüngere in Celle 1583 für die Amtsdiener des Amtes Hoya eine „Hausordnung“.41 Dort werden die Dienstpflichten des Burgvoigts sowie der anderen Amtsvoigte, des Kornschreibers, der Zöllner, Fußknechte, Wächter, Pförtner und Schlüter bis hin zum Koch und den Mägden zumindest ansatzweise beschrieben. Während die Tätigkeit des Amtmannes nicht näher geregelt wurde, sollte der Burgvoigt „das Haus“ (womit das Schloss gemeint sein dürfte) sowie das Vorwerk beaufsichtigen und dafür Sorge tragen, dass nur dazu befugte Personen Zutritt erhalten und Lieferanten nach Erfüllung ihrer Aufträge das Haus unverzüglich wieder verlassen. Insbesondere sollte er in Küche und Keller keine „Zecher“ oder „Beseelschaft“ dulden. Der Pförtner in der oberen „Pforte“ des Hauses (wobei die räumliche Lage der Pforte nicht näher beschrieben wird) sollte sich nach den Anweisungen des Burgmeisters (dieses Wort wurde in der Akte später gestrichen und durch das Wort „Ambttman“ ersetzt) richten und nur „beeidete Diener“ einlassen. Bei Gefahr sollte er „die Brücke“ heraufziehen und nur die „Klappen“ liegen lassen. Wenn Fremde mit Fuhrwerken oder zu Fuß eingelassen würden, sollte er achtgeben, dass diese sich nach Verrichtung ihrer Geschäfte nicht im Keller festsetzen. Der Schlosskeller schien also, da auch der Burgvoigt dort ausdrücklich keine Zecher dulden sollte, ein bekannt neuralgischer Punkt im Schloss gewesen zu sein. Sein Essen durfte der Pförtner der oberen Pforte immerhin – auch dieses Detail war geregelt - in der Küche einnehmen.
Der Pförtner der mittleren Pforte – von der auch nicht mitgeteilt wird, wo sie sich befand - hatte die Aufsicht über die Feuer. Im Amtshaus (das damals also noch Teil des Schlossgeländes gewesen sein muss) und an der Pforte sollte er, wenn die Untertanen etwas anzuzeigen oder zu verlangen hätten, diese den Beamten anmelden und sie im Winter nicht zulange vor der Pforte warten lassen. Diese Vorschrift für den Pförtner der mittleren Pforte wurde allerdings in der Akte später ganz gestrichen, so dass davon auszugehen ist, dass die mittlere Pforte irgendwann nach 1582 nicht mehr vorhanden war. Vielleicht wurde sie im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Amtshauses in der Amtsstraße auch umbenannt in „niedere Pforte“, da die folgende Vorschrift über den Pförtner der niederen Pforte in ganz anderer Handschrift als die vorgehenden Texte geschrieben ist, offenbar also erst später hinzugefügt wurde. Dieser Pförtner der niederen Pforte sollte sich nach den Befehlen des Amtmannes richten und „die Brücken beide“ abends zu und morgens aufschließen. Ein weiterer Pförtner hatte schließlich die Pforte des Vorwerks zu bewachen und darauf Acht zu geben, wer dort ein und ausgeht. Dieses „Vorwerk“ oder „Vorwerkhof“ war ein landwirtschaftlich genutztes Anwesen, gelegen an der heutigen (nord-östlichen) Ecke Kirchstraße/Hasseler Steinweg in Hoya, besetzt mit dem Hofmeyer, seiner Frau, fünf „Schweinemeistern“, einem „Jungen“, einem „Dröscher“ und dem Pförtner.42 Morgens sollte der dortige Pförtner zudem die „Brücke zur Weide und zur Alhuser Ahe“ auf- und abends wieder abschließen und die Schlüssel abends dem Burgvoigt übergeben. Dieser letzte Satz wurde später teilweise gestrichen, so dass er – nach dieser Änderung – abends und morgens jetzt „die Brücken“ (ohne nähere Bezeichnung) auf und zuschließen sollte. Bei der Brücke „zur Weide und zur Alhuser Ahe“ wird es sich wohl um die Brücke über die sogenannte „Kleine Weser“ gehandelt haben, die sich in Höhe des heutigen Bürgerparks befand.
Abbildung 2: Das Amt Hoya und seine Grenznachbarn.
Die Fußknechte sollten gemeinsam abrufbereit bei den Pforten stehen. Sie mussten Pacht und Schulden einfordern und gemeinsam mit den Untervoigten auf Exzesse, Gemeinheiten, Hochmut, Jagd, Holzungen und alles was sich in den Bauerschaften zuträgt achten und dem „Befehlshaber“ Meldung machen.
Die „Altenfrauen“ und Mägde waren gehalten, außer im Winter, die Wäsche an der Weser oder im Burggraben und nicht auf dem „Platze“ zu machen und die Betten reinzuhalten.
Ferner war das Amt der Wächter geregelt. Diese Wächter (späterhin wohl als „Nachtwächter“ bekannt) liefen – mit Ablösung um Mitternacht - nachts durch den Flecken Streife.
Im Winter sollten sie abends um sieben „Glockenschlag“ und dann stündlich fortlaufend bis morgens um vier Uhr das Horn auf dem „Östereich“ blasen. Sie hatten im Flecken Hoya auf Feuer und Licht zu achten und Tumulte sowie Störungen der Nachtruhe dem Burgvoigt anzuzeigen. Tagsüber sollten sie dort mitarbeiten, wo sie gerade gebraucht würden, im Backhaus, dem Vorwerk oder der Fischerei. Der in diesem Zusammenhang etwas eigentümliche Name „Östereich“ wird von Merian (1654) erwähnt und erklärt: „Wie alte Leute berichten, soll das Schloß anfänglich auff der andern oder lincken Seiten der Weser gestanden seyn, an dem Orte, welcher noch anjetzo die alte Hoya genant, und zur Weide gebraucht wird (…) Hernachmals ist es (das Schloss) auff einen Anwurf des Weserstroms, da sich derselbe theilet, in eine Ecke gesetzet, und hinten nach der Ecke zu ins runde gebauet. Vorwerts aber hat es zwey Ecken und einen Thurm in der mitte, zwischen den andern Gebäuden, das Oestereich genant, darunter das Thor und Eingang des Schlosses gemachet worden“.43„Östereich“ war also der Name des Schlossturmes zu Hoya.
(5) Die Amtsvisitation von 1618
Anlässlich einer Besichtigung des Amtes Hoya vom 22. September 1618 (und damit, ausgehend vom Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618, bereits während des gerade beginnenden Dreißigjährigen Krieges) durch die herzoglichen Räthe Julius von Bülow und Johan Behr wurde dem Amt befohlen, dass ab sofort ein jeder Drost, Hauptmann, Amtmann, Amtsschreiber und Voigt „alsbald in den ihnen betrauten Ämtern und Voigteien“ Verzeichnisse der in ihren Bezirken gelegenen Mühlen, Fischereien, Bäckereien, Pachten und anderer Gerechtigkeiten in doppelter Ausführung – wobei von jedem Register eine Ausfertigung nach Celle zu schicken sei - aufnehmen wolle. Außerdem sollten ab sofort sämtliche Ausgaben des Amtes (ganz modern) möglichst durch Quittungen belegt und alle Ein- und Ausgaben einheitlich in der Währung „Reichstaler“ geführt werden. Die genannten Beamten (damals noch als „Beampte“ verschriftlicht) sollten nicht nur das ihnen anvertraute Amt in jetzigem Zustand halten, sondern es nach Möglichkeit in einen „noch besseren Stand“ versetzen. Der Herzog „richte seine Gedanken dahin“, nach Abtragung der Schulden (womit wohl die bei Übernahme der Grafschaft Hoya 1582 bestehende hohe Verschuldung derselben – die durch die Untertanen abzutragen war - gemeint sein dürfte) keine weiteren Schulden mehr zu machen, damit es nicht nötig wäre, die „Schatzungen“ aufrechtzuerhalten um die armen und erschöpften Untertanen nicht ganz „auszumergeln “.44
Der Visitationsbericht ist recht knapp und wohlwollend gehalten und enthält sich jeglicher Kritik an den Zuständen im Amt. Es wurden lediglich einige durchaus kleinliche Verbesserungsvorschläge, insbesondere zum sparsamen Einsatz aller Ressourcen, unterbreitet. So wurde dem Amt etwa vorgegeben, welche Räume im Schloss mit welcher Höchstmenge an Holz geheizt werden dürfen („So sollen auf dem Hause nicht mehr als in der Küche, im Backhause, Amtsstube, Hofstube, im Kinderzimmer des Drosten, Pfortenstube, Stallstube, Altfrauenstube und im Stüblein des Kornschreibers, im ganzen also neun Feuer in Winterszeit gemacht werden“) und welche nicht: „Das Feuer auf dem Wächterboden45 soll ganz abgeschaffet und dagegen den Wächtern Röcke gegeben werden.“ Ebenfalls auf dem Schloss sollten „die Altenfrauen alle Sonnabend vor den Öfen und wo sonst Feuer gehalten wird, die Asche fleißig aufsammeln, an einen besonderen Ort aufschütten, und was sie nichtnötig zu verbrauchen, soll verkauft und seiner fürstlichen Gnaden berechnet werden.“ Solch geradezu „heilige preußische Sparsamkeit“ war also bereits vor den Preußen längst erfunden. Der Amtmann konnte mit dem Ergebnis der Visitation wohl durchaus zufrieden sein, da der Abschlussvermerk der Regierungskommission lautete, dass es „im Übrigen bei der Verwaltung des Amtes in jetzigem Zustand verbleiben könne“. Feststellen lässt sich anhand des Visitationsberichts, dass zu dieser Zeit neben dem Amtmann stets auch ein Drost in Hoya ansässig war, der seinen Dienstsitz im Schloss hatte. Deutlich wird aber auch, dass die Hoyaer bereits bei Ausbruch des Krieges eher in bedrängten wirtschaftlichen Verhältnissen gelebt haben, da wahrscheinlich mehrere Sonderbesteuerungen - zur Begleichung der mit der Übernahme der Grafschaft Hoya durch die Welfen verbundenen Schulden - die Untertanen bereits „arm und erschöpft“ gemacht hatten. So wiesen etwa auch die Herzöge zu Braunschweig-Wolfenbüttel und Calenberg bereits 1583 darauf hin, dass die armen Untertanen der von ihnen übernommenen Obergrafschaft Hoya „da sie durch Schatzungen bereits so ausgemergelt seien, mit neuer Zulage nicht übereilet werden dürften“. Nichtsdestotrotz wurde den armen Ausgemergelten noch im selben Jahr eine neue Sondersteuer (“Viehschatz“) zur Abtragung