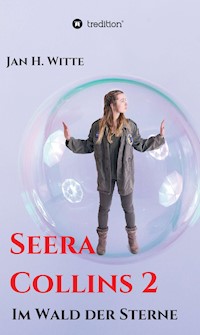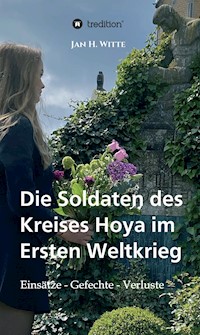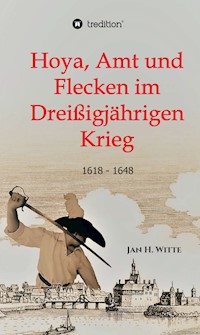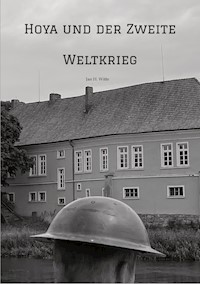
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über Hoya zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ist bereits vieles bekannt. Einige heute zugängliche Quellen und Erkenntnisse sind bislang aber auch noch nicht veröffentlicht worden. Vor allem fehlt es an einer Gesamtdarstellung der Ereignisse. Diesem Mangel soll vorliegend zumindest ansatzweise abgeholfen werden. Die Hoyaer Soldaten, der Angriff auf den Fliegerhorst und die Kämpfe um die Stadt im April 1945 bilden das Gerüst eines chronologischen Ablaufs der Geschehnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hoya und der Zweite Weltkrieg
Hoya und der Zweite Weltkrieg
Jan H. Witte
© 2022 Jan H. Witte
Buchsatz von tredition, erstellt mit dem tredition Designer
ISBN Softcover: 978-3-347-70134-2
ISBN E-Book: 978-3-347-70136-6
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Aufrüstung und der Fliegerhorst
2. Hoyaer Gefallene 1939 bis 1943
3. Von 1944 bis Frühjahr 1945
4. Luftangriff auf den Fliegerhorst, 4. April 1945
5. Hoya wird besetzt, 7. und 8. April 1945
6. Kampf um Hoyas Osten, 9. April 1945
7. Entwicklung ab dem 10. April 1945
Anhang 1 Beigesetzte alliierte Flieger
Anhang 2 Personen der Hoyaer Gedenktafel
Anhang 3 Nicht verzeichnete Hoyaer
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
Einzelne Abschnitte der Geschichte Hoyas im Zweiten Weltkrieg wurden bereits häufig von fleißigen Heimathistorikern beschrieben. Über das Kriegsende gibt es zudem einen sehr sehenswerten Film1. Ausgezeichnet aufbereitet ist auch die Geschichte der jüdischen Familien in Hoya2 und das Schicksal der in Hoya verstorbenen Zwangsarbeiter3. Neue Erkenntnisse lassen sich inzwischen kaum noch gewinnen. Dennoch fehlt es aber an einer Gesamtdarstellung der Ereignisse, zumal es durchaus noch offene Fragen gibt: Wer waren die Hoyaer Soldaten, denen mit der Gedenktafel an der Friedhofskapelle gedacht wird und wie gestalteten sich die Ereignisse und Abläufe zum Kriegsende hin in Hoya im Einzelnen?
Die Quellenlage zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen ist als mäßig gut zu bezeichnen. Auf dem Denkmal für die Kriegstoten, bei denen es sich nicht nur um gefallene Soldaten, sondern auch um Zivilisten handelt – eine schlichte Holztafel an der Friedhofskapelle - sind 191 Namen von Männern und Frauen aufgeführt. Eine weitere Liste der Hoyaer Gefallenen hat der langjährige Kämmerer der Stadt, Friedrich Gumprecht, in seiner „Hoyaer Chronik“ zusammengestellt. Es handelt sich dabei um eine nicht gedruckte, maschinenschriftliche Sammlung, die im Heimatmuseum in Hoya verwahrt wird. Gumprecht listet 156 Namen auf, die mit denen auf der Holztafel an der Friedhofskapelle weitgehend übereinstimmen. Warum er die anderen Namen nicht mit aufgenommen hat, bleibt unerklärt. Ebenso unklar bleibt, weshalb weitere „Hoyaer Bürger“, die ihr Leben als Soldat oder Zivilist durch Kriegseinwirkungen verloren, weder auf der Gedenktafel noch in Gumprechts Liste zu finden sind. Die Erklärung wird sich wohl daraus ergeben, dass bereits damals eine durchaus beachtliche Umzugsrate nach und von Hoya bestand, so dass vielleicht nicht jeder Neubürger bereits ausreichend bekannt geworden ist.
Unklar ist ohnehin, wer bei Errichtung des Denkmals aus welchem Grunde „genannt“ wurde und wer nicht: Auf der Gedenktafel finden sich in Hoya geborene Soldaten und Zivilisten, die bei Kriegsausbruch und (betreffend die Soldaten) ihrer Einberufung zur Wehrmacht auch noch in Hoya lebten. Es finden sich aber auch in Hoya Geborene, die bei Kriegsausbruch nachweislich nicht mehr in Hoya wohnten. Schließlich finden sich auch Namen von Personen, die zwar nicht in Hoya geboren sind, die aber vor oder während des Krieges nach Hoya gezogen sind. Endlich finden sich auch Namen, die auf den ersten Blick keinen Bezug zu Hoya aufweisen. Auf der anderen Seite fehlen auf dem Denkmal aber eben auch Namen gefallener Soldaten, die in Hoya geboren sind und solche, die bei Kriegsausbruch in Hoya wohnten.
Die wohl aussagekräftigste Quelle zu den Wehrmachtsangehörigen ist die mittlerweile öffentlich zugängliche Kartei der Gräberkommission der Wehrmacht. Diese Kartei ist im Wesentlichen bis Mitte 1944 umfassend geführt. Einige Namen fehlen trotzdem, weil sie falsch erfasst und/oder falsch abgelegt worden sind oder, weil es sich um Vermisste handelte, die der Gräberkommission nicht „zugänglich“ waren (so etwa die Masse der Stalingradkämpfer). Für die Verluste ab Herbst 1944 ist die Kartei hingegen lückenhaft und schließlich fehlen die Namen der in den Endkämpfen gefallenen Soldaten gänzlich, da Meldungen in den Rückzugswirren entweder nicht mehr aufgenommen oder nicht mehr weitergeleitet worden sind. Unter Heranziehung dieser Kartei kann nun zumindest das genauere Schicksal eines großen Teils der verzeichneten Hoyaer Kriegsopfer, so sie Soldaten waren, erhellt werden.
Deutlich wird daraus zumindest ansatzweise auch, in welchen Strukturen die Einziehung der Wehrpflichtigen erfolgte; es lässt sich nachvollziehen, in welchen Einheiten und damit an welchen Fronten die Masse der einheimischen Wehrmachtsangehörigen gedient hat (und natürlich auch, wer – ob freiwillig oder „gezogen“ - Dienst bei der Waffen-SS tat). Nicht öffentlich zugänglich sind bis heute - aus Datenschutzgründen - die Einträge der ehemaligen Deutschen Dienststelle („Wehrmachtsauskunftsstelle“), die 2019 in das Bundesarchiv überführt worden sind. Dort sind die Personalakten sämtlicher gut 18,5 Millionen Wehrmachtsangehöriger gespeichert. Eine Einsichtnahme ist, da hier eben auch diejenigen Soldaten, die den Krieg überlebt haben und heute noch leben könnten, nur eingeschränkt und – so denn ein datenschutzrechtlich genügendes Interesse dargelegt wird - verbunden mit erheblichen Wartezeiten möglich. Vor allen Dingen fehlt es dort aber bis heute an einer digitalisierten Durchsuchbarkeit, so dass nicht einfach nach Stichwortgruppen wie „Geburtsort Hoya“ oder „letzte Anschrift Hoya“ recherchiert werden kann. Abgesehen von diesen Karteien ist die Hinterlassenschaft der einstmals umfangreichen Wehrmachtsunterlagen – jeder Truppenteil hat eigene Gefechtstagebücher geführt - durchaus dürftig. Nach dem Ersten Weltkrieg, der ja zunächst mit einem Waffenstillstand und einem nachfolgenden Friedenvertrag endete, bestand die Armee einschließlich ihres Generalstabes (wenn auch in geänderter Form und Bezeichnung) fort. Die Reichswehr sammelte und veröffentlichte die Operationspläne und Gefechtsberichte des Ersten Weltkriegs; ehemalige und aktive Offiziere zeichneten ihre Regimentsgeschichten auf und editierten ihre Erfahrungsberichte anhand der im Reichsarchiv zugänglichen Truppenunterlagen. Im Gegensatz dazu gab es nach 1945 keine Stelle der Wehrmacht mehr, die eine solche Sammlung hätte verwalten können. Das Deutsche Reich hatte bedingungslos kapituliert, die Wehrmacht aufgehört auf zu existieren und sämtliche Soldaten, einschließlich der höchsten Stäbe, gerieten in Kriegsgefangenschaft. Zudem sind diejenigen Wehrmachtsunterlagen, die aus der Zeit bis 1941 stammten (und von der Truppe noch vor dem Überfall auf die Sowjetunion bereits an das Reichsarchiv in Potsdam abgegeben worden waren), bei einem Bombenangriff auf Potsdam im Jahre 1944 größtenteils verbrannten. Die weiteren Unterlagen der einzelnen Truppenteile und die umfangreichen Akten der Wehrmachtsverwaltung wurden bei Kriegsende, so sie nicht vernichtet worden waren, von den Alliierten beschlagnahmt. Erst in den sechziger Jahren gelangten dann einige wenige Unterlagen wieder zurück in deutsche Archive.
Hinsichtlich der auf der Gedenktafel aufgenommenen Zivilisten hilft i.d.R. allein das Adressbuch der Stadt Hoya (aus den Jahren 1936 und 1940) bzw. die standesamtlichen Unterlagen und das Kirchenbuch weiter. Dennoch bleiben aber auch hier (noch) viele der auf der Gedenktafel aufgenommenen Namen schlicht „unbekannt“.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei Henry Meyer, dem wohl besten Kenner Hoyaer Geschichte, ohne dessen tatkräftige und stets wohlwollende Unterstützung eine Studie in dieser Form nicht darstellbar gewesen wäre. Mein Dank gilt ebenso Frau Ulrike Tänzer, der ebenso kompetenten wie stets ansprechbaren Leiterin des Hoyaer Heimatmuseums und des hiesigen Stadtarchivs.
Hoya, im September 2022
Dr. Jan H. Witte
1. Die Aufrüstung und der Fliegerhorst
a) E-Hafen, Ausweichflugplatz, Muna, Luftabwehr
(1) Der E-Hafen
Die Stadt Hoya war seit der Kreisreform von 1932, als die Kreise Hoya und Syke zum Kreis Grafschaft Hoya zusammengelegt wurden, von einem erheblichen Wegzug wichtiger Behörden nach Syke betroffen. Die Stadt besaß ausweislich des Adressbuches des Landkreises Grafschaft Hoya von 1940 immerhin 2940 Einwohner. Bürgermeister Stelter war seit März 1922 im Amt4, die Stadt verfügte über sechs Schulen („Städtische Mittelschule mit sieben Lehrerkräften unter Leitung des Mittelschuldirektors Böse,Volksschule mit sieben Lehrern unter Hauptlehrer Lüder, Landwirtschaftsschule – Direktor Grendel, BDM-Frauenschule unter der Leitung von Fräulein Klossek, Gewerbliche Berufsschule unter Gewerbeoberlehrer Lenski und die Kaufmännische Berufsschule unter der Leitung des Handelsoberlehrers Bohn“), ein Wasserstraßenamt nebst Wasserneubau-Abteilung, eine Kreissparkasse, eine Filiale der Norddeutschen Kreditbank, eine Volksbank und eine Molkereigenossenschaft. Daneben gab es aber eher wenig Industrie und Gewerbe (genannt werden nur Hoppmanns Mechanische Weberei, Thielbars Dampfmühle und eine Eierverwertungsgenossenschaft). Aufgrund des Wegzugs eines Großteils der Kreisbehörden hieß es daher im März 1936 im Hoyaer Wochenblatt:
„Eine brennende Frage! Die wirtschaftliche Notlage der Stadt Hoya, die infolge der Verschmelzung der ehemaligen Kreise Hoya und Syke von fast sämtlichen zuvor hierorts vorhanden gewesenen Behörden und Verwaltungen entblößt wurde, ist wiederholt Gegenstand zu dringlichen und ernstenEingaben gewesen.“5
Die Stadt versuchte nun aufgrund ihrer wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch die Wiederaufrüstung der Wehrmacht für sich zu nutzen und eine Garnison in die Stadt verlegen zu lassen. Man wandte sich über die Regierungsstellen zunächst an das Oberkommando des Heeres. Dieses antwortete zunächst recht knapp:
„…bedauern wir mitteilen zu müssen, dass die Belegung der Stadt mit einer Truppe des Heeres leider nicht möglich ist.“6
Weitergehend teilte die Industrie- und Handelskammer mit:
„…Major von Mudra vom Reichskriegsministerium teilte mit, dass die Stadt zu klein sei. Ich habe ihm darauf nochmals die Notlage der Stadt dargestellt, die dem allmählichen Ruin entgegengehen müsste, wenn ihr nicht durch irgendwelcheMaßnahmen geholfen würde.“7
Nach diesem Mißerfolg beim Heer kam irgendwo in der „zu kleinen Stadt“ die Idee auf, sich stattdessen an die Luftwaffe zu wenden und einen Militärflugplatz einzurichten. Für diese Idee verwandte sich auch der Kreistag des Kreises Grafschaft Hoya. So schrieb der Landrat an das Luftkreiskommando IV in Münster:
„Soweit ich die Sachlage beurteilen kann, eignet sich das Weidegelände bei Hoya mit seiner vorzüglichen Grasnarbe in hervorragender Weise für die Anlegung eines Flugplatzes (…) und eignet sich vorzüglich als kleine Garnison. In der Stadt ist eine Mittelschule vorhanden und für Kinder, die die höhere Schule besuchen wollen, ist Gelegenheit, die Gymnasien der benachbarten Städte Verden und Nienburg aufzusuchen. Das wenige Kilometer entfernte Eystrup, das von Hoya aus mit vollspuriger Bahn zu erreichen ist, ist auch Haltepunkt für Schnellzüge, so das man Bremen und Hannover bequem erreichen kann.“8
Diese Idee, obschon die gelobte „Geeignetheit“ angesichts der bekannten Hochwasserprobleme wohl glatt gelogen war, schien nun zu fruchten. Bereits 1937 wurde der Bau eines „Übungsflughafens“ beschlossen. Fraglich blieb aber die Unterbringung des dafür benötigten Personals. So kann man einem Schreiben des Landrates des Kreises Grafschaft Hoya vom 5. Juni 1937 an die Stadt Hoya entnehmen, dass die Sache nun aber zumindest Fortschritte nahm:
„Der Kreisausschuss hat am siebten des Monats endgültig beschlossen, das ehemalige Kreishaus in Hoya für Berufsschulzwecke zu verwenden, um die brennende Berufsschulfrage zu lösen. Wie Ihnen bekannt ist, sind in dem Kreishause unterzubringen: die gewerbliche Berufsschule, die kaufmännische Berufsschule und die Berufsschule für Mädchen (Haushaltungsschule), außerdem sollen zwei Wohnungen für die Lehrpersonen eingebaut werden. (…) Ich bedaure daher, irgendwelche Räume im ehemaligen Kreishause zur Unterbringung des Stammpersonals für den Übungsflughafen nicht mehr zur Verfügung stellen zu können. Nach den mit der Reiter-SS gemachten Erfahrungen ist das Kreishaus zur dauernden wohnlichen Unterbringung von 60 Militär-Personen auch durchaus ungeeignet. Die Abwasser-und Klosett-Anlage ist dafür völlig unzureichend (…) Die gemeinsame Unterbringung von Militär und Schülern beiderlei Geschlechts würde zudem zu Unzuträglichkeiten und Störungen führen, die jedenfalls für den Schulbetrieb untragbar sind.“9
Abgesehen von den sanitären und sittlichen Problemen schien das Projekt dann aber auch aus anderen Gründen zunächst wieder infrage gestellt worden zu sein. Am 22. Dezember 1938 schrieb der Regierungspräsident der Oberprovinz Hannover, Diels, an den „General der Flieger“ Felmy (den Vater des später berühmt gewordenen Schauspielers Hans-Jörg Felmy), Kommandeur der Luftwaffengruppe II in Braunschweig:
„Sehr verehrter Herr General! Wie ich seinerzeit erfahren hatte, wurde beabsichtigt, den Übungsflugplatz Hoya auszubauen und Hoya mit einer friedensmäßigen Garnison zu belegen. Ich habe diesen Entschluss besonders begrüßt, weil hierdurch die Möglichkeit gegeben worden wäre, den misslichen wirtschaftlichen Verhältnissen der Stadt zu steuern und dem Wirtschaftsleben einen Auftrieb zu geben. Wie mir aber nun mitgeteilt wurde, ist dieser Plan wieder aufgegeben worden. Ich bedaure dies aus den erwähntenGründen naturgemäß lebhaft und wäre dankbar, wenn nochmals geprüft würde, ob nicht die Belegung Hoyas mit einer Garnison doch ermöglicht werden könnte.“
Aus dem Schreiben ergibt sich, dass jetzt zumindest der Übungsflugplatz bereits vorhanden war. Aus der Belegung mit einer Garnison wurde zwar trotz der Eingabe des Regierungspräsidenten nichts, dafür kamen aber die wohl längst geplanten Kasernengebäude ihrer Realisation näher, wie sich aus einer Abschrift des Protokollbuchs der Stadt Hoya vom 8. April 1939 ergibt:
„…war zu einer beratenden Verhandlung auf heute Nachmittag 6: 00 Uhr eingeladen worden, um insbesondere Aussprache zu halten über erstens den Fliegerhorst, eventueller Verkauf der Weiden und Obstplantagen des Bürgerparks, zweitens Heim der Hitler-Jugend, erster Spatenstich am 20. des Monats, dem Geburtstag des Führers.
(…) Welche Forderung die Stadt stellen würde bei käuflicher Überlassung der Hoyaer Weiden in Größe von 27 ha und der Obstplantagen des Bürgerparks in Größe von ca. 2 ha.“
Fliegerisch war Hoya allerdings bereits vor der Wiederaufrüstung tätig: Am Rande des ehemaligen „Weidegebietes“ auf welchem sich heute die Papierfabrik der Smurfit-Kappa-Gruppe befindet, hatte sich Anfang der neunzehnhundertdreißiger Jahre der „Segelflugverein Hoya von 1931 e.V.“ eine Start- und Landebahn für den Segelflugbetrieb eingerichtet. Erste Flugversuche einer Handvoll Flugbegeisterter um den 1913 in Hoya geborenen Fluglehrer Karl Rippe (aus der Bücker Straße) fanden ab 1929 auf den Weiden am Weserbogen mit einem Hängegleiter statt. Im Jahre 1932 errichtete der Verein die sogenannte Hindenburghalle für seine Segelflugzeuge und zwei Jahre später erwarb der Verein eine Motor-Schleppwinde10
Gut beschrieben wird die sich jetzt ergebende weitere Entwicklung vom Sohn des ehemaligen Stadtkämmerers Friedrich Gumprecht, dem Zeitzeugen Otto Gumprecht:
„Am 28. Mai 1937 kam eine Kommission des Luftkreiskommandos VII unter der Leitung des Oberstleutnants Fr. Koos zur örtlichen Besichtigung der großen Marsch östlich der Weser. Diese Kommission hat erklärt, dass das gesamte Weidegelände der großen Marsch nebst den sogenannten Pferdeweiden,insgesamt ca. 107 ha für die sofortige Einrichtung eines Übungsflughafens in Anspruch genommen werden sollte. Durch militärische Maßnahmen sollte die Umgestaltung der Weiden zum Flughafen mit solcher Beschleunigung vorgenommen werden, dass gegen Ende Juni des Jahres eine militärische Fliegertruppe in Stärke von etwa 300 Mann, die einstweilen in Baracken untergebracht werden sollten, hierher verlegt werden. Auf diesem Gelände war davor der Segelflugverein Hoya zu Hause. Für die Unterstellung der Segelflugzeuge hatte der Verein dort eine große Halle - die Hindenburg-Halle - gebaut. Diese wurde abgerissen. Wer weiß, wo die vielen Flugzeuge geblieben sind? Der Bau des Fliegerhorstes wurde dann auch sehr schnell vorangetrieben, und bald kamen die Soldaten die zunächst auf Sturzkampfbomber des Typs Henschel HS 123 ausgebildet wurden. Um 1939 wurden dann Kasernen gebaut, der Busbahnhof (stand dort, wo jetzt die Europa Karton steht) wurde abgerissen und der von Staffhorst‘sche Apfelgarten musste den Neubauten weichen.Im Jahre 1940 wurden dann etwa zehn zweimotorige Bomber des Typs Heinkel He 111 hierher verlegt, die dann auch Einsätze unter anderem am 14. Mai 1940 nach Rotterdam geflogen sind. Weil jedoch bei Regenwetter die Graspiste derMarsch für diese Gewichte der Bomber nicht sehr geeignet erschien, wurden diese wieder abgezogen. Stattdessen wurden die jungen Flieger zu Piloten auf leichteren Jagdflugzeugen vom Typ Messerschmidt Bf 109 ausgebildet. In der Alhuser Ahe wurde bald ein Ersatz- oder Ausweichflughafen gebaut. Die Größe dieses Geländes betrug ca. 80 ha. Dort standen auch einige dieser Jagdmaschinen. Auch einige Focke-Wulf Fw 190 waren dort. Außerdem wurden dort etwa 8-10 der zweimotorigen italienischen Mehrzweckflugzeuge vom Typ Savoia Marchetti sowie zwei amerikanische Beutemaschinen vom Typ Thunderbolt abgestellt. Betankt wurden diese Maschinen mit einem pferdegespannten Tankwagen von Johann Leymann aus Hoya. Zwischen den beiden Flugplätzen wurde zwischen Hoya und Hassel, ca. 100mrechts neben der Straße hinter der ersten Brücke, ein Munitionslager angelegt. Größe etwa 5 ha. Rund um das Rollfeld des Hauptplatzes führte eine Straße aus Klinkersteinen. An der Nord- sowie Südseite waren je drei Erdtanks, die durch unterirdische Rohrleitungen quer über das Rollfeld miteinander verbunden waren, zum betanken der Flugzeuge vorhanden. Die Start- und Landebahn konnte bei Dunkelheit befeuert werden, sodass auch ein Nachtbetrieb möglich war. Ein Anschlussgleis der Hoyaer Eisenbahn war auch vorhanden. An der Straße zwischen Hoya und Hassel, dem Hasseler Steinweg, ab dem Bürgerpark bis nach Hassel, standen große Lindenbäume, die ebenfalls gefällt wurden. Auf einer Länge von etwa 150mbei der von Behr’schen Scheune wurden die Bäume stehen gelassen, wahrscheinlich zum Schutz der Gebäude. Diese wurden dann später beim Neubau der gesamten Straße auch entfernt. Die Kantine des Fliegerhorstes war zunächst ein roter Holzbau und wurde bewirtschaftet von Hans Zech vomParkhaus. Der Tanzsaal des Parkhauses wurde von der Wehrmacht beschlagnahmt. Dort wurde eine Näherei untergebracht. Etwa 15-20 Frauen saßen an Nähmaschinen und fertigten Drillichzeug für die Wehrmacht. In der Kantinewaren ca. zehn Frauen als Köchinnen o. dgl. beschäftigt.“11
Obwohl die Dinge nun ins Laufen kamen, war die Stadt Hoya mit der Entwicklung des entstandenen Fliegerhorsts doch nicht ganz zufrieden. Nachdem sich die Stadt zur Behebung ihrer wirtschaftlichen Nöte bereits mit dem Heer und der Luftwaffe beschäftigt hatte, entstand in ihren Gremien endlich auch die Idee, vielleicht eine dauerhafte Garnison der dritten Teilstreitkraft, der Kriegsmarine, gewinnen zu können. Mit Schreiben vom 27. März 1942 wandte sich der Bürgermeister in Hoya an den Oberpräsidenten und Gauleiter Lauterbach in Hannover und führt aus:
„Die Stadt Hoya hat sich nach Zusammenlegung der beiden Kreise Hoya und Syke im Jahre 1933 sofort bemüht, für die abgezogenen Behörden Ersatz zu schaffen. Es war schließlich gelungen im Jahre 1938 einen E-Hafen der Luftwaffe nach Hoya zu bekommen. Diese Bemühungen waren unbedingt erforderlich,um das wirtschaftliche Leben der Stadt aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit zeigte sich jedoch, dass der Flugplatz nicht den Erfolg brachte, den man erhofft hatte. Es stellte sich auch heraus, dass der Boden des Flugplatzes für vollen Einsatz nicht geeignet war. Da der Platz im Überschwemmungsgebiet der Weser liegt, ist die Benutzung des Flugplatzes als solcher ferner sehr beeinträchtigt. Vor allem konnte auch das wertvolle Weidegelände, dass durch den Flugplatz beansprucht wurde, in Größe von etwa 80 ha für die hier bestehende ertragreiche Viehwirtschaft nicht mehr voll genutzt werden. Der heutigeFlugplatz war vor seiner Einrichtung Weidegelegenheit für 160 Kühe. Diese 160 Kühe waren zum größten Teil im Besitz kleiner Leute, die gezwungen waren, nun ihre Kuh, da keine Weidefläche in dem Maße mehr vorhanden war, abzuschaffen. Rechnet man nun je Kuh mit einer minimalen Leistung von 3500 l Milch im Jahr, so ergibt das 560.000 l Milch oder 20.000 Kilo Butter. Ein Stück der Weide in Größe von 20 ha wurde alljährlich zur Heugewinnung an diese Kuhhalter abgegeben. Die Heumenge betrug etwa 1600 Zentner. Durch diesen Platz wurden die kleinen Pächter der Weiden und Grasflächen gezwungen, zum überwiegenden Teil ihre Kühe abzuschaffen. Nur etwa 5-10 größere landwirtschaftliche Betriebe behielten zum Teil ihren Viehbestand. Es wurde für diese ein Ausgleich geschaffen, sie mussten aber ihre Milchkühe auf sehr weit abgelegene Weiden treiben. Letzteres wiederum erschwerte durch die langen Wege den Betrieb, da sehr viel Zeit für die Heranschaffung der Milch verloren geht. Etwa die Hälfte der voran gegebenen Milch und Buttermenge, d. h. etwa 10.000 Kilo, wurde nun praktisch nicht mehr verwertet und gehen der Fettversorgung des deutschen Volkes verloren, was besonders während des Krieges in der angespannten Fettmarktlage sehr erschwerend ins Gewicht fällt. Die Stadt Hoya hoffte durch die Anlage des Flugplatzes ständige Garnisonsstadt zu werden. Die militärische Entwicklung hat es jedoch mit sich gebracht, dass diese Hoffnungen leider nicht erfüllt wurden. Der Platz war nur vorübergehend von ein paar Kompanien belegt. Die Boden- und Wasserverhältnisse ließen ferner das Rollfeld für den eigentlichen Flugbetrieb kaum in Erscheinung treten, sodass also die großen vorher genutzten Weideflächen praktisch brachliegen bzw. nur noch als Schafweiden gelten. Weitere Bemühungen der Stadt, Kleinindustrienirgendwelcher Art als Ausgleich zu bekommen, schlugen leider fehl. Nach Mitteilung der Bezirksstelle Hannover, der Landesplanungsgemeinschaft Hannover-Braunschweig vom Februar des Jahres wurde uns nun mitgeteilt, dass das Oberkommando der Kriegsmarine ausgebaute Räumlichkeiten für neu zu errichtende Unteroffiziersvorschulen der Marine dringend benötigt. Bei meinem letzten Besuch auf dem Fliegerhorst wurde mir vom Inspektor des Platzes die Mitteilung gemacht, dass nunmehr der Flugplatz einer neuen Bestimmung entgegengeführt werden soll. Es soll ein Luftwaffen-Sanitätspark mit einer Belegschaft von 25 Mann Personal und noch zehn Frauen die ganze Belegschaft dieser Unterkunftsräume sein. Der Flugplatz kann aber normal 1000 Mann Unterkunft geben. Nach sofortigen Bemühungen der Stadt bei dem Oberkommando der Marine ist es gelungen, eine Besichtigung des E-Hafens Hoya zu erwirken. Diese Besichtigung fand am 26. März 1942 statt. Teilnehmer dieser Besichtigung waren: 1. der Oberleutnant zur See Kretschmer vom OKM, 2. der Landrat des Kreises Grafschaft Hoya, 3. der Bereichsleiter der NSDAP des Kreises Grafschaft Hoya, Kreisleiter Wiechmann, 4. der Bezirksplaner Dr. Briefs von der Landesplanungsgemeinschaft Hannover-Braunschweig, 5. der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Hoya, Parteigenosse Becker, 1. Beigeordneter und 6. der stellvertretende Ortsgruppenleiter der NSDAP, Parteigenosse Ostermeyer. Das Ergebnis der Besichtigung ist zusammengefasst folgendes: 1. die vorhandenen Gebäude des derzeitigen Flugplatzes einschließlich der gesamten Inneneinrichtung sind für die Errichtung einer Marine-Unteroffiziervorschule geeignet. 2. die Wasserverhältnisse der Weser rings um den Platz scheinen durchaus zweckmäßig und geeignet. Das Ergebnis dieser Besichtigung berechtigtuns zu der Hoffnung, dass durch die Errichtung der oben genannten Schule eine Dauereinrichtung geschaffen werden kann, damit die sehr schlechte wirtschaftliche Lage der Stadt und der Bevölkerung für immer beseitigt wird. Da die große Weidefläche nach Aussage des Herrn Oberleutnants Kretschmer vom OKM nicht benötigt wird, würde sie der sehr wertvollen Viehhaltung und damit der Versorgung wieder zugeführt werden. Wir bitten, unsere Bemühungen tatkräftig zu unterstützen und uns zu helfen, dass möglichst bald die Unteroffiziervorschule anstelle des jetzigen Flugplatzes nach Hoya verlegt wird. Gezeichnet Becker.“12
Aus einer Unteroffiziersvorschule der Marine ist in Hoya offensichtlich nichts geworden. Nicht besser als zuvor wurde die Entwicklung des Fliegerhorsts im Schreiben Stadt Hoya an den Leiter der Kommunalpolitik des Kreises Grafschaft Hoya vom 22. Januar 1943 festgehalten:
„Ich will meinen Bericht mit der Erbauung und Fertigstellung des Flugplatzes in Hoya beginnen. Von der Inbetriebsetzung des Platzes hatten wir uns alle in Hoya recht viel versprochen, jedoch das Gegenteil ist eingetreten, denn fliegerisch ist der Hoyaer Flugplatz als ungeeignet erklärt.Der Platz wird nun von einem Luft-Sanitätspark mit etwa 30 Mann in Anspruch genommen.“13
Hinsichtlich des nun tatsächlich vorübergehend eingerichteten Luftgau-Sanitätsparks gibt es auch eine Zeitzeugenerinnerung:
„Fliegerhorst. Vom Jungvolk mussten wir dort Medikamente und Verbandzeug verpacken. Kam das Sanitäts-Depot aus Dänemark? Die Leitung hatten Leute die sie vielleicht auch noch kennen. Zahnarzt Cherny, ApothekerLau, später bei Mühlenfeldt, Meyer, der Steuerberater aus Vilsen. Damals waren sie so „um Feldwebel“ auf dem Fliegerhorst. Einige Hoyaer waren dort als Soldat, Chr. Werner, Bornemann, Westhoff und noch einige. Einige Autos waren vorhanden. Eine große Zugmaschine mit Flak, ein kleiner Lastwagen mit Handkurbel. Der kleine Lastwagen sprang nicht immer an, dann mussten wir die Medikamente und Verbandszeug mit dem Plattenwagen zum Güterbahnhof bringen.“14
Der Fliegerhorst wurde später – im Rahmen der jetzt notwendigen „Reichsverteidigung“ - trotz seiner Ungeeignetheit doch noch wieder von Fliegereinheiten genutzt. Dazu passt inhaltlich auch ein Schreiben der Fliegerhorstkommandantur Hoya vom 12.6.1944 an die Stadt Hoya/Weser:
„Da die hier zur Zeit erforderlichen Ausbauarbeiten länger als vorgesehen in Anspruch nehmen, erweist sich die Gestellung von Arbeitskräften über den 15. Juni 1944 hinaus als erforderlich. Es werden bis auf unbestimmte Zeit weiter aus dem Bereich ihrer Gemeinde vier vollwertige Arbeitskräfte benötigt. Weiter werden aus ihrer Gemeinde drei Pferdegespanne mit Wagen zum Transport von Erde bzw. Kohlenschlacke benötigt. Meldung der Gespannführer jeweils um 8: 00 Uhr auf dem Alhuser Felde bzw. bei der Wache des Horstes. Gezeichnet, Oberzahlmeister.“15
Hoya war als sogenannter „E-Hafen“ (Einsatzhafen) konzipiert, der v.a. für den Einsatz von Kampf-, Sturzkampf- und Zerstörergeschwadern gedacht war. Die Rollbahn war absichtlich nicht befestigt, um das Vorhandensein eines Flugplatzes der feindlichen Luftaufklärung möglichst zu verheimlichen. Dennoch war den Alliierten das Vorhandensein eines Fliegerhorstes aber wohl spätestens ab dem Jahre 1943 bekannt.
Das Nebeneinander zwischen zivilen und militärischen Stellen in Hoya verlief auch nicht immer reibungslos. So gab es Differenzen hinsichtlich der Verteilung des Grasschnitts auf der Rollbahn,16 benötigter Grundflächen17 oder der Leuchtbefeuerung des Fliegerhorsts:
„Trotz des Hinweises, dass ein im Park stehender Baum mit roten Leuchten erst dann gefällt werden dürfe, nach dem die Hindernisbefeuerung auf einen danebenstehenden Baum angebracht wurde, ist der betreffende Baum ohne Einhaltung dieser Auflage umgeschlagen. Sollte infolgedessen bei Nachtlandungen Flugzeuge zu Schaden kommen, trägt die Stadtverwaltung die volle Verantwortung. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Bäume mit derartigen Befeuerungen als für die Luftwaffe in Anspruch genommen zu gelten haben und ohne Genehmigung des Horstes nicht gefällt werden dürfen. Kerner, Hauptmann undPlatzkommandant.“18
Gegen diese Sicht des Militärs, wonach sämtliche Bäume mit solchen Landelichtern als „für die Wehrmacht in Anspruch genommen zu gelten haben“ verwahrte sich die Stadt allerdings in ihrer Rückantwort:
„Zu obigem Schreiben teile ich mit, dass ich mich nach unserer telefonischen Vereinbarung mit ihrem Betriebsmeister Kaufmann in Verbindung gesetzt habe. Es ist hier nicht bekannt, dass irgendein Schriftstück vorliegt, dass die Bäume, in denen die Notbeleuchtung angebracht ist, als für die Luftwaffe in Anspruch genommen gelten. Der Baum musste in diesem Jahr gefällt werden, wenn er der Rüstung noch dienen sollte.“19
(2) Die Muna Hoya
Südlich der Landesstraße Hoya – Hassel befand sich zwischen dem Wiedesee (der damals noch nicht existierte) und dem östlich davon verlaufenden Koppelfeldgraben das Munitionsdepot des Fliegerhorstes. Dieses „Munitionslager Hoya“ hatte eine Größe von fünf Hektar. Es handelte sich um vier Bunker von 15 m Länge und 3,5 m Höhe mit zur Tarnung aufgebrachter Dachbegrünung. Gelagert wurden hier für die Luftwaffe Bomben und Munition, die mittels LKW-Transports zum Einsatzflughafen befördert wurden. Die Bunker wurden 1947/48 von der Flächeneigentümerin abgerissen, 1986 wurden auch die Fundamente entfernt.20 Das inzwischen längst wieder als Ackerfläche genutzte Gelände ist heute noch erkennbar.
(3) Der Ausweichhafen
Südwestlich des Einsatzhafens und südlich der Muna lag, jenseits der Landstraße nach Hassel, ein zweites für Starts und Landungen präpariertes Areal, welches an die Alhuser Ahe an grenzte.
„Der Platz befand sich 500 m südlich des Munitionslager („Muna“) und grenzte an die Alhuser Ahe an. Bis in die fünfziger Jahre standen dort noch Reste von Flugzeugen im Wald. Dieser Ausweichflughafen diente nur als Start- und Landebahn vorwiegend für die nach England startenden Bomber. Zum Ende des Krieges wurde dieser Flugplatz zunehmend weniger genutzt. Es existierte nur eineprovisorische Landebahn aus Stahlmatten.“ 21
Ob von dort aus tatsächlich Angriffe auf England geflogen worden sind, dürfte wohl bezweifelt werden, da die Kampfgeschwader ihre Einsätze vornehmlich von französischen Flugplätzen aus unternahmen. Zumindest dürfte der Ausweichflugplatz, gerade weil er unmittelbar an die Alhuser Ahe angrenzte - mit der hier gegebenen Tarnung durch die Bäume der Ahe - zum Unterstellen von Flugzeugen gedient haben.
(4) Die Luftabwehr
Auch hinsichtlich der für einen Fliegerhorst obligatorischen Luftabwehr haben sich keine archivalischen Unterlagen erhalten.
„Flugabwehrgeschütze waren rund um Hoya verteilt. Zwischen Hassel und Hoya standen nördlich der Straße drei8,8 cm und südlich der Straße bei Dieckmann, Alhusen, ebenfalls drei 8,8 cm Flak. Diese wurden gegen Ende des Krieges gegen welche mit dem Kaliber 10,5 cm ersetzt. Außerdem waren auf hölzernen Türmen sowie auf dem Gelände des Fliegerhorstes 2-Zentimeter Flak und Maschinengewehrstände vorhanden. Auf dem Gelände des Bahnhofs Hoya waren zwei Maschinengewehrstände postiert, die von den Eisenbahnern bedient werden mussten. Außerdem stand dort noch eine 10,5 cm Flak auf einemEisenbahnwagen.“22
Demnach war der Fliegerhorst durchaus ausreichend mit Flugabwehrgeschützen bestückt:
„Etwa gegen Kriegsende standen Flakgeschütze zur Heimatverteidigung und zum Schutz des Fliegerhorstes: Anfang bis Mitte des Krieges ein leichtes Geschütz auf der Eisenbahnbrücke. Ein Geschütz am Hingsterweg, nahe Warnkes am Deich. In der Alhuser Ahe, 3-4 hinter Hecken auf den Weiden, links der Straße nach Hassel, wohl Kaliber8,8 cm. Einige am Weg nach Dedendorf, bei der Ziegelei rechts herein. Ein Eisenbahngeschütz, welches beim Bahnhof auf dem Rollbock stand. Dieses Geschütz war mit dem letztenTransport der Kleinbahn von Syke gekommen und konnte nicht mehr über die Eisenbahnbrücke transportiert werden, da die Sprengungen bereits anstanden. Dieses Geschütz wurde von den deutschen Soldaten gesprengt, bevor sie sichüber die Weser zurückzogen.“23
Abbildung 1. Fliegeraufnahme vom 25. März 1945. Am unteren Bildrand ist der östliche Stadtrand Hoyas mit dem Areal der Kasernengebäude des Fliegerhorsts zu erkennen.
Auch über den Dienst auf den Beobachtungstürmen liegen Erinnerungen von Zeitzeugen vor:
„Luftnachrichtenstelle Hoya. Frau Meier war als Luftwaffenhelferin von März bis Oktober 1943 in Hoya tätig. Gebürtig aus Leipzig wurde sie mit 13 weiteren Kameradinnen für die Luftüberwachung eingesetzt. Sie wurden zuerst in Privatquartieren untergebracht und etwas später war ihre Unterkunft der Fliegerhorst Hoya. Der Einsatzort war am Hingster Weg zwischen den Häusern Warneke (am Deich liegend) und Werner (Fahrenholz) Wietzerland. Gleich hinter Warneke befand sich ein gemauerter Flakstand (Frau Meier konnte dazu nicht so genaue Angaben machen,hatte damit auch nichts zu tun). Etwas weiter in Richtung Wietzerland befand sich ein hoher Holzturm, unten eine Baracke für Aufenthalt, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße eine weitere Baracke. Für Materialien und ähnliches. Das Ganze war auf beiden Seiten der Straße von einem Holzzaun umgeben. Es wurden jeweils drei Mädchen rund um die Uhr im Dreischichtsystem eingesetzt. Ihre Aufgabe bestand darin, sämtliche Flugzeugbewegungen im Flug-Wachkommando in Bremen zu melden. Sie hat noch heute detaillierte Kenntnisse über Weltkrieg zwo Flugzeuge zum Beispiel Typen, Tragflächenform, Motor usw. Nachdem die Tieffliegerangriffe immer mehr zunahmen, wurden die Luftwaffenhelferinnen auf weniger gefährliche Positionen versetzt, sie selber kam nach Bassum und wurden vorübergehend durch Luftwaffen-Soldaten ersetzt, bis der Turm nicht mehr besetzt war. Als Episode berichtete sie über hilfreiche Nachbarn. Jeden Tag kamen abwechselnd von der Familie Warneke oder von Familie Werner, Wietzerland, ein Topf Milch und für jede Person ein tägliches Ei. Für die damaligen Zeiten eine willkommene Zusatzverpflegung. Beobachtung. Telefon.Wache. Der Turm wurde zuletzt offenbar durch ein Blinkfeuer ersetzt. Sie sprach von einem Blinkfeuer Maria. Für startende und landende Flugzeuge in Hoya.“24
Frau Meyer stammte ursprünglich aus Leipzig und hat in Hoya ihren Ehemann, einen gebürtigen Hoyaer, kennengelernt:
„Goldene Hochzeit. Kennengelernt hatte sich das Ehepaar über Freunde. Sie kannte die Freundin des Freundes ihres späteren Mannes. Man traf sich zum ersten Mal im Gasthaus im Turm. Das war im Frühjahr 1943.“25
Die Wachtürme wurden auf Privatgrundstücken errichtet, was ebenfalls durchaus zu Streitigkeiten Anlass gab. Die Stadt schrieb - hinsichtlich des Wachturms am Hingster Weg - bereits am 29. April 1940 an das Wehrbezirkskommando in Nienburg:
„Die Witwe Rebecca Warnecke (sic) Hingsterweg 7, macht bei mir Forderung wegen Entschädigung geltend für die Inanspruchnahme ihres Grundstücks seit Oktober 1939 für Zwecke einer Flakabteilung. Es ist auf dem Grundstück ein Wachtturm errichtet. Ohne jede vorherige Vereinbarung von der Flugwachtgruppe.“
b) Verbände und Personal des Fliegerhorste Hoya
Der Einsatzhafen Hoya unterstand dem Luftgau XI, das seinen Sitz anfänglich in Hannover und später in Hamburg hatte. Der Luftgau war in mehrere Flughafen-Bereichskommandos untergliedert. Hoya gehörte zum Flughafen-Bereichskommandos 12/XI, zunächst in Hannover-Langenhagen, dann in Mellendorf. Diese Bereichskommandos untergliederten sich wiederum in einzelne Fliegerhorst-Kommandanturen. Hoya gehörte zur Fliegerhorst-Kommandantur A (o) 23/XI in Wunstorf mit den drei sogenannten „Platzkommandos“ in Langenhagen, Hoya und Vahrenwald. Damit endet aber auch schon die mögliche Aufklärung der Geschehnisse. Das Bundesarchiv verfügt nur über einige wenige Unterlagen, die nach dortigen Angaben (s.o.) aber nur „einen verschwindend geringen Teil der ursprünglichen Überlieferung“ darstellen. Insoweit sind also nur noch „Splitterunterlagen“ vorhanden. Das Bundesarchiv übersandte dem Heimatmuseum in Hoya auf Anfrage bereits am 10. August 1988 zwei Kopien aus den dort unter RL 2 III/373 verwahrten Organisationsverfügungen des Generalquartiermeisters der Luftwaffe über Aufstellungen von Fliegerhorstkommandanturen mit dem Eintrag über eine Fliegerhorstkommandantur in Hoya. Daraus ergibt sich aber lediglich – ohne weitere Details - dass Hoya als Fliegerhorstkommandantur A im Luftgau XI zum 1.10.1939 neu aufgestellt wurde. Weitere Unterlagen über Hoya habe das Bundesarchiv in den nur bruchstückhaft überlieferten Luftwaffenakten nicht ermitteln können. Das Landesarchiv in Hannover hält gleichfalls keine Akten zum Thema vor, da die Wehrmachtsakten in der Zuständigkeit des Bundesarchivs liegen. Das Stadtarchiv in Hoya verfügt selbst nur über einige wenige Hinweise auf die Angelegenheiten des Fliegerhorsts.
Innerhalb der fliegenden Verbände gehörte der Fliegerhorst in Hoya ab 1944 zur Luftflotte „Reich“ und dort zur 2. Jagddivision Stade. Zuvor hatte, jedenfalls um die Jahreswende 1939/1940, eine Bombergruppe eines Kampfgeschwaders (KG) auf dem Hoyaer Fliegerhorst gestanden. So wurde die II. Gruppe des Kampfgeschwaders 54 im Dezember 1939 aus der umbenannten II. Gruppe des Kampfgeschwaders 28 (das selbst erst 1939 aufgestellt worden war) in Hoya neu aufgestellt. Die II. Gruppe des KG 28 war bereits seit November 1939 in Hoya stationiert gewesen. Das II./KG 54 der 2. Luftflotte wurde demnach in Hoya aufgestellt und verfügte in vier Staffeln über ca. 40 Heinkel He 111. Nach weit verbreiteter Ansicht26 habe das Kampfgeschwader 54 mit seiner II. Gruppe von Hoya aus am 14. Mai 1940 Rotterdam angegriffen. Tatsächlich ist die Gruppe aber offenbar schon Ende Januar 1940 wieder von Hoya wegverlegt worden. Der Angriff auf Rotterdam ist daher wohl eher nicht von Hoya, sondern von Quakenbrück, Varrelbusch und Vechta aus geflogen worden.27 Bekannt ist ferner, dass ab Mitte 1944 ganze Jagdgruppen in Hoya stationiert waren. So waren hier – soweit nachweisbar – im Rahmen der „Reichsverteidigung“ vom 11. bis 31. August 1944 die III. Gruppe des Jagdgeschwaders 4 (III/JG 4) und dann ab Ende August bis Oktober 1944 die I. Gruppe des im Jahr zuvor aus Afrika zurückgekehrten Jagdgeschwaders 27 (I/JG 27), die zu dieser Zeit noch über vier Staffeln mit jeweils ca. zehn Me 109 verfügte, stationiert. Zu dieser Zeitangabe ist auch der Absturz des Gefreiten Gerhard Koch, der dem Stab der I/JG 27 angehörte (am 22.9.1944 in Hoya), stimmig (s.u.).
Zumindest im Jahre 1945 waren in der Luftnachrichtenstelle des Fliegerhorsts zudem Teile der 30. Flugmelde-Leitkompanie des Luftnachrichtenregimenter 232 stationiert und es existierte ein Wachkommando, wie sich einem Bericht vom Frühjahr 1944 entnehmen lässt.28