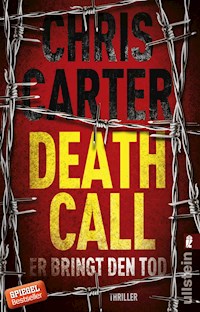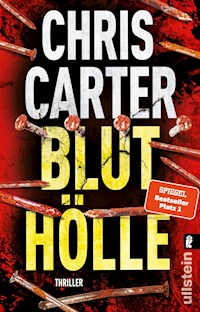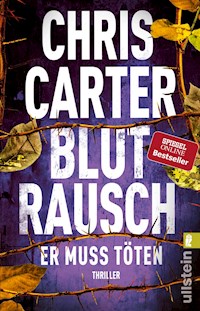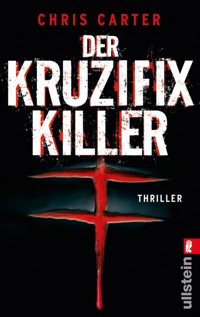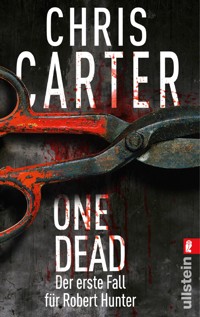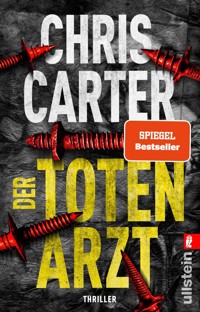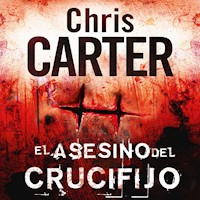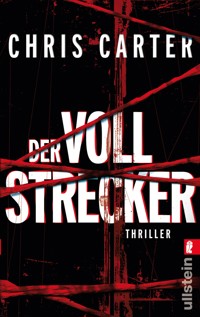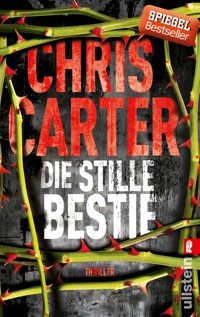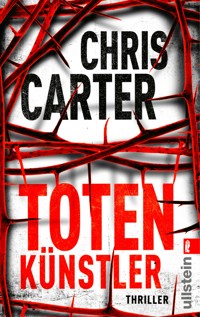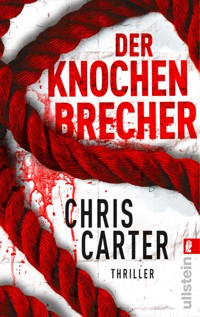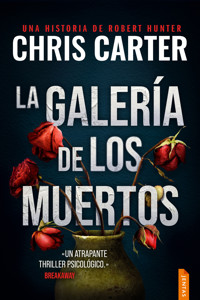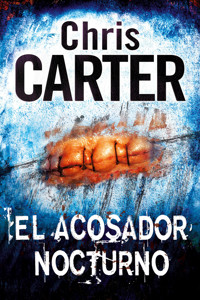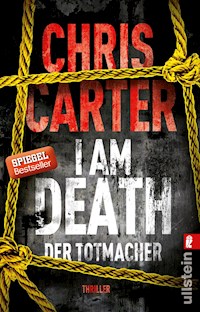
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der 7. Fall der Nr. 1 Bestsellerserie von Chris Carter! Für Hunter und Garcia beginnt eine rätselhafte Ermittlung: morbide, blutig und wahnsinnig fesselnd! Chris Carter hat jahrelang als Kriminalpsychologe für die Polizei in Los Angeles gearbeitet, das macht seine Bücher so einzigartig. Denn ich bin der Tod ... Vor dem Los Angeles International Airport wird eine brutal zugerichtete Leiche gefunden. In ihrem Hals steckt ein Zettel mit einer Botschaft: Ich bin der Tod. Profiler Robert Hunter ist der Einzige, der den Täter finden kann. Bald hat er einen Verdacht. Doch da taucht eine weitere Leiche auf. Ein grausames Spiel beginnt … »I am death ist nicht nur spannend, sondern hat auch einen Plot-Twist mit dem man wirklich gar nicht rechnet. Echt TOP« Amazon-Kundin »Alle Bücher von Chris Carter sind der Hammer. Natürlich nichts für schwache Nerven, denn jedes Buch ist wirklich brutal. Aber er schreibt so fesselnd und spannend, dass man davon einfach nicht weg kommt.« Amazon-Kundin *** Blutige Psycho-Spannung vom Feinsten. Ein Muss für Chris-Carter-Fans! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Eine junge Frau wird tot vor dem Los Angeles International Airport aufgefunden, brutal zugerichtet und wie ein Pentagramm in Menschenform hindrapiert. In ihrer Kehle steckt ein Zettel mit einer in Blut verfassten Nachricht: »Ich bin der Tod.«
Profiler Robert Hunter und sein Partner Carlos Garcia nehmen die Ermittlungen auf. Die Zeit läuft ihnen davon, denn kurz darauf wird eine weitere junge Frau ermordet. Der Modus Operandi ist ein anderer, aber die Handschrift des Täters ist eindeutig – er hinterlässt Botschaften, die an Hunter persönlich gerichtet sind. Hunter wird klar, dass er ein Monster jagt. Er glaubt, den Mörder zu kennen. Doch was, wenn er den Falschen verdächtigt? Und die Wirklichkeit noch viel schlimmer ist?
Der Autor
Chris Carter wurde 1965 in Brasilien als Sohn italienischer Einwanderer geboren. Er studierte in Michigan forensische Psychologie und arbeitete sechs Jahre lang als Kriminalpsychologe für die Staatsanwaltschaft. Dann zog er nach Los Angeles, wo er als Musiker Karriere machte. Gegenwärtig lebt Chris Carter in London. Seine Thriller um Profiler Robert Hunter sind allesamt Bestseller. I Am Death. Der Totmacher ist Hunters siebter Fall.
Von Chris Carter sind in unserem Hause bereits erschienen:
One Dead
Der Kruzifix-Killer
Der Vollstrecker
Der Knochenbrecher
Totenkünstler
Der Totschläger
Die stille Bestie
I Am Death. Der Totmacher
Chris Carter
I AM DEATH
DER TOTMACHER
THRILLER
Aus dem Englischenvon Sybille Uplegger
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1272-9
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Juni 2016
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
© Chris Carter 2015
Published by Arrangement with Luiz Montoro
Titel der englischen Originalausgabe: I Am Death (Simon & Schuster Inc.)
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: Seil: © Arcangel/Mike Dobel; © FinePic®, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
1
»Tausend Dank, dass du so kurzfristig kommen konntest, Nicole«, sagte Audrey Bennett, als sie die Tür zu ihrem weißen zweigeschossigen Haus im Upper Laurel Canyon, einer wohlhabenden Wohngegend in den Hollywood Hills von Los Angeles, öffnete.
Nicole antwortete mit einem freundlichen Lächeln.
»Ist doch überhaupt kein Problem, Mrs Bennett.«
Nicole Wilson war in Evansville, Indiana, geboren und aufgewachsen und sprach mit einem unverwechselbaren Midwestern-Akzent. Mit ihren eins sechzig war sie eher klein geraten, und ihr Gesicht taugte nicht gerade als Material für Modemagazine, aber sie war immer freundlich und verfügte über ein bezauberndes Lächeln.
»Komm rein, komm rein«, bat Audrey und bedeutete Nicole einzutreten. Sie schien sehr in Eile zu sein.
»Tut mir leid, dass ich ein bisschen spät dran bin«, sagte Nicole und kam ins Haus, während sie gleichzeitig einen Blick auf ihre Armbanduhr warf. Es war kurz nach halb neun.
Audrey lachte. »Ich glaube, du bist so ziemlich die einzige Person in ganz Los Angeles, die sich dafür entschuldigt, wenn sie nicht mal zehn Minuten zu spät kommt. Alle anderen, die ich kenne, finden das eher elegant.«
Nicole lächelte, wirkte aber nach wie vor ein wenig unglücklich. Sie legte immer größten Wert auf Pünktlichkeit.
»Das ist ein wunderschönes Kleid, Mrs Bennett. Haben Sie heute Abend was Besonderes vor?«
Audrey schürzte die Lippen und verzog das Gesicht. »Abendessen bei einem Richter.« Sie beugte sich zu Nicole herunter. Die nächsten Worte sagte sie im Flüsterton. »Das wird soooo langweilig.«
Nicole kicherte.
»Oh, hallo, Nicole«, grüßte James, Audreys Mann, der gerade die geschwungene Treppe aus dem ersten Stock herunterkam. Er trug einen eleganten dunkelblauen Anzug mit einer gestreiften Seidenkrawatte und dem dazu passenden Einstecktuch, dessen oberer Rand ein kleines Stückchen aus der Brusttasche seines Sakkos herausschaute. Seine karamellblonden Haare waren wie immer streng nach hinten gekämmt, keine Strähne wagte es, aus der Reihe zu tanzen.
»Bist du dann so weit, Schatz?«, wandte er sich an seine Frau, ehe er flüchtig auf seine Patek Philippe sah. »Wir müssen los.«
»Ja, ich weiß, James, ich komme gleich«, antwortete Audrey, bevor sie sich noch einmal an Nicole wandte. »Josh schläft schon«, erklärte sie ihr. »Er hat den ganzen Tag getobt und gespielt – zum Glück, um acht war er nämlich so erledigt, dass er vor dem Fernseher eingeschlafen ist. Wir haben ihn dann bettfertig gemacht, und sein Kopf lag noch nicht mal auf dem Kissen, da war er schon wieder eingeschlafen.«
»Wie süß«, sagte Nicole.
»So, wie der kleine Teufel heute herumgerannt ist«, klinkte sich James Bennett ein, als er auf Audrey und Nicole zutrat, »schläft er bestimmt bis morgen früh durch. Es dürfte also ein entspannter Abend für dich werden.« Er nahm Audreys Mantel von dem Ledersessel zu seiner Rechten und half seiner Frau hinein. »Wir müssen jetzt wirklich fahren, Liebling«, raunte er ihr ins Ohr, bevor er ihr einen Kuss auf den Nacken gab.
»Schon gut, schon gut«, beschwichtigte Audrey ihn, während sie gleichzeitig mit dem Kopf in Richtung der Tür deutete, die neben dem Kamin aus Flussstein an der östlichen Seite des riesigen Wohnzimmers abging. »Geh ruhig in die Küche und bedien dich, wenn du etwas möchtest. Du kennst dich ja aus, oder?«
Nicole nickte.
»Falls Josh aufwacht und noch ein Stück von dem Schokoladenkuchen will, gib ihm nichts. Das Letzte, was er braucht, ist ein Zuckerschock mitten in der Nacht.«
»Alles klar«, sagte Nicole und lächelte erneut.
»Kann sein, dass es ziemlich spät wird«, setzte Audrey noch hinzu. »Ich rufe zwischendurch mal an, um mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist.«
»Viel Spaß heute Abend«, wünschte Nicole den beiden und begleitete sie zur Tür.
Als Audrey die Stufen vor der Haustür hinablief, warf sie Nicole noch einen letzten Blick zu und sagte lautlos: »Langweilig!«
Nachdem sie die Haustür wieder geschlossen hatte, ging Nicole als Erstes nach oben und schlich auf Zehenspitzen in Joshs Zimmer. Der Dreijährige schlief wie ein Engel, ein Kuscheltier mit riesigen Augen und Ohren fest im Arm. Nicole stand lange im Türrahmen und betrachtete ihn. Mit seinen blonden Locken und den rosigen Bäckchen sah er so entzückend aus, dass sie sich am liebsten zu ihm gelegt und mit ihm geknuddelt hätte. Aber sie wollte ihn nicht aufwecken. Also beschränkte sie sich darauf, ihm von der Tür aus eine Kusshand zuzuwerfen, und kehrte dann nach unten zurück.
Sie machte es sich im Wohnzimmer gemütlich und schaute eine alte Komödie im Fernsehen an, bis nach etwa einer Stunde ihr Magen recht eindeutige Geräusche von sich gab. Erst jetzt fiel ihr wieder ein, dass Audrey etwas von einem Schokoladenkuchen erwähnt hatte. Sie sah auf die Uhr. Es war definitiv Zeit für einen kleinen Snack, und ein Stück Schokokuchen wäre genau das Richtige. Nicole verließ das Wohnzimmer und lief noch einmal rasch nach oben, um nach Josh zu sehen. Als sie zurück nach unten kam, durchquerte sie das Wohnzimmer und öffnete die Tür zur Küche.
»Uaah!«, schrie sie und machte einen Satz rückwärts.
»Uaah!«, rief der Mann, der am Küchentisch saß und ein Sandwich aß, eine Millisekunde später. Vor lauter Schreck ließ er sein Sandwich fallen und sprang vom Tisch auf, wobei er sein Glas Milch umwarf. Hinter ihm fiel polternd sein Stuhl zu Boden.
»Wer um alles in der Welt sind Sie?«, fragte Nicole mit pochendem Herzen und zog sich vorsichtshalber noch einen Schritt zurück.
Der Mann betrachtete sie einige Sekunden lang verdattert, als versuche er, sich darüber klarzuwerden, was genau hier eigentlich vor sich ging. »Ich bin Mark«, sagte er schließlich und deutete mit beiden Händen auf sich.
Sie starrten einander eine Zeitlang schweigend an, bis Mark erkennen musste, dass die Frau mit diesem Namen nicht das Geringste anfangen konnte.
»Mark?«, wiederholte er. Er machte aus jedem Satz eine Frage, als wundere er sich, dass Nicole dies alles nicht wusste. »Audreys Cousin aus Texas? Ich bin für ein paar Tage in der Stadt, weil ich ein Vorstellungsgespräch habe? Ich wohne in der Wohnung über der Garage?« Mit dem Daumen deutete er über seine rechte Schulter.
Nicoles Blick wurde nur noch fragender.
»Audrey und James haben Ihnen doch von mir erzählt, oder etwa nicht?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf.
»Oh!« Jetzt war Mark vollends verwirrt. »Hmm, also, wie gesagt, ich bin Mark, Audreys Cousin. Und Sie sind sicher Nicole, die Babysitterin, stimmt’s? Die beiden haben mir schon gesagt, dass Sie heute Abend kommen. Und es tut mir leid, ich wollte Sie wirklich nicht erschrecken – auch wenn Sie es mir ja mit gleicher Münze heimgezahlt haben.« Er legte sich die rechte Hand an die Brust und tippte mit den Fingern ein paarmal auf seine Herzgegend. »Ich habe fast einen Infarkt erlitten.«
Nicoles misstrauischer Blick wurde ein klein wenig sanfter.
»Ich bin heute Morgen hergeflogen. Ich hatte heute Nachmittag ein wichtiges Bewerbungsgespräch«, klärte Mark sie auf.
Er trug einen Anzug, der nagelneu zu sein schien und sehr elegant aussah. Außerdem war er ziemlich attraktiv.
»Ich bin erst vor zehn Minuten zurückgekommen«, fuhr er fort. »Und plötzlich hat mich mein Magen daran erinnert, dass ich den ganzen Tag noch nichts Anständiges gegessen habe.« Er legte den Kopf schief. »Wenn ich nervös bin, kriege ich nichts runter. Also wollte ich mir schnell noch ein Sandwich und ein Glas Milch holen.« Sein Blick ging zu seinem Platz, und er lachte leise. »Wobei Letztere jetzt quer über den Tisch verteilt ist und langsam auf den Boden tropft.«
Er hob den umgefallenen Stuhl auf und hielt dann Ausschau nach etwas, womit er die Milchpfütze aufwischen konnte. Neben einer großen Obstschale auf dem Tresen entdeckte er eine Rolle Küchenkrepp.
»Ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, dass Audrey vergessen hat, Ihnen zu sagen, dass ich hier übernachte«, gestand Mark, während er die Milch vom Boden beseitigte.
»Na ja, sie hatten es ziemlich eilig«, räumte Nicole ein. Ihre Körperhaltung hatte sich ein wenig entspannt. »Mrs Bennett hatte mich eigentlich gebeten, schon um acht zu kommen, aber ich konnte nicht vor halb neun und habe mich dann auch noch ein paar Minuten verspätet.«
»Aha, verstehe. Ist Josh noch wach? Ich würde ihm gerne gute Nacht sagen.«
Nicole schüttelte den Kopf. »Nein, er schläft schon tief und fest.«
»Er ist so ein toller Junge«, sagte Mark, als er die durchnässten Papiertücher zusammenknüllte und in den Mülleimer warf.
Nicole beobachtete ihn noch immer aufmerksam. »Sagen Sie mal«, meinte sie schließlich. »Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass wir uns schon mal begegnet sind?«
»Nein«, gab Mark zurück. »Ich bin zum allerersten Mal hier in L. A. Wahrscheinlich kennen Sie mich von den Fotos im Wohnzimmer und in James’ Büro. Auf zweien bin ich mit drauf. Außerdem haben Audrey und ich dieselben Augen.«
»Die Fotos. Ja, das wird es sein«, meinte Nicole. Eine verschwommene Erinnerung tauchte am äußersten Rand ihres Gedächtnisses auf, nahm aber keine Gestalt an.
Schließlich zerriss das Klingeln eines Handys ihr verlegenes Schweigen.
»Ist das Ihres?«, erkundigte sich Mark.
Nicole nickte.
»Wahrscheinlich will Audrey Ihnen sagen, dass sie vergessen hat, Ihnen von mir zu erzählen.« Er zuckte schmunzelnd mit den Schultern. »Tja. Zu spät.«
Nicole erwiderte sein Lächeln. »Ich geh da mal lieber ran.« Sie verließ die Küche und ging ins Wohnzimmer, wo sie ihr Handy aus der Tasche holte. Der Anruf war tatsächlich von Audrey Bennett.
»Hi, Mrs Bennett. Wie ist das Abendessen?«
»Noch langweiliger, als ich befürchtet hatte. Das wird ein langer Abend. Aber egal. Ich wollte nur schnell fragen, ob soweit alles in Ordnung ist.«
»Ja, alles prima«, war Nicoles Antwort.
»Ist Josh aufgewacht?«
»Nein, nein. Ich habe eben nach ihm geschaut. Der wird sich so schnell nicht rühren, glaube ich.«
»Wunderbar.«
»Ach, übrigens, ich bin gerade Mark begegnet. In der Küche.«
Aus der Leitung kam ein lautes Hintergrundgeräusch.
»Entschuldige, Nicole, was hast du gesagt?«
»Dass ich gerade Mark begegnet bin. Ihrem Cousin aus Texas, der über der Garage wohnt. Ich kam in die Küche, und er saß am Tisch und hat ein Sandwich gegessen. Wir haben uns beide zu Tode erschreckt.« Sie lachte.
Eine Weile herrschte Stille, dann sagte Audrey: »Nicole, wo ist er jetzt? Ist er nach oben in Joshs Zimmer gegangen?«
»Nein, er ist immer noch in der Küche.«
»Okay, Nicole, hör mir gut zu.« Audreys Tonfall war auf einmal ganz ernst, aber zugleich zitterte ihre Stimme ein wenig. »Geh nach oben und hol Josh, so schnell und so leise, wie du kannst, und dann macht, dass ihr aus dem Haus kommt. Ich rufe die Polizei.«
»Was?«
»Nicole. Ich habe keinen Cousin, der Mark heißt und aus Texas kommt. Und bei uns wohnt auch niemand in der Wohnung über der Garage. Ihr müsst raus aus dem Haus … sofort. Hast du mich verst–«
KLONK.
»Nicole?«
»Nicole?«
Die Leitung war tot.
2
Detective Robert Hunter vom Raub- und Morddezernat des LAPD öffnete die Tür zu seinem kleinen Büro im fünften Stock des berühmten Police Administration Building im Stadtzentrum von Los Angeles und trat ein. Die Wanduhr zeigte sechs Uhr dreiundvierzig an.
Hunter sah sich um. Es war auf den Tag genau zwei Wochen her, seit er das Büro zuletzt betreten hatte. Eigentlich hatte er gehofft, erholt und braungebrannt zurückzukommen; stattdessen war er erschöpft bis auf die Knochen und ziemlich sicher, dass er noch nie so blass ausgesehen hatte wie jetzt.
Es hätte eine Rückkehr aus dem Urlaub sein sollen – sein erster Urlaub seit fast sieben Jahren. Sechzehn Tage zuvor hatten sie ihren letzten Fall abgeschlossen, und danach hatte ihr Captain ihm und seinem Partner befohlen, sich zwei Wochen freizunehmen, um auszuspannen. Hunter hatte sich für Hawaii entschieden – ein Reiseziel, das er schon länger im Auge hatte –, doch am Tag seiner geplanten Abreise hatte Adrian Kennedy, ein alter Freund und Leiter des Nationalen Zentrums für die Analyse von Gewaltverbrechen NCAVC beim FBI, ihn um Hilfe gebeten. Er sollte einen im Zuge eines Doppelmordes festgenommenen Verdächtigen verhören. Hunter hatte es nicht über sich gebracht, nein zu sagen, und so war er statt auf Hawaii in Quantico, Virginia, gelandet. Ursprünglich sollten die Vernehmungen nicht länger als ein paar Tage dauern, doch unversehens war Hunter in einen Fall hineingezogen worden, nach dem in seinem Leben nichts mehr so war wie zuvor.
Es war keine vierundzwanzig Stunden her, dass er und das FBI den Fall zu den Akten gelegt hatten. Danach hatte Kennedy wieder einmal versucht, das einstige Wunderkind Hunter zu überreden, in sein Team zu wechseln.
Hunter war als einziges Kind armer Eltern in Compton aufgewachsen, einem sozialen Brennpunktbezirk im Süden von Los Angeles. Seine Mutter erlag einem Krebsleiden, als er gerade sieben Jahre alt war. Sein Vater heiratete danach nicht wieder und musste zeitweise in zwei Jobs arbeiten, um seinen Sohn durchzubringen.
Schon früh stellte sich heraus, dass Hunter anders war. Sein Verstand arbeitete schneller als der von Gleichaltrigen. In der Schule war er unterfordert und frustriert. Den Unterrichtsstoff der sechsten Klasse etwa lernte er in weniger als zwei Monaten, und nur um sich nicht noch mehr zu langweilen, eignete er sich in eigenständiger Arbeit auch noch den Stoff der siebten, achten, ja, sogar der neunten Klasse an.
Zu dem Zeitpunkt beschloss sein Schulleiter zu handeln. Er setzte sich mit dem Schulamt in Verbindung, und nach einer Reihe von Tests und Prüfungen erhielt Hunter im Alter von zwölf Jahren ein Stipendium für die Mirman School für Hochbegabte.
Mit vierzehn hatte er sich den kompletten Highschool-Stoff in Englisch, Geschichte, Mathematik, Biologie und Chemie beigebracht. Von vier Highschool-Jahren übersprang er zwei und machte mit fünfzehn einen Einser-Abschluss. Dank Empfehlungen von allen seinen Lehrern wurde Hunter als Juniorstudent an der Stanford University angenommen. Mit neunzehn hatte er bereits ein Psychologie-Diplom – summa cum laude – in der Tasche, und mit dreiundzwanzig wurde ihm die Doktorwürde in Kriminal- und Biopsychologie verliehen. Das war der Moment, in dem Adrian Kennedy zum ersten Mal versuchte, Hunter für das FBI anzuwerben.
Hunters Dissertation mit dem Titel »Psychologische Deutungsansätze krimineller Verhaltensmuster« hatte zufällig den Weg auf Kennedys Schreibtisch gefunden. Er und der FBI-Direktor waren so beeindruckt, dass sie den Text zur Pflichtlektüre am NCAVC machten. Seitdem hatte Kennedy mehrmals versucht, Hunter für sein Team zu gewinnen. Es wollte ihm einfach nicht in den Kopf, dass Hunter lieber als Detective bei der Polizei arbeitete, als Mitglied der fortschrittlichsten Sondereinheit zur Ergreifung von Serientätern zu werden, die es in den ganzen Vereinigten Staaten, vermutlich sogar auf der ganzen Welt, gab. Doch Hunter hatte nie auch nur einen Funken Interesse an einem Posten beim FBI gezeigt und jedes Angebot, das Kennedy und seine Vorgesetzten ihm unterbreitet hatten, ausgeschlagen.
Hunter saß an seinem Schreibtisch, jedoch ohne seinen Computer einzuschalten. Es kam ihm merkwürdig vor, dass alles noch genauso war wie immer und zugleich vollkommen anders. Genau wie immer, weil in seiner Abwesenheit nichts angerührt worden war. Vollkommen anders, weil etwas fehlte. Oder besser: jemand – der Mann, der seit nunmehr sechs Jahren Hunters Partner war. Detective Carlos Garcia.
Ihr letzter gemeinsamer Fall vor dem Zwangsurlaub hatte sie auf die Fährte eines extrem sadistischen Serienmörders geführt, der seine Morde live im Internet übertrug. Die Ermittlungen hatten ihnen nicht nur mental das Äußerste abverlangt, sondern Hunter beinahe das Leben gekostet und darüber hinaus Garcias Frau in große Gefahr gebracht. Garcia hatte sich geschworen, es nie wieder so weit kommen zu lassen.
Unmittelbar vor ihrem Urlaub hatte er daher seinem Partner offenbart, dass er nicht wisse, ob er nach seiner Auszeit ins Morddezernat I zurückkehren werde. Seine Prioritäten hatten sich geändert. Er musste an seine Familie denken, alles andere kam an zweiter Stelle.
Hunter selbst hatte keine Familie. Er war nicht verheiratet. Hatte keine Kinder. Aber er konnte die Sorgen seines Partners nachempfinden, und er war sicher, dass er die richtige Entscheidung treffen würde. Wie auch immer die am Ende aussah.
Das Morddezernat I des LAPD war eine Elite-Einheit, die sich ausschließlich mit Serienmorden und Tötungsdelikten befasste, die stark im Licht der Öffentlichkeit standen, zeitaufwendige Ermittlungen und spezielles Fachwissen erforderten. Als studierter Kriminologe und Psychologe kam Hunter innerhalb des Dezernats I eine ganz besondere Rolle zu. Alle Morde, bei denen der Täter mit extremer Brutalität und/oder Sadismus vorgegangen war, wurden innerhalb des Dezernats als »ultra violent«, kurz: »UV« eingestuft. Hunter und Garcia bildeten zusammen die UV-Einheit des Dezernats, und Garcia war der beste Freund und Partner, den Hunter sich jemals hätte wünschen können.
Endlich beugte Hunter sich vor, um seinen Rechner einzuschalten, doch noch ehe sein Finger den Knopf berührt hatte, wurde die Tür zum Büro geöffnet, und Garcia kam herein.
»Oh!«, sagte Garcia verblüfft, als er einen Blick auf die Uhr an der Wand warf. »Du bist aber früher dran als sonst, Robert.«
Hunter sah ebenfalls nach der Zeit – sechs Uhr einundfünfzig –, dann zu seinem Partner. Dessen langes braunes Haar war zu einem glatten Pferdeschwanz zurückgebunden, noch feucht von der Dusche. Seine Augen wirkten müde und besorgt.
»Ja, mag sein«, antwortete Hunter.
»Besonders braun bist du ja nicht für jemanden, der gerade von einem Hawaii-Urlaub zurückkommt.« Garcia stutzte, dann sah er Hunter stirnrunzelnd an. »Du warst doch im Urlaub, oder?« Hunter war der unverbesserlichste Workaholic, den Garcia je gekannt hatte.
»Wie man’s nimmt«, sagte Hunter mit einem unbestimmten Nicken.
»Und das heißt was?«
»Ich habe freigenommen«, erklärte Hunter. »Ich war bloß nicht auf Hawaii.«
»Wo warst du denn dann?«
»Ach, nicht der Rede wert. Ich habe einen alten Bekannten an der Ostküste besucht.«
»Aha.«
Garcia spürte sehr wohl, dass dies nicht die ganze Geschichte war, aber er kannte Hunter gut genug, um zu wissen, dass es sinnlos wäre, ihn zu drängen: Er würde nicht darüber reden, wenn er es nicht wollte.
Garcia ging zu seinem Schreibtisch, setzte sich aber nicht hin. Er schaltete auch seinen Computer nicht ein. Stattdessen öffnete er die oberste Schublade und begann den Inhalt auszuräumen. Er legte alles auf seinen Schreibtisch.
Hunter beobachtete seinen Partner, ohne etwas zu sagen. Schließlich sah Garcia zu ihm hoch und brach das befangene Schweigen, das sich im Raum ausgebreitet hatte. »Tut mir leid, Partner«, sagte er, als er nun auch die zweite Schublade auszuleeren begann.
Hunter nickte einmal kurz.
»Ich habe lange und gründlich über alles nachgedacht, Robert«, vertraute Garcia ihm an. »Die letzten zwei Wochen habe ich praktisch nichts anderes gemacht. Ich habe mir alle Möglichkeiten durch den Kopf gehen lassen, alles gegeneinander abgewogen, und ich weiß, dass ich es von einem rein persönlichen Standpunkt aus vermutlich den Rest meines Lebens bereuen werde. Aber ich weiß auch, dass ich nicht zulassen kann, dass Anna jemals wieder so etwas durchmacht, Robert. Sie ist alles für mich. Wenn ihr wegen meiner Arbeit etwas zustieße, würde ich mir das niemals verzeihen.«
»Das verstehe ich«, gab Hunter zurück. »Und ich mache dir auch keinen Vorwurf daraus. Im Gegenteil. Ich hätte genauso gehandelt.«
Diese von Herzen kommenden Worte entlockten Garcia ein mattes, aber dankbares Lächeln. Hunter bemerkte, wie sehr seinem Partner die Situation an die Nieren ging.
»Du bist mir keine Erklärung schuldig, Carlos. Mir ganz bestimmt nicht.«
»Ich bin dir sogar noch viel mehr schuldig, Robert«, widersprach Garcia. »Ich verdanke dir mein Leben. Ich verdanke dir Annas Leben. Allein deinetwegen sind wir beide nicht tot, hast du das etwa schon vergessen?«
Hunter wollte nicht über die Vergangenheit sprechen, also wechselte er lieber das Thema.
»Apropos, wie geht es Anna?«
»Überraschend gut, wenn man bedenkt, was sie erleiden musste«, antwortete Garcia, der mittlerweile beide Schubladen vollständig geleert hatte. »Sie ist für ein paar Tage zu ihren Eltern gefahren.«
»Sie ist eine unglaublich starke Frau«, sagte Hunter. »Körperlich und seelisch.«
»Das ist sie.«
Erneut senkte sich eine befangene Stille über den Raum.
»Und? Was habt ihr jetzt vor?«, fragte Hunter irgendwann.
Garcia hielt inne und sah seinen Partner an. Er wirkte ein bisschen verlegen.
»Wir ziehen nach San Francisco.«
Hunter konnte sein Erstaunen nicht verbergen.
»Ihr wollt weg aus L. A.?«
»Wir sind übereingekommen, dass es so das Beste ist, ja.«
Damit hatte Hunter nicht gerechnet. Er nickte schweigend. »Das Morddezernat von San Francisco kann sich glücklich schätzen, dich zu bekommen.«
Garcias Verlegenheit wurde noch größer. »Ich gehe nicht zum Morddezernat.«
Hunters Erstaunen schlug in Verwirrung um. Schließlich wusste er, wie lange und hart Garcia darum gekämpft hatte, Detective im Morddezernat zu werden.
»Sondern zum Betrugsdezernat«, sagte Garcia endlich. »Das ist in etwa vergleichbar mit unserer White Collar Crime Unit, WCCU.«
Hunter glaubte, sich verhört zu haben.
Die WCCU war die Abteilung für Wirtschaftskriminalität des LAPD, die in schweren Betrugsfällen mit mehreren Verdächtigen oder Opfern ermittelte. Sie war zuständig für Unterschlagung, schweren Diebstahl, Bestechung und Veruntreuung durch städtische Angestellte, Regierungsbeamte und andere Amtspersonen. Innerhalb des LAPD war das WCCU als eine Einheit verschrien, in der man als Detective eher unfreiwillig landete.
Garcia hob in einer Geste der Kapitulation die Hände. »Ich weiß, ich weiß. Das ist ziemlich mies. Aber das ist im Moment die einzige freie Stelle dort. Und Anna freut sich natürlich, dass der neue Job nicht so gefährlich ist. Nach dem, was passiert ist, kann ich ihr das auch kaum verübeln.«
Hunter wollte gerade etwas erwidern, da klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch. Er nahm ab, hörte etwa fünf Sekunden lang zu und legte schließlich den Hörer zurück auf die Gabel, ohne ein Wort gesagt zu haben.
»Ich muss zum Captain«, verkündete er, stand auf und trat von seinem Schreibtisch weg.
Garcia machte dasselbe. Sie standen mitten im Büro und sahen sich lange an. Garcia war derjenige, der den ersten Schritt machte. Er breitete die Arme aus und umarmte Hunter, als wäre dieser sein lange verschollener Bruder.
»Danke, Robert«, sagte er und sah Hunter ins Gesicht. »Für alles.«
»Meld dich mal«, bat Hunter. In seiner Stimme schwang eine kaum hörbare Traurigkeit mit.
»Mache ich.« Als Hunter zur Tür ging, hielt Garcia ihn zurück. »Robert.«
Hunter drehte sich um.
»Pass auf dich auf.«
Hunter nickte und verließ das Büro.
3
Sie glotzten ihn schon wieder an.
Die Dunkelhaarige und ihre Freundinnen.
Das machten sie oft: Sie glotzten, kicherten, und dann glotzten sie weiter. Nicht, dass ihm das was ausgemacht hätte. An solche Sachen war der elfjährige Ricky Temple mittlerweile gewöhnt. Mit seinen gebrauchten Kleidern, den struppigen schwarzen Haaren, den dürren Armen und Beinen, der spitzen Nase und den Segelohren fiel er immer und überall auf. Und wurde ausgelacht. Dass er ziemlich klein für sein Alter war, kam noch erschwerend hinzu.
Fünf Schulen in den letzten drei Jahren, weil sein Vater keinen Job halten konnte, und es war überall dasselbe: Die Mädchen machten sich über ihn lustig. Die Jungs schubsten ihn herum oder verprügelten ihn. Die Lehrer lobten ihn für seine guten Noten.
Ricky betrachtete die Klassenarbeit auf seinem Pult. Er war über zwanzig Minuten vor den anderen fertig geworden. Obwohl er den Blick gesenkt hatte, spürte er die Blicke der anderen im Nacken. Hörte ihr gehässiges Kichern.
»Ist an der Klassenarbeit irgendetwas komisch, Miss Stewart?«, fragte Mr Driscall, ihr Mathelehrer in der Achten, sarkastisch.
Lucy Stewart war ein ausgesprochen hübsches Mädchen mit leuchtenden haselnussbraunen Augen und pechschwarzen glatten Haaren mit Pony, die zum Pferdeschwanz gebunden genauso schön aussahen wie offen. Sie hatte ein bezauberndes Lächeln, und ihre Haut war unglaublich rein für eine Vierzehnjährige. Die meisten Mädchen in ihrem Alter hatten bereits mit den ersten Anzeichen von Akne zu kämpfen, doch Lucy schien gegen solche Dinge immun zu sein. Jeder Junge auf der Morningside Junior High schwärmte für sie, aber sie gehörte Brad Nichols. Behauptete der jedenfalls. Ricky dachte insgeheim immer, wenn man im Lexikon die Definition von »Arschloch« aufschlagen würde, müsste eigentlich neben dem Eintrag Brads Foto abgebildet sein.
»Nein, gar nicht, Sir«, antwortete Lucy und rutschte auf ihrem Stuhl hin und her.
»Sind Sie fertig, Miss Stewart?«
»Fast, Sir.«
»Dann hören Sie mit dem Gekicher auf und arbeiten Sie weiter. Sie haben nur noch eine Viertelstunde.«
Im Klassenzimmer brach hektische Geschäftigkeit aus.
Lucy hatte erst die Hälfte der Aufgaben gelöst. Sie hasste Mathe. Eigentlich hasste sie fast alle Fächer. Vor allem, weil sie wusste, dass sie dazu bestimmt war, Hollywoodstar zu werden.
Ricky kaute auf seinem Bleistift und kratzte sich an der Nasenspitze. Am liebsten hätte er sich umgedreht und zurückgeglotzt. Aber Ricky Temple tat nur sehr selten das, was er wollte. Er war zu schüchtern … und er fürchtete sich vor den Konsequenzen.
»Alle herhören … die Zeit ist um! Legt mir die Zettel beim Rausgehen auf den Tisch.«
Der Gong ertönte, und Ricky fiel ein Stein vom Herzen. Wieder eine Woche geschafft. Jetzt war Wochenende, da konnte er endlich allein sein und das tun, was er am liebsten tat – Geschichten schreiben.
Ricky ging an seinen Spind und zog sich eine kurze Hose an, ehe er seine Bücher in seinen verblichenen grünen Rucksack stopfte und sein rostiges altes Fahrrad vom Fahrradständer am Schuleingang holte. Er konnte es gar nicht erwarten, von hier wegzukommen.
Er bog in die West 104th Street ein und nahm die Abkürzung über die South 7th Avenue. Ricky liebte die Häuser in diesem Teil der Stadt. Sie waren groß und farbenfroh mit wunderschönen Vorgärten und prächtigen Blumenbeeten. Einige von ihnen hatten sogar einen Swimmingpool im Garten. Eine ganz andere Welt als die armselige Wohnung in Inglewood, South Los Angeles, in der er zusammen mit seinem prügelnden Vater wohnte. Seine Mutter hatte sich aus dem Staub gemacht, als Ricky sechs gewesen war. Seitdem hatte er sie nicht mehr gesehen, aber er dachte jeden Tag voller Sehnsucht an sie.
Ricky hatte sich geschworen, dass er eines Tages auch ein Haus mit großem Garten und Swimmingpool besitzen würde. Er würde Schriftsteller werden. Ein erfolgreicher Schriftsteller.
Ricky war so in seine Gedanken vertieft, dass er die näher kommenden Fahrräder gar nicht hörte. Als er sie bemerkte, war es schon zu spät.
Eins der Räder fuhr von links ganz dicht an ihn heran und drängte ihn gegen die hohe Bordsteinkante des Gehwegs. Vor lauter Angst trat Ricky schneller in die Pedale, statt zu bremsen.
»Wo willst du denn hin, du Spast?«, rief der Junge auf dem anderen Fahrrad. Er hatte eine Kapuze auf dem Kopf, und die untere Hälfte seines Gesichts war unter einem blau-weiß gemusterten Tuch verborgen. »Du hast in dieser Nachbarschaft nichts verloren, du hässliches Klappergestell. Los, verpiss dich in deinen dreckigen Slum.«
Zwei andere Jungs begannen ebenfalls, Ricky zu beschimpfen, aber der war so verängstigt, dass er sie gar nicht richtig hörte.
Ricky hatte keinen Platz mehr, sein Vorderrad schrammte schon am Bordstein entlang. Er zitterte am ganzen Leib. Ihm war klar, dass er jeden Moment stürzen würde. Plötzlich tauchte noch ein zweiter Radfahrer mit Kapuze auf und trat ihm gegen das linke Bein, so dass er mitsamt Fahrrad auf den Gehsteig flog. Der Aufprall war hart, und er schlitterte noch einen ganzen Meter, wobei die Haut an seinen Händen und Knien fast vollständig abgeschürft wurde. Sein Fahrrad landete direkt auf seinen Beinen, was höllisch weh tat.
»Buu-huu! Die hässliche Kröte ist vom Rad gefallen«, hörte Ricky einen der Jungs sagen, ehe sie laut lachend davonfuhren.
Ricky lag einen Augenblick lang da, die Augen ganz fest zugekniffen, und kämpfte gegen die Tränen an. Er glaubte das Geräusch herbeieilender Schritte zu hören.
»Hey, geht es dir gut?«, erklang kurz darauf eine männliche Stimme.
Ricky öffnete die Augen. Alles war verschwommen.
»Geht es dir gut?«, fragte die Stimme erneut.
Ricky spürte, wie jemand das Fahrrad von seinen Beinen hob. Seine Hände und Knie schmerzten, als wären sie mit kochendem Wasser übergossen worden. Als er aufsah, kniete ein Mann neben ihm. Er trug einen dunklen Anzug, ein schickes weißes Hemd und eine rote Krawatte. Seine gewellten braunen Haare waren leicht zerzaust. Er hatte eine hohe Stirn, ausgeprägte Wangenknochen und ein kräftiges Kinn mit einem sauber gestutzten Ziegenbärtchen. Seine hellblauen Augen blickten besorgt.
»Was waren das für Jungs?«, wollte er von Ricky wissen und deutete mit einer Kopfbewegung in die Richtung, in der die Bande verschwunden war. Er wirkte verärgert.
»Was?«, sagte Ricky, immer noch ein bisschen durcheinander.
»Ich war gerade auf dem Weg, um meinen Sohn von der Schule abzuholen, da habe ich gesehen, wie die Kerle dich zu Fall gebracht haben.« Er zeigte auf sein Auto, das auf der anderen Straßenseite mit zwei Rädern auf dem Gehsteig parkte, als hätte er in aller Eile angehalten. Die Fahrertür stand offen.
Ricky folgte dem Blick des Mannes. Er wusste, dass die Jungs auf den Fahrrädern Brad Nichols und seine widerlichen Freunde waren, aber er sagte nichts. Es hätte sowieso nichts gebracht.
»Mensch, du blutest ja«, sagte der Mann in ernsthafter Sorge, als sein Blick erst auf Rickys Hände, dann auf seine Knie fiel. »Das muss man säubern, sonst entzündet es sich am Ende noch. Hier.« Er griff in seine Brusttasche und reichte Ricky einige Papiertaschentücher. »Nimm erst mal die, aber wir sollten die Wunden so bald wie möglich mit warmem Wasser und Desinfektionsmittel auswaschen.«
Ricky nahm die Taschentücher und betupfte damit seine Handflächen.
Durch den Sturz war sein Rucksack aufgegangen, und seine Bücher lagen überall über dem Gehsteig verstreut.
»Oh!«, sagte der Mann und half Ricky auf die Beine, ehe er sich nach den Büchern bückte, um sie aufzusammeln. »Du gehst auf die Morningside? Mein Sohn auch!« Als er Ricky das letzte Buch gab, stutzte er, sichtlich überrascht. »Du bist in der Achten?«
Ricky nickte gleichgültig. Noch immer sagte er kein Wort.
»Wirklich? Du siehst jünger aus. Ungefähr zehn, würde ich schätzen.«
»Ich bin elf«, antwortete Ricky mit einer Spur Entrüstung in der Stimme.
»Tut mir leid«, sagte der Mann und ruderte zurück. »Ich wollte dich nicht beleidigen – aber trotzdem: Du bist ziemlich jung für die achte Klasse, oder? Mein Sohn ist zehn, und er ist erst in der vierten.«
Ricky steckte das letzte Buch in seinen Rucksack. »Ich bin ein Jahr früher eingeschult worden, und weil ich so gute Noten hatte, habe ich die Sechste übersprungen.« Diesmal schwang Stolz in seinen Worten mit.
»Wow! Das ist wirklich beeindruckend. Ich befinde mich also in Gegenwart eines Wunderkindes.«
Ricky wischte sich das letzte Blut von den Händen, ehe er sein Fahrrad, insbesondere das verbogene Vorderrad, in Augenschein nahm. »Scheiße.«
»Sieht ziemlich hinüber aus«, pflichtete der Mann ihm bei. »Ich glaube nicht, dass du damit heute noch weit kommst.«
Ricky machte ein Gesicht, als hätte er keine Ahnung, was er jetzt tun sollte. Dem Mann entging seine Ratlosigkeit nicht.
»Pass auf«, sagte er und sah auf die Uhr. »Ich bin ein bisschen spät dran, deswegen muss ich jetzt weiter, meinen Sohn abholen, aber wenn du möchtest, kannst du hier warten, und auf dem Rückweg kommen John und ich wieder vorbei, gabeln dich auf und setzen dich zu Hause ab. Ich brauche höchstens fünf Minuten. Wie wär’s?«
»Danke, aber ich komm schon klar. So kann ich eh nicht nach Hause.« Ricky begann sich mit den Papiertaschentüchern die aufgeschürften Knie zu betupfen.
Der Mann zog verwirrt die Brauen hoch. »Wieso denn nicht?«
»Wenn ich blutend und mit einem kaputten Fahrrad zu Hause auftauche, dann war das, was die Jungs gerade gemacht haben, ein Witz im Vergleich zu dem, was mein Vater mit mir anstellt.«
»Was? Im Ernst? Aber du konntest doch gar nichts dafür. Die haben dich angegriffen!«
»Interessiert den doch nicht.« Ricky wandte den Blick ab. »So was interessiert den nie.«
Man hörte deutlich, wie gequält der Junge klang.
Der Mann betrachtete Ricky einen Moment lang nachdenklich, während dieser sein Rad vom Boden aufhob.
»Also gut, wie wäre es, wenn John und ich dich nach Hause bringen? Dann kann ich mit deinem Vater reden und ihm erklären, was passiert ist. Ich sage ihm, dass ich alles mit angesehen habe und dich keinerlei Schuld trifft. Einem Erwachsenen wird er doch bestimmt glauben.«
»Ich hab’s Ihnen doch gesagt, das interessiert ihn nicht, okay? Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Danke für die Hilfe, aber ich schaff das schon.« Ricky humpelte los, sein verbogenes Fahrrad hinter sich herziehend.
»He, jetzt warte doch. Wenn du nicht nach Hause gehst, wo willst du denn dann hin, mit dem schweren Ding da? Du kannst ja nicht mal richtig laufen. Du musst wirklich bald deine Wunden versorgen.«
Ricky ging weiter. Er sah sich nicht um.
»Also gut, ich habe einen besseren Vorschlag. Hör mir doch mal zu«, sagte der Mann und kam Ricky hinterher. »Mein Sohn John ist ein netter Junge. Ein bisschen still vielleicht, aber nett. Er könnte wirklich einen Freund gebrauchen – und du auch, so wie es aussieht. Ich kann dein Fahrrad in den Kofferraum laden, wir holen John von der Morningside ab, und dann setze ich euch beide bei seiner Mutter ab. Das ist nicht weit von hier. Sie hat einen Swimmingpool und noch andere tolle Sachen. Und sie kann sich deine Verletzungen ansehen.«
Das Wort »Swimmingpool« ließ Ricky schließlich stehen bleiben. Er drehte sich zu dem Mann um.
»Und währenddessen kann ich dein Rad schnell in dem Laden vorbeibringen, wo ich Johns Rad gekauft habe. Die kriegen das bestimmt in null Komma nichts wieder hin.«
Ricky schien zu schwanken.
Der Mann sah erneut auf seine Uhr. »Jetzt komm schon.« Er presste kurz die Lippen aufeinander. »Hör zu, ich will ehrlich sein, wenn John nicht in der Schule ist, tut er nichts als Comics zu lesen und Computerspiele zu spielen … allein. Hier …« Der Mann zückte seine Brieftasche, holte ein Foto heraus und zeigte es Ricky. »Vielleicht hast du ihn in der Schule schon mal gesehen?«
Durch zusammengekniffene Augen betrachtete Ricky das Foto eines dünnen Jungen mit kurzem dunkelblondem Haar.
»Kann sein. Weiß nicht genau.«
Den Mann schien das nicht weiter zu überraschen. Schüler der höheren Klassen gaben sich nicht mit Grundschülern ab – nicht mal Außenseiter wie Ricky Temple.
»Ist ja auch egal«, fuhr der Mann fort. »Er könnte wirklich einen Freund gebrauchen. Ich weiß, er ist erst in der vierten Klasse, aber er ist ein kluger Junge, wirklich, und er hat jede Menge Spiele, die dir garantiert gefallen würden. Ihr solltet mal zusammen spielen.« Er gab Ricky einen Moment zum Überlegen. »Na, komm, was hast du schon zu verlieren? Und ich repariere auch dein Fahrrad für dich. Was sagst du?«
Ricky kratzte sich am Kinn.
Wieder ein rascher Blick auf die Armbanduhr. »Okay, dann warte einfach fünf Minuten hier. Ich hole schnell John ab und komme dann zurück. So kannst du ihn erst mal kennenlernen, und danach entscheidest du.«
»Er mag Comics?«, fragte Ricky.
Der Mann lachte. »Mögen ist eine Untertreibung.«
Ricky zog die Schultern hoch. »Hört sich eigentlich ganz okay an.«
»Das ist er auch. Ehrlich.«
»Also gut«, gab Ricky nach.
Der Mann lächelte und trug Rickys Fahrrad über die Straße. Nachdem er es im Kofferraum seines Wagens verstaut hatte, stieg er auf der Fahrerseite ein.
»Wir müssen trotzdem noch deine Hände und Knie anständig säubern«, meinte er, als er den Gang einlegte und losfuhr. Er bog erst rechts ab und am Ende des Häuserblocks links.
Ricky runzelte die Stirn, als der Mann am Schultor der Morningside nicht anhielt.
»Sie sind dran vorbeigefahren.« Ricky sah den Fahrer an.
Der Mann erwiderte den Blick mit einem bösartigen Lächeln. »Ganz ruhig, Kleiner.« Seine Stimme hatte sich verändert. Von der anfänglichen Wärme und Freundlichkeit war jetzt nichts mehr übrig; sie klang hart, kalt und heiser.
»Jetzt kann dir niemand mehr helfen.«
4
Der große, offene Raum, der das Hauptbüro des Raub- und Morddezernats des LAPD bildete, lag auf demselben Flur wie Hunters Büro. Hier gab es keine wackligen Trennwände oder Arbeitsnischen, die Ordnung in das Chaos aus Schreibtischen gebracht hätten. Suchte man einen bestimmten Detective, schaute man entweder nach den Namensschildern auf den Tischen – sofern diese sichtbar waren –, oder man rief den Namen des Betreffenden und wartete darauf, dass irgendjemand die Hand hob und »Hier!« brüllte. Selbst früh am Morgen ging es hier zu wie in einem Bienenstock – überall Gewimmel, Lärm und das unverständliche Summen vieler Stimmen, das aus allen Ecken gleichzeitig zu kommen schien.
Das Büro von Captain Barbara Blake befand sich am hinteren Ende des Stockwerks. Es war nicht riesig, aber einigermaßen geräumig. Die südliche Wand war voller Bücherregale, die vor in Leder gebundenen Büchern schier überquollen. An der Nordwand hingen diverse gerahmte Fotos, Belobigungen und Auszeichnungen für besondere Verdienste. Die Ostseite bestand aus einem Panoramafenster mit Blick auf die South Main Street. Vor dem massiven Mahagonischreibtisch waren zwei bourbonbraune Chesterfield-Ledersessel platziert. Ein rechteckiger schwarzweißer Teppich lag in der Mitte des Raums.
Hunter klopfte dreimal fest an. Eine Sekunde später hörte er eine Stimme von drinnen »Herein« rufen.
Captain Blake saß hinter ihrem Schreibtisch, das Telefon am linken Ohr.
»Es ist mir völlig egal, wie Sie es machen«, sagte sie in den Hörer und hob die Hand, um Hunter hereinzuwinken und ihm zu bedeuten, dass sie gleich Zeit für ihn hätte. »Tun Sie es einfach. Und zwar heute noch.« Damit knallte sie den Hörer auf.
Wenigstens ist hier noch alles beim Alten, dachte Hunter.
Barbara Blake leitete seit fünf Jahren das Raub- und Morddezernat. Schon kurze Zeit nachdem sie die Stelle von ihrem Vorgänger übernommen hatte, hatte sie sich einen Ruf als knallharte Chefin erarbeitet, die ihre Abteilung mit eiserner Faust führte. Sie war eine apart aussehende Frau – groß, elegant und sehr attraktiv, mit langem schwarzem Haar und durchdringenden dunklen Augen, die ihr Gegenüber mit einem Blick entweder beruhigen oder in ein winselndes Häufchen Elend verwandeln konnten. Nichts und niemand machte ihr Angst.
»Robert«, sagte sie und stand auf. Sie trug ein maßgeschneidertes hellgraues Kostüm mit einer weißen Viskosebluse, schwarzen Schuhen und einem schmalen schwarzen Gürtel. Ihr Haar war zu einem Knoten frisiert, und die dezenten Perlenohrringe passten zu ihrer Halskette. »Willkommen zurück.« Sie machte eine kurze Pause. »Tut mir leid, dass aus Ihrem Urlaub nichts geworden ist.«
Sie ahnte nichts vom wahren Ausmaß der Enthüllungen, die sich im Zuge der Ermittlungen, in die Hunter während seiner kurzen Zeit beim FBI involviert gewesen war, ergeben hatten. Trotzdem war ihr Ton voller Mitgefühl.
Hunter nickte knapp.
Blake kam um ihren Schreibtisch herum, nur um dann mit leicht gerunzelter Stirn stehen zu bleiben.
»Wo zum Henker steckt Carlos?«, fragte sie und lehnte sich ein Stück zur Seite, wie um an Hunter vorbeizuschauen.
Hunter erwiderte ihren fragenden Blick.
»Er ist im Büro und packt.« Er zeigte mit dem Daumen über seine Schulter.
»Er packt?« Blakes Verwirrung wuchs. »Was packt er denn?«
Hunter war nicht minder irritiert. Garcia musste doch mit ihr über seine Versetzung gesprochen haben.
»Seine Sachen.«
Captain Blake sah ihn verständnislos an.
»San Francisco? Betrugsdezernat?«, sagte Hunter mit einem leichten Kopfschütteln. »Das Pendant zu unserem WCCU?«
Allmählich verstand Blake gar nichts mehr.
»Wovon um alles in der Welt reden Sie, Robert?«
Genau in diesem Moment wurde die Tür zu Captain Blakes Büro geöffnet, und Garcia trat ein.
»Tut mir leid, dass ich etwas spät dran bin, Captain. Ich musste noch ein paar Sachen in meinem Schreibtisch sortieren.«
In vollendeter Verwirrung drehte Hunter sich zu seinem Partner um.
»Wow«, sagte Garcia mit einem diebischen Lächeln. »Du hast das alles geglaubt, oder? Frisco? Das Betrugsdezernat? Im Ernst, Robert? Jetzt komm aber!«
»Verdammte –«, begann Hunter. Dann erschien ein breites Grinsen in seinem Gesicht.
»Vielleicht wirst du alt, mein Freund«, witzelte Garcia und klopfte Hunter beim Eintreten auf die Schulter. »Du lässt langsam nach. Ich dachte, du merkst sofort, dass ich dich verarsche.«
Hunter senkte im Eingeständnis seiner Niederlage den Kopf. »Vielleicht bin ich wirklich zu alt.« Er schmunzelte immer noch. »Ich habe es nicht kommen sehen, ehrlich. Selbst nachdem du das Betrugsdezernat erwähnt hast. Dabei hätte mich das eigentlich stutzig machen müssen.«
»Vielleicht bin ich auch einfach zu gut«, sagte Garcia grinsend. »Die Umarmung am Ende war ein schöner Zug, oder? Noch ein paar Sekunden länger, und ich hätte mir wahrscheinlich sogar ein paar Tränen abgedrückt.«
»Das wäre gar nicht nötig gewesen«, sagte Hunter. »Ich habe dir auch so alles abgekauft.«
»Also schön«, klinkte Captain Blake sich ein. Ihr Register hatte von verschmitzt zu ernst gewechselt. Sie nahm zwei Mappen von ihrem Schreibtisch. »Die Zeit zum Spielen ist endgültig vorbei. Willkommen zurück in der UV-Einheit.«
»Also, was gibt’s denn, Captain?«, wollte Garcia wissen.
Captain Blake reichte jedem der Detectives eine Akte. Sie zögerte mit der Antwort, aber nicht um des Effekts willen.
»Einen gottverdammten Alptraum, das gibt es.«
5
Nachdem der Mann ihn mitgenommen hatte, wurde Ricky ausgezogen und bewusstlos geschlagen. Als er wieder zu sich kam, wurde er mit einem starken Strahl eiskalten Wassers abgespritzt und dann erneut verprügelt, diesmal mit einem breiten Gürtel, der ihm die Haut aufriss, bis er blutete. Wenige Schläge reichten, und er wurde erneut ohnmächtig.
Rickys Lider flatterten eine ganze Weile, ehe er endlich die Augen aufbekam. Aber es machte sowieso keinen Unterschied. Die Dunkelheit in seiner kleinen fensterlosen Zelle war undurchdringlich. Trotzdem zuckte sein benommener Blick erst nach links, dann nach rechts, als suche er nach etwas, ehe er die Augen wieder schloss. Das Durcheinander in seinem Kopf war so schlimm, dass er gar nicht wusste, ob das hier real war, ob er wirklich wach war oder nicht.
Aber dann setzte der Schmerz ein – heftig und in rasender Geschwindigkeit breitete er sich bis in die letzte Zelle seines Körpers aus. Damit war jeder Zweifel ausgeräumt.
Das hier war kein Alptraum. Das hier war etwas viel, viel Schrecklicheres.
Mit dieser Erkenntnis kam eine Angst, wie Ricky sie noch nie zuvor in seinem Leben empfunden hatte.
Er hustete, was die Schmerzen noch schlimmer zu machen schien. Bunte Lichtpunkte explodierten hinter seinen geschlossenen Lidern, und bei jeder Explosion hatte er das Gefühl, als würde ein Nagel in seinen Schädel getrieben. Er war kurz davor, den Schmerzen nachzugeben und wieder ohnmächtig zu werden, als er von rechts ein Geräusch hörte.
Ricky erstarrte.
Klonk.
Es klang, als würde die Tür zu seiner Zelle aufgeschlossen. Die Augen des Jungen huschten in die Richtung, aus der das Geräusch kam. In Todesangst wartete er.
Klonk, klonk.
Zwei weitere Umdrehungen des Schlüssels, eine kurze Stille, dann ging die Tür auf.
In nackter Angst krabbelte Ricky über den Betonboden rückwärts, vergrub das Gesicht in den Armen und zog die Knie an die Brust. Er machte sich so klein wie nur möglich. Das bereitete ihm erneut fürchterliche Schmerzen, und er hörte das schauderhafte Klirren von Metall auf Metall, als die dicke Kette an seinem rechten Knöchel rasselnd durch den Eisenring glitt, der in die Wand aus rauen Ziegeln eingelassen war.
Ricky schossen Tränen in die Augen, und seine Kehle zog sich zusammen, so dass er kaum noch Luft bekam. Das Herz hämmerte in seiner Brust, als wollte es aus seinem Körper springen.
Die Glühbirne, die in einem Drahtgestell in der Mitte der Decke hing, flackerte ein paarmal, ehe sie anging. Gleichzeitig mit dem Licht setzte ein elektrisches Summen ein, das wie ein Schwarm wütender Wespen klang.
Ricky lag schon so lange im Dunkeln, dass das Licht auf seiner Netzhaut brannte, selbst als er die Augen schloss.
Beim Geräusch der Stiefel seines Entführers, als dieser den Raum betrat, wurde Rickys kleiner, zerbrechlicher Körper erneut von einer Welle heißer Panik erfasst, und er begann am ganzen Leib zu zittern. Er musste gar nicht hinsehen. Er wusste, dass der Mann da war. Er konnte ihn riechen – es war ein bitterer, saurer und zugleich ekelhaft süßlicher Geruch, bei dem sich die Seele des kleinen Jungen vor Furcht zusammenkrampfte. Wenn das Böse einen Geruch hatte, dann musste es dieser sein.
Der widerliche Geruch des Mannes brannte in Rickys Nasenlöchern und kratzte ihm die Kehle wund wie die Krallen einer Katze.
Ricky wollte stark sein, so wie er stark war, wenn er in der Schule von Brad Nichols und seiner Gang schikaniert wurde, aber er hatte solche Angst, dass er gar nicht mehr wusste, was er tat.
»Bitte … nicht wieder schlagen.« Die Worte entschlüpften ihm ohne sein Zutun.
Keine Antwort. Alles, was Ricky hörte, war das schwere Atmen des Mannes, der in der Tür stand. Er klang wie ein wütender Drache, kurz bevor er Feuer speit.
»Bi-bitte.« Das Wort kam leise und stoßweise.
Die Schritte näherten sich.
Ricky machte sich noch kleiner, kniff die Augen zusammen und wappnete sich. Er wusste, was gleich kommen würde, und die Angst davor schmerzte fast so sehr wie die Schläge selbst.
»Wie heißt du, Junge?« Die Stimme des Mannes füllte den ganzen Raum aus, so laut und mächtig war sie. Aber sie klang ganz anders als die Stimme des Mannes, mit dem er sich nach der Schule unterhalten hatte. Sie klang rau, hart und kalt.
Ricky erstarrte. War das hier jemand anders?
Das Atmen fiel ihm immer schwerer.
»Sieh mich an.« Es klang, als würden die Worte durch wütend zusammengebissene Zähne hervorgestoßen.
Doch Ricky konnte sich vor lauter Furcht nicht rühren.
»Sieh. Mich. An.«
Ganz langsam hob Ricky den Kopf.
»Mach die Augen auf und sieh mich an.«
Endlich nahm Ricky den Kopf von seinen Armen. Seine Lider flatterten erneut, diesmal etwas länger, bis er sich an die Helligkeit gewöhnt hatte. Langsam öffnete er die Augen und starrte den Fremden an, der vor ihm stand.
Wer war dieser Mann?
»Du erkennst mich nicht wieder, was?«
Ricky atmete aus. Er brachte keinen Ton heraus.
»Vielleicht hilft es dir, wenn ich so spreche wie jetzt und dir ein bisschen von meinem Sohn John erzähle. Dem schüchternen kleinen John.« Von einem auf den anderen Augenblick hatte sich die Stimme in die Stimme des Mannes verwandelt, mit dem Ricky nach seinem Fahrradunfall gesprochen hatte. »Na ja. In Wirklichkeit existiert John gar nicht.« Der Mann lachte.
Rickys Augen weiteten sich vor Erstaunen. Der Mann, der vor ihm stand, sah vollkommen anders aus. Der Bart war ab, genau wie die braunen Haare. Stattdessen hatte er nun einen glattrasierten Schädel. Die vormals hellblauen Augen, die ihn mit solch aufrichtiger Besorgnis angesehen hatten, waren jetzt dunkelbraun, fast schwarz.
»Guck nicht so erstaunt, Junge. Das eigene Aussehen zu verändern ist nicht weiter schwierig.«
Ricky bebte noch immer am ganzen Leib.
»Also«, fuhr der Mann fort. »Ich frage dich noch einmal – wie heißt du?«
Rickys Lippen bewegten sich, aber seine Stimme versagte ihm den Dienst.
»Wie war das? Ich habe dich nicht verstanden.«
Der Mann machte einen Schritt auf Ricky zu. Der riss instinktiv die Arme hoch, um sein Gesicht zu schützen. Der Mann blieb abwartend stehen und beobachtete den Jungen.
»Richard. Ich heiße Richard Temple.« Die Stimme war kaum lauter als ein Flüstern.
»Hmm.« Der Mann nickte, während er sich am Kinn kratzte, als würde er seinen Bart vermissen. »Aber alle nennen dich Ricky, oder?« Jetzt war seine Stimme wieder heiser und kalt.
Der Junge nickte.
»Nun, damit ist es vorbei.« Der Mann sog scharf Luft durch die Nase hoch, als wollte er ausspucken. »Ich verrate dir ein Geheimnis. Eigentlich hättest du hier sterben sollen. Ich hatte vor, mich mit dir zu amüsieren und dich dann umzubringen.«
Ricky strömten die Tränen über die Wangen.
»Aber dann habe ich beschlossen, es nicht zu tun. Wenigstens noch nicht gleich.«
Ricky war unfähig, seinen Blick vom Gesicht des Mannes loszureißen.
»Aber lass dir eins gesagt sein: Das Leben, wie du es kennst, ist vorbei, verstehst du das? Du wirst nie wieder hier rauskommen. Du wirst nie wieder einen Freund haben – obwohl ich nicht glaube, dass du vorher welche hattest. Du wirst nie wieder zur Schule gehen oder draußen spielen oder deine Familie wiedersehen oder irgendetwas anderes tun, als mir zu gehorchen. Ist das klar?«
Furcht hinderte Ricky daran, zu antworten.
»Ob. Das. Klar. Ist?«
Ricky sah, wie sich die Finger des Mannes zur Faust schlossen, und aus schierer Angst brachte er ein Nicken zustande.
»Du wirst alles tun, was ich dir befehle. Du wirst nicht den Mund aufmachen, es sei denn, ich gebe dir die Erlaubnis zu sprechen. Du wirst nur das essen, was von meinem Teller übrig bleibt. Wenn nichts übrig bleibt, wirst du nichts essen. Versuchst du zu fliehen, werde ich es merken und dich bestrafen. Missachtest du eine meiner Regeln, werde ich es merken und dich bestrafen. Hast du das verstanden?«
Wieder nickte der Junge.
»Dies hier ist ein Neuanfang für dich«, fuhr der Mann fort. »Und da es ein Neuanfang ist, brauchst du auch einen neuen Namen. Dein alter gefällt mir nämlich nicht.« Er wischte sich mit dem Rücken der rechten Hand über den Mund und machte ein nachdenkliches Gesicht. »Weißt du, wie du aussiehst, so unbeholfen und mager, wie du bist?« Er wartete nicht auf eine Antwort. »Ein Wurm. Du siehst aus wie ein Wurm.« Eine kurze Pause. »Das gefällt mir richtig gut.« Er lächelte. »Das wird dein neuer Name – Wurm. Jedes Mal, wenn ich ihn rufe, antwortest du mit ›Ja, Sir‹. Hast du das verstanden, Wurm?«
Der Junge war wie gelähmt vor Angst.
»OB DU DAS VERSTANDEN HAST, WURM?« Die Stimme des Mannes hallte von den Ziegelwänden wider wie der Ruf des Todes.
»Ja, Sir.« Rickys Stimme war tränenerstickt.
Lächelnd ging der Mann zurück zur Zellentür.
»Willkommen in deinem neuen Leben, Wurm. Willkommen in der Hölle.«
Die Tür schloss sich mit dem dumpfen Dröhnen eines zufallenden Sargdeckels.
6
Captain Blake wartete, während die beiden Detectives die Akten durchsahen. Zuoberst lag das DIN-A4-große Farbporträt einer Frau.
»Ihr Name lautet Nicole Wilson«, begann Blake und lehnte sich gegen die Kante ihres Schreibtischs. »Zwanzig Jahre alt. Geboren und aufgewachsen in Evansville, Indiana. Ihre Eltern leben noch dort. Vor etwa einem Jahr ist sie nach L. A. gezogen, weil sie ein Stipendium für die juristische Fakultät an der California State University bekommen hat. Ihre Zeugnisse belegen, dass sie eine sehr gute Studentin war. Um sich etwas dazuzuverdienen, hat sie, sofern ihr Stundenplan es erlaubte, ein paar Abende die Woche als Babysitterin gearbeitet. Es wären ihre ersten Semesterferien gewesen, aber statt nach Indiana zu ihren Eltern zu fahren, hat sie beschlossen, in L. A. zu bleiben. Sie hatte einen Job als Bürogehilfin in einer kleinen Anwaltskanzlei in Downtown L. A. bekommen. Einer ihrer Professoren hat ihn ihr vermittelt.«
Hunter und Garcia studierten das Foto eine Zeitlang. Nicole Wilson hatte ein rundliches Gesicht mit ausdrucksstarken, leicht schrägstehenden Augen, einer zierlichen Nase und vollen Lippen. Sie hatte ein paar Sommersprossen auf den Wangen und dunkelblonde Haare, die ihr bis zu den Schultern reichten.
»Vor sieben Tagen«, fuhr Captain Blake fort, als Hunter und Garcia die zweite Seite des Berichts – Nicole Wilsons Datenblatt – aufschlugen, »wurde Nicole entführt, während sie auf den kleinen Sohn von Audrey und James Bennett, einem wohlhabenden Ehepaar, wohnhaft in Upper Laurel Canyon, aufpasste.«
Hunter sah hoch.
»Ja«, beantwortete Blake seine unausgesprochene Frage. »Sie wurde beim Babysitten entführt, nicht auf dem Weg dorthin oder auf dem Heimweg. Der Täter hat sie aus dem Haus der Bennetts verschleppt.«
Hunter wandte seine Aufmerksamkeit wieder der Akte zu. Er blätterte zur nächsten Seite und überflog sie. »Keine Anzeichen eines Kampfes?«
»Die Spurensicherung hat jedenfalls nichts gefunden, was darauf hindeutet«, lautete Blakes Antwort. Sie beobachtete einen Moment lang schweigend die Detectives, ehe sie einmal kurz mit dem Kopf nickte. »Ich weiß, was Sie jetzt denken – dass Nicole den Täter höchstwahrscheinlich kannte und ihn ins Haus gelassen hat und dass es deshalb keine Anzeichen eines Kampfgeschehens gibt. Dasselbe habe ich auch gedacht, als ich die Akte zum ersten Mal gelesen habe – aber nein, so scheint es sich nicht abgespielt zu haben.«
»Wieso nicht?«, fragte Garcia.
Captain Blake zuckte mit den Achseln und ging zur Espressomaschine in der Ecke bei den Bücherregalen. »Weil der Täter Nicole mit einer erfundenen Geschichte eingewickelt hat.« Sie suchte sich eine Kaffeekapsel aus und legte sie in die Maschine ein. Es war bereits ihre zweite Tasse, seit sie vor nicht mal einer halben Stunde ins Büro gekommen war.
»Eine erfundene Geschichte?« Hunter zog die Brauen zusammen.
»Ganz richtig. Kaffee?«
Beide verneinten.
Blake sah zu, wie die letzten Kaffeetropfen in ihre Tasse rannen, während sie weiter ausführte: »Wie es aussieht, hat der Täter ihr gegenüber behauptet, Mrs Bennetts Cousin aus Texas zu sein, der angeblich für die Dauer seines Besuchs in der Wohnung über der Garage übernachtet.« Sie wartete kurz, um Hunter und Garcia Gelegenheit zu geben, die Information zu verarbeiten. »Audrey Bennett hat keinen Cousin in Texas. Und es hat auch niemand in der Garagenwohnung übernachtet.« Sie ließ eine Süßstofftablette in ihre Tasse fallen. »Und jetzt halten Sie sich fest: Der Täter saß in der Küche und hat ein Sandwich gegessen, als Nicole ihn überrascht hat.«
Garcias Neugier stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Er hat ein Sandwich gegessen?«
»Laut Aussagen von Mrs Bennett, ja.«
»Moment mal.« Hunter hob die Hand. »Wenn Nicole für die Bennetts gebabysittet hat, dann waren die doch wohl zur fraglichen Zeit nicht zu Hause, oder?«
»Das ist richtig«, bestätigte Captain Blake. »Sie waren bei einem Richter zum Abendessen eingeladen. James Bennett ist ein sehr erfolgreicher Anwalt.«
»Wenn sie also außer Haus waren, woher weiß Mrs Bennett dann, dass der Täter sich als ihr Cousin ausgegeben hat?«
»Das ist der Punkt, an dem es unheimlich wird«, sagte Captain Blake und nippte an ihrem Kaffee. »Der Täter hat zugelassen, dass Nicole einen Anruf von Audrey Bennett entgegennimmt und ihr von dem Mann, dem sie kurz zuvor in der Küche begegnet war, erzählt, bevor er sie überwältigt hat.« Sie deutete auf die Akte in Hunters Hand. »Auf der nächsten Seite finden Sie ein detailliertes Protokoll der Aussage von Mrs Audrey Bennett, die sie auf der Vermisstenstelle gemacht hat. Darin gibt sie auch den ungefähren Wortlaut ihres Telefonats mit Nicole wieder.«
Hunter und Garcia wandten sich der entsprechenden Seite zu.
»Wie hat sich der Täter Zutritt zum Haus verschafft?«, wollte Hunter wissen.
»Das ist bis jetzt noch ungeklärt«, gab Blake Auskunft. »Es gab keine Anzeichen gewaltsamen Eindringens, aber die Hintertür war nicht abgeschlossen. Das Problem ist, dass sich Mrs Bennett nicht mehr erinnern kann, ob sie sie offen gelassen hat oder nicht. Und selbst wenn nicht, hätte Nicole sie aus irgendeinem Grund öffnen können, und vielleicht hat sie vergessen, sie danach wieder abzuschließen. Es gibt keine Möglichkeit, das festzustellen. Darüber hinaus könnte es auch sein, dass der Täter das Schloss geknackt hat. Die Spurensicherung hat zwar gesagt, es weise keinerlei Beschädigungen auf, aber wenn man sich damit auskennt und das richtige Werkzeug hat, sind Türschlösser nicht besonders schwer zu öffnen.«
Hunter nickte und las weiter.
»Mrs Bennett hat sofort die Polizei verständigt, nachdem ihre Verbindung zu Nicole unterbrochen wurde«, fügte Captain Blake hinzu. »Aber als die beim Haus ankam – zweiundzwanzig Minuten später –, war Nicole bereits verschwunden.«
»Gibt es Kameras in der Gegend, in der die Bennetts wohnen?«, fragte Garcia.
Captain Blake schüttelte den Kopf. »Keine. Die nächstgelegene befindet sich ganz unten am Fuß der Hollywood Hills.«
»Was ist mit dem Jungen, auf den sie aufgepasst hat?«, fragte Hunter, der etwas davon in der Akte gelesen hatte.
»Joshua, drei Jahre alt«, bestätigte Blake. »Ihm ist nichts passiert. Er lag oben in seinem Zimmer und hat geschlafen, als seine Eltern zurückkamen. Er hat weder etwas gesehen noch gehört.«
»Sind Nicoles Eltern wohlhabend?«, wollte Hunter als Nächstes wissen.
»Nein, ganz und gar nicht. Der Vater ist Lehrer, die Mutter arbeitet im Supermarkt.«
»Das heißt also, der Täter ist in das Haus einer reichen Familie eingebrochen, um die Babysitterin zu entführen?«, fragte Garcia. »Nicht den Sohn?«
»So widersinnig das auch klingen mag, genauso war es«, bestätigte Captain Blake, ehe sie erneut einen Schluck von ihrem Kaffee trank. »Und deshalb lautet unsere erste knifflige Frage: Warum? Warum hat er sich die Sache absichtlich so schwergemacht? Er hätte es doch viel leichter haben können, wenn er sich Nicole entweder auf dem Weg zum Haus der Bennetts oder hinterher auf dem Heimweg gegriffen hätte. Wieso erhöht er absichtlich sein Risiko, indem er ins Haus einbricht und sie sich dort schnappt?«
Beide Detectives verstanden Captain Blakes Argumentation sehr gut. Sie wussten, dass eine Entführung auf offener Straße es der Polizei äußerst schwermachte, Beweise wie Fingerabdrücke, Fasern, Haare und Ähnliches zu sichern – ganz zu schweigen davon, dass sämtliche Spuren, falls es welche gab, der Witterung ausgesetzt waren. Sie konnten leicht vom Wind verweht, vom Regen fortgewaschen oder auf zahllose andere Weisen kontaminiert werden. Befand sich der Täter hingegen in einem geschlossenen Raum, beispielsweise einem Haus, sank das Risiko einer Verunreinigung von Spuren drastisch, außerdem hinterließ er der Polizei ein von der Witterung unbeeinflusstes, noch dazu relativ begrenztes Gebiet zur kriminaltechnischen Untersuchung.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.