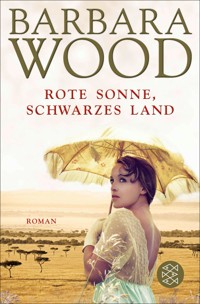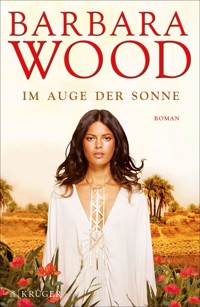
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Gehorsam und Rebellion: Eine verbotene Liebe führt die Heilerin Leah bis vor den Thron der Pharaonen. Der neue Roman der Bestsellerautorin Barbara Wood entfaltet große Gefühle vor den Sehnsuchtsorten der Welt. Leah möchte eine gehorsame Tochter sein. Sie soll den mächtigsten Kaufmann von Ugarit heiraten. Im Geheimen liebt sie jedoch David, den Kämpfer und Schriftgelehrten. Er lehrt Leah die Schriftzeichen, die er erfunden hat, damit sie ihre Heilrezepte aufzeichnen kann. Doch dann wird Leah entführt. Verzweifelt folgt David ihrer Spur, und beide geraten in den Eroberungszug der Ägypter. Als Gefangene werden sie vor den Pharaonenthron gebracht. Im Angesicht der Sonnenkönigin Hatschepsut müssen Leah und David ihre Fähigkeiten beweisen – oder mit dem Leben bezahlen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Barbara Wood
Im Auge der Sonne
Roman
Über dieses Buch
Leah möchte eine gute Tochter sein. Aber als ihr Vater sie mit Jotham, dem reichsten Kaufmann von Ugarit, verheiraten will, kann sie nicht gehorchen. Auch wenn sie damit ihre ganze Familie ins Elend stürzt. Im Geheimen liebt sie David, den Kämpfer und Schriftgelehrten. Doch David hat eine Mission: er will die mächtige, aber korrupte Bruderschaft der Schreiber reformieren. Er ersinnt eine neue, einfache Schrift: das Alphabet. Und er lehrt Leah diese Schrift, damit sie ihre Heilrezepte aufzeichnen kann. Doch dann wird Leah entführt. David folgt ihrer Spur, und beide geraten in den Eroberungszug der Ägypter. Als Gefangene werden sie vor den Pharaonenthron gebracht. Im Angesicht der Sonnenkönigin Hatschepsut müssen Leah und David ihre Fähigkeiten beweisen – oder mit dem Leben bezahlen…
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Barbara Wood ist international als Bestsellerautorin bekannt. Allein im deutschsprachigen Raum liegt die Gesamtauflage ihrer Romane weit über 13 Mio., mit Erfolgen wie ›Rote Sonne, schwarzes Land‹, ›Traumzeit‹, ›Kristall der Träume‹, ›Das Perlenmädchen‹ und ›Dieses goldene Land‹. 2002 wurde sie für ihren Roman ›Himmelsfeuer‹ mit dem Corine-Preis ausgezeichnet. Barbara Wood stammt aus England, lebt aber seit langem in den USA in Kalifornien.
Im Fischer Taschenbuch Verlag ist das Gesamtwerk von Barbara Wood erschienen:
›Rote Sonne, schwarzes Land‹, ›Traumzeit‹, ›Herzflimmern‹, ›Sturmjahre‹, ›Lockruf der Vergangenheit‹, ›Bitteres Geheimnis‹, ›Haus der Erinnerungen‹, ›Spiel des Schicksals‹, ›Die sieben Dämonen‹, ›Das Haus der Harmonie‹, ›Der Fluch der Schriftrollen‹, ›Nachtzug‹, ›Das Paradies‹, ›Seelenfeuer‹, ›Die Prophetin‹, ›Himmelsfeuer‹, ›Kristall der Träume‹, ›Spur der Flammen‹, ›Gesang der Erde‹, ›Das Perlenmädchen‹, ›Dieses goldene Land‹ und ›Die Schicksalsgabe‹, sowie die Romane von Barbara Wood als Kathryn Harvey, ›Wilder Oleander‹, ›Butterfly‹ und ›Stars‹.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bürosüd°, München
Umschlagabbildung: Gaby Gerster
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel ›The Serpent and the Staff‹
im Verlag Turner Publishing Co, Nashville, Tennessee
© Barbara Wood 2013
Published by Arrangement with Barbara Wood
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402716-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für meinen lieben Mann [...]
PROLOG
ERSTES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
ZWEITES BUCH
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Nachwort
Für meinen lieben Mann Walt
PROLOG
In der Nacht, als Jericho fiel, war ich sechzehn Jahre alt. Ich war unsterblich verliebt.
Meine Gedanken kreisten nicht im Entferntesten um Krieg, als ich mich in meinem Bett hin- und herwarf und die Geräusche der Stadt an mein Ohr drangen – Jericho am Jordanfluss schlief niemals –, sondern kehrten immer wieder zurück zu Benjamin, dessen schönes Gesicht mir den Schlaf raubte.
Aus der Ferne war Donner zu hören. Ein Frühlingsgewitter, das vom Meer her aufzieht, dachte ich. Schwarze Wolken, die sich über den Küstenstädten, über Jerusalem zusammenballen und bald auch Jerichos Durst stillen würden. Dem Allerhöchsten sei Dank, betete ich im Stillen. Die Dattelhaine meines Vaters brauchten dringend Regen.
Er befand sich zu jener Stunde im Tempel, um ein fettes Frühjahrslamm zu opfern und den Allerhöchsten um Erlösung von der Dürre zu bitten. Sein Bruder, mein Onkel und ein angesehener Arzt hier in Jericho, hielt sich im Armenviertel auf, wo das Fieber, das mit der Trockenheit einherging, am ärgsten wütete. Die Armen kannten seine Gestalt und begrüßten ihn mit der Anrede »verehrter Heiler«.
In jener schicksalsschweren Frühlingsnacht kreisten meine Gedanken jedoch nicht lang um die wohltätigen Verrichtungen frommer Männer. Sobald ich die Augen schloss, sah ich Benjamin vor mir, seine Gesichtszüge, sein Lachen, die breiten Schultern, seinen Gang. Oh, er war wunderbar! Ich war jung, und ich träumte vom Heiraten. Benjamin war der Sohn einer wohlhabenden Familie, die das Monopol auf Jerichos florierenden Textilhandel besaß. Sein Vater war ein enger Freund des Königs.
Wir waren uns versprochen.
An jenem Abend hatte Papa mir einen Gutenachtkuss gegeben und versichert, er werde nun mit Benjamins Vater über das Datum für die Hochzeit sprechen. Sie sollte im Sommer stattfinden, die verheißungsvollste Zeit für Eheschließungen. Das Leben konnte nicht schöner sein. Mein Vater war einer der reichsten Bürger von Jericho, meine Mutter von königlichem Geblüt: Sie stammte von einem König aus dem im Norden gelegenen Syrien ab. Wir bewohnten ein palastartiges Haus mit marmornen Säulen innerhalb der hohen Mauern von Jericho. Es war die sicherste Stadt der Welt, und unser hochherrschaftliches Haus, das an Eleganz nur vom Palast des Königs übertroffen wurde, lag im schützenden Schatten von Jerichos mächtigem Südwestturm, von dem aus Soldaten die Mauern seit Jahrhunderten verteidigt hatten. Wir verfügten über Diener und erlesenes Mobiliar, meine Schwestern und ich kleideten uns in weichste Wolle. Wir trugen Goldschmuck, speisten von silbernen Tellern. Gleich einem festlich gedeckten Tisch sah ich deshalb einem Leben in Überfluss und Freude und unbegrenzten Möglichkeiten entgegen.
Kein Mädchen konnte glücklicher sein als ich.
Das Donnern in jener Nacht kam näher, rollte über die Hügel im Westen. Als ich Rufe und Geschrei auf den Straßen unter meinem Balkon hörte, wunderte ich mich, warum sich irgendwer vor einem Frühlingsregen fürchtete.
Aber dann schrie jemand direkt unter mir laut auf. Ein Poltern. Schritte, die über den polierten Sandsteinboden stampften. Ich sprang aus dem Bett, rannte auf die Galerie, die um das Innere des oberen Stockwerks verlief, schaute hinunter in die große Halle, in der wir Gäste empfingen und üppige Bankette ausrichteten. Entsetzt riss ich die Augen auf, als ich sah, wie dort Soldaten hereinstürmten und rücksichtslos vorandrängten. Sie trugen nicht die grünen Tuniken der Kanaaniter-Truppen, sondern weiße Faltenröcke, lederne Bruststücke und eng anliegende Helme. Den Befehlen nach, die sie den verschreckten Dienern entgegenbellten, schien es sich um Ägypter zu handeln.
Jetzt begriff ich endlich, dass der Donner, den ich gehört hatte, nicht Regen für Jericho versprach, sondern vom Lärm der Streitwagen herrührte, die über die Ebene auf die Stadt zuhielten.
Wie versteinert beobachtete ich, wie ein Soldat eine unserer Dienerinnen an den Haaren packte und sie über den Boden schleifte, obwohl sie sich verzweifelt zu wehren versuchte. Wie eine Amme unten auftauchte, mit einem Baby auf dem Arm, meiner jüngsten Schwester, die noch keinen Namen erhalten hatte. Ein Soldat riss ihr den Säugling aus den Armen, umfasste mit einer Pranke die winzigen Füßchen und schleuderte ihn an die Wand. Ich sah, wie der weiche Schädel aufplatzte, Gehirnmasse und Blut herausspritzten.
Als ich Schritte hinter mir hörte, fuhr ich herum. Es war Tante Rakel, die sich mit einer Lampe näherte. Ihre Sandalen glitten lautlos über den Marmorfußboden. Ihre weißen Gewänder umwogten sie wie eine Wolke. Ihr Gesicht war kreidebleich.
»Rasch, Avigail«, sagte sie. »Zieh dich an. Wir müssen uns in Sicherheit bringen.«
Hastig kleidete ich mich an, und wir verließen über eine Hintertreppe das obere Stockwerk. An der Tür zu einem Geheimgang wartete bereits die restliche Familie. Meine Mutter hatte die Arme um meine beiden jüngeren Schwestern gelegt. Die Angst, die aus ihren Augen sprach, verriet mir den Ernst der Lage. Meine Mutter war eine Schönheit und von königlichem Geblüt. Jeder rühmte ihr selbstsicheres Auftreten, ihre Eleganz. In jenem Augenblick strahlte sie jedoch nichts als Entsetzen aus.
Zitternd und bebend hörten wir mit an, wie Geschrei unser Haus erfüllte, wie Gegenstände zerschmettert wurden, wie auf Ägyptisch herumgebrüllt wurde. Bestimmt war das nur ein Traum. Ein Albtraum, aus dem ich bald erwachen würde. Der König hatte uns Frieden zwischen Jericho und Ägypten zugesichert. Man hatte ein Abkommen unterzeichnet.
Unser Hausverwalter Avraham, der seit zwei Generationen unserer Familie diente, erschien. Sein langes schwarzes Gewand war ramponiert, die rote Schärpe hing nachlässig herunter. »Das Haus bietet keinen Schutz mehr, Herrin«, sagte er zu meiner Mutter. »Die Ägypter dringen in alle Wohnstätten ein. Außerhalb der Mauern sind wir sicherer. Ich werde euch zu den Hügeln führen.«
»Aber mein Gemahl …«
»Rasch, Herrin.«
Tante Rakel fasste mich am Arm. »Komm, Avigail, wir müssen uns in Sicherheit bringen.«
Ihr Gesicht war leichenblass. Furcht brannte in ihren Augen. Ihr Mann – mein Onkel – hielt sich im Armenviertel auf, mein Vater im Tempel. Würde der Allerhöchste sie beschützen?
Wir folgten Avraham durch einen schmalen Gang, den man vor langer Zeit als Fluchtweg innerhalb der Mauern angelegt hatte, war doch Jericho im Laufe der Jahrhunderte häufig überfallen worden. Wir rannten los, verängstigt, mit pochendem Herzen, in den Ohren die Schreie unserer Dienerschaft.
Wir gelangten ins Freie, in eine Nacht voller Chaos und Grauen. Menschen hetzten durch die Straßen, gejagt von feindlichen Soldaten hoch zu Ross. Wir drängten uns aneinander, warteten darauf, dass Avraham eine günstige Gelegenheit abpasste, um uns auf die Felder jenseits der Mauern zu bringen. Die Stadttore standen weit offen, und dort bot sich uns ein grauenvoller Anblick … lodernde Fackeln, Soldaten im Kampf Mann gegen Mann, Generäle in vergoldeten Streitwagen, ohrenbetäubendes Geschrei und Blut, entsetzlich viel Blut …
Wir rannten los.
Die Bewohner von Jericho flohen in alle Richtungen, die Straßen entlang, über Felder, die der Frühjahrsernte entgegensahen, mit Kindern und Besitztümern bepackt, einige nur notdürftig bekleidet, gejagt von den Schwertern und Speeren ägyptischer Soldaten.
Als unsere Gruppe im Licht des Vollmonds über ein Zwiebelfeld hastete, tauchte aus dem Nichts ein ägyptischer Kavallerist auf und lenkte sein Pferd im Galopp auf uns zu. Ich wich seitwärts aus, entkam um Haaresbreite den donnernden Hufen. Meine Mutter sprang zur anderen Seite, aber da senkte sich das Schwert des Soldaten in einem unheilvollen Bogen, die Klinge durchtrennte den Hals meiner Mutter so sauber wie eine Sichel eine Garbe Weizen. Ich sah ihren Kopf in die Luft fliegen, den überraschten Ausdruck auf ihrem Gesicht. Das Kriegsross stürmte weiter, während der weißgekleidete Körper meiner Mutter gleich einer umstürzenden Statue zu Boden sank.
Mit offenem Mund stand ich da. Ich konnte in jenem Augenblick nicht begreifen, was sich da abspielte, was gerade geschehen war. Wie betäubt sah ich mich nach Mutters Kopf um. Warum, weiß ich nicht. Aber es schien mir wichtig festzustellen, wo er hingeflogen war.
Alles, woran ich mich danach erinnere, ist, dass ich von starken Armen umfangen wurde, dann wurde es dunkel um mich herum.
Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich inmitten einer Gruppe von Flüchtlingen in den Bergen westlich von Jericho. Noch war es Nacht. Viele hatten Zuflucht in Höhlen oder in dicht bewaldeten Hainen gesucht, wo sie aneinandergeklammert voller Entsetzen mit ansahen, wie Jericho der Armee des Pharaos erlag.
Aus der Dunkelheit tauchte eine hochgewachsene Gestalt auf. Dem Allerhöchsten Preis und Dank, es war Rakels Sohn, mein Vetter Yacov. Er war es, der mich zu den Hügeln getragen hatte, ehe er wieder in die Stadt zurückgekehrt war, um sich ein Bild von der Lage zu machen. »Sprich ein Gebet«, sagte Yacov. »Die Männer sind tot. Sie wurden zusammengetrieben und zum Tempel des Mondes gebracht und dort erschlagen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.«
»Papa?«, fragte ich.
Aus Yacovs Blick sprach Hoffnungslosigkeit. »Ja, Avigail. Und meinen Vater haben sie von der Bettkante eines Patienten gezerrt und zum Schlachten abgeführt. Dafür sind sie jetzt beim Allerhöchsten, gepriesen sei Sein Name.«
Tante Rakel schlug die Hände vors Gesicht. »Allerhöchster«, murmelte sie, »nimm ihre Seelen gnädig bei dir auf.« Ihr Schleier war verrutscht, gab volles kastanienbraunes Haar preis. Die gleiche Farbe wie die von Yacovs Haar und seinem Bart.
»Das ist das Ende von Jericho!«, erklang ein verzweifelter Ruf neben uns. »Das ist das Ende der Welt.«
»Der Pharao hat nicht die Absicht, die Stadt zu zerstören«, entgegnete Yacov. »Er hat vor, Jericho zu belagern. Schließlich ist es eine reiche Stadt an der Kreuzung vieler einträglicher Handelsrouten. Das bedeutet, dass unsere Häuser nicht zerstört werden, aber wir werden nicht dorthin zurückkönnen, denn die werden an ägyptische Bürger vergeben.« Und verbittert fügte er hinzu: »Der Pharao erweitert sein Imperium, indem er große und kleine Städte in Kanaan erobert und sie zu Vasallen Ägyptens macht.«
Meine Schwestern, neun und elf Jahre alt, wippten vor und zurück und wimmerten in ihre vors Gesicht geschlagenen Hände: »Was wird dann aus uns? Wo sollen wir hin?«
»Können wir nicht erst einmal abwarten, Yacov?«, fragte Tante Rakel. »Können wir nicht ausharren, bis die Feindseligkeiten abgeklungen sind, und dann vielleicht über die Rückgabe unseres Hauses verhandeln?« Ich sah, wie sie die Hände rang und um Haltung bemüht war. Meine Eltern tot, Rakels Ehemann erschlagen. Ihr und ihrem jungen Sohn kam es jetzt zu, dafür zu sorgen, dass wir, die mit heiler Haut davongekommen waren, überlebten.
Yacov schüttelte den Kopf. »Die Ägypter vergewaltigen die Frauen. Es geht ihnen darum, ägyptischen Samen zu verbreiten und durch ihre Bastard-Mischlinge die Loyalität zum Pharao zusätzlich zu untermauern. Mutter, du und die Mädchen dürft auf keinen Fall zurück.«
»Aber was soll das alles bezwecken, mein Sohn?« Rakel suchte verzweifelt nach einer Begründung für diese Katastrophe.
»Es heißt, der Pharao benötigt Arbeiter für den Aufbau seiner neuen Stadt im Nildelta. Seine Truppen überfallen die Länder südlich von hier, um Gefangene zu machen und sie in einem Gewaltmarsch nach Ägypten zu bringen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Habiru, nomadische Schäfer, die leicht zu überrumpeln sind, weil sie sich nicht verteidigen können. Aber auch Kanaaniter sind ihnen in die Hände gefallen.«
»Der Pharao muss verrückt sein«, stellte ich ernüchtert fest und legte die Arme um meine beiden kleinen Schwestern. »Die Habiru sind ein ungehobeltes Volk, das sich nur darauf versteht, Zelte aus Ziegenhäuten zu errichten. Aber doch nie und nimmer Gebäude aus Stein!«
»Avigail, sprich ein Gebet!«, wies mich Tante Rakel zurecht. »Es gehört sich nicht, abschätzig über ein Volk zu reden, von dem du nichts weißt.«
»Man wird die Habiru im Bau von Häusern unterweisen«, sagte Vetter Yacov.
Als meiner Tante Tränen über die Wangen liefen, fügte er hinzu: »Sorge dich nicht um Jericho, Mutter. Könige kommen und gehen, Königreiche erstehen und fallen. Jericho aber wird ewig sein. Keine Macht auf Erden kann diese gewaltigen Mauern zum Einstürzen bringen.«
Er richtete den Blick auf die Stadt, in der die Kämpfe bereits abebbten, und während er von »Überraschungsangriffen« und »gebrochenen Abkommen« sprach und sich darauf berief, auf welch heimtückische Weise Ägypten schon so oft den Frieden mit Jericho gebrochen hatte, spähte ich auf den Feldern vor der Stadt nach meiner Mutter aus. Eine Schönheit war sie gewesen, von allen geliebt, jetzt brutal niedergemetzelt. Ich wollte weinen, aber weder Tränen noch Trauer wollten sich einstellen. Es war, als hätte der Soldat hoch zu Ross mich ebenfalls erschlagen, als ob mein Leichnam neben dem meiner Mutter läge, schemenhaft und gefühllos.
Und wo war Benjamin? Mein Liebster, mein Verlobter?
»Wir müssen von hier weg«, sagte Yacov und stand auf. Er war erst achtzehn, wirkte aber, als er sich in seiner knielangen, in der Mitte gegürteten braunen Tunika und dem schwarzen Umhang um die Schultern über uns erhob, wie ein Riese. Er holte goldene Ringe aus seiner Schärpe. »Ich habe Geld. Wir werden uns zum Schutz mit anderen Familien zusammentun.«
»Wir können doch nicht einfach unser Zuhause aufgeben!«, rief Rakel.
»Mutter, sobald die Truppen des Pharaos die Stadt gesichert haben, werden sie diese Hügel nach Flüchtigen durchkämmen. Wir haben keine Wahl.«
Sie dachte darüber nach, sagte dann sehr ernst: »Ich hatte einen Traum, der diese Nacht voraussagte. Als ich meinem Gatten davon berichtete, meinte er, das habe nichts zu bedeuten, ich solle es vergessen. Jetzt aber habe ich begriffen, dass Träume Botschaften aus der unsichtbaren Welt sind. Möglicherweise sogar vom Allerhöchsten. Nichts auf sie zu geben ist falsch. Ich für meinen Teil werde nie wieder die prophetische Macht der Träume unterschätzen.«
An ihren Sohn gewandt, fuhr sie ruhig fort: »Wir haben Verwandte im Norden. Lass uns aufbrechen.« Sie, die Älteste von uns, bewahrte einen kühlen Kopf, und auch wenn sie jetzt Witwe war, durfte sie sich nicht den Luxus erlauben, ihren Gefühlen weiterhin freien Lauf zu lassen.
Dies hat sich mir von jener Nacht am tiefsten eingeprägt. Tante Rakels Kraft. Ihre Präsenz, die durch nichts aus der Ruhe zu bringen war. »Avigail«, sagte sie zu mir, »dir kommt es ab sofort zu, dich um deine Schwestern zu kümmern. Wir haben einen langen Weg vor uns. Wir müssen aufeinander achtgeben. Verlier nicht den Glauben. Der Allerhöchste wird uns zu einem neuen Zuhause im Norden führen. Und jetzt wollen wir beten und uns dann nach Ugarit in Syrien aufmachen.«
Ich schaute auf die Stadt, in der ich das Licht der Welt erblickt und in der ich nur Glückseligkeit und Sicherheit kennengelernt hatte, und spürte, wie mir das Herz brach. Der Schmerz war unerträglich. Mein Vater tot, mein Onkel tot. Meine Mutter, deren kopfloser Leichnam auf einem Acker lag. Und wo war Benjamin, mein Liebster? Obwohl Tante Rakel uns versicherte, dass die Verwandten in Ugarit uns aufnehmen würden, wusste ich, dass ich in jener fernen Stadt, in einem Haus, das nicht das unsere war, niemals glücklich sein würde.
Wir kehrten also Jericho den Rücken und begannen unseren kummervollen Exodus, klammerten uns aneinander, weinten, verließen unser angestammtes Zuhause mit nichts weiter als dem, was wir am Leibe trugen. Wir gingen auf in einem Strom heimatloser Flüchtlinge, ohne zu wissen, was die Zukunft für uns bereithielt. Aber auch wenn wir unsere wertvollen Besitztümer – Möbel aus Zedern- und Pinienholz, Vasen aus Alabaster und Malachit, Juwelen, die über Generationen hinweg weitervererbt worden waren – zurückließen, nahmen wir dennoch etwas Kostbares mit: die Geschichte unserer Familien, Namen, Ereignisse, Tragödien und Triumphe – aber auch Geheimnisse, die jede Familie hat –, alles immer wieder in Erinnerung gebracht und in unseren Herzen bewahrt. Wir mochten zwar unsere Häuser verlieren, unsere Identität hingegen niemals. Wir würden uns immer bewusst sein, dass wir Kanaaniter waren, Nachfahren von Shem, dem Sohn Noahs, und deshalb auserwählt von El, dem Allerhöchsten.
Für mich, Avigail bat Shemuel, geschah es nicht in jener Nacht, als Jericho an Ägypten fiel, nicht auf unserer Flucht nach Jerusalem, wo uns Freunde aufnahmen und mit Proviant für die vor uns liegende beschwerliche Wanderung versorgten, sondern irgendwo in den Ebenen von Sharon und Jesreel, irgendwo im Bergland westlich von Galiläa, als wir bei Nomaden und Schafhirten unser Lager aufschlugen – der alte Avraham, meine verwitwete Tante Rakel, ihr Sohn Yacov, meine beiden Schwestern, drei Diener und ich –, als ich zum Allerhöchsten für die Seelen meines Vaters, meines Onkels, meiner Mutter und meines geliebten Benjamin betete, als ich unter kalten, mir unbekannten Sternen schlief und meine Gedanken um meine ungewisse Zukunft kreisten, als ich in meine Hände schluchzte und glaubte, mein gebrochenes Herz würde nie wieder heilen – in jenem Moment geschah es, dass ich einen Schwur ablegte: heimlich, leise flüsternd, nur für mich bestimmt.
Ich schwor, mir nie wieder mein Zuhause wegnehmen zu lassen. Nie wieder zuzulassen, dass eine feindliche Macht meiner Familie ein Leid antat. Bis zum Ende meines Lebens, wo immer mein Weg mich hinführen, welch unbekannte Stadt, welch fremdes Land auch immer ich betreten würde, ich schwor mir, Wurzeln zu schlagen, einen Platz für mich und meine Familie zu beanspruchen und mich nie wieder vertreiben zu lassen wie in jener verhängnisvollen Nacht, als Jericho fiel …
ERSTES BUCH
1
»Woran denkst du, Großmutter?«
Als sie keine Antwort erhielt, drehte Leah sich um. »Großmutter?«
Avigail riss sich aus ihren Gedanken. Es war eine Nacht im Frühjahr, und in der Ferne grollte Donner. Jedes Jahr, wenn Frühlingsgewitter über Ugarit niedergingen, musste sie an jene furchtbare Nacht denken. Damals, als Jericho fiel. Vor so vielen Jahren und doch in ihrer Erinnerung noch so deutlich, als wäre sie erst gestern aus der Stadt geflohen.
Avigail betrachtete das kleine Fruchtbarkeitsamulett aus fein gehämmertem Gold in ihrer Hand, in das über zwei Brüsten und einem Schamhügel das Gesicht einer Frau eingraviert war – die vertrauten Züge von Qadesch, der Heiligen Hure, Göttin der Liebe und sinnlichen Freuden. Ein Glücksbringer, der sicherstellen sollte, in arglosen Männern Leidenschaft zu entfachen, und Avigail hoffte, dass er heute Abend bei Jotham, dem wohlhabenden Schiffbauer, Wirkung zeigte.
Die Bürger von Ugarit verehrten die Göttin. Als Allerhöchster wurde zwar El, der Gott Jerichos, gepriesen, aber er war nicht Ugarits einzige Gottheit. Seit langem mit einem Anhänger Baals verheiratet, hatte Avigail im Laufe der Zeit gelernt, zu den vielen Gottheiten des nördlich gelegenen Kanaan zu beten.
»In Gegenwart unseres Gastes«, sagte sie zu ihrer Enkelin, als sie Leah das Amulett in den Gürtel schob, »hältst du die Augen gesenkt. Jotham wird dich prüfend anschauen, und wenn dein Blick sich mit seinem kreuzt, wird er das als ungehörig werten und gekränkt sein. Sprich nicht, zapple nicht herum. Halt die Hände still und dein Gesicht verborgen.«
»Ja, Großmutter«, murmelte Leah. Ihr Herz klopfte. Von einem der reichsten Männer in Ugarit auserwählt zu sein! Und dies zu einem Zeitpunkt, da sich ihre Eltern bereits Sorgen machten, dass kein Mann um sie anhalten würde. Mit achtzehn hatte Leah das gängige Verlobungsalter bereits überschritten. Sie war einem jungen Mann aus einer anderen Familie versprochen gewesen und hätte ihn im vergangenen Sommer auch geheiratet, wenn er nicht von dem Fieber, das damals in der Stadt grassierte, dahingerafft worden wäre. Leah hatte schon befürchtet, als alte Jungfer zu enden, wäre es nicht zu dieser unerwarteten Kontaktaufnahme aus dem Hause Jotham gekommen.
Und jetzt herrschte im Haus von Elias geschäftiges Treiben. Familienmitglieder und Dienerschaft überstürzten sich vor Eifer in Erwartung der Ankunft eines solch erlauchten Gastes.
Leah und ihre Großmutter hielten sich in dem den Frauen vorbehaltenen Trakt der palastartigen Villa auf, einer in sanftes Licht getauchten abgesonderten femininen Welt mit lichtdurchlässigen Vorhängen, die sich in der Frühlingsnacht sanft bewegten, wo sich süßer Blumenduft mit dem zarten Parfüm der Frauen mischte und das Klimpern von Armreifen an schlanken Handgelenken mit dem Plätschern von Springbrunnen.
Mit den festlichen Vorbereitungen waren zwei weitere Frauen sowie zwei junge Mädchen beschäftigt: Leahs Mutter Hannah, die betagte Tante Rakel sowie Leahs jüngere Schwestern Tamar und Esther, die alle Leah beim Ankleiden halfen, bei der Auswahl des Schmucks und beim Schminken.
»Wenn du unseren Gast bedienst«, fuhr Leahs Großmutter fort, »bring durch deine Haltung Unterwürfigkeit und Demut zum Ausdruck. Zeig ihm, dass du ihm eine gehorsame Ehefrau sein wirst. Und vergiss nicht, dass eine gute Ehefrau niemals spricht, es sei denn, das Wort wird an sie gerichtet.«
Avigail hielt inne, um zur Beruhigung ihrer Nerven einen Schluck Wein zu nehmen. Noch war über die Heirat keine Einigung erzielt worden. Im Verlauf zahlreicher Nachrichten von Jotham, dem wohlhabenden Schiffbauer, an Elias, dem erfolgreichen Winzer, hatte Ersterer lediglich sein Interesse bekundet, die älteste Tochter des Letzteren zu ehelichen. Jetzt war dieser Besuch vereinbart worden, um dem ehrenwerten Jotham Gelegenheit zu geben, Leah, die er bereits mehrmals auf den Basaren von Ugarit in Begleitung ihrer Mutter, ihrer Schwestern und Dienerinnen erblickt hatte, näher in Augenschein zu nehmen. Halla!, befand Avigail, die jetzt bemüht war, die Falten und Säume von Leahs langen Röcken und Schleiern zu ordnen. Wenn Jotham Leah heiratet, wird durch die Verbindung unserer beiden Häuser die mächtigste Familie in Ugarit, vielleicht sogar in ganz Kanaan begründet! Mit unseren Weingärten und Jothams Schiffen können wir uns dann das Monopol auf den Weinhandel von hier bis zum Oberlauf des Nils sichern.
Während sie eine einzelne Locke, die sich aus dem dichten Haar der Enkelin verselbständigt hatte, zurück unter Leahs Schleier schob, sagte sie: »Ich habe den ehrenwerten Jotham wissen lassen, dass deine Mutter siebenmal empfangen hat – und dass sie jetzt sogar zum achten Mal guter Hoffnung ist. Das wird ihm verraten, dass unsere Frauen fruchtbar sind.« Avigail hatte nicht erwähnt, dass aus Hannahs sämtlichen Schwangerschaften Mädchen hervorgegangen waren, von denen lediglich drei das Säuglingsalter überlebt hatten. Sie warf ihrer Schwiegertochter, die wegen ihrer Schwangerschaft in einem bequemen Sessel saß, einen Blick zu. Alle hofften, dass es diesmal ein Sohn würde.
Leah, die der Fürsorge der Großmutter allmählich überdrüssig wurde, biss sich auf die Lippen. In das Gefühlschaos, das ihr das Herz bis zum Halse klopfen ließ, mischte sich Beklemmung. Sie wusste, wie sich Männer und Frauen verhielten und was hinter Schlafzimmertüren vor sich ging. Und sie schwor sich, eine gute, gehorsame Ehefrau zu sein und ihr Bestes zu geben, um Söhne zu gebären. Dies war nicht nur zum Wohle der Familie von Bedeutung, sondern für Leah selbst. Kanaanäische Frauen wurden nämlich nicht mit ihrem eigenen Namen angesprochen, sondern mit dem ihres männlichen Beschützers. Leah kannte man als »Bat Elias«, Tochter des Elias. Wenn heute alles nach Wunsch verlief, würde sie »Isha Jotham« heißen, Ehefrau von Jotham. Und mit der Geburt ihres ersten Sohnes würde ihr der ehrenwerte Titel »Em« verliehen werden, was »Mutter von« bedeutete. Mit Frauen, die nicht wenigstens einen Sohn zur Welt gebracht hatten, empfand man Mitleid, erfuhr ihr Status doch keine zusätzliche Aufwertung; sie wurden weiterhin lediglich als Ehefrau bezeichnet, ungeachtet dessen, wie viele Töchter sie hatten.
»Ich erinnere mich noch gut«, sagte Avigail und nahm erneut einen Schluck von dem kräftigen Rotwein, »wie es war, als mein Yosep kam, um mich zu begutachten. Weil es noch weitere junge Mädchen aus anderen Familien gab, die er in die engere Wahl gezogen hatte, ließ er sich bei mir viel Zeit. Als er mich ganz frech in den Hintern kniff, so als erwäge er den Kauf eines Fettsteißschafs, quietschte ich auf. Ich glaube, genau das war es, weshalb er sich für mich entschied. Wir waren dreißig Jahre lang verheiratet, und er nahm sich lediglich zwei Konkubinen. Möge er in der Glückseligkeit der Götter ruhen.«
Avigail seufzte und dachte zurück an den langen Weg, den sie in diesen letzten vierzig Jahren seit ihrer Flucht aus Jericho zurückgelegt hatte.
Nach einer beschwerlichen, von Not und Rückschlägen gezeichneten Wanderung hatten sie nach vielen Monaten die Stadt Ugarit erreicht und bei Verwandten Aufnahme gefunden. Dort hatten sie erfahren, dass die Ägypter mittlerweile die Leichen aller hingemetzelten Kanaaniter eingesammelt und auf einem mächtigen Scheiterhaufen verbrannt hatten. Es hieß, der Qualm sei bis nach Jerusalem zu sehen gewesen. Sie erfuhren, dass auch Benjamin und seine Familie erschlagen worden waren. Ägypter wären in die Häuser der Reichen eingezogen und hätten alles an kanaanäischen Töpfereien, Möbeln und Göttern gegen ihre eigenen Töpfereien, Möbel und Götter ausgetauscht. Dem König von Jericho habe man gestattet, auf dem Thron zu bleiben, er sei jedoch ab sofort lediglich eine Art Aushängeschild, während die Regierung Jerichos und der umliegenden Distrikte von Vertretern des Pharaos übernommen worden sei.
Zwei Jahre später hatte die achtzehnjährige Avigail die Aufmerksamkeit eines wohlhabenden Winzers namens Yosep geweckt. Obwohl sie mittellos war, wollte er sie unbedingt heiraten. Gewiss, sie war arm, aber sie besaß etwas ungemein Wertvolles: In ihren Adern floss königliches Blut. Die Kunde, dass Avigail von Ozzediah, einem beliebten König von Ugarit, abstammte, machte sie als Ehefrau umso begehrenswerter. Nach der Hochzeit führte Yosep sie heim in diese Villa hier, am Ausläufer der Berge gelegen und von üppigen grünen Weinbergen umstanden. Damals hatte Avigail gespürt, dass sie hier, in ihrem neuen Zuhause, Wurzeln schlagen würde, und sich geschworen, nie wieder von hier wegzugehen.
Mit gerunzelter Stirn nahm sie ihre Enkelin in Augenschein. »Deine Hüften sind erbärmlich schmal, Leah. Tamar, Liebes, reich mir mal den Schleier dort drüben.« Avigail rollte das Tuch der Länge nach zusammen und schob es Leah unter das Kleid. »Schon besser«, sagte sie und betrachtete ihr Werk.
»Wird Jotham nicht verärgert sein, wenn er die Schummelei bemerkt?«
Avigail lachte. »Glaub mir, liebes Kind, in der Hochzeitsnacht bemerkt kein Mann mehr den genauen Hüftumfang seiner Braut. Und jetzt hör gut zu: Um den Klang deiner Stimme zu beurteilen, wird Jotham eine Frage an dich richten. Wenn du antwortest, sprich ihn mit ›Mein Gebieter‹ an, so als wärest du bereits seine Ehefrau.« Sie zupfte Leahs Schleier zurecht. »Wunderschönes Haar hast du. So dicht und lang. Ich wünschte, du könntest es Jotham zeigen. Er würde es sich nicht zweimal überlegen, dich zur Frau zu nehmen.«
Sie trat einen Schritt zurück, um ihre Enkelin zu bewundern. Leah war bildhübsch. Groß und schlank, mit klaren Gesichtszügen und großen glänzenden Augen. Ihre Stirn war so ebenmäßig, dass Avigail hoffte, sie würde eines Tages mit goldenen Ringen geschmückt sein, um wie bei Avigail selbst den Reichtum ihres Ehegatten zur Schau zu stellen. »Sprich ein Gebet, Leah. Wenn heute Abend alles nach Wunsch verläuft, wirst du bald die Herrin eines prächtigen Hauses mit Blick über den Hafen sein. Du wirst viele Sklaven und Diener befehligen. Und wenn du mit deinem ersten Sohn niederkommst, wird dich jede Frau in Kanaa beneiden.«
Tiefste Zufriedenheit erfüllte Avigail. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sie sich ganz im Einklang mit der Welt und genoss die sichere Überzeugung, dass ihre Familie weiterbestehen würde.
Der Albtraum von Jericho war nie ganz von ihr gewichen. Und so hatte sie alles daran gesetzt, die Sicherheit und den Schutz ihrer Familie zu gewährleisten. Von dem Moment an, da sie als Jungvermählte in diese Villa eingezogen war, hatte sie entschlossen und zielstrebig diese Aufgabe angepackt. Das Haus von Elias wurde inzwischen von einer starken und loyalen Schutztruppe bewacht, die in regelmäßigen Abständen um die äußeren Mauern patrouillierte. Sie war bewaffnet und darauf eingeschworen, jedweden Eindringling bis auf den Tod zu bekämpfen. Um ganz sicherzugehen, dass ihre Familie wirklich beschützt wurde, hatte Avigail darüber hinaus jedem Wachhabenden, der sich im Ernstfall bewährte, eine großzügige Belohnung zugesagt. Schlau, wie sie war, hatte sie außerdem dafür gesorgt, dass Angehörige aller Wachposten als Sklaven oder als Diener im Haus lebten und arbeiteten – ein zusätzlicher Anreiz, Überfälle entschlossen abzuwehren.
Weitere Sicherheitsvorkehrungen umfassten ein versteckt gelegenes und mit Vorräten gefülltes Haus oben in den Bergen – ein Zufluchtsort für ihre Familie, falls Ugarit einmal von feindlichen Truppen überrannt werden sollte. Auch Gold war auf diesem abgelegenen Grundstück vergraben; sollte also die Familie flüchten müssen, hätte sie immerhin Geld für Nahrung und Unterkunft. Seit Jericho war Avigail besessen von dem Gedanken, alles zu tun, damit ihrer Familie nie wieder jene Schrecken widerfahren würden, die sie selbst, ihre Schwestern und Rakel hatten ertragen müssen.
Und jetzt, heute Abend, sah sie sich auf dem Gipfel des Erfolgs für all ihre Bemühungen und ihre Entschlossenheit. Leah würde mit einem der reichsten Männer Syriens verlobt werden, ihre Zukunft war gesichert. Danach galt es, einen Ehemann für Tamar zu suchen. Zum ersten Mal seit Jahren würde Avigail, wenn es donnerte, nicht an Streitwagen denken und zu Tode erschrecken. Sie würde wissen, dass es nur der Regen war, der geräuschvoll niederging, und die Nacht damals, vor vielen Jahren, würde sie nur noch daran erinnern, dass sie im Bett gelegen und an ihren geliebten Benjamin gedacht hatte.
Sie lächelte. Der Kreis schloss sich. Das Leben war angenehm, ihre Familie gesegnet.
Vielleicht könnte sie dann sogar eine Reise nach Jericho unternehmen. Ihre Schwestern waren zu den Göttern gegangen, ihr Cousin Yacov war vor langer Zeit bei einem Unfall gestorben. Avigail und Tante Rakel waren die Einzigen, die von jener furchtbaren Nacht übrig geblieben waren. Jericho stand wieder unter kanaanäischer Verwaltung. Nach jenem so ungeheuerlichen Überfall hatte es keine weiteren gegeben. Es hieß, Ägypten verfüge über ausreichend Sklaven zur Errichtung seiner Bauwerke. Nach und nach waren Bewohner, die hatten fliehen müssen, wieder in ihre Häuser zurückgekehrt, zumal viele Ägypter die Stadt rasch verließen, so dass letztendlich nur noch eine Handvoll Vertreter des Pharaos in Jericho darüber wachte, dass jährlich der volle Tribut an die Staatskasse Ägyptens entrichtet wurde. Wie schön es doch wäre, ihr Elternhaus wiederzusehen, sinnierte Avigail wehmütig vor sich hin.
Eine Sklavin trat ein und raunte ihrer Herrin etwas zu. »Asherah sei gelobt«, sagte Avigail lächelnd. »Jotham ist eingetroffen und lässt sich bereits den ersten Becher Wein schmecken. Wir können jetzt hinuntergehen. Erflehe den Segen der Götter und denk daran, dir den Schleier vors Gesicht zu halten.«
»Warte!«, rief die zwölf Jahre alte Esther. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und steckte Leah eine eben aufgegangene süß duftende Jasminblüte ans Ohr.
»Ich danke dir, Esther«, sagte Leah. Die arme Esther war mit einer gespaltenen Lippe zur Welt gekommen, weshalb es ihr bestimmt zu sein schien, unverheiratet zu bleiben und sich später einmal um ihre alten Eltern zu kümmern.
Die hübsche Tamar, sechzehn Jahre alt, wollte nicht zurückstehen. Mit einem »Hier, für dich, liebe Schwester« zog sie sich einen Ring ab und schob ihn auf Leahs Finger.
Verwundert sah Avigail ihre zweite Enkelin an, die für ihren Egoismus bekannt war. »Das ist aber wirklich selbstlos von dir, Tamar.«
»Ist auch nur für heute Abend. Danach will ich ihn zurückhaben.«
Als sie erkannte, weshalb sich Tamar derart großzügig gab – sie durfte nämlich nicht heiraten, ehe nicht ihre ältere Schwester verheiratet war –, dachte Avigail einen Moment lang über die Enkeltochter nach, der sie weniger zugetan war als den beiden anderen. Wie sie wusste, hatte Tamar ihr Herz an den Sohn eines Olivenanbauers verloren. Eine weitere glänzende Verbindung wäre das, überlegte Avigail, obwohl sie das unbestimmte Gefühl hatte, dass Tamar, ganz gleich, wen sie heiratete, niemals so ganz glücklich werden würde.
»Es ist Zeit«, wandte sie sich erneut an Leah, ihren Liebling. »Erflehe den Segen der Götter.«
Die Villa war um einen zentralen Hof gebaut, der nach oben hin offen war, um das Tageslicht und die Sonne hereinzulassen und auch den Regen, der in Abständen die Zisterne in der Mitte füllte. Um diesen gepflasterten Hof herum zog sich eine von Säulen getragene Loggia, von der aus Türen zu den inneren Räumlichkeiten führten. In dieser westlichen Hälfte des Hauses spielte sich das tägliche Kommen und Gehen ab, auch Besucher wurden hier empfangen. Die Küchen, die Wäscherei, Vorratslager und, in einem umzäunten Hof, Laufställe für Tiere sowie ein Schuppen, in dem geschlachtet wurde, befanden sich in der östlichen Hälfte des Anwesens, so dass der meist vom Meer kommende Wind die Gerüche vom Haus forttrieb.
Ursprünglich war das herrschaftliche Haus ebenerdig gewesen, ehe man dann im Laufe von Generationen Räume auf dem Dach errichtet hatte, so dass ein vollständiges oberes Stockwerk entstanden war. Hier befanden sich die Privaträume von Elias, dem Hausherrn, sowie leere Schlafkammern, die darauf warteten, von Söhnen und Enkeln bewohnt zu werden. Auf der anderen Seite des offenen Hofs lagen die Schlafkammern der Frauen und ihre abgeschirmten Höfe und Gärten, deren Betreten Männern grundsätzlich untersagt war.
Über dieses obere Stockwerk zog sich ein mit viel Grün bepflanztes Flachdach, von dem aus sich ein Blick auf die familieneigenen Weinberge bot, die sich über die Hänge der umliegenden Hügel erstreckten und, weiter entfernt, auf die Stadt Ugarit. Das Haus von Elias, dem Kanaaniter, war eines der höchsten und geräumigsten im Lande, und seine prachtvolle Ausstattung erregte den Neid vieler wohlhabender Familien.
Avigail begleitete Leah in die Empfangshalle, in der ihr Sohn Elias den Gast unterhielt. Im Schein glänzender Bronzelampen lagerten die beiden Männer, den Rücken an dicke Kissen gelehnt, auf kostbaren Teppichen, derweil Sklaven goldene Platten mit Köstlichkeiten aus der Küche auftrugen: Kammmuscheln, speziell geformte Brotlaibe, künstlerisch arrangierte gebratene Spargelspitzen, Schweinekoteletts, Spanferkel und nicht zuletzt die in Ugarit beliebten Blutwürste. Dass Leah gleichzeitig mit dem Auftragen der Speisen im Saal erschien, symbolisierte ihre Rolle als diejenige, die ihren Herrn bedient.
»Shalaam, Em Elias«, sagte Jotham zu Avigail, nicht ohne das schweigsame Mädchen an ihrer Seite mit einem kurzen Blick zu streifen. Im Gegensatz zu seinem Gastgeber, der eine braune Tunika unter einem konservativen Gewand mit einer Schärpe um die Mitte trug, hatte Jotham seinen massigen Körper in eine flammend rote Tunika gekleidet und darüber einen gestreiften Umhang geworfen. Da er seine Sandalen an der Tür abgelegt hatte, war er barfüßig. Sein dunkelbraunes Haar und der Bart waren geölt und gekräuselt, und seine kräftigen Handgelenke umschlossen breite Goldreifen. Auf dem niedrigen Tischchen vor ihm funkelte im Schein der Lampe sein Geschenk für Leahs Familie: fünf Kugeln eines duftenden Gummiharzes, Weihrauch genannt. Ein ungemein großzügiges Geschenk.
»Shalaam. Möge Dagon dich segnen«, erwiderte Avigail und bemühte sich, angesichts der zweiten Person, die, angetan mit einem langen schwarzen Gewand und einem schwarzen Schleier über Kopf und Schultern, auf einem Hocker saß – Jothams Schwester Zira –, nicht die Stirn zu kräuseln. Dass sie den Bruder begleiten würde, war Avigail entgangen. Hinter dem Paar standen Jothams Schreiber und ein Anwalt bereit, um das Treffen schriftlich festzuhalten und einen Vertrag auszufertigen. Elias’ eigener Schreiber saß auf einem Hocker hinter seinem Herrn und wartete ebenfalls darauf, das Treffen auf Tontafeln aufzuzeichnen.
»Willkommen im Hause meines Sohns, Em Yehuda«, sagte Avigail zu Zira, auch wenn sie die Zurschaustellung von ausnahmslos goldenen Ringen auf der Stirn dieser Frau – nicht einem einzigen aus Kupfer oder Silber! – reichlich übertrieben fand. Zira hatte keine Ähnlichkeit mit ihrem Bruder, den man, wäre er nicht so fett gewesen, als durchaus gutaussehend hätte bezeichnen können. Zira dagegen war zaundürr, hatte kantige Wangenknochen und einen schlimmen Überbiss.
Auch wenn sie Jothams Schwester bisher nur bei großen Festen gesehen hatte, war sie selbst erstaunt, wie heftig ihre spontane Abneigung gegen Ziras Anwesenheit in ihrem Haus war. Avigail zog sich mit einer Entschuldigung hinter einen aufwendig geschnitzten Wandschirm zurück, wo sie sich zu Hannah und Tante Rakel und den beiden jüngeren Mädchen setzte, um mit ihnen von dort aus das weitere Geschehen zu beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Als sie Platz nahm, hörte sie die betagte Rakel murmeln: »Asherah stehe uns bei, Jothams Schwester gefällt mir nicht. Ihre Mutter muss von einem Esel verschreckt worden sein.«
Avigail und Rakel wandten ihre Aufmerksamkeit Leah und den Gästen zu, als Hannah sich plötzlich vorbeugte und die Hände schützend auf ihren Bauch legte. Ihr Gesicht verriet höchste Bedrängnis.
Vergangene Nacht hatte sie einen Traum gehabt, der sie noch immer verstörte: Sie wird wach, als ein Rabe in ihre Bettkammer fliegt, die sie mit ihrem Ehemann Elias teilt. Der Rabe hockt sich ans Fußende des Bettes und sagt zu ihr: »Zweihundert Amphoren deines besten Jahrgangs sind angemessen.«
Gleich darauf betritt ein Mädchen, das ihrer Tochter Leah ähnelt, mit einer Schüssel voll dampfender Suppe die Kammer. Der Duft von Muscheln breitet sich aus. Als das Mädchen auf das Bett zugeht, fliegt der Rabe unvermittelt wie närrisch krächzend auf und flattert heftig mit den schwarzen Flügeln. Das Mädchen stößt einen Schrei aus, lässt die Suppenschüssel fallen und sinkt, von einem Krampf geschüttelt, zu Boden.
Hannah ist zu keiner Bewegung fähig. Elias wacht nicht auf. Fassungslos sieht sie mit an, wie sich das Mädchen auf dem Boden windet, wie ihr Schaum und Speichel über die Lippen quellen, wie sie mit Armen und Beinen um sich schlägt und ein durchdringender Laut ihrer Kehle entweicht.
Dann war Hannah aus dem Schlaf hochgeschreckt und hatte den ganzen Tag in Angst und Schrecken über die Bedeutung dieses Traums nachgegrübelt.
Jetzt war der Traum wieder da, in allen Einzelheiten und mit all seinen qualvollen Momenten, denn Jothams Schwester in ihrem Witwenkleid ähnelte einem großen schwarzen Vogel, und ihre Nase erschien wie ein Schnabel. Hannah presste die Hand auf den Busen und spürte, wie ganz plötzlich ihr Herz zu rasen begann.
Jetzt bediente Leah die Gäste, immer darauf bedacht, ihr Gesicht verschleiert zu halten, während sie ihrem Vater, Jotham und Zira Platten mit Essen anbot. Jotham nahm sich eine mit Knoblauch gespickte, ölig schwarz glänzende Olive, und während er sie sich in den Mund schob, erklärte er: »Eins sag ich dir, Bruder, die Ägypter sind pervers. Man stelle sich das mal vor – das mächtigste, das reichste und fortschrittlichste Land der Welt wird von einer Frau regiert!«
»Für die Fortschrittlichsten würde ich sie nicht gerade halten«, erwiderte Elias und griff nach einer rohen Auster in Essig. Ende dreißig und barttragend wie alle Kanaaniter, war Elias der Winzer ein kräftiger Mann mit gradlinigem Charakter. In Ugarit schätzte man ihn überall als unparteiisch und klug.
»Frauen fehlt es an komplexem Denkvermögen und an der Befähigung, ein Land zu regieren. Hatschepsut dürfte eine Menge Berater auf Trab halten.«
»Der Knabe, der den Thron geerbt hat, ist einfach zu jung«, sagte Elias, der stets eine Situation von beiden Seiten aus zu beurteilen pflegte. »Thutmosis braucht einen Mitregenten. Seine Stiefmutter steht ihm nur so lange bei, bis er sich selbst behaupten kann.«
»Elias, mein Freund, mit einer Königinwitwe kann ich mich ja noch abfinden. Aber dieses überspannte Weib hat sich selbst zum König ausgerufen! Hatschepsut trägt Männerkleidung und schmückt sich sogar mit einem falschen Bart! Was sind die Ägypter doch für Schwächlinge, dass sie eine derartige Verirrung hinnehmen? Puh! Sorgen sich nur darum, woher der nächste Becher Bier kommt. Keiner Frau sollte derart viel Macht zugestanden werden. Das ist gefährlich.«
»Immerhin versteht sich Königin Hatschepsut darauf, Ugarit aufgrund von angeblich freundschaftlichen Handelsbeziehungen einen jährlichen Tribut aus der Nase zu ziehen.«
»Ja. Und überall in Kanaan murrt man darüber und schwört, sich eines Tages dagegen zu erheben.«
»Genug von Politik«, sagte Elias. »Lass uns trinken, auf dass die Traube uns Flügel verleihe!« Er forderte Jotham auf, einen neuen Wein zu verkosten. Der Schiffbauer schaute in seinen Becher und runzelte die Stirn. »Hast du mir da Wasser eingeschenkt?«
»Beileibe nicht! Probier mal!«
Jotham trank zögernd. Dann: »Das ist ja Wein! Tatsächlich! Aber diese Farbe, oder soll ich sagen, Farblosigkeit?«
»Das ist weißer Wein, mein Freund, eine spezielle Lese, an deren Verfeinerung ich gearbeitet habe. Es begann mit einem Experiment, bei dem ich von den gepressten Trauben vor Beginn der Gärung die Haut entfernte. Aus reiner Neugier, was dann passieren würde. Und dies ist das Ergebnis. Die Götter seien gepriesen!«
Ein weiterer Schluck. Jotham schnalzte mit den Lippen. »Leicht. Frisch. Süßlich. Ich glaube, das wird ein großer Erfolg. Wie du weißt, mein Freund und Bruder, habe ich vor, eine neue Werft auf Zypern zu bauen und von dort aus neue Handelswege über das Meer zu erschließen. Welch einträgliche Geschäftsverbindung das werden könnte – du mit deinen legendären Weinen und ich mit meinen schnellen Schiffen. Schon bald wird die ganze Welt diesen außergewöhnlichen Tropfen genießen.« Bei dem Wort »Verbindung« schielte er zu Leah und legte ein wenig mehr Betonung auf diesen Ausdruck.
Elias grinste und hob seinen Becher. »Auf den Wein und die Schiffe, mein Freund und Bruder! Heute Abend sind die Götter mit uns.«
Jotham wiederholte den Trinkspruch und leerte seinen Becher. »Köstlich«, murmelte er mit einem Seitenblick auf Leahs Hüften.
Während sich Elias und seine Gäste gebratenes Schweinefleisch, Muscheln in Soße und Riesenkrabben schmecken ließen, setzte ein Frühlingsregen ein, der zunächst wie ein Flüstern anmutete, bald jedoch in anhaltendes Rauschen überging. Kalter Wind wehte ins Haus.
Jothams Schwester Zira tupfte sich die Lippen mit einem Tuch ab und ergriff zum ersten Mal das Wort. »Du solltest froh sein, dass wir bereit sind, dir Leah in Anbetracht ihres Alters abzunehmen.«
Elias runzelte die Stirn. »Meine Tochter ist nicht so alt.«
Zira reckte das Kinn. »Dennoch wird man sich fragen, woran es liegt, dass sie mit ihren achtzehn Jahren noch nicht verheiratet ist. Wir müssen schließlich an unseren guten Ruf denken.«
»Mein Haus ist in ganz Kanaan wohlbekannt. Jeder angesehene Bürger weiß, was meiner Tochter widerfahren ist.«
»Weshalb man sie bedauern muss?«, fragte Zira spitz.
»Halla!«, zischelte Avigail hinter dem Wandschirm. »Das Weib dreht meinem Sohn das Wort im Mund um. Und Jotham weist sie nicht zurecht!«
Avigail hatte angenommen, dass Zira, die, seit sie verwitwet war, im Hause ihres älteren Bruders lebte, einen niedrigeren Rang einnahm. Aber dem schien keineswegs so zu sein. Während Jotham unter seinesgleichen hohes Ansehen genoss und ein wohlhabender Geschäftsmann mit Beziehungen zum Adel und Königshaus war, schien er in seinem eigenen Haus unter der Knute seiner Schwester zu stehen.
»Halla, Mutter Avigail!«, flüsterte Hannah. »Ich finde diese Frau grässlich.«
Avigail musterte ihre schwangere Schwiegertochter. Sie stammte aus dem Norden, ihr Vater baute Datteln an. Hannahs gekrümmte Haltung und die Art, wie sie sich die Hände auf den geschwollenen Leib presste, gaben ihr zu denken. Wo sie doch achtundzwanzig Tage hintereinander im Tempel der Asherah ein männliches Kind erfleht hatte! »Sprich rasch ein Gebet, Tochter.«
Jetzt war wieder die scharfzüngige Frau zu hören: »Versteht sich deine Tochter auf harte Arbeit, Elias? Ich dulde nämlich keine Faulheit unter meinem Dach.«
»Halla!«, stieß Hannah abermals leise aus und presste die Hände auf den Leib. »Sie wird meine Tochter wie eine Sklavin schuften lassen. Ein angenehmes Leben dürfte Leah nicht bevorstehen.«
»Hannah, such deine Kammer auf. Sprich ein Gebet. Du musst an dein Kind denken.«
Hannah jedoch blieb sitzen. »Mir gefällt nicht, wie Jotham meine Tochter anstiert«, tuschelte sie wütend. »Mögen die Götter ihr beistehen.«
Avigail tätschelte den Arm ihrer Schwiegertochter. »Er ist ein Mann. Da muss er sie doch so ansehen.«
»Und wie er sich die Lippen leckt! So unverkennbar lüstern, einfach widerlich! Seine früheren Frauen sollen ja daran gestorben sein, dass er sie in der Schlafkammer über alle Maßen traktiert hat.«
»Beruhige dich, Hannah«, sagte Avigail beschwichtigend. Erstaunlich, welche Wirkung Qadeschs Fruchtbarkeitsamulett zeigte, denn Jotham glotzte Leah tatsächlich mit unverhohlener Begierde an. »Du regst dich nur unnötig auf. Ruf die Götter an. Denk an dein ungeborenes Kind.«
»Er ist so alt. Fünfundvierzig. Und keines seiner männlichen Kinder hat überlebt! Über seinem Haus schwebt Unheil.«
Avigail unterdrückte die Bemerkung, dass es im Hause Elias nicht anders stand und dass sie in Gebeten Qadesch und Asherah anflehte, eine Verbindung der beiden Häuser möge diese Pechsträhne beenden. Da sie sah, wie verstört ihre Schwiegertochter war, sagte sie jedoch: »Mach dir keine Sorgen, Hannah, Liebes. Ich werde schon dafür sorgen, dass Leah in Jothams Haus gut behandelt wird. Denk lieber an das Kind in deinem Leib. Es muss noch zwei Monate darin ausharren. Bring ihm keine bösen Träume. Ruf Asheras gesegneten Namen an.«
Aber Hannahs Erregung steigerte sich immer mehr. Alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. Der Albtraum geisterte durch ihre Gedanken – der Rabe, der von Weinamphoren sprach, das Mädchen, das Leah ähnelte und das sich in Krämpfen auf dem Boden wand …
In diesem Augenblick wollte Leah gerade Jotham eine Schale mit Muschelsuppe zureichen. »Mutter Avigail –«, hauchte Hannah so kraftlos, dass ihre Worte die Schwiegermutter nicht erreichten.
»Du wirst wohl ein bisschen mehr für die Mitgift aufbringen müssen.« Auf diese unverschämte Bemerkung Ziras hin erwarteten Elias und auch die Frauen hinter dem Wandschirm, dass Jotham ihr zu schweigen gebieten würde. Aber der dicke Schiffbauer beschäftigte sich mit einer Blutwurst und ließ seine Schwester gewähren.
»Wieso sagst du das?«, fragte Elias, der nicht gewohnt war, Geschäftliches mit einer Frau zu besprechen.
»Mein Bruder wird ein Mädchen heiraten, das weitergereicht wurde. Was sollen denn die Leute denken?«
»Weitergereicht?«, empörte sich Elias. »Der junge Mann ist gestorben.«
Zira zuckte mit den Schultern. »Mein Bruder fordert eine Entschädigung dafür, dass wir sie dir abnehmen. Zweihundert Amphoren deines besten Jahrgangs sind angemessen.«
»Was?!«, fuhr Elias auf. Und hinter dem Wandschirm flüsterte seine Ehefrau Hannah Avigail zu: »Mutter Avigail, der Traum, von dem ich dir heute Morgen erzählte – genau das hat der Rabe zu mir gesagt! Und dann sah ich, wie das Mädchen, das Leah so ähnlich sah, einen Anfall bekam und zu Boden sank. Jetzt weiß ich, was der Traum zu bedeuten hat. Er weist darauf hin, dass die Fallsucht Jotham im Blut liegt. Das Mädchen, das wie Leah aussah, ist bestimmt die Tochter, die sie irgendwann bekommt, und die Götter warnen uns, dass bei einer Heirat zwischen Leah und Jotham ihre Kinder diese Fallsucht erben könnten.«
Avigail schwieg betroffen. Jeder in Ugarit wusste von dem Gerücht, dass Ziras Sohn unter Anfällen litt. Da Zira aber politische Ambitionen für ihren Sohn hegte, durfte man, wenn es um Politik ging, Gerüchten nicht unbedingt Glauben schenken. Andererseits hatte Tante Rakel seit ihrer Flucht aus Jericho Avigail immer wieder eingeschärft, die prophetische Bedeutung von Träumen ernst zu nehmen. Deshalb schien es ihr jetzt einleuchtend, Hannahs Traum tatsächlich als Warnung der Götter zu verstehen.
»Mutter«, sagte Hannah, »das Mädchen in meinem Traum trug Muschelsuppe auf. Und jetzt sieh doch, was Leah gerade tut.«
Avigail nickte ernst, tätschelte dann beruhigend Hannahs Hand. »Das werden wir sofort klären.«
Zum Entsetzen ihres Sohnes und seiner Gäste trat sie hinter dem Wandschirm hervor und baute sich kerzengerade vor ihnen auf. »Verzeih die Störung, Sohn«, sagte sie, »aber bevor weiterverhandelt wird, sollte etwas Wichtiges zur Sprache gebracht werden.«
Sie wandte sich an Zira. »Entschuldige vielmals, Em Yehuda, aber ehe ich meine Enkelin deinem Bruder zur Ehe gebe, muss ich eine etwas heikle Frage stellen. Vergib mir, dass ich darauf zu sprechen komme, aber du wirst verstehen, dass dies von höchster Bedeutung ist. Es wird behauptet, dein Sohn Yehuda leide an der Fallsucht. Ist das wahr?«
»Mutter!«, brauste Elias auf.
Zira sprang hoch. »Wie kannst du es wagen!«
»Ich wage es, weil ich es mir, wenn es sich so verhält, noch einmal überlegen muss, ob ich meine Enkelin deinem Bruder anvertraue. Es heißt, dass Fallsucht vererblich ist. Wenn dem so ist, riskiert Leah, Kinder zu gebären, die diese Krankheit in sich tragen. Deshalb frage ich dich, Zira Em Yehuda: Leidet dein Sohn an dieser Krankheit?«
Zira presste die Lippen zu einem Strich zusammen. »Das ist ein bösartiges Gerücht, sonst nichts.«
Die Blicke der beiden Frauen kreuzten sich. Avigail sah, wie Zira die Hände verkrampfte, wie sie zitterte. »Du schwörst bei Asherah, dass dein Sohn diese Krankheit nicht hat?«
Zira öffnete den Mund, schloss ihn dann wieder.
»Halla«, flüsterte Avigail. »Dann stimmt es also. Yehuda leidet an der Fallsucht.«
Hinter dem Wandschirm war ein schriller Aufschrei zu hören, dann Tamars Ruf: »Großmutter! Mit Mutter stimmt etwas nicht!«
Avigail wandte sich an einen Diener. »Sag Jeremia, er soll sofort den Arzt holen. Sag ihm, es geht um eine Entbindung. Rasch!« Dann eilte sie Hannah zu Hilfe.
Beim Aufschrei ihrer Mutter hinter dem Wandschirm war Leah so heftig zusammengefahren, dass ihr die Schale mit der heißen Muschelsuppe entglitt und auf Jothams Schoß landete. Verärgert sprang er auf. Sofort eilten Sklaven mit Leintüchern auf ihn zu. Elias war entsetzt, Ziras Gesicht verfärbte sich vor Zorn tiefrot.
Wie versteinert blickte Leah zu der Trennwand. Als das Schluchzen und Stöhnen der Mutter allmählich verklang, schloss sie daraus, dass man Hannah zur anderen Seite des Hauses brachte.
»Tochter!«, wies Elias sie zurecht.
Sie wandte sich um und sah, dass sich die Muschelsuppe über Jothams scharlachrote Tunika ergossen hatte und Sklaven emsig dabei waren, das Malheur mit Tüchern zu beseitigen. Elias hatte sich erhoben und bedachte die Tochter mit einem vorwurfsvollen Blick. »Entschuldige dich sofort bei unserem Gast.«
Gerade als Leah der Aufforderung nachkommen wollte, hörte sie wieder einen Schrei. Hatten bei ihrer Mutter die Wehen eingesetzt? Dafür war es doch noch viel zu früh!
Ohne zu zögern, kehrte sie ihrem Vater und seinen Gästen den Rücken zu und stürmte aus der Empfangshalle.
Hannah lag auf dem Bett in der Kammer, in der üblicherweise Geburten stattfanden, und schrie erneut auf, derweil Avigail und mehrere Sklavinnen sich um sie bemühten. Noch ganz außer Atem, trat Leah hinzu, kniete neben dem Bett nieder und griff nach der Hand der Schwangeren. »Wie geht es dir, Mutter?«
Hannah bewegte den Kopf hin und her. Leichenblass war sie, ihr Gesicht schweißnass. »Die Schmerzen sind diesmal unerträglich«, hauchte sie. »Irgendetwas scheint nicht wie sonst zu sein.«
Jetzt schob Avigail Hannahs Gewand hoch, entblößte den geschwollenen Unterleib. »Halla«, sagte sie leise, als sie sah, wie sich die gespannte Haut kräuselte.
Angst zeichnete sich auf den Gesichtern von Tamar und ihrer jüngeren Schwester ab, die im Hintergrund knieten.
»Schafft gewürzten Wein herbei und ein Schüreisen, um ihn zu erwärmen«, wies Avigail in ruhigem Ton die Umstehenden an. »Und ich brauche eine Schüssel Wasser und frisches Leinen. Rasch! Tamar, mach dich nützlich und zünde Weihrauch vor Asheras Schrein an. Esther, bete für deine Mutter.« Obwohl sie sich nichts anmerken ließ, befürchtete Avigail das Schlimmste. Man wusste ja, dass sich Worte, sobald sie ausgesprochen sind, verselbständigen und ihre Wirkung entweder wohltuend oder verletzend sein kann. Ziras Worte hatten Unheil ausgelöst und sich gleich einem boshaften Wind verbreitet, hatten durch Hannahs Ohren Eingang gefunden und waren bis in ihren Bauch gedrungen, wo sie jetzt ihre dämonische Wirkung auf ihr ungeborenes Kind entfalteten.
Avigail beugte sich über ihre Schwiegertochter, legte ihr die Hand auf die Stirn. »Hannah, ruf die Götter an. Komm zur Ruhe. Wir müssen die Wehentätigkeit zum Stillstand bringen. Das Baby darf noch nicht geboren werden. Es würde nicht überleben.«
»Dieses abscheuliche Weib«, stieß Hannah mit zusammengebissenen Zähnen aus. An ihrem Hals traten Adern hervor. »Ich werde ihr nicht meine Tochter überlassen. Sie ist ein Rabe, der meinen Enkeln die Fallsucht anhängt.« Sie schrie auf, als sich zwischen ihren Beinen Wasser ergoss und auf dem Bett verteilte.
»Halla«, kam es kaum vernehmbar von Avigail, die sofort ein Schutzzeichen in die Luft malte und sich dann in der Kammer umschaute. »Wo bleibt der Wein? Wo ist das Mädchen mit der Wasserschüssel und dem Leinenzeug? Esther und Tamar, hört nicht auf zu beten. Ruft Asherah und Dagon an. Schnell! Erfleht den Beistand der Götter.«
Sie nahm eine Kerze von einem Leuchter, um überall in der Kammer Weihrauch zu entzünden, so dass alsbald die Luft mit süßem Rauch zur Abwehr böser Geister erfüllt war. Dann eilte sie in den äußeren Korridor und spähte unruhig die von Fackeln erhellte Säulenreihe hinunter.
Leah, die angstvoll neben dem Bett ihrer Mutter hockte, spürte eine Hand auf ihrem Arm. Es war Tante Rakel, die Älteste in Elias’ Haus, in dem sie seit zwanzig Jahren lebte. Ihr Gesicht war mit der Zeit schrumpelig geworden, ihr verrutschter Schleier gab krauses weißes Haar frei. »Mera, Liebes, lauf in die Küche und hol mir das Elixier der Asherah.«
»Das Elixier der Asherah? Was meinst du damit, Tantchen?«
»Spute dich. Das Rezept stammt von meinem Mann. Er war Arzt und pflanzte alle möglichen Büsche und Blumen und auch ein paar Bäume an. Damals in Jericho, wo ich herkomme. Die Leute besuchten unser Haus, um sich von meinem Mann behandeln zu lassen. Wenn er hier wäre, würde er Hannah das Elixier der Asherah verabreichen.«
»Was ist das Elixier der Asherah?«
Rakel legte ihre von weißen und blauen Adern durchzogene Hand auf Hannahs Unterleib. »Durch die Gnade der Göttin werden damit die Wehen zum Stillstand gebracht. Als meine Schwester im siebten Monat schwanger war, verirrte sich ein Falke ins Haus und fand nicht mehr heraus. Wir versuchten ihn einzufangen, aber er flog von einem Zimmer ins andere, bis er an einen Pfeiler stieß und tödlich verletzt zu Boden fiel. Bei meiner Schwester setzten daraufhin die Wehen ein, und um ein Haar hätten wir das Kind verloren, wenn nicht mein Ehemann ihr das Elixier verabreicht hätte. Aber nachdem sie es genommen hatte, kamen die Wehen zum Stillstand, und das Baby konnte voll ausgetragen werden. Er lebt noch und ist kerngesund, mein Neffe Ari.«
Avigail kam vom Korridor zurück. »Worüber spricht Tante Rakel da? Wer ist Ari?«, fragte sie stirnrunzelnd.
»Mera, geh sofort in die Küche!«, rief die alte Frau. »Noch einmal dürfen wir Rebekka nicht verlieren!«
»Rebekka?« Avigail sah sie verdutzt an, dann hellten sich ihre Züge auf. »Ari, Rebekka. Halla, die sind schon seit Jahren tot. Wenn ich mich recht erinnere, war Mera, als ich klein war, eine Dienerin. Leah, schau nach, wo der Arzt bleibt. Rakel, du gehst jetzt in deine Kammer. Mit deinem Gerede jagst du Hannah nur Angst ein.«
»Aber das Elixier der Asherah wird ihr helfen! Es wird das Kind retten.«
»Komm schon, sei so gut und leg dich hin. Bete zu den Göttern. Ah, da ist ja der Wein.«
Avigail nahm den Becher entgegen und eilte zum Bett, setzte sich neben ihre Schwiegertochter und hielt ihr den Wein an die Lippen. »Trink, so viel du kannst, Liebes, und rufe dabei die Götter an. Das wird die Wehentätigkeit verlangsamen und dich so weit beruhigen, dass du das Baby in dir behalten kannst.«
»Asherah, hilf mir, ich kann nicht!«, schrie Hannah. »Das Kind kommt!«
Mit zitternder Hand stellte Avigail den Becher ab und trat zum Fußende des Bettes. Der Schleier war ihr vom Kopf gerutscht, kastanienbraunes Haar mit silbernen Strähnen glänzte im Schein der Lampe auf. Zum Handeln bereit, beugte sie sich vor. »Oh, Hannah! Aufhalten lässt es sich nicht mehr. Alles liegt in der Hand von Asherah. Komm, Leah, hilf mir.«
Mit vor Angst weit aufgerissenen Augen kniete sich Leah neben die Großmutter und sah fassungslos mit an, wie das Baby kam, schnell und zusammen mit viel Blut.
»Die Götter seien gepriesen! Es ist ein Junge!«, rief Avigail, ehe sie das kläglich wimmernde Kind in eine Decke wickelte und es Leah überreichte. Überschwänglich hatte sich ihr Ausruf nicht angehört.
Sie wandte sich wieder Hannah zu und schnitt mit einer scharfen Kupferklinge die Nabelschnur durch, während Leah das kleine Leben in ihren Armen in Augenschein nahm, das rote Gesichtchen, die geschlossenen Augen, das mit Blut und Geburtsflüssigkeit verschmierte Körperchen. Aus dem offenen Mündchen des Winzlings drangen Schreie, die denen junger Katzen ähnelten, und bei jedem Luftholen überlief ihn ein Zittern.
Wie klein er war, wie hilflos. Leahs Tränen tropften auf ihn, als sie mit einem stummen Gebet Asherah anflehte, ihn am Leben zu lassen.
Der Hausverwalter trat ein, atemlos, seine Gewänder vom Regen durchnässt. »Der Arzt war nicht zu Hause, Herrin«, sagte er zu Avigail. »Sein Diener verwies mich auf einen Arzt in der Nähe, den ich auch antraf und der zusagte, unverzüglich zu kommen.«
»Nicht zu Hause?« Wie alle wohlhabenden Familien hielt sich auch die von Elias einen Arzt in ständiger Bereitschaft. Er hatte Tag und Nacht zur Verfügung zu stehen, um ihnen zu ersparen, sich wie gewöhnliche Bürger an einen der Ärzte wenden zu müssen, die im Haus des Goldes praktizierten. Sie rümpfte die Nase und blickte zur Tür. »Und? Wo ist der Mann? Wir benötigen dringend …«
Die Worte blieben ihr im Halse stecken, sie riss die Augen auf, als sie den Fremden erblickte, der leise eintrat. Er war hochgewachsen, in Weiß gekleidet, trug eine lange schwarze Perücke und an einem Riemen über der Schulter einen Kasten.
»Du schleppst uns einen Ägypter an?«, herrschte sie den Verwalter an. »Halla! Damit bringst du Fluch über unser Haus!«
Schon wollte sie mit einer abweisenden Geste den Fremden fortschicken, als dieser jedoch näher trat und mit schwerem Akzent sagte: »Ich habe meine Ausbildung im Haus des Lebens in Theben absolviert. Ich kann helfen.«
Avigail überlief ein Schauer. Unwohlsein überkam sie. Draußen ging ein Frühjahrsregen nieder, begleitet von Donnergrollen, und hier drinnen baute sich ein Ägypter vor ihr auf. Wie seinerzeit in Jericho.
Etwas abseits stand Leah mit dem Baby im Arm und lauschte dem Wortwechsel. Der Arzt schien keinerlei böse Absichten zu verfolgen. Er war sauber gekleidet und höflich und schien bereitwillig helfen zu wollen. Allerdings wusste sie, wie sehr die Großmutter das Volk verabscheute, dem dieser Mann hier angehörte und der jetzt Avigail kurz zunickte und daraufhin die Kammer verließ. Was für Wundermittel mochte er in dem Kasten an seiner Schulter aufbewahren?
»Mein Sohn«, flüsterte Hannah. »Bitte reich ihn mir.«
Leah genügte ein Blick auf den Kleinen, um zu erkennen, dass er nicht länger zitterte. Seine Ärmchen waren erschlafft und der winzige Mund entspannt.
»Großmutter!«, rief sie leise.
Avigail eilte zu ihr und wusste sofort Bescheid. »Er ist zu den Göttern gegangen«, murmelte sie und malte ihm das heilige Zeichen Asherahs auf die Stirn.
»Halla!«, hörte man einen Mann rufen. In voller Größe und in einer Frauenkammer eher nutzlos und unbeholfen wirkend, stand Elias an der Tür.
»Elias«, erschrak Avigail, »du darfst hier nicht hereinkommen. Das bringt Unglück.«
»Als Hannah zu schreien aufhörte, habe ich auf Nachricht gewartet, aber niemand sagte etwas.«
Avigail ging ihm entgegen, schloss ihn in die Arme und sagte: »Mein Sohn, das Kind ist gestorben. Wir konnten es nicht retten.«