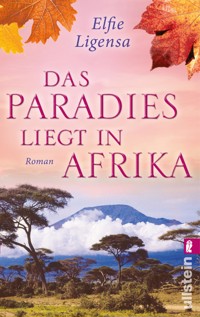7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Voller Hoffnung wandert der Winzersohn Ben Ruhland 1795 aus dem beschaulichen Rheingau nach Südafrika aus. Seit er denken kann, träumt er von einem eigenen Weingut. Zunächst will es nicht gelingen, die Reben in der trockenen Erde zu ziehen. Jemand legt ihm Steine in den Weg. Erst als er sich in die schöne Charlotte de Havelbeer verliebt, beginnt er zu glauben, dass alles gut wird. Doch ihr Vater hat für seine Tochter andere größere Pläne ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Im Herzen der Feuersonne
Die Autorin
Elfie Ligensa schreibt erfolgreich Romane und Drehbücher und lebt mit ihrem Mann und einer eigenwilligen Katze in der Nähe von Köln.
Das Buch
Voller Hoffnung wandert der Winzersohn Ben Ruhland 1795 aus dem beschaulichen Rheingau nach Südafrika aus. Seit er denken kann, träumt er von einem eigenen Weingut. Zunächst will es nicht gelingen, die Reben in der trockenen Erde zu ziehen. Jemand legt ihm Steine in den Weg. Erst als er sich in die schöne Charlotte de Havelbeer verliebt, beginnt er zu glauben, dass alles gut wird. Doch ihr Vater hat für seine Tochter andere größere Pläne ...
Elfie Ligensa
Im Herzen der Feuersonne
Historischer Liebesroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Juni 2021© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011Umschlaggestaltung: bürosüd GmbH, MünchenTitelabbildung: Trevillion Images / © Rekha Garton (Frau); www.buerosued.de (Landschaft)Karte: © Peter PalmAutorinnenfoto: © Anne-Marie von SarosdyE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-8437-2633-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
Gedicht
Lieb-, Lied- und Weines Trunkenheit, Ob’s nachtet oder tagt,Die göttlichste Betrunkenheit, Die mich entzückt und plagt.
Johann Wolfgang von Goethe
Na, hast du es dir so vorgestellt?« Mit weit ausholender Geste wies Olivier Garnier hinüber zur Bucht, einem eher beschaulich wirkenden Ort, hinter dem sich das beeindruckende Massiv des Tafelbergs in der flimmernden Luft und hinter einem von glitzernden Wellen übersäten Meer erhob wie eine Erscheinung. Obwohl es noch früh am Morgen war und leichter Seewind aufkam, spürte Ben bereits die Kraft der Sonnenstrahlen. Es versprach ein heißer Tag zu werden. Er musste die Augen zusammenkneifen, um an Land etwas erkennen zu können. Die Häuser erschienen winzig vor dem Hintergrund des Bergs, sie boten den gewöhnlichen Anblick eines Hafens, wie ihn die Parisienne in den vergangenen zwei Jahren unzählige Male angelaufen hatte.
»Voilà, das ist das legendäre Kap der Guten Hoffnung – armselig, was?« Olivier klopfte seinem Nebenmann auf die Schulter, ganz so, als wären sie in Wahrheit Freunde, und Ben wich beinahe unmerklich zurück. Ein Blick auf die Gestalt an seiner Seite weckte seinen ganzen Abscheu, wie immer, wenn Olivier ihm unter die Augen kam. Das fleckige Hemd des anderen Matrosen war weit geöffnet und entblößte die dichte Brustbehaarung. Ben konnte deutlich erkennen, wie sich Oliviers Schmerbauch über die ausgewaschene Leinenhose wölbte, die mit einer roten Kordel gehalten wurde, und er roch einen Hauch des muffigen Geruchs, den das letzte Saufgelage unter Deck in dessen Kleidern hinterlassen hatte. Ein rotes Tuch, das er sich um den Hals gebunden hatte, schützte den feisten Nacken vor der sengenden Sonne. Das dicke schwarze Haar des Südfranzosen aus dem kleinen Küstenort Collioure im Roussillon war stumpf, und seine Augen standen eng zusammen. Ein leichter Schauder überlief Ben. Der Mann war ihm widerwärtig, das hatte er gleich gespürt, als er ihm vor zwei Jahren das erste Mal an Bord begegnet war. So lange war das her, er konnte es kaum fassen.
Der junge Deutsche wandte den Blick ab und atmete die würzige Seeluft ein. Egal, was Olivier sagte, es konnte sein Glück nicht trüben, konnte ihm nichts von seinem aufgeregten Herzklopfen nehmen. Selbst wenn das, von dem er annahm, dass es Cape Town oder Kapstadt war, nicht gerade so aussah, als wenn es eine glückliche Zukunft für ihn bereithalten würde. Drüben in dem Hafen an der Südspitze Afrikas herrschte reges Treiben, das konnte man selbst aus der Entfernung erkennen. Zwischen einfachen Holzhäusern, Lagerschuppen, Pferdekutschen und Ochsengeschirren war ein emsiges Gewirr von Menschen zu erahnen, und er spürte Unruhe in sich aufsteigen, weil er nun kurz vor dem Ende seiner langen Reise stand.
Afrika! Endlich war er angekommen, und sein Traum würde wahr werden, der Traum, der ihn aus seinem beschaulichen Heimatort im Rheingau in diesen entlegenen Winkel der Welt geführt hatte. Sein Leben würde hier endlich beginnen. Welches Schicksal erwartet mich hier?, fragte er sich bang. Würde er die Lebensprüfung, die ihm ohne Zweifel bevorstand, zum Guten wenden können – oder würde er seinen Traum begraben müssen, so wie sein Ahne vor vielen Jahren?
Er wusste, dass er sich Olivier gegenüber nichts anmerken lassen durfte von seinen Träumen und Hoffnungen, wenn er diese nicht der unverhohlenen Häme des Franzosen preisgeben wollte.
»Ein Städtchen wie viele andere auch, dieses Kapstadt«, antwortete Ben daher nur knapp und strich sich eine Strähne seiner im Nacken zusammengebundenen dunklen Haare zurück, die ihm der raue Küstenwind ins Gesicht geweht hatte. Der dreißig Lenze zählende Ben galt mit seinem muskulösen Körperbau und seinem markanten Gesicht mit den dunklen Augen als gutaussehender Bursche, und er wusste, dass ihm nicht wenige Männer auf dem Schiff seinen Schlag beim anderen Geschlecht neideten. Ben hätte viele Frauen haben können, und nicht nur gegen bare Münze, wie einige der anderen Besatzungsmitglieder. Im Laufe der vergangenen Jahre hatte es nicht nur eine Frau gegeben, die seiner Wortgewandtheit und seinem rauen Charme erlegen war und deren Reizen auch er nicht hatte widerstehen können. Sie hatten ihm oft geschworen, sie würden auf ihn warten, bis er wiederkäme von hoher See, doch keiner war es gelungen, ihm so sehr den Kopf zu verdrehen, dass er auch nur flüchtig daran gedacht hätte, seinen Traum von Afrika aufzugeben. Und dann war da noch Katrin, wegen der er den Rheingau überhaupt erst verlassen hatte …
Oliviers spöttisches Lachen riss ihn aus seinen Gedanken. »Dummkopf, das ist nicht Kapstadt, sondern False Bay!«, rief er grob. »Man sagt, hier liegen die Schiffe sicherer. Als ich jung war, sind wir noch am Castle of Good Hope gelandet. Mit Ruderbooten mussten wir alles an Land bringen, so flach war das Hafenbecken.« Olivier lachte wieder. »Nichts für Schwächlinge, sag ich dir.« Er legte Ben die riesige Pranke auf die Schulter. »Eh, copain, gibst gleich eine Abschiedsrunde, nicht wahr?« Sein gieriger Blick, in der Erwartung eines Schlucks Branntwein, berührte Ben unangenehm.
»Mal sehen.« Er hatte nicht die Absicht, die Schiffsbesatzung mit Schnaps zu versorgen, doch das würde er dem Trunkenbold nicht verraten. Sollte der doch an Land gehen und seine sauer verdiente Heuer in der Gosse mit den Huren vertrinken. Ben hatte Besseres im Sinn mit seinen Talern. Er wand sich aus Oliviers Griff und blickte erneut hinüber zum weit ausladenden Tafelberg, der sich über der Stadt erhob, die seit Jahren sein Ziel war. Sanfte weiße Wolken hingen über dem Gipfel wie eine weiche Decke, der Berg schimmerte blaugrün, unwirklich, so als ob er einem Traum entsprungen wäre. An seinem Fuße breitete sich die Stadt aus, die für Ben eines Tages mit ein wenig Glück zu einer zweiten Heimat werden sollte …
Plötzlich schallte die Stimme des Kapitäns übers Deck.
»Alles antreten! Keiner geht von Bord, bis die Ladung komplett gelöscht ist. Lasst euch bloß nicht einfallen, einfach abzuhauen, ihr Halunken! Jeden, den ich dabei erwische, wie er sich aus dem Staub macht, werde ich eigenhändig kielholen, bis der Teufel ihn sich schnappt!«
»Leuteschinder«, knurrte Olivier und fuhr sich durch das struppige schwarze Haar. Er schob die Ärmel seines zerschlissenen Hemdes hoch. »Dann will ich mal, bevor der alte Knauser noch die Heuer einbehält.«
Ben atmete auf. Er warf einen letzten Blick auf den Küstenstreifen, der in der Hitze des Tages flirrte. Unwillkürlich tastete er mit der Rechten nach den Briefen seines Großvaters, die er in seinem Wams immer bei sich trug. Sie hatten ihm den Weg zum südlichsten Ende Afrikas gewiesen. Inzwischen waren sie alt und drohten zu zerfallen, so oft hatte er sie auseinandergefaltet und Wort für Wort gelesen. Sie schienen ihm wie ein Talisman, der ihm Glück bringen sollte, und er achtete sorgsam darauf, sie nicht zu verlieren.
Vom Vorderschiff her klangen knappe Kommandos, Flüche, hin und wieder auch ein heiseres Lachen zu ihm herüber. Er musste sich beeilen, beim Anlegen und beim Löschen der Ladung zu helfen, sonst würde der Kapitän der Parisienne ihn womöglich um das Kostbarste bringen, was er besaß.
Noch wenige hundert Meter, dann hatte das Handelsschiff den Kai erreicht. In der Hafenanlage sammelten sich die ersten Männer mit ihren Lastkarren. Fremd klingende Wortfetzen, Gelächter und Geschrei hallten zwischen den Hafenmauern wider.
»Dammit, Ben, fass endlich mit an! Zum Kai rüberstarren kannst du später noch. Die Ladys laufen schon nicht weg!« Der Zweite Offizier der Parisienne, Henry Gardener, ein kleiner und drahtiger Mann in einer blauen Uniformjacke mit rot gesäumtem Kragen und mit Messingknöpfen, der schütteres aschblondes Haar hatte, winkte ihn zu sich heran. Ben hätte es sich nicht erlauben können, Mr Gardeners Befehl nicht Folge zu leisten. Und er wollte es auch nicht, denn er hatte ihm viel zu verdanken. Also lief er mit bloßen Füßen eilig über die knarzenden Planken und mischte sich unter die anderen Matrosen, die bereits die schweren Taue und den Anker bereitmachten, damit das Schiff anlegen konnte. Vielen von ihnen lief von der anstrengenden Arbeit schon der Schweiß herunter, einige hielten zwischendurch inne, um die Augen mit der Hand gegen die Sonne zu schützen. Sie blickten zum Hafen hinüber, um zu sehen, ob sich dort schon irgendwelche Dirnen versammelt hatten, wie immer, wenn ein Schiff anlegte.
Nicht einmal eine halbe Stunde später lag das stolze Handelsschiff vor Anker, die Segel waren gerafft, alles war sicher vertäut. Das Entladen konnte beginnen. Eile war geboten, denn allzu lange sollte das Schiff nicht im Hafen bleiben. Zwei, höchstens drei Tage mussten genügen, dass die Mannschaft sich in den Hafenkneipen ein wenig vergnügen und dass Proviant aufgenommen werden konnte. Der Kapitän hoffte auch auf neue Ladung, aber noch hatte der Schoner keine neue Fracht in Aussicht. Falls das Schiff länger im Hafen liegen musste, war dies kostspielig, aber in Südafrika bestand eine gute Chance auf einen raschen und lukrativen Auftrag, zu vielfältig waren die Güter, zu rege der Handel und der Bedarf an den exotischen Waren in der Heimat.
Die Parisienne, deren Heimathafen Marseille war, hatte für False Bay in erster Linie Saatgetreide geladen, außerdem Salz aus der Camargue, getrockneten Oregano, Rosmarin, Majoran und Lorbeer aus der Provence, Zimt, Koriander und schwarzen Pfeffer aus Sri Lanka sowie etliche Fässer Branntwein und Stockfisch aus Norwegen – letztere Güter waren meist für italienische Auswanderer bestimmt. Darüber hinaus gehörten zur Fracht etliche Ballen feinsten Brokats und Damasts aus Lyon, sorgfältig verpackt und vom Ersten Offizier gehütet wie der Kronschatz.
Oft hatte Ben die anderen Matrosen über ebendiesen Teil der Fracht munkeln hören, dass es sich dabei um Schmuggelware handele, auch kannte er die derben Scherze über die reichen Damen, deren Körper der teure Stoff in Südafrika umhüllen würde, aber er hatte keinen Sinn für solcherlei Geschwätz. Was scherte es ihn, ob der Kapitän ein falsches Spiel spielte, um sich an den Stoffen zu bereichern? Er hatte Wichtigeres vor. Obwohl er nur ein einfacher Matrose war, hatte er selbst einen kleinen Teil der Ladefläche für sich beanspruchen können, den ihm der Kapitän für ein paar Heller abgetreten hatte.
»Du bist verrückt, Ben«, hatte er gesagt und sich über den schmalen Oberlippenbart gestrichen, »aber ich kann dich gut leiden. Vielleicht weil du aus Deutschland kommst, so wie meine Großmutter. Und du bist nicht so ein roher Kerl wie die meisten anderen Matrosen, du hast große Pläne … daran habe ich Gefallen. Und wer weiß, vielleicht wird ja tatsächlich etwas aus deinem Vorhaben.« Er spuckte einen Brocken Kautabak über die Reling. »Dann erwarte ich ein Fass von der ersten Ernte als zusätzliches Entgelt.« Als er seine Hand ausgestreckt hatte, war Ben ein Stein vom Herzen gefallen, und er hatte erleichtert eingeschlagen.
Dort, an dem verborgenen Platz unter Deck, wo das Licht durch eine Luke in der Bordwand gerade ausreichte, damit die Pflanzen nicht eingingen, hatte Ben sich nach der harten körperlichen Arbeit an Bord stets Zeit genommen, die Rebstöcke zu pflegen, die seinen ganzen Besitz darstellten. Sie brauchten Wasser, mussten gegen Fäulnis und gegen Ungeziefer geschützt werden, und sie mussten immer ein wenig frische Luft bekommen. Etwa ein Dutzend der kostbaren Pflanzen hatte er dennoch verloren – und das, obwohl er fast jede freie Minute bei seinen Reben verbracht hatte.
Unter den anderen Matrosen hatte sich sein »Hirngespinst«, wie sie es nannten, schnell herumgesprochen. Für viele war er ein Traumtänzer oder jemand, der zu tief ins Glas geschaut hatte. Jemand, über den man spottete, eine traurige Figur. Ob auch nur einer von ihnen ahnte, was diese Pflanzen für Ben bedeuteten? Mit den Händen über die ein wenig knorrigen Stöcke zu streichen bedeutete, seine Zukunft zu spüren. Es bedeutete ein besseres Leben und neue Hoffnung.
Wieder strich Ben sich eine dunkle Strähne aus dem von der Arbeit erhitzten Gesicht. Es war viel zu lang, deswegen musste er es im Nacken mit einem Band zusammenhalten. Marty, ein Matrose, der auch als Barbier gearbeitet hatte, war vor vier Wochen gestorben. Seither hatte kaum jemand von der Mannschaft der Parisienne einen Kamm oder gar ein Rasiermesser gesehen. Daher war Ben Ruhlands Gesicht zum Teil von einem struppigen Bart verdeckt, der ihn älter erscheinen ließ als seine dreißig Jahre. Von weitem hätte jeder ihn für einen groben Seemann gehalten, aber seine warmen dunklen Augen verrieten sein freundliches Wesen.
Als er sich kurz an einem der Polder ausruhte, nachdem er wie alle anderen sorgfältig verschnürte Pakete auf Karren gewuchtet, Rollen über die Planken getragen und Fässer gerollt hatte, wanderten seine Gedanken zurück zu seinem Großvater, dessen Briefe ihn an ebendiesen Ort geführt hatten. Die Hafengeräusche nahm Ben auf einmal nur noch wie von ferne wahr, genau wie das gegen die Kaimauer schwappende Wasser, in dem allerlei Unrat trieb. Johannes Ruhland hatte vor mehr als siebzig Jahren bei dem Winzer Simon van der Stel als Kellermeister gearbeitet und war dann in den Rheingau zurückgekehrt, um dort seinen Lebensabend zu beschließen. Bis zu seinem Tod hatte Johannes Ruhland von Afrika geträumt, von den weiten Hängen unterhalb des Tafelbergs, die grün waren von Reben. »Der Duft des Bodens ist erdig und kraftvoll, und die Farben dort sind tausendmal leuchtender als hier«, hatte er voller Inbrunst gesagt. »Wenn ich die Augen schließe, sehe ich den Morgentau auf den Weinreben in der Sonne glitzern, Ben.« Ein sehnsüchtiger Seufzer hatte die Worte begleitet. »Es wird mir immer auf der Seele liegen, dass ich Ruhlands Hoffnung nicht halten konnte. Vielleicht bringst du eines Tages das zu Ende, was ich nicht schaffen konnte.« Er hatte dem Buben kurz übers Haar gestreichelt. »Du bist wie ich, Benjamin – voller Träume, voller Sehnsucht nach der Fremde.«
An diese Worte des alten Mannes, der die letzten Lebensmonate krank und kraftlos auf dem heimatlichen Weingut verbracht hatte, musste Ben oft denken. Dank der Erzählungen seines Großvaters wusste er auch, dass es hierzulande sowohl sandigen Grund wie auch Granitböden und Schiefer gab und dass man daher die verschiedensten Rebsorten anbauen konnte. Er wusste um die Tücken des Wetters und um die Magie des ersten Schlucks Wein aus jedem neuen Jahrgang. Fast konnte er schon spüren, wie ein fruchtiger Tropfen seine Kehle hinunterrann. Wie lange war es her, dass er einen Wein wirklich geschmeckt hatte, dass er sich von dem Aroma die Sinne hatte rauben lassen?
Simon van der Stel, bei dem sein Großvater in Lohn und Brot gestanden hatte, bevor er etwas Eigenes kaufte, war der Gründer des großen Weinguts Stellenbosch gewesen, das noch heute bestand. Für den jungen Winzer Johannes war dieser Mann einst ein großes Vorbild, ja fast ein Gott gewesen, für den er um die halbe Welt gefahren war, um bei ihm die Kunst des Weinanbaus zu vervollkommnen. Ben hoffte nur, dass er mehr Erfolg haben würde als Simon van der Stels Nachkommen. Dessen großer Besitz, der unter seiner Hand im Schatten des Tafelbergs zu großem Ansehen erblüht war, war nun, im Jahr 1795, nicht mehr so bedeutend wie einst, das wusste Ben aus Erzählungen der Schiffer und von anderen Winzern. Misswirtschaft trug daran offenbar die Schuld ebenso wie ungünstige Witterung, die vor Jahren einen großen Teil der kostbaren Weinstöcke vernichtet hatte.
Den Traum jedoch, den Simon zu seiner Zeit verwirklicht hatte, träumte auch Ben. Ein eigenes Weingut, ein Haus inmitten grüner Reben, ein blühender Handel mit dem guten Tropfen, den nur seine eigene Erde hervorbrachte – all das hatte er sich wieder und wieder ausgemalt, wenn er auf seiner Pritsche unter Deck keinen Schlaf fand. Er hatte inständig gebetet, dass er klügere Entscheidungen treffen und eine länger währende Glückssträhne haben möge als Simon van der Stel. Er hatte sich sogar schon einen Namen ausgesucht – Hopeland wollte er seinen Besitz nennen, in Anlehnung an den Namen, den der Großvater seinem Land einst gegeben hatte. Jetzt, da die Engländer immer mehr die Herrschaft über die Welt übernahmen, klang ihm ein englischer Name allerdings passender als das deutsche Ruhlands Hoffnung.
Als er sich erhob und zum Schiff zurücklief, um seine Heuer einzufordern, knisterten die Briefe des Großvaters in der Innentasche seines Wamses, ganz so, als wollten sie verheißungsvoll verkünden: Auf zu neuen Ufern, auf zum größten Wagnis deines Lebens!
Johlend und unter großem Gelächter gingen in diesem Moment alle Matrosen an ihm vorbei von Bord. Allen voran Olivier, der lauthals damit prahlte, dass er die Bierstube mit den schönsten Mädchen förmlich riechen könnte. »Das ist Begabung und langjährige Erfahrung in einem!«, rief er. »Allez, die Schönsten der Schönen können es kaum erwarten, dass wir sie beglücken.«
Die Männer waren ausgehungert – nicht nur nach einem Wirtshausbesuch, sondern auch nach willigen Mädchen, die sie die raue Zeit an Bord für eine Zeitlang vergessen ließen und die ihnen im Tausch gegen einige Münzen Leidenschaft vorspielten. Ben wusste, es würde genügend Spelunken im Hafen geben, dass alle auf ihre Kosten kamen. Schlechter Wein floss dort in Strömen, doch auf den Geschmack kam es den Matrosen selten an, nur auf den Rausch, mit dem sie sich einige sorgenfreie Augenblicke erkauften und sich fühlen konnten wie große Herren.
Ben schritt schneller die Planke hinauf, lief schon fast. Seine Sorge galt allein den Pflanzen im Bauch der Parisienne, die nun sacht im Hafen dümpelte. Die Brigantine zählte zu den schnellsten Schiffen der französischen Handelsmarine. Als Ben angeheuert hatte, war ihm dies besonders wichtig gewesen. Für die Ladung, die er von Europa nach Afrika zu bringen gedachte, zählte jeder Tag. Wenn die Rebstöcke, die er in Frankreich und in Italien erwerben wollte, eingehen sollten, wäre er mittellos. Um sie bezahlen zu können, hatte er zwei Jahre lang als Matrose auf dem Zweimaster geschuftet und alles für seine letzte große Reise gespart.
Ein Winzer als Seefahrer – er wusste selbst, dass das eigentlich widersinnig war. Aber sollten sie ruhig über ihn lachen, er hatte nichts mehr zu verlieren. Was war ihm auch anderes übriggeblieben? Daheim hatte er nicht bleiben können. Es hätte ihn seinen Lebensmut und seinen ganzen Willen gekostet. Damals zumindest. Heute, nach zwei harten Jahren auf See, die ihn an den äußersten Rand seiner Kräfte getrieben hatten und in denen er Einsamkeit und Schwermut ertragen, in denen er der Hitze und der Kälte getrotzt hatte, aber auch neue Länder und Menschen kennengelernt hatte, war die unglückliche Liebe, die ihn aus der Heimat fortgetrieben hatte, kaum mehr als eine flüchtige Erinnerung.
»He, Ben! Fass mal mit an! Die Stoffballen müssen noch von Bord.« Die heisere Stimme des Ersten Offiziers ließ Ben zusammenfahren. Er folgte der Aufforderung sofort, denn mit diesem Mann, das wusste er, war nicht gut Kirschen essen. Die Stoffe wurden auf ein Pferdefuhrwerk verladen, das sich deutlich von den anderen unterschied: Die Tiere waren gut genährt, ihr Fell glänzte in der Sonne, der Wagen war massiv gebaut und sogar mit einer festen Abdeckung versehen.
Die Stoffe müssen noch wertvoller sein, als ich zuerst vermutet habe, schoss es Ben durch den Kopf, sonst würde man deswegen nicht so ein Aufhebens machen. Bei dieser besonderen Fracht schienen der Kapitän und der Erste Offizier gemeinsame Sache zu machen. Ben rieb einem der Pferde über die Blesse, und es schnappte leicht nach seiner Hand, so als erwarte es einen Leckerbissen. Nur aus dem Augenwinkel nahm der junge Deutsche wahr, wie der Kapitän etwas in seinen Lederbeutel steckte und diesen zurück unter sein Hemd schob. Na, ihm konnte es egal sein!
»Und jetzt deine Reben«, befahl der Kapitän, als das Pferdefuhrwerk sich mit der Ware in Bewegung setzte, und deutete mit einem Rucken des Kopfes zum Schiff hinüber.
Ben schüttelte den Kopf. »Ich bitte Euch, gebt mir noch etwas Zeit. Ich muss erst die Gegend erkunden und nach dem Platz suchen, wo ich sie anpflanzen kann.« Er senkte den Blick. Er wusste, dass der Kapitän nun über sein Schicksal entschied.
Der Kapitän verzog keine Miene. »Gut, ein Tag sei dir gewährt.«
»Habt ein Einsehen, ich bitte Euch. Es könnte sein, dass ich länger brauche, um diesen Platz ausfindig zu machen.« Ben mühte sich, damit seine Stimme keinen allzu flehentlichen Klang annahm, er wollte trotz aller Dringlichkeit seines Anliegens seinen Stolz nicht verlieren.
Der Kapitän spuckte ein wenig Kautabak ins Hafenbecken und fuhr sich mit der Hand über seinen schmalen Bart. Dann wandte er sich zum Gehen. »Nicht mehr als zwei Tage. Auf die Stunde genau. Wenn ich bis dahin keine Nachricht von dir habe, landet alles im Hafenbecken. Verstanden?«
Als er raschen Schrittes das Hafengebiet hinter sich ließ und zwischen den ärmlichen Häusern durch die Hauptstraße in ein kleines Städtchen kam, schien die afrikanische Erde zu schwanken. So ging es allen Seeleuten, wenn sie nach Wochen an Land kamen. Ben war froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich bin eben doch eine Landratte, dachte er und musste schmunzeln. Er genoss die sanfte Hitze des Morgens, den Anblick der vielen fremden Gesichter, das lebhafte Stimmengewirr, der Geruch nach Gedünstetem und Gebratenem, was bedeutete, dass es bereits auf Mittag zuging, und die Schreie der Händler, die ihre Waren anpriesen.
Aus einer der Spelunken, an denen er vorbeikam, dröhnte Oliviers Stimme, nur unterbrochen von dem albernen Kreischen und Kichern einiger Mädchen. Das Haus trug den großspurigen Namen Ye Golden Whale Tavern, doch es wirkte so trist wie ein Armenhaus am Rheinufer. Adieu Seemannsleben und auf Nimmerwiedersehen, du Prahlhans, dachte Ben und verspürte große Genugtuung bei dem Gedanken, dass er diesen Taugenichts nun wohl nie mehr in seiner Nähe ertragen musste.
Nur weiter, schließlich hatte er keine Lust, die Ausschweifungen der anderen Matrosen mitanzusehen. Die nächste Gaststätte wirkte nicht ganz so verkommen, aber fast noch ärmlicher. Die Buchstaben, die jemand vor langer Zeit sorgfältig auf ein hölzernes Schild über der Eingangstür gepinselt hatte, waren von Sonne, Wind und Regen ausgeblichen, aber noch gut zu entziffern: Zum Rheinfels, las er, und ein angenehmer Schauer überlief ihn. Das klang verheißungsvoll nach Heimat. Vielleicht hatte er Glück und traf auf einen Landsmann? Sein Herz pochte aufgeregt, als er die Tür aufdrückte, die dabei ein unwilliges Knirschen von sich gab.
»Grüß Gott!«, rief er, als er das schummrige Innere betrat. Seine Augen gewöhnten sich schnell an die Dunkelheit, und er sah, dass nur wenige Gäste im Schankraum saßen.
»Gott zum Gruße, Seemann.« Ein warmes Gefühl breitete sich in ihm aus, als er seine Muttersprache vernahm. Zugegeben, die Stimme war hoch, ein wenig schrill – aber in Bens Ohren klang sie wunderbar. Hinter dem Tresen trat eine kleine Frau hervor. Die gebeugten Schultern und die dünnen, sehnigen Arme ließen darauf schließen, dass sie Entbehrungen und harte Arbeit gewohnt war. Ihr strähniges graues Haar und die tief in den Höhlen liegenden Augen in dem hageren Gesicht zeugten davon, dass sie schon einiges erlebt hatte.
»Haste Hunger?«, fragte sie und sah ihn mit wachem Blick an. »Ich hab Hühnerbrühe und Brot. Mehr is’ nicht.« Ein Schulterzucken begleitete diese Worte.
»Dann nehme ich das gern. Kann ich ein Bier dazu bekommen?«
Die Alte lachte meckernd. »Was für ’n wohlerzogenes Bürschchen! Klar kannste Bier haben. Gibt auch Wein.« Sie zwinkerte Ben kurz zu, drehte sich um und holte einen Krug aus dem morschen Holzregal hinter der Theke. »Den kriegt nich’ jeder. Aber du bist ja aus der Heimat …« Bei diesen Worten wurden ihre Züge weicher. Sie lächelte, und Ben konnte erkennen, dass ihr viele Zähne fehlten. Dennoch verriet dieses Lächeln, dass die Wirtin einst sehr hübsch gewesen sein musste. Ein wenig von der verblichenen Schönheit schimmerte auch aus den lebhaften Augen.
»Ein Bier und dann zum Essen gerne Wein«, sagte er und nahm den Platz ein, den sie ihm mit einer knappen Handbewegung zuwies. Es war ein Tisch gleich bei der Küche. Er bekam einen Krug Bier, dann erst einmal einen Kanten Brot, das erfreulich frisch war und würzig schmeckte. Eine Wohltat nach der langen Schiffsreise! Da hatte es in den letzten Wochen nur noch wurmzerfressenen Zwieback, gepökeltes Fleisch und hin und wieder einen Fisch gegeben, den der Schiffsjunge geangelt hatte.
»Hier.« Die Alte kam aus der Küche zurück und stellte eine Schale mit dampfender Suppe vor ihn hin. Dann holte sie einen Krug mit Wein, stellte zwei Becher dazu und ließ sich Ben gegenüber nieder. »Woher kommst du, Seemann?«, fragte sie mit neugierigem Blick und nahm einen Schluck aus dem Becher.
»In den letzten Monaten war ich auf See«, erwiderte er und begann mit Heißhunger, die Suppe zu löffeln. »Aber eigentlich bin ich kein Seemann.« Er trank, wischte sich den Schaum von der Oberlippe und sah die Wirtin kurz an. »Ich heiße Benjamin Ruhland und bin aus dem Rheingau.«
»Wie mein Alter, Gott hab ihn selig.« Sie musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen. »Warst lange unterwegs, was?«
»Ja. Insgesamt bin ich vier Jahre von daheim weg. Erst bin ich durchs Land gezogen, hab mir Arbeit gesucht und schließlich auf einem Handelsschiff angeheuert.« Er aß mit Appetit. Die Suppe, die reichlich Fleisch enthielt, kam ihm vor wie ein Festmahl. Der blankgescheuerte Tisch wirkte sauber, genau wie Löffel und Becher. Das war in Hafenkneipen selten.
Im hinteren Teil der Gaststube saßen vier Männer und tranken schweigend ihr Bier. Als Ben hereingekommen war, hatten sie nur kurz den Kopf gehoben, dann wieder in ihre Bierhumpen gestarrt. Irgendwann zog einer von ihnen ein paar Würfel aus dem groben Wams, und sie begannen zu spielen. Auch dabei fiel kaum ein Wort. Zweimal bestellten sie frisches Bier, ohne ihr Würfelspiel zu unterbrechen.
Ben bemerkte erst jetzt, dass sich auch drei Matrosen der Parisienne hierher verirrt hatten. Es waren ältere Männer mit wettergegerbtem Gesicht und hagerer Gestalt. Seit Ben sie kannte, hielten diese drei sich immer ein wenig abseits. Zechten kaum einmal, pöbelten nicht, arbeiteten meist schweigend. Hin und wieder hatte einer von ihnen ein Buch hervorgeholt und den anderen daraus vorgelesen. Worum es sich handelte, hatte Ben nicht herausgefunden. Er hatte aber auch nie gefragt. Es war deutlich gewesen, dass sie unter sich bleiben wollten, und das war von allen stillschweigend geduldet worden. Nicht einmal der vorlaute Olivier hatte es gewagt, an den drei Sonderlingen sein Mütchen zu kühlen. Jetzt nickten sie Ben kurz zu, und der Älteste, der einen Bart trug und mit einem langen schwarzen Rock bekleidet war, hob die Hand zum Gruß.
Benjamin wandte sich wieder der Alten zu. »Die Suppe ist sehr gut«, sagte er und schob die Schale weg, als sie leer war.
Die Wirtin lachte heiser. »Willste noch was?«
Er schüttelte den Kopf. »Sei bedankt, es ist erst mal genug. Aber … weißt du einen Platz, wo ich etwas unterstellen könnte?«
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Dein Gepäck? Seesack und so?«
»Nein … Rebstöcke.«
»Ach, schau an! Biste vielleicht Winzer? Schließlich kommste aus dem Rheingau! Willst du dich hier niederlassen?« Die Augen der Alten bekamen plötzlich Glanz, und sie beugte sich neugierig vor. Ben stellte fest, dass ihre Augen bernsteinfarben waren. Ein Kranz von unzähligen Fältchen umgab sie, und als sie jetzt lächelte, erhielt ihr altes Gesicht neuen Reiz.
Ben nickte zustimmend. Er wollte nicht zu viel preisgeben. Man konnte nie wissen, wem man gegenübersaß. Das hatte er in den letzten Jahren hin und wieder schmerzlich erfahren müssen. Von seiner Gutgläubigkeit, mit der er einst die großen Reisen über den Ozean angetreten hatte, war nichts mehr übrig geblieben, er war misstrauisch geworden. In der Zeit auf dem Schiff war er erst richtig erwachsen geworden. Er hatte viel ertragen müssen, aber er hatte auch viel gelernt. Nicht nur etwas über die Arbeit an Bord eines Segelschiffs, sondern auch darüber, dass das, womit einer sein Brot verdiente, nicht unbedingt etwas darüber aussagte, was für ein Mensch er war. So war der dickbäuchige Koch der Parisienne zum Beispiel ein geschickter Jongleur, der die Besatzung in freien Stunden mit seinen Kunststücken unterhalten hatte. Pasquale, ein Portugiese mit scharfen Augen, der häufig im Ausguck saß, konnte hervorragend Gitarre spielen, dessen spanischer Freund Miguel sang dazu mit warmem Bariton. Andere wiederum schienen auf den ersten Blick freundliche Gesellen zu sein, aber in Wahrheit waren sie Schlitzohren und Taugenichtse, denen man nicht trauen konnte.
Durch Olivier und die übrige Besatzung hatte Ben Französisch gelernt, auch ein paar Brocken Spanisch. Und Henry Gardener, der Zweite Offizier, hatte Ben schließlich mit Hilfe einiger Bücher ganz passables Englisch beigebracht. »Die Zeit, da die Holländer am Kap das Sagen haben, wird bald zu Ende gehen«, hatte Gardener gesagt. »Wir Engländer sind die neue Weltmacht. Da kann es nicht schaden, wenn man unsere Sprache beherrscht.« Vaterlandsstolz hatte aus diesen Worten geklungen, was nicht wirklich angebracht war, denn die Männer auf dem Segler waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen, der zu einem guten Teil aus rauen Gesellen bestand, die ihr Schicksal dem weiten Meer anvertraut hatten.
Benjamin Ruhland hatte dem Zweiten Offizier zunächst nicht recht glauben mögen, dass die Engländer eine Vormachtstellung einnahmen, denn es gab viele Nationen, die den dunklen Kontinent und andere Teile der Welt für sich beanspruchten. Aber mit der Zeit änderte er seine Meinung. Und er prägte sich so viel ein, wie er konnte, und lernte eifrig. Wer wusste schließlich, was die Zukunft für ihn bereithielt?
Als er vor Jahren seine Heimat verlassen hatte, war er entschlossen gewesen, sich der Ungewissheit und den Gefahren der Fremde zu stellen. Auch heute dachte er nur ungern daran zurück, welche Ereignisse zu diesem Entschluss geführt hatten.
Ben war der jüngste Sohn der Ruhlands, einer alteingesessenen Winzerfamilie im Rheingau. Der Besitz wurde einer alten Tradition folgend stets dem ältesten Sohn vererbt. So würde also Benjamins Bruder Peter einst die Weinberge bestellen. Der Zweitälteste, Markus, würde in die Familie des Nachbarguts einheiraten und nicht Winzer, sondern Bauer werden. Er wirkte zufrieden mit seinem Los, und Ben verstand ihn, denn die rothaarige Marie, Markus’ Braut, war ein hübsches Mädchen, drall und gesund. Sie konnte arbeiten, aber sie konnte auch lustig sein. Oft hörte Ben sie lachen, wenn die beiden Verliebten sich abends im alten Weinberg, der gleich ans Haus angrenzte, trafen oder auf der Bank neben der Scheune ein Stelldichein hatten.
Ben hatte keine großen Aussichten, er hatte nur die Kraft seiner Hände und eine Liebe, die ihm das Herz weit machte. Wenn man ihn fragte, dann war Katrin Wegener das hübscheste Mädel weit und breit, und Ben machte sich berechtigte Hoffnungen, dass sie ihm eines Tages das Jawort geben würde. Dass er ihr nichts würde bieten können, bekümmerte ihn oft, denn daheim schien kein Platz für ihn zu sein, es sei denn, er ordnete sich Peter unter, und mit dem hatte er oft Streit, denn sein Bruder neigte dazu, ihm seine Stellung im Haus nur allzu deutlich vor Augen zu führen.
Nun, damit hätte er sich vielleicht noch abfinden können. Er hätte vielleicht als Kellermeister gearbeitet oder als Vorarbeiter im Weinberg. Doch dann sah er eines Abends auf dem Heimweg aus dem Weinberg, es war im Mai 1791, zufällig, wie Peter Katrin unter der alten Kastanie im Hof küsste. Leidenschaftlich, voller Verlangen. Und Katrin, die doch angeblich ihm, Ben, gut war, ließ es sich gefallen. Sie schmiegte sich an Peter, vergrub die Hände in seinem dunklen Haar, bog den Kopf zurück und ließ es geschehen, dass Peter die zarte Stelle zwischen ihren Brüsten küsste. Gleich darauf zog er sie in den Stall, in dem die vier Ackergäule standen. Und was dort geschehen war … Ben hatte diese Bilder aus seinem Gedächtnis verbannen wollen, jede Erinnerung an das, was er gesehen hatte, als er sich anschlich und durch die Stalltür spähte: Peter und Katrin wälzten sich im Stroh, Katrin, das blonde Haar wild zerzaust, hatte die Röcke hochgeschoben und zog mit fliegenden Fingern Peter das Leinenwams aus, löste den Gurt, mit dem die Hose zusammengehalten wurde. Dabei lachte sie leise und kehlig. Gleich darauf lagen die beiden übereinander. Peter keuchte vor Lust, Katrin schrie … und er, Ben, er stand da wie erstarrt.
Das musste eine Sinnestäuschung sein! Katrin liebte doch ihn, Ben! Sie hatte es ihm doch schon so oft geschworen, in so vielen kalten Winternächten, wenn er sich in ihre Kammer geschlichen und sich zu ihr unter ihr warmes Federbett gelegt hatte …
Lüge. Alles Lüge und Berechnung. Sie wollte Herrin auf dem Weingut werden, das war es! Da vergaß sie einfach, was sie ihm, Ben, erst im Frühjahr bei einem zärtlichen Zwiegespräch unter dem blühenden Fliederbusch am hinteren Gartenzaun versprochen hatte. Damals hatte er sie zum ersten Mal geliebt. Wie genau er sich erinnerte – auch jetzt noch, vier Jahre später, hätte er jede Linie ihres Gesichts nachzeichnen können. Und der Duft ihrer Haut an jenem Tag … er glaubte, ihn immer noch zu riechen. Es war der Duft ihrer Haut und der Duft nach Heu und nach frischer Milch, denn sie war gerade aus dem Kuhstall gekommen. Aber es war auch der Duft nach Flieder … Verdammt, wenn er daran dachte, dann tat es immer noch weh!
Ben wollte die Gedanken verscheuchen, doch sie ließen ihn nicht los. Hundertmal hatte er die Szene in seinen Träumen vor sich gesehen. Katrin und Peter, die sich im Stroh wälzten und sich ihrer Lust hingaben – das war keine Liebe, sondern hemmungslose Leidenschaft, das wusste Ben genau. Und als sein Bruder lachte, selbstsicher, triumphierend, da kam es ihm so vor, als wüsste er, dass Ben draußen stand, mit wehem Herzen und mit einer ungezügelten Wut im Leib. Doch falls er es wusste, so kümmerte es Peter sicher nicht. Er war immer schon skrupellos gewesen, hatte seinen Willen durchgesetzt und sich nicht darum geschert, was die anderen dachten oder fühlten. Nun hatte er sich einmal mehr genommen, was ihm gefiel.
Bens Augen brannten. Er spürte kaum, dass ihm die Tränen übers Gesicht liefen, als er sich umdrehte und zum Haus hinüberrannte.
Dort packte er mit fliegenden Fingern seine spärliche Habe zusammen, nur beobachtet von Miez, der alten grauen Katze, die er einst großgezogen hatte, nachdem ihre Mutter von einem Fuchs gerissen worden war.
»Es muss sein, Miez«, sagte er verzweifelt und strich der Katze über das struppige Fell. »Hier kann ich nicht bleiben.«
Miez schnurrte nur. Sie verstand nicht, was er fühlte – dass für ihn gerade eine Welt zusammengebrochen war. Vor Tagesanbruch würde er sich aufmachen, um ein neues Leben zu finden.
In jener Nacht hatte er kein Auge zugetan, er wälzte sich im Bett hin und her und grübelte darüber nach, wohin er sich wenden könnte und wie sein weiteres Leben verlaufen würde, wenn er die Heimat verließ, als ihm plötzlich ein Gedanke kam. Schließlich stand er auf und schlich auf nackten Sohlen hinunter ins Erdgeschoss. Behutsam, um niemanden zu wecken, öffnete er die Tür zur guten Stube. In diesen Raum kam die Familie nur an Feiertagen. Es gab einen ledernen Sessel, einen gedrechselten Tisch, auf dem eine Decke lag, die die Mutter selbst genäht und bestickt hatte, eine Eichenkommode mit Messingknäufen und ein Sofa mit einem bunten Flickenteppich davor.
Vorsichtig zog Ben die oberen beiden Schubladen der alten Kommode auf. Wo war nur die kleine Holzkiste mit den Briefen und den beiden Urkunden des Großvaters? Sein Herzschlag ging rasch, denn er hatte Sorge, dass jemand ihn entdecken und von seinem Vorhaben abhalten könnte.
Wenig später schon hatte er die Kiste gefunden. Ganz unten in der Kommode lag sie. Fast vergessen. Niemand sprach mehr vom Großvater, der vor etlichen Jahren als todkranker Mann aus dem fernen Afrika zurückgekehrt war, um in der Heimat zu sterben. Er hatte in einer kleinen Kammer über dem Hühnerstall gelebt, die Mutter hatte ihm das Essen gebracht und sich um ihn gekümmert, so gut sie es eben vermochte. Auch Ben hatte sich oft zu dem alten Mann hinübergeschlichen und mit glühenden Wangen zugehört, wenn der Großvater von Afrika erzählt hatte. Von den wilden Tieren, die in der Savanne lebten, von der Landschaft, die unendlich weit sein musste, von fremdartigen Gewächsen und Bäumen, vom tobenden Meer und vom Wind, der für Rebstöcke gefährlich werden konnte.
Vieles hatte Ben vergessen, aber da waren ja noch die Briefe, die der Großvater aus dem fernen Land geschrieben hatte. Und so war es beschlossene Sache: Er würde aus dem Rheingau weggehen und auf dem fremden, unbekannten Kontinent neu anfangen. Vielleicht gelang ihm, Ben, sogar das, was dem Großvater verwehrt geblieben war, und er konnte sich etwas aufbauen, konnte ein wohlhabender Mann werden. Mit dem Landbesitz, den die Urkunden seines Vorfahren verhießen, ließ sich das vielleicht bewerkstelligen. Und da er stets der Einzige gewesen war, der dem alten Mann aufmerksam gelauscht und ihm Glauben geschenkt hatte, hatte er nicht das Gefühl, etwas Unrechtes zu tun, als er die Papiere nun an sich nahm.
Wenige Stunden später, nur die Mutter war schon auf, verließ Ben sein Elternhaus, in dem er nie wieder glücklich werden konnte. Das wusste er ganz genau nach der Enttäuschung, die Katrin und Peter ihm bereitet hatten.
Die Mutter, die er ein letztes Mal umarmte, wollte ihn nicht gehen lassen, aber er küsste sie innig, strich ihr über das dunkle Haar, in das sich schon viele graue Fäden mischten, murmelte ein »Behüt dich Gott« – und ging hinaus in die Dunkelheit. Im Osten dämmerte mit fahlem Rot der neue Tag herauf.
Als die Mutter ihm nachlief, das alte Wolltuch fest um sich geschlungen, und fragte, warum er sich denn davonschleiche wie ein Dieb, sagte er nur mit brüchiger Stimme: »Frag den Peter.«
»Aber der Vater … er wird es nicht verstehen.« Josefa Ruhland, vor der Zeit gealtert, mit müden Augen und mit viel zu früh welk gewordener Haut, rang die Hände. »Was soll ich ihm denn sagen?«
»Ich lass ihn grüßen.« Ben schloss die Hand um sein Bündel so fest, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. »Du weißt doch, dass ich nie wirklich gezählt hab für ihn. Er hat immer nur den Peter gesehen, den Gutserben, den Namensträger.« Er konnte nicht verhindern, dass Bitterkeit in seiner Stimme mitschwang. Sein Vater war ein grobknochiger, strenger Mann, der nur eine Freude zu kennen schien: seine Weinberge und den Ertrag daraus. Seine Söhne waren nichts weiter als Gehilfen auf dem Gut. So zumindest hatte Ben es immer empfunden. Allein Peter als Erbe der Ruhlands besaß die Achtung des Vaters. Er sollte die Arbeit vergangener Generationen fortführen.
»Sag nicht so etwas, Junge! Der Vater ist dir gut«, rief Josefa verzweifelt. »Ben! So bleib doch, Bub!«
In diesem Moment tat ihm seine Mutter noch mehr leid als sonst. Ihr Leben war nicht leicht gewesen, denn sein Vater war ein Mensch, der nur selten lachte und der auch ihr, seiner Frau, keine Freude gönnte. Josefa hatte nur ein junges Ding von zwölf Jahren als Hilfe im Haus. Hanni, die Tochter eines Tagelöhners, war ein spindeldürres Mädchen, das ihr kaum wirklich zur Hand gehen konnte.
Aber was konnte er ändern an ihrer Lage? Nichts. Sein Abschied würde die Mutter immerhin von einem weiteren Esser befreien.
Ein letzter Blick, ein inniger Händedruck. Ben beugte sich noch einmal zu ihr hinab und küsste sie auf die Wange. Sie schlug das Kreuzzeichen über ihn, dann ging er ohne ein weiteres Wort davon.
Nachdem er sich einige Zeit als Pferdeknecht, dann sogar als Landarbeiter in Venetien und Umbrien verdingt hatte, kam er auf seiner Wanderung schließlich nach Frankreich und heuerte in Marseille zum ersten Mal als Matrose an. Auf dem Meer fühlte er sich frei und ungebunden, also blieb er dabei, zumal er auf der Parisienne in Jérôme Bertrand einen ordentlichen, rechtschaffenen Kapitän gefunden hatte, der seine Leute gut behandelte und der sie ehrlich bezahlte. Die Heuer war zwar alles andere als ein fürstlicher Lohn, ein paar Silbertaler gerade mal, aber Ben sparte eisern. Er hatte ein Ziel, und für dieses Ziel lohnte sich jede Entbehrung!
Als sich das zweite Jahr auf See dem Ende entgegenneigte, kaufte er in Frankreich und in Italien, im Piemont, einige Rebstöcke und brachte diese in Genua an Bord, wo die Parisienne für sechs Tage ankerte, da einige Segel ausgebessert werden mussten.
Diese musste er nun schnell zu seinem Land schaffen – oder vorübergehend an einem Ort lagern, an dem nicht die Gefahr bestand, dass sie gestohlen oder von irgendeinem Hohlkopf als Unkraut vernichtet wurden.
Die Wirtin wischte sich die Hände an der fleckigen Schürze ab und sah ihn forschend an. »Du hast also vor, hier Wein anzubauen, Jungchen, ja?«
Er nickte nur.
»Da bist du nicht der Erste. Mein Großvater hat’s auch versucht, aber er hatte kein Glück.« Sie zuckte mit den Schultern. »Na, hat auch mehr gesoffen als gearbeitet. Genau wie mein Alter.« Sie sah Ben streng, aber nicht unfreundlich an. »Ich hab einen Schuppen im Hof. Mit ’nem eisernen Schloss an der Tür. Kannst deine Reben dort unterstellen und die Nacht da verbringen, wenn du willst.«
Über Bens Gesicht glitt ein erleichtertes Lächeln. »Ich danke Euch, wie soll ich das nur …«
»Schon gut.« Sie winkte ab, bevor Ben zu einer überschwenglichen Dankesrede ansetzen konnte. »Du gefällst mir. Scheinst ein ehrlicher Kerl zu sein. Und falls es dir wirklich gelingt, gescheiten Wein anzubauen, dann denk später mal an mich. Einen wirklich guten Tropfen hab ich schon ewig nicht mehr in der Kehle gehabt.« Schwerfällig stand sie auf. »Satt geworden?«
»Ja, danke. Das war gut«, sagte er, obwohl er noch Hunger verspürte, aber er konnte es sich nicht leisten, noch mehr Geld im Wirtshaus zu lassen.
Die Wirtin lachte, denn sie sah ihm seinen Zwiespalt offenbar an. »Bist wohl nicht gerade verwöhnt worden an Bord.« Sie schlurfte davon, kam wenig später mit einem Stück Braten zurück. »Hier, das ist Kaninchen. Musste nicht bezahlen«, fügte sie hinzu, als sie sah, dass der junge Mann zögerte.
Das Fleisch war zart und gut gebeizt. Ben aß erneut mit großem Appetit, denn so etwas Gutes hatte er lange nicht mehr bekommen.
»Danke nochmals.« Er legte drei Münzen auf den Tisch. »Ich schau mich mal um in der Gegend und komme später wieder vorbei.«
Als Ben aus dem Wirtshaus in den hellen Sommertag trat, musste er kurz die Augen zusammenkneifen. Die Sonne blendete, das Stimmengewirr im Hafen kam ihm auf einmal viel zu laut vor. Vor ihm, im Rinnstein, liefen zwei Ratten. Das war eine Plage, derer man in Hafenstädten kaum Herr wurde. Die Tiere machten sich über die Abfälle her und vermehrten sich rasend schnell.
Gleich gegenüber der kleinen Schenke Zum Rheinfels war ein größeres Wirtshaus. Hier ging es lärmend zu. Eine raue Männerstimme brüllte etwas, das Ben nicht verstehen konnte, dann begann eine Frau zu singen. Dem grölenden Gelächter und den Pfiffen nach zu urteilen, die daraufhin einsetzten, hatte das Lied einen anzüglichen Text.
Ben ging weiter, er wollte so rasch wie möglich fort aus dem Hafenviertel, in dessen Straßen und Gassen sich der Unrat türmte und wo es wahrscheinlich mehr Ungeziefer gab als Menschen. Draußen auf dem Meer war die Luft frisch gewesen, hatte nach Salz geschmeckt. Vor allem hatte es besser gerochen als hier, wo sich neben alten Fischernetzen, in denen sich Seetang und toter Beifang verfangen hatten, auch die Abfälle aus den Gaststuben sammelten.
So waren sie alle, die Hafenstädte, die Ben in den zwei Jahren kennengelernt hatte, in denen er als Matrose auf der Parisienne gefahren war: laut und schmutzig, aber voller Leben.
Kapstadt erstreckte sich in einiger Entfernung, eingebettet in die Ausläufer des Berges. Der Tafelberg war von leichten Dunstschleiern umgeben, und die Ausmaße der Stadt an seinem Fuß schienen gigantisch zu sein, viel größer, als er es sich vorgestellt hatte. Unterhalb des Berges zogen sich weithin sichtbar Weinhänge entlang. Selbst aus der Entfernung konnte Ben die säuberlich gezogenen Reihen der Reben erkennen.
Er wollte gerade die Karte hervorziehen, die sein Großvater dem letzten seiner Briefe beigelegt hatte, um seinen Standort zu bestimmen, als ganz in seiner Nähe wüstes Geschrei anhob. Zunächst sah er nur zwei Reiter, die ihre lange Gerte wild herabsausen ließen. Erst dann bemerkte er die Schwarze, die sich vor den Männern in Sicherheit zu bringen versuchte. Sie trug einen Jungen von etwa fünf Jahren auf der Hüfte und presste ihn angstvoll an sich. Mit der anderen Hand hatte sie den gelb-roten Rock etwas hochgezogen, damit sie rascher laufen konnte. Ben sah, dass sie nicht einmal einfache Schuhe anhatte, sondern barfuß war. Schon hatte sie eine schmale Gasse zwischen zwei Gebäuden erreicht, als die Gerte des einen Reiters sie am Arm erwischte und zu Fall brachte. Sie schrie auf, als sie zu Boden stürzte, und ihr Kind begann, laut zu weinen.
»Hab ich dich, verfluchte Schlampe!« Der Reiter auf dem Apfelschimmel, deutlich jünger als der andere Mann, der auf einem dunklen Wallach saß, stellte sich in den Steigbügeln auf und ließ die Gerte erneut durch die Luft zischen.
Der dunkelhäutige Junge, er konnte höchstens fünf Jahre alt sein und war erschreckend dünn, wollte sich gerade aufrappeln, da waren die Reiter schon bei ihm. Der ältere, ein kräftiger Kerl mit ungepflegtem Bart, beugte sich vor und hob den Kleinen an dem einfachen ärmellosen Hemd hoch. Der Stoff riss, und das Kind fiel wieder auf die staubige Erde.
Ben hastete los, aber da war die Frau schon bei ihrem Sohn, versuchte, ihren Jungen an sich zu ziehen. Ihre großen dunklen Augen waren vor Angst noch mehr geweitet, und Ben sah, dass ihr Gesicht tränenüberströmt war. Nur noch unterdrücktes Wimmern drang über ihre Lippen. Jetzt bemerkte Ben die blutigen Striemen auf ihren Armen, und auch über ihr Gesicht, das außergewöhnlich feine Züge hatte, zog sich eine rote Spur; offensichtlich hatte die Peitsche sie hier getroffen. Das Tuch, das sie nach Art des Landes zu einem Turban geschlungen eben noch auf dem Kopf getragen hatte, lag jetzt im Straßenstaub, ihre kurzen krausen Haare schimmerten im hellen Licht wie Ebenholz.
»Weg da! Aus dem Weg, Kerl!« Der Reiter auf dem hochbeinigen Wallach zügelte sein Pferd so knapp vor Ben, dass das Tier auf die Hinterhand stieg. »Bist du irr? Verschwinde, sonst zieh ich dir auch eins über.«
»Wag das lieber nicht!« Ben sah den älteren Weißen herausfordernd an. »Warum verfolgt ihr die Frau?«
»Bist wohl neu hier, was? Halt dich raus, sonst kriegst du Ärger. Das Weib hat versucht zu fliehen. Mitsamt ihrem Bastard. Aber nicht mit mir!« Er stieg vom Pferd und packte die junge Frau grob am Arm, doch die riss sich mit einem Ruck wieder los und taumelte wie Schutz suchend ein paar Schritte zu Ben hin.
»Lass sie!« Ben ging mit forschen Schritten auf den Mann zu. Dessen Gesicht hatte etwas Grobes, seine pockennarbige Haut war von der Sonne verbrannt. Ben bemerkte, dass er leicht hinkte – sein linkes Bein schien kürzer zu sein als das rechte.
»Ein Sklavenfreund«, höhnte der Mann. »Das hab ich gern!«
»Sie ist eine Sklavin?«, entfuhr es Ben.
»Stell dir vor«, erwiderte der Hinkende in schlechtem Englisch. Sein Akzent ließ vermuten, dass er aus Holland oder Flandern stammte. »Und sie ist nicht die Einzige. Meine Äcker kann ich schließlich nicht alle selber bestellen. Und mein Haus putze ich auch nicht. Dafür ist Sina da. Aber dieses Miststück …« Er versetzte der Frau einen Tritt, so dass sie wieder zu Boden geworfen wurde.
»Schluss damit!« Ben hatte zwar gehört, dass die Sklaverei in Südafrika üblich war, aber er selbst lehnte es ab, sich auf diese Weise Arbeiter zu beschaffen; Menschen waren schließlich keine Ware. »Ich … ich kaufe die Frau.« Er erschrak vor den Worten, die er unwillkürlich ausgestoßen hatte. Was sagte er da? War er wahnsinnig geworden? Aber er wusste genau, dass es im Moment der einzige Weg war, die junge Frau vor dem brutalen Weißen zu retten.
Schallendes Gelächter war die einzige Antwort.
Ben tastete nach seinem Geld. Der kleine dunkelbraune Lederbeutel hing an einem schmalen Lederstrick um seine Hüfte, von Hemd und Joppe verborgen. Mit den Jahren hatte er gelernt, dass es ratsam war, das Geld dicht am Körper zu tragen, denn so bot man Dieben weniger Gelegenheit. Viel besaß er nicht mehr. Ein paar Taler und ein paar holländische Dukaten, englische Sovereigns, mit denen sein Kapitän ihn zuletzt bezahlt hatte. Dazu noch sieben Louis d’or – ein kleines Vermögen, das er bei allem Mitleid auf keinen Fall anrühren konnte. Mit diesen Goldstücken musste er noch mehr Land kaufen, ein Haus bauen, die Existenz gründen. Dafür hatte er jahrelang eisern gespart. Aber da waren noch ein paar Silbertaler. Es waren deutsche Taler, er hatte sie nie angerührt in den letzten Jahren, er wusste nicht einmal, ob sie hier in der Fremde als Zahlungsmittel Gültigkeit hatten. Er konnte nur hoffen, dass der Kerl sie annahm. Noch bevor er recht überlegt hatte, hielt er die Münzen schon in der Hand. »Hier, mehr hab ich nicht.«
Das gierige Glitzern in den Augen des anderen hätte ihm verraten müssen, dass er viel zu viel geboten hatte. Aber Ben trat schon zu der jungen Schwarzen und reichte ihr den Arm.
Sie duckte sich, als erwartete sie erneut Schläge.
»Sie gehört dir«, rief der Mann ungeduldig. »Ich hab nicht ewig Zeit!« Er ging zu seinem Pferd zurück.
»Ich will sie und den Jungen.«
»Dann leg noch mal die Hälfte drauf.« Der Hinkende war wieder aufs Pferd gestiegen, als fühlte er sich hier sicherer, überlegener.
»Nein. Nehmt das Geld oder lasst es.« Ben gab sich betont gleichgültig, doch er hoffte inständig, dass der andere sein Angebot annehmen würde. Die Frau tat ihm leid, aber zu viel konnte er nicht für sie opfern.
»Meinetwegen«, sagte der Reiter und nahm die Münzen entgegen. »Aber ihre armselige Habe behalte ich!« Der hochbeinige Wallach stieg wieder auf die Hinterhand, als der Pockennarbige ihm die Sporen fest in die Flanken drückte. Der Reiter rief noch: »Los jetzt, Peer!«, dann preschten die Männer davon. Zurück blieb nur eine bräunlich gelbe Staubwolke.
Ben sah den beiden Kerlen einen Augenblick lang wie benommen nach, dann beugte er sich zu der jungen Schwarzen hin, die mühsam aufgestanden war und die jetzt versuchte, ihm die Hände zu küssen.
»Lass das!« Als sie ihn verständnislos ansah, fügte er hinzu: »Ich will das nicht. Sag mir lieber, was ich jetzt mit dir machen soll.«
Die Frau zog ihren Sohn schützend an sich. »Dunno, Master …« Sie senkte den Blick, als hätte sie Angst vor neuen Schlägen.
Ben sah es und schüttelte den Kopf. »Steh auf, ich werde dir ganz bestimmt nichts tun«, versicherte er langsam und deutlich auf Englisch. »Und deinem Kind erst recht nicht.« Unsicher blickte er sich um. Die Straße war belebt, Kutschen fuhren rasch vorüber, ein paar Frauen standen auf dem Gehweg und sahen neugierig herüber. Auch drei Soldaten waren Zeugen des Zwischenfalls geworden, doch offensichtlich hatte niemand es für nötig befunden, einzugreifen. Ben sah den Frauen, die elegant gekleidet waren, mit ihren Sonnenschirmen spielten und jetzt rasch weitergingen, kopfschüttelnd nach, dann wandte er sich wieder an Sina. »Wir sollten sehen, dass wir von hier wegkommen. Die Frage ist nur – wohin?«
»Your house …?« Fragend sah die junge Frau ihn an.
»No house … ich habe kein Haus«, versuchte er ihr verständlich zu machen. Als er sie nun zum ersten Mal richtig ansah, musste er sich eingestehen, dass sie sehr hübsch war. Ihre Haut glänzte mokkafarben, ihr Mund hatte eine sanft geschwungene Form. »Dein Name ist Sina, nicht wahr?«, fragte er, denn er erinnerte sich daran, dass der Hinkende sie so genannt hatte.
»Ja, Master. Und das ist Will«, antwortete sie mit einem leichten Zittern in der Stimme. »Er ist fünf und kann schon ein bisschen arbeiten.« Sie schob den Jungen ein Stückchen vor, so als sei der Kleine ein Stück Vieh, das begutachtet werden sollte.
»Dafür ist er doch noch viel zu jung.« Ben schüttelte den Kopf.
Der kleine Junge begann zu weinen. Er verstand ganz offensichtlich nicht, was hier geschah. Ängstlich versteckte er das runde Gesichtchen, in dem die Augen so groß und glänzend wirkten wie Brombeeren, in den Rockfalten der Mutter.
»Wir sollten gehen«, wiederholte Ben.
»Und – wohin? Du hast Geld, aber keinen Platz, wo du schläfst?« Sina sah ihn ungläubig an.
»Ich bin eben vom Schiff dort drüben gekommen. Und jetzt will ich weiter ins Hinterland. Da habe ich ein Stück Land geerbt. Es muss irgendwo östlich von hier liegen.«
Sina wurde lebhafter. »Wir suchen zusammen. Sina kennt sich aus, ist viel herumgekommen.«
Ben wollte lieber nicht genau wissen, wie viel sie gesehen hatte. Er war sich auch so ziemlich sicher, dass Sina schon an verschiedenen Orten als Sklavin hatte arbeiten müssen. Ihr kleiner Sohn hatte eine hellere Hautfarbe als seine Mutter – wahrscheinlich hatte irgendwann einmal einer ihrer Herren sie zu sich ins Bett geholt.
»Kannst du mir den Weg zeigen? Ich muss in Richtung Nordosten.« Er zögerte, dann fügte er hinzu: »Ich suche ein bestimmtes Land. Der Boden muss für den Weinanbau geeignet sein.«
»Ja, komm.« Schon wandte sie sich zum Gehen.
»Warte! Ich muss dich erst noch etwas fragen.«
Wieder flackerte Angst in den großen dunklen Augen auf.
Ben sah es und hob die Hände zu einer beschwichtigenden Geste. »Ich will nur wissen, wie lange es dauert, bis wir Cape Town hinter uns gelassen haben. Die Stadt ist größer, als ich gedacht habe.«
»Das hier ist Simon’s Town. Cape Town liegt ein Stück weiter in die Richtung.« Sie wies nach Norden. Der Anflug eines Lächelns war auf Sinas Gesicht zu erkennen. »Warum weißt du das nicht, Seemann?«
Ben zuckte leicht mit den Schultern. »Weil ich nie eine genaue Karte gesehen habe. Es gibt nur eine Zeichnung meines Großvaters, die hab ich immer vor Augen. Aber da ist das Kap nur in groben Umrissen eingezeichnet. Und mein Kapitän hat nie ein Wort darüber verloren, dass der Hafen nicht direkt zu Kapstadt gehört. Oder ich hab nicht richtig hingehört.« Er lächelte verlegen. »Wie weit ist es von hier bis in die Stadt?«
»Wenn man zu Fuß geht, ist es fast ein Tagesmarsch. Mit dem Pferdefuhrwerk drei Stunden.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: