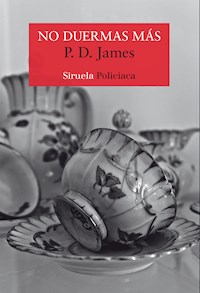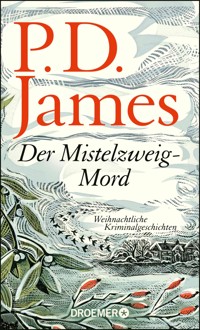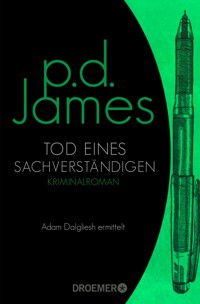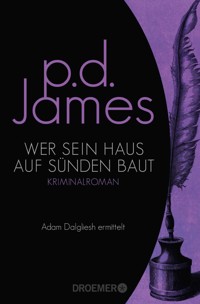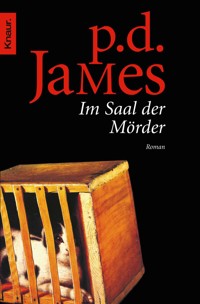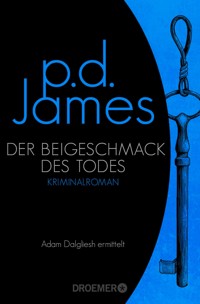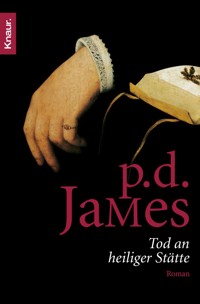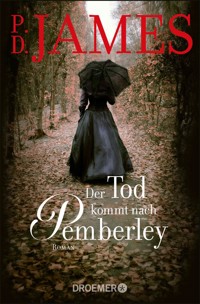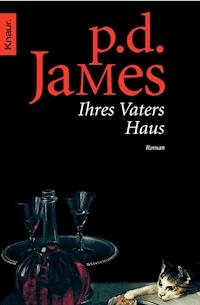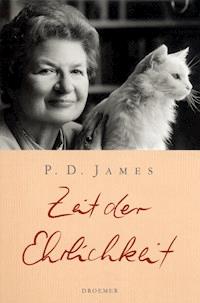4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Polit-Thriller, der im England des Jahres 2021 spielt. Große Teile der Insel sind von Wald bedeckt, viele Straßen von Gras überwuchert. Wie überall auf der Welt haben die Menschen ihre Fortpflanzungsfähigkeit verloren. Unter der Regierungsherrschaft eines Despoten scheint Ordnung zu herrschen, aufrechterhalten allerdings durch eine allgegenwärtige Geheimpolizei. Bespitzelungen und Einweisungen in Straflager gehören zum Alltag. Aber es existiert eine kleine Dissidentengruppe, die sich gegen das brutale Regime auflehnt ... Im land der leeren Häuser von P.D. James: packender Thriller im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
P. D. James
Im Land der leeren Häuser
Roman
Aus dem Englischen von Christa Seibicke
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Wiederum meinen Töchtern Clare und Jane für ihre Mithilfe
Erstes BuchOMEGA
Januar – März 2021
Ω
1. Kapitel
Freitag, 1. Januar 2021
Heute früh, am 1. Januar 2021 um null Uhr drei, ist bei einer Kneipenschlägerei in einem Vorort von Buenos Aires der mutmaßlich letzte auf Erden geborene Mensch im Alter von fünfundzwanzig Jahren, zwei Monaten und zwölf Tagen ums Leben gekommen. Ersten noch unbestätigten Berichten zufolge starb Joseph Ricardo, wie er gelebt hatte. Mit der Ehre, falls man es überhaupt so nennen kann, der letzte Mensch zu sein, dessen Geburt amtlich erfaßt wurde – was freilich nicht im mindesten sein Verdienst war – hatte er sich immer schwergetan. Und jetzt ist er tot. Wir hier in Großbritannien erfuhren es aus den Neun-Uhr-Nachrichten des staatlichen Rundfunksenders, die ich eher zufällig eingeschaltet hatte. Ich hatte mich eben hingesetzt, um dieses Tagebuch über die zweite Hälfte meines Lebens zu beginnen, als ich merkte, daß es gleich neun war, also gerade Zeit für den Nachrichtenüberblick zur vollen Stunde. Die Meldung über Ricardos Tod kam erst zum Schluß, und auch nur ganz kurz, in wenigen Sätzen, gleichmütig verlesen von der unaufdringlichen Stimme eines geschulten Nachrichtensprechers. Aber als ich sie hörte, sah ich darin doch einen Grund mehr dafür, mein Tagebuch gerade heute anzufangen; am ersten Tag eines neuen Jahres, der zugleich mein fünfzigster Geburtstag ist. Als Kind war ich immer ein bißchen stolz auf diese Besonderheit, auch wenn ein Geburtstag so kurz nach Weihnachten den leidigen Schönheitsfehler hatte, daß ein Geschenk – zumal nie merklich größer als das, was ich sowieso bekommen hätte – für beide Feste herhalten mußte.
Jetzt, beim Schreiben, bin ich allerdings nicht mehr so sicher, ob die drei Ereignisse – das neue Jahr, mein fünfzigster Geburtstag und Ricardos Tod – Grund genug dafür sind, die ersten Seiten dieses neuen Loseblattbuches vollzukritzeln. Trotzdem werde ich fortfahren, und sei es nur, um der eigenen Trägheit vorzubeugen. Wenn es nichts zu berichten gibt, werde ich das Nichts protokollieren, und wenn ich alt bin, vorausgesetzt, ich werde es – womit die meisten von uns rechnen können, denn in puncto Lebensverlängerung haben wir es ja weit gebracht –, dann mache ich eine von meinen Blechbüchsen mit den gehorteten Streichhölzern auf und entfache still für mich mein kleines Fegefeuer der Eitelkeiten. Ich habe nämlich nicht die Absicht, mein Tagebuch als Zeugnis der letzten Jahre eines Menschenlebens zu hinterlassen. Selbst in Anwandlungen höchster Eitelkeit würde ich mich nie zu einer solchen Selbstüberschätzung versteigen. Denn was könnte schon interessant sein an den Aufzeichnungen von Theodore Faron, Doktor der Philosophie, Fellow am Merton College der Universität Oxford, Dozent für viktorianische Geschichte, geschieden, kinderlos, einsam und bemerkenswert allenfalls wegen seiner Verwandtschaft mit Xan Lyppiatt, dem Diktator und Staatschef, genannt Warden of England.
Persönliche Erinnerungen sind sowieso überflüssig. Weltweit schicken die Nationalstaaten sich derzeit an, die Zeugnisse ihres kulturellen Schaffens für eine Nachwelt zu bewahren, von der wir uns gelegentlich immer noch vorgaukeln, daß es sie geben wird – jene Wesen von einem anderen Stern, die vielleicht einmal in dieser grünen Wildnis landen werden und dann wissen möchten, was für beseeltes Leben einst hier gehaust hat. Wir archivieren unsere Bücher und Manuskripte, die großen Gemälde, die Partituren und Instrumente, die Artefakte. In spätestens vierzig Jahren werden die berühmtesten Bibliotheken der Welt verwaist und versiegelt sein, und die Bauwerke sprechen, soweit sie noch stehen, für sich selbst. Freilich dürfte der weiche Oxforder Stein kaum mehr als zwei, drei Jahrhunderte überdauern. Schon jetzt streitet man sich an der Universität darüber, ob es sich noch lohnt, die Fassade des baufälligen Sheldonian Theatre zu erneuern. Aber ich stelle mir gern vor, wie diese Fabelwesen auf dem Petersplatz landen und die mächtige Basilika betreten, in der unter dem Staub der Jahrhunderte die Stille widerhallt. Ob sie wohl erkennen, daß dies einst der größte unter all den Tempeln war, die der Mensch jemals einem seiner vielen Götter geweiht hat? Ob sie neugierig sein werden auf diesen Gott, der mit soviel Pomp und Prunk verehrt wurde, und herumrätseln am Mysterium seines Symbols, den beiden gekreuzten Hölzern, an sich so schlicht, daß man es überall in der Natur wiederfindet, hier aber goldstrotzend und mit funkelnden Juwelen besetzt? Oder werden ihre Werte und Denkprozesse den unseren bereits so fremd sein, daß nichts sie mehr in Staunen oder Ehrfurcht versetzt? Doch trotz der Entdeckung eines Planeten – war das nicht 1997? –, auf dem die Astronomen organisches Leben für denkbar halten, glauben nur die wenigsten von uns, daß dessen Bewohner tatsächlich kommen werden. Sicher, geben muß es sie. Es wäre doch wider alle Vernunft, sich einzubilden, daß im ganzen weiten Universum nur ein einziger kleiner Planet fähig ist, denkendes Leben hervorzubringen und zu erhalten. Aber wir werden nicht zu ihnen gelangen, und sie werden nicht zu uns kommen.
Vor zwanzig Jahren, als die Welt schon halbwegs davon überzeugt war, daß der Mensch die Fähigkeit zur Fortpflanzung endgültig verloren habe, wurde die Suche nach dem Letztgeborenen seiner Spezies weltweit zur fixen Idee, wurde hochstilisiert zu einer Frage des Nationalstolzes, ja einem internationalen Wettstreit, der letzten Endes sinnlos war, aber deshalb nicht weniger heftig und unerbittlich verlief. Berücksichtigt wurden nur amtlich bescheinigte Geburten, mit Datum und genauer Zeitangabe. Damit schied von vornherein ein hoher Prozentsatz aus, nämlich all diejenigen, die zwar den Geburtstag, nicht aber die Stunde nachweisen konnten. Daß man auf diese Weise nie zu einem definitiven Ergebnis kommen konnte, wurde stillschweigend in Kauf genommen. Mit ziemlicher Sicherheit ist irgendwo in einem entlegenen Urwald, in einer primitiven Hütte der letzte Mensch geboren worden, ohne daß die Öffentlichkeit davon Notiz genommen hätte. Nach monatelangen Kontrollen und Gegenproben hat man dann schließlich Joseph Ricardo, einen unehelichen Mischling, der am 19. Oktober 1995 um drei Uhr zwei Minuten westlicher Zeitrechnung in einer Klinik in Buenos Aires zur Welt kam, offiziell zum Sieger erklärt. Als das Ergebnis erst einmal bekanntgegeben war, überließ man es ihm, das Beste aus seinem Ruhm zu machen, indes die Welt, als sei ihr plötzlich die Nutzlosigkeit des Unterfangens klargeworden, sich anderen Dingen zuwandte. Und jetzt, wo Ricardo tot ist, bezweifle ich, daß irgendein Land sich darum reißen wird, die übrigen Anwärter noch einmal aus der Versenkung zu zerren.
Was uns schockiert und zermürbt, ist nicht so sehr das drohende Ende der Menschheit oder unsere Ohnmacht, es zu verhüten, als vielmehr unser Unvermögen, die Ursache zu ergründen. Westliche Wissenschaft und Medizin haben uns weder auf das Ausmaß dieses elementaren Fehlschlags vorbereitet noch auf die Demütigung, die er uns zufügt. Es hat in unserer Geschichte viele Krankheiten gegeben, die schwer zu diagnostizieren oder zu heilen waren und von denen eine fast zwei Kontinente entvölkert hat, ehe sie abklang. Aber am Ende waren wir doch immer imstande zu erklären, warum. Wir haben Namen für die Viren und Bakterien, die auch heute noch von unserem Körper Besitz ergreifen – sehr zu unserem Leidwesen, halten wir es doch fast für einen persönlichen Affront, daß sie uns immer noch anfallen wie alte Feinde, die den Kampf hartnäckig fortsetzen und gelegentlich auch mal ein Opfer zur Strecke bringen, obwohl ihr Sieg längst garantiert ist. Die westliche Wissenschaft war unser Gott. In seiner Machtvielfalt hat er uns behütet, getröstet, geheilt, gewärmt, ernährt und unterhalten, und wir haben uns die Freiheit genommen, ihn zu kritisieren und bisweilen auch abzulehnen, wie Menschen zu allen Zeiten gegen ihre Götter revoltiert haben, freilich in der Gewißheit, daß dieser Gott, unser Geschöpf und Sklave, sogar uns Abtrünnige weiterversorgen würde; mit Schmerzbetäubungsmittelri, Ersatzherzen und -lungen, Antibiotika, rollenden Rädern und beweglichen Bildern. Das Licht wird immer angehen, wenn wir den Schalter betätigen, und wenn es doch einmal nicht funktioniert, können wir feststellen, warum. Ich bin in den Naturwissenschaften nie sehr bewandert gewesen. In der Schule habe ich in den einschlägigen Fächern nur wenig begriffen, und jetzt, als Fünfzigjähriger, verstehe ich auch nicht viel mehr davon. Aber obwohl ihre Errungenschaften mir weitgehend unbegreiflich sind, war die Wissenschaft auch mein Gott, und ich teile die universelle Trauer derjenigen, deren Gott gestorben ist. Ich erinnere mich noch ganz deutlich an die zuversichtliche Prognose eines Biologen, als endlich offenkundig war, daß es nirgendwo auf der Welt mehr eine schwangere Frau gab: »Es kann einige Zeit dauern, bis wir die Ursache dieser offenbar globalen Unfruchtbarkeit aufgedeckt haben.« Seitdem sind fünfundzwanzig Jahre vergangen, und wir rechnen mit keinem Erfolg mehr. Wie ein von plötzlicher Impotenz geschlagener Sexprotz fühlen wir uns zutiefst gedemütigt und in unserem Selbstvertrauen erschüttert. Mit all unserem Wissen, unserer Intelligenz und Überlegenheit schaffen wir nicht einmal mehr das, was jedes Tier ohne zu überlegen tut. Kein Wunder, daß wir die Tiere gleichzeitig vergöttern und hassen. Das Jahr 1995 wurde bekannt als Jahr Omega, eine Bezeichnung, die sich inzwischen weltweit durchgesetzt hat. Ende der neunziger Jahre entbrannte eine große Diskussion darüber, ob das Land, das ein Mittel gegen die allgemeine Unfruchtbarkeit fände, dieses mit der übrigen Welt teilen würde, und wenn ja, zu welchen Bedingungen. Es herrschte Einigkeit darüber, daß es sich hier um eine globale Katastrophe handele, auf die man mit vereinten Kräften reagieren müsse. Damals sprachen wir von Omega immer noch wie von einer Krankheit, einer Funktionsstörung, die mit der Zeit diagnostiziert und anschließend behoben werden würde, so wie der Mensch ja auch ein Mittel gegen Tuberkulose gefunden hatte oder gegen Diphtherie, gegen Kinderlähmung und am Ende sogar, wenngleich zu spät, gegen AIDS. Doch als Jahr um Jahr verging, ohne daß die gemeinschaftlichen Anstrengungen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zum Erfolg führten, zerbrach die Allianz, und mit der feierlich gelobten Offenheit war es vorbei. Fortan wurde im geheimen geforscht und die Entwicklung in den anderen Ländern gespannt und argwöhnisch verfolgt. Die Europäische Gemeinschaft entschloß sich immerhin zu konzertierten Aktionen und geizte nicht mit Forschungsmitteln oder Fachkräften. Das vor den Toren von Paris gelegene Zentrum zur Erforschung der Fruchtbarkeit beim Menschen zählte zu den renommiertesten in der Welt. Dieses Institut wiederum arbeitete, zumindest offiziell, mit den Vereinigten Staaten zusammen, die womöglich noch größere Anstrengungen unternahmen als wir hier in Europa. Zu einer rassenübergreifenden Kooperation kam es allerdings nicht; dafür stand zuviel auf dem Spiel. Darüber, zu welchen Bedingungen man die Lösung des Rätsels weitergeben könne, gab es allerlei Spekulationen und leidenschaftliche Debatten. Man einigte sich zwar darauf, daß der Entdecker des Heilmittels es der übrigen Welt zugänglich machen müsse, handelte es sich doch um wissenschaftliche Erkenntnisse, die kein Volk auf die Dauer für sich behalten konnte oder durfte. Trotzdem beobachteten wir einander über Kontinente, Staats- und Rassengrenzen hinweg mit geradezu zwanghaftem Mißtrauen und stürzten uns gierig auf jedes neue Gerücht, jede neue Theorie. Das marode Gewerbe der Spionage kam wieder in Gang. Greise Agenten krochen aus ihren gemütlichen Alterssitzen in Weybridge oder Cheltenham hervor und gaben ihr Wissen an den Nachwuchs weiter. Das gegenseitige Bespitzeln hatte natürlich nie aufgehört, nicht einmal nach dem offiziellen Ende des Kalten Krieges, 1991. Der Mensch ist dieser berauschenden Melange aus jugendlichem Freibeutertum und Erwachsenenperfidie schon zu sehr verfallen, als daß er sie völlig aufgeben könnte. Ende der neunziger Jahre blühte die Spionagetätigkeit aber wieder auf wie zu Zeiten des Kalten Krieges und brachte neue Helden, neue Schurken und neue Legenden hervor. Besonders auf die Japaner hatten wir ein wachsames Auge, fürchtete man doch, dieses übertechnisierte Volk könne der Lösung bereits auf der Spur sein.
Heute, rund zwanzig Jahre später, liegen wir immer noch auf der Lauer, aber inzwischen weniger gespannt und bar jeder Hoffnung. Man spioniert zwar weiter, aber da seit fünfundzwanzig Jahren kein Mensch mehr zur Welt gekommen ist, glaubt im Grunde seines Herzens kaum noch jemand daran, daß auf unserem Planeten je wieder der Schrei eines neugeborenen Kindes zu hören sein wird. Unser Interesse am Sex läßt nach. Romantische, idealisierte Liebe ist an die Stelle kruder Fleischeslust getreten, so sehr sich der Warden of England auch bemüht, uns mit Hilfe von Pornoshops wieder auf den Geschmack zu bringen. Aber wir haben ja unsere Ersatzdrogen; über den staatlichen Gesundheitsdienst sind sie jedermann zugänglich. Unsere alternden Körper werden geknetet, gestreckt, gewalkt, getätschelt, eingeölt und parfümiert. Wir werden manikürt und pedikürt, gemessen und gewogen. In Lady Margaret Hall, dem ehemaligen Mädchencollege, ist das Massagezentrum Oxford untergebracht, und dort liege auch ich jeden Dienstagnachmittag auf der Couch, blicke hinaus in den vorläufig noch gepflegten Park und genieße meine staatlich finanzierte, gewissenhaft bemessene Stunde sinnlicher Streicheleinheiten. Und wie beharrlich, mit welch zwanghaftem Eifer klammern wir uns an die Illusion, versuchen, wenn schon nicht die Jugend, so doch wenigstens die Vitalität der sogenannten besten Jahre festzuhalten. Golf ist zum Nationalsport geworden. Ohne Omega würden die Naturschützer dagegen protestieren, daß man so viele Morgen Land, darunter einige unserer schönsten Naturgebiete, gewaltsam verändert und umgemodelt hat, bloß um immer noch anspruchsvollere Plätze bauen zu können. Sie sind übrigens alle gebührenfrei; das gehört zu der vom Warden propagierten Politik der Lebensfreude. Ein paar exklusive Clubs schaffen es trotzdem, unwillkommene Mitglieder fernzuhalten, denn wo das Gesetz Beitrittsbeschränkungen verbietet, bleiben ja immer noch jene subtilen Signale eisiger Ablehnung, die selbst der unsensibelste Brite von klein auf zu deuten gelernt hat. Wir brauchen unsere Snobismen; Gleichstellung ist ein politisches Axiom, das vor der Praxis nicht besteht, nicht einmal in Xans egalitärem Großbritannien. Ich habe es übrigens auch einmal mit Golf versucht, fand das Spiel aber von Anfang an völlig reizlos, vielleicht weil ich zwar reihenweise Divots in den Rasen geschlagen, aber partout keinen Ball getroffen habe. Jetzt bin ich aufs Joggen umgestiegen. Fast täglich drehe ich meine Runden auf dem weichen Boden von Port Meadow oder den verlassenen Spazierwegen im Wytham Wood, zähle die Meilen, notiere anschließend den Puls und führe Buch über Gewichtsverlust und Kondition. Ich hänge genauso am Leben wie alle anderen, bin genau wie sie auf den eigenen Körper fixiert.
Viele Aspekte dieser Fitneßmanie lassen sich bis in die frühen neunziger Jahre zurückverfolgen: die Suche nach einer alternativen Medizin, die Duftöle und Massagen, das Walken und Salben, der Glaube an die magische Heilkraft von Steinen, Sex ohne Penetration. In Film und Fernsehen, in der Literatur und auch im Leben nahmen Pornographie und sexuelle Gewalt immer mehr Raum ein und wurden zunehmend brutaler, während zumindest bei uns im Westen immer weniger Kinder gezeugt wurden. Damals, in einer durch Überbevölkerung massiv geschädigten Welt, begrüßte man diese Entwicklung sogar. Ich als Historiker sehe darin freilich den Anfang vom Ende.
Hätten wir doch nur die Warnungen Anfang der neunziger Jahre beherzigt. Bereits 1991 verzeichnete ein Bericht der Europäischen Gemeinschaft einen drastischen Rückgang der Geburtenziffern in Europa – 8,2 Millionen waren es 1990, mit besonders starkem Gefälle in den römisch-katholischen Ländern. Wir meinten die Gründe zu kennen, glaubten an einen gezielten Geburtenschwund, verursacht durch eine liberalere Einstellung zu Empfängnisverhütung und Abtreibung, durch den Trend berufstätiger Frauen, den Kinderwunsch der Karriere unterzuordnen, sowie durch den generellen Anspruch der Familien auf einen höheren Lebensstandard. Auch die Ausbreitung von AIDS, besonders in Afrika, galt als mitverantwortlich für die sinkenden Bevölkerungszahlen. Einige europäische Länder starteten massive Kampagnen zur Geburtenförderung, aber den meisten von uns schien die rückläufige Tendenz wünschenswert, ja sogar notwendig. Die Masse Mensch verseuchte den Planeten Erde; da konnte man doch nur froh sein, wenn wir weniger Kinder in die Welt setzten. Über die sinkende Geburtenrate im allgemeinen regte man sich also nicht sonderlich auf; wer sich Sorgen machte, das waren die einzelnen Nationen, die ihr Volk, ihre Kultur, ihre Rasse erhalten und genügend Nachwuchs zur Sicherung ihres Wirtschaftssystems heranziehen wollten. Doch soweit ich mich erinnere, wies niemand auf eine dramatische Veränderung der menschlichen Fertilität hin. Omega brach wie aus heiterem Himmel über uns herein und wurde entsprechend ungläubig aufgenommen. Scheinbar über Nacht hatte die Menschheit ihre Zeugungsfähigkeit eingebüßt. Als man im Juli 1994 entdeckte, daß sogar die für Experimentalzwecke und künstliche Befruchtung eingefrorenen Spermaproben ihre Potenz verloren hatten, war das Entsetzen so groß, daß Omega in den Dunstkreis von Aberglauben und Hexerei geriet; man sprach von einer Schicksalsfügung. Die alten Götter standen wieder auf, furchtbar in ihrer Macht.
Die Welt gab dennoch die Hoffnung nicht auf, bis der Jahrgang 1995 zur Geschlechtsreife gelangte. Aber als nach Auswertung aller Testreihen feststand, daß auch nicht einer aus dieser Generation fruchtbaren Samen produzieren konnte, da mußten wir uns mit dem Ende des Homo sapiens abfinden. In dem Jahr, 2008, nahmen denn auch die Selbstmorde zu. Nicht nur unter den Alten, sondern auch in meiner Generation, also bei den mittleren Jahrgängen, dereinst die Hauptleidtragenden in einer überalterten und aussterbenden Gesellschaft mit all ihren Nöten und peinlichen Pflichten. Xan, der inzwischen als Warden of England die Macht übernommen hatte, versuchte der drohenden Epidemie Einhalt zu gebieten, indem er die nächsten Verwandten eines Selbstmörders mit empfindlichen Geldstrafen belegte. (Heute ist es genau umgekehrt. Da zahlt der Staatsrat den Angehörigen behinderter und pflegebedürftiger alter Menschen, die sich das Leben nehmen, eine ansehnliche Pension.) Die Rechnung ging auf, damals. Die Selbstmordrate bei uns hielt sich in Grenzen, verglichen mit den schwindelerregenden Zahlen anderer Länder, allen voran die, deren Religion im Ahnenkult und Fortbestand der Familie wurzelt. Die Lebenden aber verfielen scharenweise jenem Negativismus, den die Franzosen ennui universel nennen. Er kam über uns wie eine schleichende Krankheit; ja, es war eine Krankheit, deren Symptome uns bald geläufig wurden: Mattheit, Depression, diffuses Unwohlsein, erhöhte Anfälligkeit für unbedeutsame Infektionen und lähmende, chronische Kopfschmerzen. Wie viele andere kämpfte ich dagegen an. Einige wenige, darunter auch Xan, blieben gänzlich verschont; vielleicht schützte sie ihre mangelnde Phantasie oder, wie in seinem Fall, eine Überheblichkeit, an der jede äußere Katastrophe wirkungslos abprallt. Ich muß mich immer noch ab und zu zur Wehr setzen, damit die Krankheit nicht Besitz von mir ergreift, aber ich fürchte mich jetzt nicht mehr so vor ihr. Die Waffen, mit denen ich sie bekämpfe, sind sogleich auch mein Trost: Bücher, Musik, gutes Essen, Wein, die Natur.
Diese erquickenden Annehmlichkeiten erinnern allerdings auch schmerzlich an die Vergänglichkeit menschlicher Freude; aber wann wäre die je von Dauer gewesen? Ich kann mich immer noch, wenngleich mehr intellektuell als sinnlich, ergötzen am seidigen Glanz unseres Oxforder Frühlings, an den Blumen in der Belbroughton Road, die mir mit jedem Jahr schöner vorkommen, am Sonnenlicht, das über eine Steinmauer wandert, an windbewegten Kastanienkerzen, am Duft eines blühenden Bohnenfeldes, an den ersten Schneeflocken, der zarten Festigkeit einer Tulpe. Man braucht sich die Freude an alledem nicht vergällen zu lassen, nur weil Hunderte von Frühlingen kommen werden, deren Knospen kein menschliches Auge mehr sieht, weil die Mauern einstürzen werden, die Bäume absterben und vermodern, die Gärten dem Unkraut weichen, und weil alle Schönheit auf Erden den menschlichen Intellekt, der sie beschreibt, der sich an ihr erfreut und sie besingt, überdauern wird. Das sage ich mir immer wieder, aber glaube ich es auch, jetzt, wo die Freude sich nur noch so selten einstellt und, wenn sie kommt, kaum mehr vom Schmerz zu unterscheiden ist? Ich verstehe, warum die Adeligen und Großgrundbesitzer ohne Hoffnung auf Nachkommenschaft ihre Güter verfallen lassen. Unsere Wahrnehmung ist auf den Augenblick beschränkt, nicht um eine Sekunde können wir diesen überschreiten, und wer das begreift, der ist der Ewigkeit schon so nahe wie irgend möglich. Aber der Geist streift durch die Jahrhunderte zurück, um sich seiner Wurzeln zu vergewissern, und ohne Hoffnung auf ein Weiterleben des Geschlechts, wenn schon nicht der eigenen Familie, ohne die Gewißheit, daß wir auch im Tod noch weiterleben werden, erscheinen mir alle geistigen und sinnlichen Freuden manchmal bloß wie ein kläglich bröckelnder Schutzwall gegen den eigenen Untergang.
Wie gramgebeugte Eltern haben wir in unserer weltweiten Trauer alle schmerzlichen Erinnerungen an den Verlust ausgelöscht. Die Kinderspielplätze in unseren Parks wurden abgebaut. In den ersten zwölf Jahren nach Omega waren die Schaukeln nur festgestellt und gesichert, die Rutschen und Klettergerüste blieben ungestrichen. Jetzt hat man sie endlich demontiert, die asphaltierten Spielplätze sind in Rasenflächen umgewandelt oder mit Blumen bepflanzt wie kleine Massengräber. Die Spielsachen haben wir verbrannt, bis auf die Puppen, die ein paar halb verrückten Frauen zum Kinderersatz geworden sind. Die Schulen, die längst schließen mußten, sind mit Brettern vernagelt oder wurden in Zentren für Erwachsenenbildung umgewandelt. Aus unseren Bibliotheken hat man die Kinderbücher systematisch entfernt. Kinderstimmen hören wir nur mehr vom Band oder auf Schallplatte, und das heitere, rührende Bild der Jugend sieht man bloß noch im Kino oder im Fernsehen. Manche bringen es nicht übers Herz, sich das anzuschauen, doch die meisten trösten sich damit wie mit einer Droge.
Die Kinder, die im Jahre 1995 geboren wurden, nennt man Omegas. Keine Generation hat man gründlicher studiert und untersucht, um keine hat man mehr gezittert, und keine wurde mehr gerühmt oder verwöhnt. Sie waren unsere Hoffnung, unser Rettungsanker, und sie waren – ja sind es noch – über die Maßen schön. Man könnte meinen, die kaltherzige Natur wollte uns noch einmal besonders deutlich vor Augen führen, was wir verloren haben. Die Knaben, inzwischen fünfundzwanzigjährige Männer, sind stark, individualistisch, intelligent und schön wie junge Götter. Viele sind außerdem grausam, arrogant und gewalttätig. Merkmale, die sich bei Omegas überall auf der Welt wiedergefunden haben. Man munkelt, die gefürchteten Banden der Papageiengesichter, so genannt wegen ihrer Kriegsbemalung, die des Nachts über Land fahren und unvorsichtige Reisende aus dem Hinterhalt überfallen, seien Omegas. Und weiter heißt es, daß ein Omega, der geschnappt wird, straffrei ausgeht, wenn er der Staatssicherheitspolizei beitritt. Die übrigen aber, obwohl sie nichts Schlimmeres verbrochen haben, werden abgeurteilt und landen in der Sträflingskolonie auf der Isle of Man, wohin heutzutage alle überführten Gewalttäter, auch Einbrecher oder mehrfache Diebe abgeschoben werden. Doch wenngleich es sich nicht empfiehlt, schutzlos auf unseren schlechten Nebenstraßen herumzugondeln, unsere Gemeinden und Städte sind jedenfalls sicher, denn mit der Rückkehr zur Deportationspolitik des neunzehnten Jahrhunderts sind wir des Verbrechens endlich Herr geworden.
Die weiblichen Omegas sind nicht mit ihren männlichen Pendants zu vergleichen. Ihre Schönheit ist klassisch entrückt, matt und unbeseelt, ohne Feuer. Sie haben ihren unverwechselbaren Stil, den andere Frauen nie kopieren, vielleicht weil sie sich nicht trauen. Sie tragen ihr Haar lang und offen; ein Zopf oder Band, mal glatt, mal geschlungen, hält die Stirn frei. So eine Frisur steht nur dem klassisch schönen Gesicht mit der hohen Stirn und den großen, weit auseinanderliegenden Augen. Auch die weiblichen Omegas sind anscheinend keiner tieferen Gefühlsregung fähig. Ob Mann, ob Frau, die Omegas sind eine Klasse für sich, verwöhnt, gegängelt, gefürchtet, mit einer halb abergläubischen Scheu respektiert. In manchen Ländern, so wird uns berichtet, opfert man sie bei wiederbelebten Fruchtbarkeitsriten, die jahrhundertelang von einer hauchdünnen Zivilisationskruste verdeckt waren. Ich frage mich mitunter, was wir in Europa tun werden, falls uns eines Tages die Nachricht erreicht, daß die alten Götter diese Opfergaben angenommen und wahrhaftig ein Kind auf die Erde entsandt haben.
Vielleicht hat erst unsere Torheit die Omegas zu dem gemacht, was sie sind; ein System, das ständige Überwachung mit unerschöpflicher Nachsicht verquickt, kann ja wohl kaum für eine gesunde Entwicklung bürgen. Und wenn man Kinder von klein auf wie Götter behandelt, neigen sie als Erwachsene eben dazu, sich wie Teufel zu gebärden. Ich habe eine besonders lebhafte Erinnerung an sie, die Omegas, eine Szene, die ebenso mein Bild von ihnen verdeutlicht wie das ihre von sich selbst. Es war im letzten Juni, an einem heißen, aber nicht schwülen Tag mit klarer Sicht und langsam ziehenden Wolken, die wie weiße Tücher vor dem hohen, azurblauen Himmel dahinsegelten. Da ein angenehm kühles Lüftchen ging, hatte der Tag nichts von der feuchtwarmen Trägheit, die ich normalerweise mit einem Oxforder Sommer assoziiere. Ich war auf dem Weg zu einem Kollegen in Christ Church, und als ich durchs Wolsey-Torhaus trat, um den Tom Quad, den Innenhof des Colleges, zu überqueren, da sah ich sie am Sockel der Merkurstatue, vier weibliche und vier männliche Omegas in eleganter Pose. Die Frauen mit ihrer Aureole schimmernder Locken über der hohen Stirn und den raffiniert gefältelten Rüschen an ihren fast durchsichtigen Kleidern sahen aus, als wären sie geradewegs den präraffaelitischen Fenstern der Kathedrale entstiegen. Die vier jungen Männer standen breitbeinig, mit verschränkten Armen, hinter ihnen und sahen starr über ihre Köpfe hinweg, als wollten sie mit dieser arroganten Attitüde ihre Oberhoheit über den ganzen Hof geltend machen. Als ich vorbeiging, begegneten die Mädchen mir mit leerem, gleichmütigem Blick, in dem aber sekundenlang unverhohlene Verachtung aufblitzte. Die Männer wandten sich nach einem flüchtigen, finsteren Blick ab wie von einem Gegenstand, der keine Beachtung verdient, und sahen wieder starr hinaus auf den Hof. Ich dachte damals, und ich denke es heute wieder: Nur gut, daß ich sie nicht mehr unterrichten muß. Die meisten Omegas legten das erste Examen ab und damit Schluß; sie sind an keiner Weiterbildung interessiert. Die Omega-Studenten, die noch bei mir Vorlesungen besuchten, waren intelligent, aber sprunghaft, disziplinlos und sehr schnell gelangweilt. Ich war froh, daß ich ihre unausgesprochene Frage: »Wozu das Ganze?« nicht zu beantworten brauchte. Die Geschichtswissenschaft, die die Vergangenheit interpretiert, um die Gegenwart zu verstehen und sich der Zukunft stellen zu können, ist die undankbarste Disziplin für eine aussterbende Spezies.
Ein Kollege, der sich durch Omega überhaupt nicht aus der Ruhe bringen läßt, ist Daniel Hurstfield. Aber als Professor für statistische Paläontologie denkt er natürlich in ganz anderen Zeiträumen. Gleich dem Gott des Psalters sind auch ihm tausend Jahre wie eine Nachtwache. In dem Jahr, als mir der Weinkeller unterstand, saßen wir einmal bei einem College-Bankett nebeneinander. »Und was kredenzen Sie uns zum Moorhuhn, Faron?« erkundigte er sich. »Aha. Nun, fürwahr ein guter Tropfen. Manchmal haben Sie, fürchte ich, einen etwas verwegenen Geschmack. Übrigens hoffe ich doch, Sie haben ein vernünftiges Trinkprogramm aufgestellt, damit wir den Keller beizeiten leer kriegen. Ich könnte nicht ruhig sterben bei dem Gedanken, daß diese barbarischen Omegas sich an den College-Vorräten gütlich tun.«
Ich entgegnete: »Wir denken darüber nach. Vorerst wird natürlich immer noch eingelagert, aber in reduzierten Mengen. Einige meiner Kollegen meinen freilich, wir seien zu pessimistisch.«
»Oh, ich glaube, man kann überhaupt nicht pessimistisch genug sein. Ich begreife nicht, warum ihr euch alle so über Omega wundert. Schließlich sind von den vier Milliarden Lebensformen, die es einmal auf diesem Planeten gab, inzwischen drei Milliarden und neunhundertsechzig Millionen ausgestorben. Warum, wissen wir nicht. Manche durch mutwillige Ausrottung, andere durch Naturkatastrophen, wieder andere fielen Meteoriten und Asteroiden zum Opfer. Angesichts dieses massenhaften Aussterbens wäre es doch wirklich töricht anzunehmen, ausgerechnet der Homo sapiens würde verschont bleiben. Nein, unsere Spezies wird einmal zu den kurzlebigsten überhaupt gehören, nur ein Blinzeln, gewissermaßen, im Auge der Zeit. Übrigens wäre es, Omega hin oder her, durchaus möglich, daß eben jetzt ein Asteroid Kurs auf uns nimmt, der groß genug ist, diesen Planeten zu zerstören.« Und als ob diese Aussicht ihm die allerhöchste Befriedigung verschaffe, machte er sich schmatzend über sein Moorhuhn her.
2. Kapitel
Dienstag, 5. Januar 2021
Während der zwei Jahre, in denen ich, auf Ersuchen Xans, als eine Art beobachtender Berater an den Sitzungen des Staatsrats teilnahm, war es unter Journalisten Usus zu schreiben, wir seien zusammen aufgewachsen und einander geschwisterlich verbunden. Das entspricht nicht der Wahrheit. Ab unserem zwölften Lebensjahr verbrachten wir die Sommerferien miteinander, aber das war auch schon alles. Der Irrtum ist gleichwohl verständlich. Ich bin ihm ja selbst beinahe aufgesessen. Bis heute erscheint mir das Sommertrimester, das den Ferien vorausging, in der Rückschau wie eine langweilige Kette genau berechenbarer Tage, regiert von Stundenplänen, weder qualvoll noch gefürchtet, aber bis auf die wenigen erfreulichen Erlebnisse, die ich meiner Intelligenz und leidlicher Beliebtheit verdankte, eben durchzustehen bis zum ersehnten Augenblick der Erlösung. Erst verbrachte ich ein paar Tage daheim, dann schickte man mich nach Woolcombe.
Selbst jetzt beim Schreiben ist mir noch nicht klar, was ich damals für Xan empfand, warum das Band zwischen uns so fest blieb und so lange hielt. Es hatte nichts mit Erotik zu tun, wenn man einmal davon absieht, daß in fast jeder engen Freundschaft unterschwellig auch sexuelle Anziehungskraft mitschwingt. Wir haben uns nie berührt, soweit ich mich erinnere, nicht einmal im ausgelassenen Spiel, bei Raufereien. Aber dazu kam es sowieso fast nie, denn Xan haßte es, angefaßt zu werden, und ich erkannte und respektierte frühzeitig das unsichtbare Niemandsland, in dem er lebte, genau wie er das meine respektierte. Es war auch nicht die übliche Geschichte vom überlegenen Partner, wo der Ältere, und sei es auch nur um vier Monate, den Jüngeren, seinen Schüler und Bewunderer, am Gängelband führt. Xan gab mir nie das Gefühl, der Unterlegene zu sein, das war nicht sein Stil. Er nahm mich ohne besondere Herzlichkeit auf, aber so, als bekäme er in mir seinen Zwilling, einen Teil seiner selbst zurück. Selbstverständlich hatte er Charme; den hat er noch. Daß eine Eigenschaft wie Charme oft so geringschätzig abgetan wird, ist mir unbegreiflich. Schließlich hat ihn keiner, der nicht auch imstande wäre, andere Menschen aufrichtig gern zu haben, zumindest im direkten Kontakt und Gespräch. Charme ist immer echt; er mag oberflächlich sein, aber man kann ihn nicht vortäuschen. Wenn Xan sich mit jemandem unterhält, dann hat man den Eindruck, er steht mit diesem Menschen auf vertrautem Fuß, interessiert sich für ihn, ja würde sich keine andere Gesellschaft wünschen. Bereits am nächsten Tag könnte er den Tod dieses Menschen gleichmütig hinnehmen, ihn womöglich ohne Skrupel selber umbringen. Wenn ich heutzutage am Bildschirm verfolge, wie Xan den Vierteljahresbericht an die Nation verliest, dann sehe ich den gleichen Charme am Werk.
Unsere Mütter, die Schwestern waren, sind inzwischen beide tot. Gegen Ende, als sie pflegebedürftig wurden, kamen sie nach Woolcombe, das heute ein Privatsanatorium für die Angehörigen und Günstlinge des Staatsrats ist. Xans Vater wurde ein Jahr nach Xans Ernennung zum Warden of England bei einem Autounfall in Frankreich getötet. Die Umstände waren ziemlich rätselhaft; die Protokolle wurden nie freigegeben. Ich habe damals viel über den Unfall nachgegrübelt, ja tue es noch, und das sagt mir eine Menge über mein Verhältnis zu Xan. Ein bißchen bin ich immer noch geneigt, ihm einfach alles zuzutrauen, ja fast ist es mir ein Bedürfnis, ihn für skrupellos und unbesiegbar zu halten, jenseits normaler Verhaltensnormen, so wie ich ihn gesehen habe, als wir noch Kinder waren.
Das Leben der Schwestern war sehr unterschiedlich verlaufen. Meine Tante hatte dank einer lukrativen Kombination von Schönheit, Ehrgeiz und Glück einen Baronet mittleren Alters geheiratet, meine Mutter einen Beamten im mittleren Dienst. Xan wurde auf Woolcombe geboren, einem der schönsten Herrensitze in Dorset; ich in Kingston, Surrey, auf der Entbindungsstation des Ortskrankenhauses, von wo man mich heimbrachte in eine viktorianische Doppelhaushälfte an einer langen, trostlosen Straße, die zum Richmond Park führte und in der ein Haus aussah wie das andere. Ich wuchs in einer Atmosphäre verbiesterter Unzufriedenheit heran. Ich brauche nur daran zu denken, wie meine Mutter mir den Koffer für die Sommerferien auf Woolcombe packte. Sorgfältig sortierte sie die sauberen Hemden aus, hielt mein bestes Jackett gegen das Licht, schüttelte und musterte es nachgerade feindselig, als ärgere sie sich doppelt über das gute Stück, weil es sie soviel Geld gekostet hatte, ohne den gewünschten Zweck zu erfüllen: Neu war es eine Nummer zu groß gewesen, damit ich hineinwachsen könne, und ehe man sich's versah, spannte es überall. Ihre Ansicht über die glänzende Partie ihrer Schwester tat sie in einer Reihe oft wiederholter Bemerkungen kund: »Ich bin ja froh, daß sie in Woolcombe keinen Abendanzug zum Dinner tragen. Ich werfe nämlich kein Geld für einen Smoking raus, nicht in deinem Alter! Lächerlich!« Und dann die unvermeidliche Frage, mit abgewandtem Blick gestellt, denn sie war nicht ohne Schamgefühl: »Es ist doch alles in Ordnung bei ihnen, oder? Getrennte Schlafzimmer sind in diesen Kreisen ja ganz normal.« Und zum Schluß: »Na ja, für Serena ist es bestimmt in Ordnung so.« Sogar mit meinen zwölf Jahren begriff ich, daß es so nicht in Ordnung war für Serena.
Ich habe den Verdacht, daß meine Mutter sehr viel öfter an ihre Schwester und ihren Schwager dachte als umgekehrt. Und sogar meinen altmodischen Vornamen habe ich Xan zu verdanken. Er wurde nach seinem Großvater und Urgroßvater getauft; der Name Xan war bei den Lyppiatts seit Generationen in der Familie. Mich taufte man ebenfalls nach meinem Großvater väterlicherseits. Meine Mutter sah keinen Grund, warum sie sich ausstechen lassen sollte, wenn es galt, einem Kind einen exzentrischen Namen zu verpassen. Aber Sir George war und blieb ihr ein Rätsel. Ich habe noch ihre gereizte Klage im Ohr: »Für mich sieht er nicht aus wie ein Baronet.« Er war der einzige Baronet, den wir kannten, und ich frage mich, welch heimliches Idealbild sie wohl heraufbeschwor – ein aus seinem Rahmen herabgestiegenes bleiches, romantisches Van-Dyck-Porträt, düstere byronische Arroganz oder einen bramarbasierenden Squire mit hochrotem Kopf und dröhnender Stimme, der bei der Fuchsjagd brilliert? Aber ich wußte trotzdem, was sie meinte; auch für mich sah er nicht aus wie ein Baronet. Und wie der Besitzer von Woolcombe erst recht nicht. Er hatte ein spatenförmiges, rotgeflecktes Gesicht mit schmalen, feuchten Lippen unter einem Schnurrbart, der ebenso lächerlich wie unecht wirkte, rötliches Haar, das Xan geerbt hatte, das aber bei ihm fahl und ausgebleicht war wie dürres Stroh, und Augen, die halb verdutzt, halb traurig über seine Ländereien schweiften. Doch er war ein guter Schütze – das hätte meiner Mutter imponiert. Xan schlug ihm auch darin nach. Die Purdeys seines Vaters durfte er zwar nicht anrühren, aber er besaß zwei eigene Flinten, mit denen wir auf Kaninchenjagd gingen, und dann konnten wir noch zwei Pistolen benutzen, allerdings nur mit Platzpatronen. Wir nagelten Zielscheiben an die Bäume und übten stundenlang, um unsere Trefferquote zu verbessern. Nach ein paar Tagen war ich sowohl mit dem Gewehr als auch mit der Pistole besser als Xan. Mein Geschick überraschte uns beide, mich noch mehr als ihn. Ich hatte nicht damit gerechnet, daß Schießen mir Spaß machen würde oder daß ich Talent dazu hätte; fast verwirrt registrierte ich an mir eine halb schuldbewußte, beinahe sinnliche Freude am Umgang mit der Waffe, an der Berührung des Metalls, dem griffigen, wohl bemessenen Gewicht in der Hand.
Xan hatte während der Ferien keine Gesellschaft außer mir und schien auch kein Bedürfnis danach zu haben. Freunde von Sherborne kamen nicht nach Woolcombe. Wenn ich ihn nach der Schule fragte, antwortete er ausweichend: »Ist ganz in Ordnung. Besser als Harrow gewesen wäre.«
»Auch besser als Eton?«
»Das kommt für uns nicht mehr in Frage. Urgroßvater hatte einen Mordskrach mit denen, öffentliche Anschuldigungen, wütende Briefe, entrüsteter Abgang. Ich hab' vergessen, worum es eigentlich ging.«
»Bist du nie traurig, wenn du wieder ins Internat zurück mußt?«
»Warum sollte ich? Bist du's etwa?«
»Nein, ich gehe ganz gern zur Schule. Wenn ich nicht hier sein kann, dann ist mir die Schule lieber als Ferien.«
Er schwieg einen Moment und sagte dann: »Das Dumme ist, daß die Lehrer einen immer verstehen wollen. Sie glauben, dafür werden sie bezahlt. Aber aus mir werden sie nicht schlau. Ein Trimester lang bienenfleißig, glänzende Noten, Liebling des Internatsbetreuers, das Stipendium für Oxford schon so gut wie in der Tasche; im nächsten Trimester Mordsscherereien.«
»Was denn für Scherereien?«
»Nicht so schlimm, daß sie mich rausschmeißen können, und natürlich bin ich im Trimester drauf wieder der Musterknabe. Das verwirrt sie, macht ihnen Kopfzerbrechen.«
Ich verstand ihn auch nicht, aber das beunruhigte mich nicht weiter. Ich verstand mich selber nicht.
Heute weiß ich natürlich, warum er mich gern auf Woolcombe zu Gast hatte. Geahnt habe ich es wohl schon fast von Anfang an. Er hatte mir gegenüber keinerlei Verpflichtung, nicht einmal Freundschaft oder persönliche Wahl banden ihn an mich. Denn er hatte mich ja nicht gewählt. Ich war sein Vetter, ich wurde ihm aufgehalst, ich war einfach da. Solange ich auf Woolcombe war, brauchte er nie die ansonsten unvermeidliche Frage zu fürchten: »Warum lädst du in den Ferien nicht einmal deine Freunde zu uns ein?« Warum sollte er? Er mußte sich doch um seinen vaterlosen Cousin kümmern. Ich befreite ihn, das reizende Einzelkind, von der Last übermäßiger elterlicher Fürsorge. Von der merkte ich zwar nie sonderlich viel, aber ohne mich hätten seine Eltern sich vielleicht genötigt gefühlt, sie zu zeigen. Schon als Junge konnte er neugierige Fragen nicht leiden und duldete nicht, daß man sich in sein Leben einmischte. Ich hatte Verständnis dafür; mir ging es ganz ähnlich. Wenn man die Zeit hätte und die Gewißheit, daß etwas dabei herauskommt, wäre es interessant, einmal unsere gemeinsamen Vorfahren zurückzuverfolgen, um die Wurzeln dieser zwanghaften Unabhängigkeit aufzudecken. Heute weiß ich, daß sie mit ein Grund war, warum meine Ehe gescheitert ist. Und wahrscheinlich ist sie auch der Grund dafür, daß Xan nie geheiratet hat. Es bedürfte schon einer Macht, die stärker wäre als geschlechtliche Liebe, um den Schutzwall vor diesem wehrhaften Herzen und Verstand zu durchbrechen.
Seine Eltern sahen wir in diesen langen Sommerwochen nur selten. Wie die meisten jungen Leute schliefen wir morgens lange, und wenn wir herunterkamen, hatten sie schon gefrühstückt. Für mittags stellte man uns in der Küche ein Picknick zusammen: eine Thermoskanne hausgemachter Suppe, Brot, Käse, Pastete und zum Nachtisch selbstgebackenen Obstkuchen. Die Köchin, die das für uns herrichtete, war eine ewig jammernde Person, die die Ungereimtheit fertigbrachte, sich über das bißchen Mehrarbeit zu beschweren, das wir verursachten, und gleichzeitig zu beklagen, daß es nicht genug vornehme Dinnerpartys auf Woolcombe gab, bei denen sie ihr Talent hätte entfalten können. Abends kamen wir rechtzeitig zurück, um uns zum Essen umzuziehen. Mein Onkel und meine Tante hatten nie Gäste, jedenfalls nicht, wenn ich dort war, und das Tischgespräch bestritten sie fast ausschließlich allein. Xan und ich langten unterdessen zu und wechselten hin und wieder verstohlen einen kritischen Blick. Die sprunghafte Unterhaltung zwischen Onkel und Tante drehte sich regelmäßig um Pläne für uns und wurde geführt, als ob wir gar nicht da wären.
Meine Tante, während sie vornehm einen Pfirsich schälte und ohne den Blick zu heben: »Vielleicht würden die Jungs sich gern mal Maiden Castle anschauen.«
»Gibt nicht viel zu sehen auf Maiden Castle. Jack Manning könnte sie in seinem Boot mit rausnehmen, wenn er die Hummer einholt.«
»Ich glaube, vor diesem Manning sollte man sich in acht nehmen. Morgen ist in Poole ein Konzert. Vielleicht würden sie da gern hingehen.«
»Was denn für ein Konzert?«
»Ich weiß nicht mehr. Das Programm habe ich doch dir gegeben.«
»Vielleicht würden sie gern mal für einen Tag nach London fahren.«
»Aber doch nicht bei diesem herrlichen Wetter. Da sind sie an der frischen Luft viel besser aufgehoben.«
Als Xan siebzehn wurde und den Wagen seines Vaters benutzen durfte, fuhren wir hinunter nach Poole, Mädchen aufreißen. Ich fand diese Streifzüge schrecklich und machte nur zweimal mit. Es war, als beträte man eine andere Welt; das Gekichere, die Mädchen, die paarweise auf Männerfang gingen, die frechen, herausfordernden Blicke, die anscheinend belanglose, aber obligatorische Plauderei. Nach dem zweiten Mal sagte ich: »Wir spielen ihnen keine Gefühle vor. Wir mögen sie nicht mal; und sie uns erst recht nicht. Wenn also beide Parteien bloß auf Sex aus sind, warum sagen wir's dann nicht freiheraus und sparen uns all dieses peinliche Drumherum?«
»Oh, sie brauchen das anscheinend. Und die einzigen Frauen, die du so direkt angehen kannst, verlangen Barzahlung im voraus. In Poole kommen wir mit einer Kinokarte und zwei Stunden Kneipenhocken zum Zuge.«
»Ich glaub', ich fahre nicht mehr mit.«
»Wahrscheinlich hast du recht. Ich hab' am nächsten Morgen meistens auch das Gefühl, daß es nicht der Mühe wert war.« Es war typisch für ihn, daß er, obwohl er mich bestimmt durchschaut hatte, mein Sträuben nicht als Mischung von Verlegenheit, Versagensängsten und Scham entlarvte. Ich konnte Xan kaum dafür verantwortlich machen, daß ich meine Unschuld unter hochnotpeinlichen Bedingungen auf einem Pooler Parkplatz an eine Rothaarige verlor, die sowohl während meines tapsigen Vorspiels als auch danach kein Hehl daraus machte, daß sie den Samstagabend schon mal amüsanter verbracht hatte. Und ich kann auch nicht behaupten, daß dieses Erlebnis sich negativ auf mein Sexualleben ausgewirkt hat. Du meine Güte, wenn unser Sexualleben von den ersten Jugendexperimenten abhinge, dann würden wir uns bald alle zum Zölibat bekehren. Erfahrungsgemäß sind aber die Menschen auf keinem Sektor mehr davon überzeugt, daß noch was Besseres kommt, wenn sie nur am Ball bleiben.
Abgesehen von der Köchin besinne ich mich nur auf wenige Dienstboten in Woolcombe. Sie hatten einen Gärtner, Hobhouse, mit einer krankhaften Abneigung gegen Rosen, besonders wenn sie mit anderen Blumen zusammengepflanzt waren. Die überwuchern alles, grummelte er, als ob die Strauch- und Kletterpflanzen, die er ebenso widerstrebend wie geschickt beschnitt, sich auf geheimnisvolle Weise von selbst vermehrten. Und dann war da noch Scovell mit seinem hübschen, naseweisen Gesicht. Ich bin nie dahintergekommen, als was genau er eingestellt war: Chauffeur, Gärtnerbursche, Faktotum? Xan behandelte ihn entweder wie Luft oder kränkte ihn vorsätzlich. Da ich nie erlebt hatte, daß er einen anderen Dienstboten schlecht behandelte, hätte ich ihn gern gefragt, was er ausgerechnet gegen Scovell hatte, wenn ich nicht, wie immer wachen Sinns für die kleinsten Gefühlsschwankungen meines Vetters, gespürt hätte, daß die Frage besser unterblieb.
Ich nahm es nicht übel, daß Xan der Liebling unserer Großeltern war. Ich fand es sogar ganz natürlich, daß sie ihn bevorzugten. Ich erinnere mich an ein paar Gesprächsfetzen, die ich bei dem einen Weihnachtsfest aufschnappte, das wir unglücklicherweise alle zusammen auf Woolcombe verbrachten. »Ich frage mich manchmal, ob Theo es am Ende nicht weiterbringen wird als Xan.«
»O nein! Theo ist ein gutaussehender, intelligenter Junge, gewiß, aber Xan ist brillant.«
Xan und ich teilten stillschweigend dieses Urteil. Als ich den Sprung nach Oxford schaffte, freute sich die Familie, aber man war überrascht. Als Xan in Balliol aufgenommen wurde, fanden alle das nur recht und billig. Als ich mein Examen mit Auszeichnung bestand, hieß es, ich hätte Glück gehabt. Als Xan bloß mit Gut abschnitt, wurde moniert – aber durchaus nachsichtig –, er habe es eben an Fleiß fehlen lassen.
Xan verlangte nichts von mir, behandelte mich nie wie einen armen Verwandten, den man alljährlich für seine Gesellschaft oder Unterwürfigkeit mit Essen, Trinken und Gratisferien entschädigt. Wenn ich allein sein wollte, dann akzeptierte er das wortlos und ohne zu murren. Ich zog mich dann meistens in die Bibliothek zurück, die ich hinreißend fand mit ihren Regalwänden voll ledergebundener Bücher, den Pilastern und geschnitzten Kapitellen, dem wuchtigen gemauerten Kamin, auf dem das Familienwappen eingemeißelt war, den Marmorbüsten in den Nischen, dem riesigen Kartentisch, auf dem ich meine Bücher und Ferienaufgaben ausbreiten konnte, den tiefen Ledersesseln und hohen Fenstern mit Blick über den Rasen bis hinunter zum Fluß und der Brücke. Hier war es auch, wo ich beim Blättern in den Chroniken des Countys entdeckte, daß im Bürgerkrieg eben diese Brücke Schauplatz eines Gefechts gewesen war, in dem fünf junge Royalisten den Flußübergang bis zum letzten Mann gegen die Roundheads verteidigt hatten. Sogar ihre Namen waren verzeichnet, ein Zeugnis romantischen Heldenmuts: Ormerod, Freemantle, Cole, Bydder, Fairfax.
Ich lief in heller Aufregung zu Xan und schleppte ihn in die Bibliothek. »Sieh nur, der Kampf jährt sich nächsten Mittwoch, am 16. August. Das sollten wir feiern.«
»Und wie? Willst du vielleicht Blumen ins Wasser streuen?«
Aber er sagte das weder geringschätzig noch verächtlich und amüsierte sich nur ein kleines bißchen über meine Begeisterung.
»Wie wär's, wenn wir einfach auf sie trinken? Einen Toast ausbringen?«
Wir taten beides. Bei Sonnenuntergang gingen wir mit einer Flasche Bordeaux seines Vaters und den beiden Pistolen zur Brücke. Ich hatte außerdem noch einen Armvoll Blumen aus dem ummauerten Garten dabei. Gemeinsam leerten wir die Flasche, und dann balancierte Xan auf dem Brückengeländer und feuerte beide Pistolen ab, wozu ich die Namen der Gefallenen ausrief. Das ist ein Augenblick aus meiner Kindheit, der mir geblieben ist, ein Abend ungetrübter, reiner Freude, weder von Schuld noch von Überdruß oder Reue geschmälert und für mich verewigt im Bild Xans, der mit flammendrotem Haar vor der untergehenden Sonne balanciert, im Bild der zarten Rosenblätter, die unter der Brücke flußabwärts treiben, bis sie unseren Blicken entschwinden.
3. Kapitel
Montag, 18. Januar 2021
Ich erinnere mich noch an meine ersten Ferien auf Woolcombe. Ich folgte Xan über eine zweite Treppe am Ende des Korridors in ein Zimmer im obersten Stock mit Blick über die Terrasse und den Park bis hinunter zum Fluß und der Brücke. Pikiert und angesteckt vom Groll meiner Mutter fragte ich mich schon, ob man mich in den Dienstbotentrakt abschieben wolle.
Da sagte Xan: »Mein Zimmer ist gleich daneben. Wir haben unser eigenes Bad, hinten am Ende des Flurs.«
Ich sehe dieses Zimmer noch in allen Einzelheiten vor mir. Während meiner ganzen Schulzeit, und bis ich Oxford verließ, bekam ich es jeden Sommer wieder. Ich veränderte mich, aber der Raum blieb immer gleich, und im Geiste sehe ich eine ganze Phalanx von Schuljungen und Studenten, deren jeder eine geradezu unheimliche Ähnlichkeit mit mir hat, Sommer für Sommer diese Tür öffnen und sein rechtmäßiges Erbe antreten. Seit dem Tod meiner Mutter vor acht Jahren bin ich nicht mehr auf Woolcombe gewesen, und jetzt werde ich wohl nie mehr hinfahren. Trotzdem habe ich manchmal die Vision, daß ich als alter Mann nach Woolcombe zurückkehre und in diesem Zimmer sterbe; ich sehe mich die Tür zum letztenmal aufstoßen, sehe wieder das Himmelbett mit den geschnitzten Bettpfosten, die Patchwork-Tagesdecke aus verschossener Seide; den Wiener Schaukelstuhl mit dem Kissen, das eine längst verstorbene Lady Lyppiatt bestickt hat; die Patina des georgianischen Schreibtisches, der schon ein bißchen abgenutzt, aber stabil, solide und praktisch ist; das Bücherbord mit Knabenbüchern des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts: Henty, Fenimore Cooper, Rider Haggard, Conan Doyle, Sapper, John Buchan; die bauchige Kommode mit dem Spiegel voller Fliegendreck darüber; und die alten Stiche, Schlachtenszenen mit verängstigten Pferden, die vor den Kanonen scheuen, wild augenrollenden Kavallerieoffizieren, dem sterbenden Nelson. Am deutlichsten aber erinnere ich mich an den Tag, an dem ich zum erstenmal in dieses Zimmer kam und, ans Fenster tretend, hinuntersah auf die Terrasse, die schräg abfallenden Rasenflächen, die Eichen, den schimmernden Flußlauf und die kleine, buckelige Brücke.
Xan stand in der Tür. Er sagte: »Wenn du Lust hast, können wir morgen einen Ausflug machen, mit dem Rad. Der Bart hat dir ein Fahrrad gekauft.«
Ich sollte noch lernen, daß er von seinem Vater selten anders sprach als so, qua Abkürzung seines Titels. Ich sagte: »Das ist sehr nett von ihm.«
»So nett auch wieder nicht. Er hatte schließlich keine andere Wahl, wenn er will, daß wir zusammen was unternehmen.«
»Ich habe selbst ein Fahrrad. Ich radle immer zur Schule damit. Das hätte ich ja mitbringen können.«
»Der Bart meinte, es sei weniger umständlich, gleich eines hier zu deponieren. Ich mache mich tagsüber gern dünn, aber du brauchst nicht mitzukommen, wenn du keine Lust hast. Radeln ist nicht obligatorisch. Nichts ist obligatorisch auf Woolcombe, außer Unglücklichsein.«
Mit der Zeit kam ich dahinter, daß er sich in solch hämischen, altklugen Bemerkungen gefiel. Er wollte mir damit imponieren und tat es auch. Trotzdem glaubte ich ihm nicht.
In der naiven Verzauberung jenes ersten Aufenthalts war es mir unvorstellbar, daß jemand in einem solchen Haus unglücklich sein könnte. Und sich selbst hatte er doch bestimmt nicht gemeint.
Ich sagte: »Ich würde mir gern irgendwann mal das Haus ansehen« und wurde rot, aus Angst, ich hätte mich angehört wie ein potentieller Käufer oder wie ein Tourist.
»Sicher, das läßt sich einrichten. Falls du bis Samstag warten kannst, da macht Miss Maskell vom Pfarrhaus die Führung. Es kostet dich ein Pfund, aber dafür ist auch der Park dabei. Der ist jeden zweiten Samstag zugunsten des Kirchenfonds für Publikum geöffnet. Was Molly Maskell an historischem und kunstgeschichtlichem Wissen fehlt, das macht sie mit Phantasie wett.«
»Ich fände es schöner, wenn du mich herumführst.«
Ohne darauf zu antworten, sah er zu, wie ich meinen Koffer aufs Bett wuchtete und anfing auszupacken. Für diesen ersten Besuch hatte meine Mutter mir einen neuen Koffer gekauft. Ich schämte mich, weil ich spürte, daß er zu groß, zu modisch und zu schwer war, und wünschte mir, ich wäre mit meiner alten Segeltuchreisetasche gekommen. Natürlich hatte ich zuviel zum Anziehen eingepackt und obendrein noch die falschen Sachen, aber er sagte nichts dazu; ich weiß nicht, ob das Feingefühl war oder Takt oder ob es ihm einfach nicht auffiel. Während ich mein Unterzeug hastig in eine der Schubladen stopfte, fragte ich: »Ist es nicht merkwürdig, hier zu wohnen?«
»Es ist unbequem und manchmal langweilig, aber merkwürdig – nein. Meine Vorfahren haben seit dreihundert Jahren hier gelebt.« Und er fügte hinzu: »Eigentlich ist es ein ziemlich kleines Haus.«
Es hörte sich an, als setze er sein Erbe herab, um mir die Befangenheit zu nehmen, aber als ich ihn anschaute, sah ich zum erstenmal jenen Ausdruck, der mir noch vertraut werden sollte, eine stille innere Erheiterung, die Augen und Mund zwar erreichte, aber nie ein offenes Lächeln hergab. Damals wußte ich genausowenig wie heute, wieviel ihm wirklich an Woolcombe lag. Es dient noch immer als Sanatorium und Seniorenheim für die oberen Zehntausend – Verwandte und Freunde der Staatsrats, Mitglieder der Landes-, Bezirks- und Kommunalräte, Leute, die sich angeblich um das Wohl des Staates verdient gemacht haben. Bis meine Mutter starb, absolvierten Helena und ich regelmäßig unsere Pflichtbesuche. Ich sehe sie noch vor mir, die beiden Schwestern, wie sie beisammen auf der Terrasse saßen, warm eingemummt gegen die Zugluft, die eine unheilbar krebskrank, die andere mit Herzasthma und Arthritis geschlagen, Neid und Mißgunst zwischen ihnen vergessen im Angesicht des großen Gleichmachers Tod. Wenn ich mir die Welt ohne einen einzigen lebenden Menschen denke, dann kann ich mir die großen Kathedralen und Tempel vorstellen – wer könnte das nicht? –, die Paläste und Schlösser, die durch unbelebte Jahrhunderte fortbestehen, die British Library, die erst kurz vor Omega eröffnet wurde, mit ihren sorgsam archivierten Manuskripten und Büchern, die niemals mehr jemand aufschlagen oder lesen wird. Aber was mir zu Herzen geht, ist einzig der Gedanke an Woolcombe; ich sehe seine muffigen, verlassenen Räume, die moderne Täfelung in der Bibliothek, den Efeu, der sich über die bröckelnden Mauern rankt, die Gras- und Unkrautwildnis, die Kieswege, Tennisplatz und Ziergarten verschlingt. Das geht mir zu Herzen, ja, das und die Erinnerung an jenes kleine Hinterzimmer, verwaist und unverändert, bis endlich die Tagesdecke ganz vermodert ist, die Bücher zu Staub zerfallen und das letzte Bild von der Wand rutscht.
4. Kapitel
Donnerstag, 21. Januar 2021
Meine Mutter hatte künstlerische Ambitionen. Nein, das klingt überheblich und ist nicht einmal wahr. Eigentlich hatte sie überhaupt keine Ambitionen, außer daß sie brennend gern gesellschaftsfähig gewesen wäre. Aber sie besaß ein gewisses künstlerisches Talent, auch wenn ich sie nie ein eigenes Bild habe malen sehen. Ihr Hobby war es, alte Stiche zu kolorieren, meist viktorianische Szenen aus schadhaften Zeitschriftenbänden wie Girls Own Paper oder Illustrated London News. Ich glaube nicht, daß es sehr schwierig war, aber sie bewies doch einiges Geschick dabei und bemühte sich, wie sie mir erklärte, den historisch richtigen Farbton zu treffen, auch wenn ich nicht weiß, wie sie das beurteilen konnte. Mir scheint, sie kam dem Glück am nächsten, wenn sie mit ihrem Malkasten und zwei Marmeladengläsern am Küchentisch saß, die verstellbare Lampe direkt auf den vor ihr auf einer Zeitung liegenden Stich gerichtet. Ich beobachtete sie gern, wenn sie so in ihre Arbeit vertieft war, behutsam den dünneren Pinsel ins Wasser tauchte und die Farben auf ihrer Palette anrührte, bis Blau-, Gelb- und Weißgrundierungen ineinanderflossen. Der Küchentisch war ziemlich groß, und wenn auch nicht all meine Hausaufgabenhefte darauf Platz hatten, so reichte es doch, um meinen wöchentlichen Aufsatz zu schreiben oder zu lesen. Zwischendurch riskierte ich gern einen Blick, der mir auch nicht verübelt wurde, und sah zu, wie die leuchtenden Farben sich langsam über den Stich verteilten und die trübgrauen, winzigen Pünktchen sich in eine lebendige Szenerie verwandelten; eine belebte Bahnstation, auf der Frauen mit bestickten Hauben auf dem Kopf von ihren Liebsten Abschied nehmen, die in den Krimkriegziehen; eine viktorianische Familie, die Frauen mit Pelzen und Turnüren, beim weihnachtlichen Ausschmücken der Kirche; Queen Victoria, begleitet von ihrem Gemahl und umringt von Kindern in Reifröcken, bei der Eröffnung der ersten Weltausstellung; Ruderpartien auf der Isis mit längst ausrangierten College-Booten im Hintergrund und davor schnurrbärtige Männer in Clubjacken und vollbusige Mädchen mit Wespentaille in Miederjäckchen und Strohhut; Dorfkirchen mit einer weit auseinandergezogenen Prozession von Gläubigen, allen voran der Squire und seine Lady, wie sie zur Ostermesse schreiten, und im Hintergrund die Gräber, festlich mit Frühlingsblumen geschmückt. Vielleicht hat meine kindliche Freude an diesen Genrebildern mich bewogen, mein Interesse als Historiker dem neunzehnten Jahrhundert zu widmen, einer Epoche, die mich heute, nicht minder als seinerzeit im Studium, anmutet wie eine Welt durchs Teleskop betrachtet, also ganz nah und doch unendlich fern, faszinierend mit ihrer Energie, ihrem moralischen Ernst, ihrem sprühenden Geist und ihrer Verworfenheit.
Das Hobby meiner Mutter war durchaus einträglich. Zusammen mit Mr. Greenstreet, dem Küster der Ortskirche, die sie gemeinsam regelmäßig besuchten, während ich nur widerstrebend mitging, rahmte sie die fertigen Bilder und verkaufte sie an Antiquitätengeschäfte. Ich werde nun nie mehr erfahren, welche Rolle Mr. Greenstreet im Leben meiner Mutter spielte, abgesehen von seinem Geschick im Umgang mit Holz und Leim, oder welche Rolle er gespielt haben könnte, wäre ich nicht dauernd dazwischengekommen; und ich kann auch nicht mehr feststellen, wieviel meine Mutter für die Bilder bekam und ob, wie ich jetzt annehme, diese Nebeneinkünfte meine Schulausflüge finanzierten, die Kricketschläger und die zusätzlichen Bücher, um die ich nie zu feilschen brauchte. Ich steuerte allerdings auch mein Teil bei; ich war es nämlich, der die Stiche aufspürte. Auf dem Heimweg von der Schule oder an unterrichtsfreien Samstagen durchstöberte ich die Kisten in den Trödelläden von Kingston und noch weiter draußen, ja radelte manchmal zwanzig, fünfundzwanzig Kilometer bis zu einem Laden mit den besten Beutestücken. Die meisten waren spottbillig, und ich kaufte sie von meinem Taschengeld. Die besten klaute ich. Ich erwarb mir großes Geschick darin, schonend die Mittelseiten aus gebundenen Büchern herauszutrennen oder einen Stich aus dem Passepartout zu entfernen und in meinem Schulatlas zu verstecken. Ich brauchte diese Akte mutwilliger Zerstörung, so wie wahrscheinlich die meisten Jungs ihre kleinen Straftaten brauchen. Ich wurde nie verdächtigt, ich, der uniformierte, höfliche Gymnasiast, der seine unbedeutenderen Funde zur Kasse trug und ohne Hast oder spürbare Beklemmung dafür zahlte, und der gelegentlich auch billigere Secondhandbücher aus den Kisten mit den vermischten Schriften draußen vor der Ladentür kaufte. Ich hatte Spaß an diesen einsamen Ausflügen, dem Nervenkitzel, der Erregung, wenn ich einen Schatz entdeckte, der triumphalen Heimkehr mit meiner Beute. Meine Mutter sagte nicht viel dazu, fragte nur, wieviel ich ausgegeben hätte, und erstattete mir die Kosten. Falls sie argwöhnte, daß einige der Stiche mehr wert waren, als ich vorgab, dafür bezahlt zu haben, nahm sie mich doch nie ins Verhör, aber ich wußte, daß sie sich freute. Ich liebte sie nicht, aber ich stahl für sie. Früh schon lernte ich dort an diesem Küchentisch, daß es Mittel und Wege gibt, sich ohne Schuldgefühle den Banden der Liebe zu entziehen.
Ich weiß, oder glaube zu wissen, wann meine schreckliche Angst davor, Verantwortung für Glück oder Leben anderer Menschen zu übernehmen, einsetzte, auch wenn ich mich da vielleicht täusche. Ich habe mich immer schon meisterhaft darauf verstanden, Entschuldigungen für meine Charakterfehler zu erfinden. Jedenfalls folge ich den Wurzeln gern bis ins Jahr 1983, das Jahr, in dem mein Vater seinen Kampf gegen den Magenkrebs verlor. So jedenfalls hörte ich es, wenn ich die Gespräche der Erwachsenen belauschte. »Er hat seinen Kampf verloren«, sagten sie. Und heute begreife ich, daß es ein Kampf war und daß er ihn mit einigem Mut führte, auch wenn ihm kaum eine andere Wahl blieb. Meine Eltern bemühten sich, das Schlimmste von mir fernzuhalten. »Wir versuchen den Jungen zu schonen«, lautete ein anderer oft aufgeschnappter Satz. Aber den Jungen zu schonen bedeutete, mir nichts weiter zu sagen, als daß mein Vater krank sei, einen Spezialisten konsultieren müsse, ins Krankenhaus käme, um sich operieren zu lassen, bald wieder daheim sein würde, zurück ins Krankenhaus müsse. Manchmal sagte man mir nicht einmal das; dann kam ich aus der Schule heim, er war nicht mehr da, und meine Mutter hielt fieberhaft und mit versteinertem Gesicht Hausputz. Den Jungen schonen hieß, daß ich ohne Geschwister in einer Atmosphäre unverstandener Bedrohung lebte, in der wir drei unerbittlich auf eine unvorstellbare Katastrophe zutrieben, eine Katastrophe, an der, wenn sie eintrat, ich schuld sein würde. Kinder sind immer bereit zu glauben, sie trügen die Schuld am Unglück der Erwachsenen. Meine Mutter sprach mir gegenüber das Wort »Krebs« nie aus, erwähnte Vaters Krankheit immer nur indirekt, beschönigend. »Dein Vater ist heute morgen ein bißchen müde.« – »Dein Vater muß heute wieder ins Krankenhaus.« – »Hol deine Schulbücher aus dem Wohnzimmer und geh' nach oben, bevor der Doktor kommt. Er will sicher noch mit mir reden.« Sie sprach in solchen Fällen mit abgewandtem Blick, als sei die Krankheit etwas Peinliches, ja Unanständiges, und damit nicht geeignet als Gesprächsthema für ein Kind. Oder hatte diese Verlegenheit einen tieferen Grund, war das geteilte Leid so sehr Bestandteil ihrer Ehe geworden, daß sie mich davon mit Recht ebenso fernhielten wie aus ihrem Schlafzimmer? Heute frage ich mich, ob hinter dem Schweigen meines Vaters, das ich damals als Ablehnung verstand, wirklich Absicht lag. Waren es am Ende nicht so sehr Krankheit, Erschöpfung und langsam versiegende Hoffnung, was uns entfremdete, als vielmehr sein Wunsch, den Trennungsschmerz nicht noch zu vergrößern? Aber gar so sehr kann er mich nicht gemocht haben. Ich war kein Kind, das man ohne weiteres liebgewann. Und wie hätten wir uns verständigen sollen? Die Welt der unheilbar Kranken ist weder die der Lebenden noch die der Toten. Ich habe nach meinem Vater noch andere Todgeweihte beobachtet und immer gespürt, daß etwas Fremdes von ihnen ausging. Sie sitzen da und reden und werden angesprochen und hören zu und lächeln sogar, aber innerlich sind sie schon von uns abgerückt, und wir haben nun einmal keinen Zutritt zu ihrem schattenhaften Niemandsland.