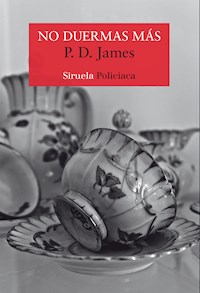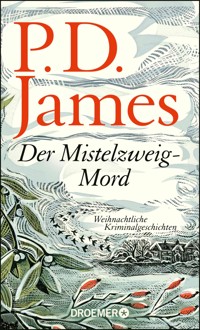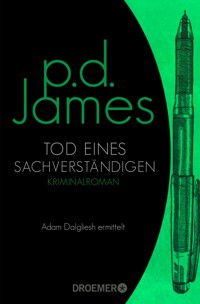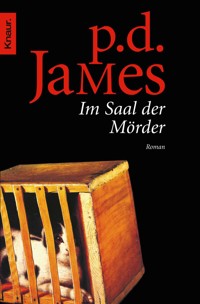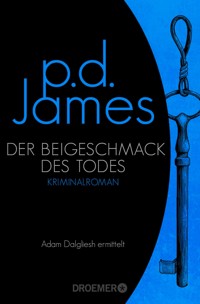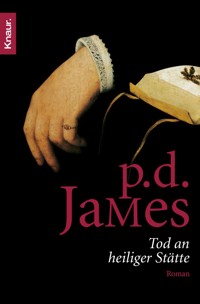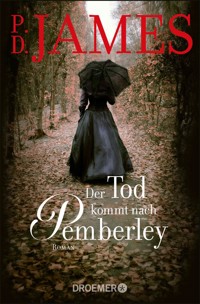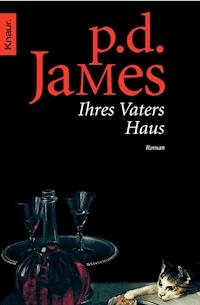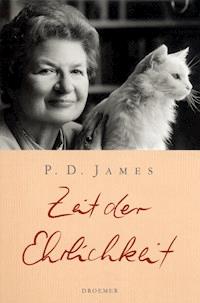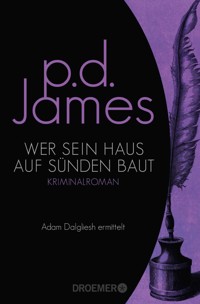
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dalgliesh-Romane
- Sprache: Deutsch
Fall 9 für Commander Adam Dalgliesh - einer der erfolgreichsten Romane von P. D. James. Und ein Leckerbissen für alle, die hinter die Kulissen eines Verlags schauen wollen Peverell Press ist ein angesehenes Londoner Verlagshaus. Doch seit kurzem stehen die Geschicke des Unternehmens unter einem schlechten Stern; jemand versucht dem Verlag zu schaden. Als der Verleger ermordet wird, ist die Zahl der Verdächtigen groß, denn Gerard Etienne hat sich mit seiner drastischen Verlagspolitik viele Feinde gemacht. Scotland Yards Mordspezialist Commander Adam Dalgliesh steht einem überaus komplexen Mordfall gegenüber ... »Eine klassische P. D. James: reichhaltig, köstlich und befriedigend.« Evening Standard Die vierzehn Kriminal-Romane mit Commander Adam Dalgliesh sind in folgender Reihenfolge erschienen: 1. Ein Spiel zuviel 2. Eine Seele von Mörder 3. Ein unverhofftes Geständnis 4. Tod im weißen Häubchen 5. Der schwarze Turm 6. Tod eines Sachverständigen 7. Der Beigeschmack des Todes 8. Vorsatz und Begierde 9. Wer sein Haus auf Sünden baut 10. Was gut und böse ist 11. Tod an heiliger Stätte 12. Im Saal der Mörder 13. Wo Licht und Schatten ist 14. Ein makelloser Tod
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 891
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
P. D. James
Wer sein Haus auf Sünden baut
Übersetzt von Christa Seibicke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Anmerkung der Verfasserin
Erstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Zweites Buch
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Drittes Buch
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Viertes Buch
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
Fünftes Buch
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
Anmerkungder Verfasserin
Der vorliegende Roman spielt an der Themse, und Freunden dieses Flusses werden viele der hier dargestellten Schauplätze in und um London bekannt sein. Das Verlagshaus Peverell Press sowie alle Figuren des Buches existieren dagegen nur in der Phantasie der Autorin und haben keinerlei Bezug zu Orten oder Personen des wirklichen Lebens.
Erstes Buch
Vorspruch zum Mord
1
Dass eine Aushilfsstenotypistin eine neue Stelle antritt und dort gleich am ersten Tag Zeuge eines Leichenfundes wird, ist, wenn schon nicht einmalig, dann zumindest ungewöhnlich genug, um nicht mehr als Berufsrisiko durchzugehen. Fest steht, dass Mandy Price, mit neunzehn Jahren und zwei Monaten bereits anerkannter Star in Mrs. Crealeys Agentur »Nonplusultra«, am Morgen des 14. September, einem Dienstag, auf der Fahrt zum Vorstellungsgespräch beim Verlagshaus Peverell Press nicht mehr Herzklopfen verspürte als vor jedem anderen Job, ein Herzklopfen, das nie arg war und auch weniger der Sorge entsprang, sie könne die Erwartungen des künftigen Arbeitgebers nicht erfüllen, als vielmehr umgekehrt er nicht die ihren. Von der neuen Stelle hatte sie erfahren, als sie letzten Freitag gegen sechs in der Agentur vorbeischaute, um den Lohn für zwei Wochen stumpfsinniger Plackerei bei einem Direktor zu kassieren, der sich eine Sekretärin als Statu‘ssymbol hielt, ohne dass er ihre Fähigkeiten sinnvoll zu nutzen verstand. Umso mehr freute sie sich jetzt auf einen neuen, möglichst aufregenden Job, wenn auch vielleicht nicht gar so aufregend, wie er sich dann entpuppen sollte.
Mrs. Crealeys Agentur, für die Mandy schon seit drei Jahren arbeitete, war eigentlich bloß eine bescheidene Zwei-Zimmer-Wohnung über einem Zeitungs- und Tabakladen gleich hinter der Whitechapel Road – in günstiger Lage, wie sie ihren Mädchen und auch den Kunden gegenüber gern betonte, sowohl für die City als auch für die Bürotürme in den Docklands. Zwar hatte diese Nachbarschaft sich geschäftlich bisher noch in keiner Richtung ausgezahlt, aber während andere Agenturen im Strudel der Rezession untergingen, konnte Mrs. Crealeys kleines, unzulängliches Schiffchen sich immerhin, wenn auch schwankend, über Wasser halten. Wenn nicht gerade eins der Mädchen frei war und ihr zur Hand ging, führte sie die Agentur ganz allein. Das vordere Zimmer war ihr Büro, in dem sie unzufriedene Kunden beschwichtigte, Vorstellungsgespräche mit Neuzugängen führte und allwöchentlich den Einsatzplan zusammenstellte. Hinter dem Büro lag ihr privates Refugium, ausgestattet mit einem Schlafsofa, auf dem sie hin und wieder übernachtete, obwohl das gegen den Mietvertrag verstieß, ferner mit einer kleinen Bar, einem Kühlschrank, einer winzigen, verblendeten Einbauküche, einem großen Fernsehapparat und zwei Clubsesseln vor einem Gasofen, in dem hinter künstlichen Holzscheiten ein grellrotes Licht flackerte. Mrs. Crealey nannte diesen Raum ihre »Oase«, und Mandy gehörte zu den ganz wenigen unter ihren Mädchen, die dieses Allerheiligste betreten durften.
Vermutlich war es die Oase, die Mandy bei der Stange hielt, auch wenn sie sich nie und nimmer zu so einem Bedürfnis nach Nestwärme bekannt hätte, das einem Mädchen wie ihr kindisch und albern vorkommen musste. Ihre Mutter hatte die Familie verlassen, als Mandy sechs Jahre alt war, und sie selbst hatte mit Ungeduld ihren sechzehnten Geburtstag herbeigesehnt, an dem sie sich endlich von einem Vater trennen konnte, der unter elterlicher Fürsorge kaum mehr verstand als die Beschaffung zweier Mahlzeiten pro Tag (die sie kochen musste) und ihrer Kleidung. Vor einem Jahr hatte sie ein Zimmer in einem Reihenhaus in Stratford East gemietet, wo sie seitdem in ruppiger Kameraderie mit einer Freundin und einem Pärchen lebte; Hauptstreitpunkt war Mandys stures Beharren darauf, ihre Yamaha in dem engen Hausflur abzustellen. Aber für Mandy war die Oase hinter der Whitechapel Road, wo es nach Wein und chinesischem Essen vom Home-Service roch, wo der Gasofen zischte und wo sie sich in einem der beiden tiefen, zerschlissenen Sessel zusammenkuscheln und ein Nickerchen halten konnte, der Inbegriff dessen, was sie unter Geborgenheit und einem gemütlichen Zuhause verstand.
Die Sherryflasche in der linken und einen Notizzettel in der rechten Hand, kaute Mrs. Crealey so lange an ihrer Zigarettenspitze herum, bis die ihr in den Mundwinkel gerutscht war und dort, wie gewöhnlich dem Gesetz der Schwerkraft trotzend, kleben blieb. Mit zusammengekniffenen Augen überflog die Chefin ihre fast unleserliche Schrift.
»Wir haben einen neuen Kunden, Mandy, Peverell Press. Ich hab im Verlagsverzeichnis nachgeschlagen. Er ist einer der ältesten, vielleicht sogar der älteste Verlag von ganz England, Gründungsjahr 1792. Liegt direkt an der Themse: Peverell Press, Innocent House, am Innocent Walk in Wapping. Falls du schon mal mit dem Ausflugsdampfer in Greenwich warst, hast du Innocent House bestimmt gesehen – der reinste venezianische Protzpalast. Nobler Laden: Die Angestellten werden mit dem verlagseigenen Motorboot vom Charing Cross Pier abgeholt, aber da du in Stratford wohnst, bringt dir das nicht viel. Dafür liegt die Peverell Press an deinem Themseufer, immerhin etwas. Nimm dir am besten ein Taxi, aber vergiss nicht, dir die Fahrt erstatten zu lassen, bevor du gehst.«
»Ach, das ist nicht nötig, ich fahr mit dem Motorrad.«
»Wie du willst. Dienstagmorgen um zehn sollst du dort sein.«
Mrs. Crealey wollte eigentlich noch sagen, dass bei einem Kunden von diesem Prestigewert vielleicht eine eher dezente Kleidung angebracht sei, aber das verkniff sie sich dann doch vorsichtshalber. So weit es die Arbeit und das Verhalten den Kunden gegenüber betraf, ließ sich Mandy durchaus etwas sagen, aber bei den exzentrischen, ja bisweilen bizarren Modeschöpfungen, mit denen sie ihrem Selbstbewusstsein und ihrem überschäumenden Temperament Ausdruck verlieh, durfte man ihr nicht dreinreden.
»Wieso erst Dienstag?«, fragte sie jetzt. »Arbeiten die denn montags nicht?«
»Keine Ahnung. Das Mädchen, das hier angerufen hat, sagte jedenfalls Dienstag. Vielleicht hat Miss Etienne vorher keine Zeit. Sie gehört zur Geschäftsleitung und möchte das Einstellungsgespräch gern persönlich führen. Miss Claudia Etienne. Hier, ich hab dir alles aufgeschrieben.«
Mandy fragte: »Wozu das ganze Brimborium? Wieso muss ich mich bei der Chefin persönlich vorstellen?«
»Miss Etienne ist nicht die Chefin, sondern nur ein Mitglied der Geschäftsleitung. Diese Verlagsfritzen wollen eben nicht einfach eine x-beliebige Tippse. Jedenfalls haben sie meine beste Kraft verlangt, und die sollen sie kriegen. Natürlich könnte es auch sein, dass sie eine feste Anstellung zu vergeben haben und die Betreffende erst mal testen wollen. Du wirst dich doch nicht überreden lassen zu bleiben, oder, Mandy?«
»Hab ich mich schon mal von wem ködern lassen?«
Mandy bekam ein Glas süßen Sherry in die Hand gedrückt, kuschelte sich in einen Sessel und studierte Mrs. Crealeys Notizen. Dass ein potenzieller Arbeitgeber ein Vorstellungsgespräch mit einer Aushilfskraft wünschte, war selbst dann ungewöhnlich, wenn der Kunde, wie in diesem Fall, noch nie mit der Agentur zusammengearbeitet hatte. Das übliche Verfahren war allen Beteiligten wohlvertraut. Ein Chef in Nöten bat Mrs. Crealey telefonisch um eine Teilzeitkraft und flehte sie an, ihm diesmal ein Mädchen zu schicken, das des Lesens und Schreibens kundig sei und wenigstens annähernd so flink in Steno und Maschineschreiben, wie es die Agentur in ihrer Werbung garantierte. Mrs. Crealey versprach Wunder an Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein und Fleiß, schickte dasjenige ihrer Mädchen, das gerade verfügbar war und sich den Job aufschwatzen ließ, und hoffte im Übrigen darauf, dass die Erwartungen von Kunde und Arbeitskraft dieses eine Mal übereinstimmen würden. Spätere Reklamationen parierte sie mit der Standardklage: »Ich verstehe das einfach nicht. Andere Chefs haben ihr glänzende Zeugnisse ausgestellt. Sharon wird andauernd verlangt.«
Der Kunde, der glauben musste, selbst an dem Fiasko schuld zu sein, legte dann seufzend den Hörer auf und mahnte, ermunterte und litt fortan so lange, bis die beiderseitige Qual zu Ende war und die hauseigene Sekretärin sich bei ihrer Rückkehr aufs Schmeichelhafteste hofiert sah. Mrs. Crealey kassierte ihre Provision, die bescheidener war als bei den meisten anderen Agenturen, was vermutlich die Krisenfestigkeit ihres Geschäfts erklärte, und damit war der Fall erledigt, bis die nächste Grippewelle oder die großen Ferien dafür sorgten, dass abermals die Hoffnung über besseres Wissen triumphierte.
Jetzt sagte Mrs. Crealey: »Den Montag kannst du dir freinehmen, Mandy, natürlich als bezahlten Urlaubstag. Ach, und stell ein bisschen was zusammen über deinen Werdegang, Ausbildung und so. Schreib drüber ›Curriculum vitae‹, das macht sich gut und schindet Eindruck.«
Mandys Lebenslauf und Mandy selbst machten – trotz ihres exzentrischen Äußeren – eigentlich immer Eindruck. Und das verdankte sie ihrer Englischlehrerin, Mrs. Chilcroft. Diese Mrs. Chilcroft hatte sich damals vor ihrer Klasse elfjähriger Trotzköpfe aufgebaut und kategorisch erklärt: »Ihr werdet lernen, ein sauberes, korrektes und halbwegs stilgerechtes Englisch zu schreiben und es obendrein so zu sprechen, dass ihr nicht gleich untendurch seid, sowie ihr den Mund aufmacht. Diejenigen von euch, die im Leben mehr erreichen wollen, als mit sechzehn unter der Haube zu sein und dann in einer Sozialwohnung einen Haufen Kinder großzuziehen, sind darauf angewiesen, sich anständig ausdrücken zu können. Und wenn ihr keinen anderen Ehrgeiz habt, als euch später von einem Mann oder vom Staat ernähren zu lassen, dann seid ihr erst recht darauf angewiesen, schon allein, damit ihr euch bei der Fürsorge oder beim Gesundheits- und Sozialamt durchsetzen könnt. Aber lernen werdet ihr’s so oder so.«
Mandy wusste nie so recht, ob sie Mrs. Chilcroft nun hasste oder bewunderte, aber in deren sendungsbewusstem, wenn auch unorthodoxem Unterricht hatte sie gelernt, ihre Muttersprache in Wort und Schrift zu beherrschen und sich darin nicht nur klar, sondern auch einigermaßen gewandt und flüssig auszudrücken. Die meiste Zeit verheimlichte sie allerdings ihr Können. Sie fand nämlich, auch wenn sie diesen ketzerischen Gedanken nie aussprach, dass es wenig Sinn habe, in Mrs. Chilcrofts Welt heimisch zu sein, wenn sie es sich dadurch mit ihrer eigenen verscherzte. Ihre Sprach- und Stilkenntnisse, die sie je nach Bedarf zum Einsatz brachte, waren ein berufliches, mitunter auch gesellschaftliches Kapital, das Mandy noch dadurch mehrte, dass sie ungeheuer flink in Steno und Maschineschreiben war und sich mit verschiedenen Textverarbeitungssystemen auskannte. Sie wusste, dass sie mit ihren Qualifikationen jederzeit eine feste Anstellung hätte finden können, aber sie blieb Mrs. Crealey treu. Abgesehen von der Oase war es auch sehr vorteilhaft, in so einer Agentur als unentbehrlich zu gelten; zum Beispiel durfte man sich garantiert immer die besten Jobs rauspicken. Hin und wieder versuchte ein Chef, ihr eine Dauerstellung schmackhaft zu machen, wobei die Herren des Öfteren mit Anreizen lockten, die wenig mit jährlicher Gehaltserhöhung, Essensbons oder großzügigem Rentenzuschuss zu tun hatten. Aber Mandy blieb bei »Nonplusultra«, und ihre Treue wurzelte längst nicht nur in materiellem Kalkül. Manchmal empfand sie für ihre Chefin ein fast etwas frühreifes Mitleid. Mrs. Crealeys Probleme erwuchsen nämlich hauptsächlich aus dem Dilemma, dass sie einerseits von der Falschheit der Männer überzeugt war, andererseits aber nicht ohne sie auskommen konnte. Abgesehen von dieser unguten Dichotomie war ihr Leben beherrscht von dem Kampf darum, die wenigen vermittelbaren Mädchen bei der Stange zu halten, und von einem endlosen Zermürbungskrieg gegen ihren Ex-Mann, den Steuerprüfer, den Filialleiter ihrer Bank und ihren Vermieter. In all diesen traumatischen Kämpfen war Mandy ihr Bundesgenosse, ihre Vertraute und Trösterin. So weit es Mrs. Crealeys Liebesleben betraf, stand sie ihr freilich eher aus Gutmütigkeit als aus Verständnis bei, denn die Vorstellung, dass es ihrer Chefin tatsächlich Spaß machte, mit den alten – manche waren sicher mindestens fünfzig – und wenig attraktiven Männern ins Bett zu gehen, die gelegentlich im Büro herumhingen, war für Mandys neunzehnjährigen Verstand einfach zu grotesk, um ernsthaft in Betracht zu kommen.
Nachdem es eine Woche lang fast ununterbrochen geregnet hatte, versprach der Dienstag, schön zu werden; schon am frühen Morgen lugten vereinzelte Sonnenstrahlen durch die tiefhängenden Wolkenbänke. Es war keine lange Fahrt von Stratford East, aber Mandy hatte vorsichtshalber reichlich Zeit eingeplant, und so war es erst Viertel vor zehn, als sie von The Highway in die Garnet Street einbog und über Wapping Wall rechts ab in den Innocent Walk gelangte. Im Schritttempo holperte sie die breite, kopfsteingepflasterte Sackgasse entlang, die nach Norden hin von einer drei Meter hohen Ziegelmauer und im Süden von den drei Gebäuden des Verlagshauses Peverell Press begrenzt wurde.
Auf den ersten Blick war Mandy enttäuscht von Innocent House, einem stattlichen, aber wenig bemerkenswerten georgianischen Bau, dessen architektonische Anmut sie mehr vom Kopf als vom Gefühl her erkannte und der sich kaum von anderen Zeugnissen der gleichen Epoche unterschied, die sie schon in vornehmen Londoner Wohnvierteln gesehen hatte. Die Vordertür war verschlossen, auch hinter der vierstöckigen Fassade mit den achtfach unterteilten Fenstern, deren zwei untere Reihen mit eleganten, schmiedeeisernen Gittern eingefasst waren, konnte sie kein Lebenszeichen entdecken. Rechts und links vom Hauptgebäude stand je ein kleines, schlichtes Haus, beide etwas zurückversetzt wie zwei arme Verwandte, die respektvoll Abstand halten. Mandy, die sich jetzt vor dem ersten davon, der Nummer 10, befand (ohne dass weit und breit etwas von Nummer 1 bis 9 zu sehen gewesen wäre), sah, dass zwischen diesem und dem Haupthaus die Innocent Passage verlief, ein kleiner Durchgang, den ein schweres Eisentor zur Straße hin versperrte und den die Verlagsangestellten offenbar als Parkplatz benutzten. Im Augenblick stand das Tor offen, und Mandy sah, wie drei Männer mittels eines Flaschenzugs große Pappkartons aus einem der oberen Stockwerke herunterließen und auf einen Kleintransporter luden. Einer der drei, ein schmächtiges dunkles Kerlchen, zog seinen zerbeulten Holzfällerhut und machte Mandy eine spöttische Verbeugung. Auch die beiden anderen musterten sie mit unverhohlener Neugier. Mandy klappte das Visier hoch und bedachte alle drei mit abschätzigem Blick.
Das Nebengebäude auf der anderen Seite war durch die Innocent Lane vom Haupthaus getrennt. Hier sollte sich, nach Mrs. Crealeys Beschreibung, der Eingang zum Verlag befinden. Mandy stieg vom Motorrad und schob die Maschine auf der Suche nach einem möglichst unauffälligen Parkplatz übers Kopfsteinpflaster. Und dann erhaschte sie den ersten Blick auf den Fluss, ein wellenbewegtes Glitzerband unter aufklarendem Himmel. Sie parkte die Yamaha, nahm den Sturzhelm ab, kramte ihren Hut aus der Satteltasche, setzte ihn auf und ging, den Helm unterm Arm und ihre Tasche geschultert, aufs Wasser zu, wie magisch angezogen vom starken Sog der Gezeiten und dem schwachen, salzigen Duft des Meeres.
Sie kam auf eine geräumige, mit schimmernden Marmorfliesen ausgelegte Terrasse, eingefasst von einem niedrigen Gitter aus filigranem Schmiedeeisen, dem je eine Glaskugel, getragen von zwei ineinander verschlungenen Delphinen, als Eckpfeiler diente. Von einer Öffnung inmitten der Gitterfront führte eine Treppe zum Fluss hinunter. Sie konnte das rhythmische Plätschern des Wassers gegen das steinerne Fundament hören. Langsam, in trancehaftem Staunen, so als hätte sie den Fluss noch nie gesehen, ging Mandy dem Geräusch nach. Und dann lag sie vor ihr, eine weite, wogende, sonnengefleckte Wasserfläche, die alsbald vor ihren Augen von einer auffrischenden Brise zu millionenfachem Wellenspiel angeregt wurde, ja sich gleichsam wie ein rastloses Binnenmeer gebärdete, um dann, kaum dass der Wind abflaute, wieder zum geheimnisvoll unbewegten, glatten Spiegel zu erstarren. Mandy drehte sich um und erblickte es zum erstenmal wirklich, das hoch aufragende Wunder von Innocent House, vier Stockwerke aus farbigem Marmor und goldglänzendem Stein, der sich dem Wechsel des Lichts anzupassen schien, indem er bald heller wurde, bald in noch satterem Goldton erstrahlte. Der stattliche, überwölbte Haupteingang war von schmalen Bogenfenstern flankiert, darüber erhoben sich zwei Stockwerke mit steingemeißelten Balkonen und, ihnen vorgelagert, eine Marmorkolonnade, deren schlanke Säulen anmutige Kleeblattbögen trugen. Über dem Portikus mit seinen hohen Bogenfenstern lag, unter dem Fries des Flachdachs, noch ein letztes, schmuckloses Obergeschoss. Mandy verstand nichts von den architektonischen Feinheiten, aber sie hatte schon ähnliche Häuser gesehen: als Dreizehnjährige auf einer ausgelassenen, schlecht organisierten Klassenfahrt nach Venedig. Von der Stadt hatte sich ihr wenig mehr eingeprägt als der hochsommerliche Gestank der Kanäle, vor dem die Kinder sich, in gespieltem Ekel kreischend, die Nase zuhielten, und die überfüllten Museen und Paläste, die man sie bewundern hieß, obschon sie doch ganz baufällig wirkten und aussahen, als könnten sie jeden Moment einstürzen und im nächsten Kanal versinken. Mandy hatte Venedig gesehen, als sie noch zu jung und vor allem unzureichend darauf vorbereitet gewesen war. Hier im Angesicht von Innocent House spürte sie zum erstenmal ein Echo auf jenes Kindheitserlebnis, eine Mischung aus Ehrfurcht und Entzücken, die sie überrascht und auch ein bisschen erschrocken zur Kenntnis nahm.
Eine Männerstimme weckte sie aus ihrer Trance: »Suchen Sie jemand?«
Als sie sich umdrehte, sah sie einen Mann durchs Gitter spähen, der wie durch Zauberei aus dem Fluss aufgetaucht zu sein schien. Doch als sie näher trat, erkannte sie, dass er im Bug eines Motorboots stand, das links von der Treppe festgemacht war. Er hatte die Mütze auf dem schwarzen Lockenschopf weit ins Genick geschoben, und seine Augen funkelten wie helle Schlitze aus dem wettergegerbten Gesicht.
Mandy sagte: »Ich bin hier wegen einer Stelle. Hab mir nur rasch mal den Fluss angesehen.«
»Ach, der Fluss läuft Ihnen nicht weg. Da drüben geht’s rein.« Er wies mit dem Daumen Richtung Innocent Lane.
»Ja, ich weiß.«
Betont unbeeindruckt sah Mandy flüchtig auf die Uhr, wandte sich um und betrachtete noch zwei volle Minuten lang die Fassade von Innocent House. Erst dann ging sie, mit einem letzten Blick zurück auf den Fluss, zur Innocent Lane hinauf.
An der Tür prangte ein Schild: Peverell Press – Bitte treten Sie ein. Mandy drückte die Klinke und ging durch ein verglastes Foyer zum Empfang. Gleich links neben einem bauchigen Schreibtisch bediente ein grauhaariger Mann mit freundlichem Gesicht die Telefonzentrale. Er begrüßte Mandy lächelnd und hakte ihren Namen auf einer Liste ab. Als sie ihm ihren Sturzhelm zur Aufbewahrung gab, griffen seine kleinen, altersfleckigen Hände so vorsichtig danach, als hätte sie ihm eine Bombe gereicht. Zuerst schien er nicht recht zu wissen, wo er damit hin sollte, dann legte er ihn einfach neben sich auf den Tisch.
Als er sie telefonisch angemeldet hatte, sagte er: »Miss Blackett wird gleich herunterkommen und Sie zu Miss Etienne führen. Wenn Sie inzwischen Platz nehmen möchten?«
Mandy setzte sich an einen niedrigen Tisch, auf dem neben drei Tageszeitungen etliche Literaturzeitschriften und Kataloge ausgebreitet waren. Ohne einen Blick daran zu verschwenden, sah sie sich in dem Raum um, der anscheinend früher einmal sehr elegant gewesen war. Jedenfalls passten der Marmorkamin mit dem Ölgemälde vom Canal Grande in der Täfelung darüber, die feine Stuckdecke und das Schnitzdekor ganz und gar nicht zu der modernen Empfangstheke, den zwar bequemen, aber unschönen Allzweckstühlen, dem großen, mit Boi bespannten Anschlagbrett und dem Aufzug rechts vom Kamin. An den sattgrün gestrichenen Wänden hingen eine Reihe sepiafarbener Porträts. Mandy, die darin die Peverell’sche Ahnengalerie vermutete, war gerade aufgestanden, um sich die Bilder aus der Nähe anzusehen, als ihre Eskorte erschien, eine stämmige, unansehnliche Frau, die wohl Miss Blackett sein musste. Sie begrüßte Mandy ohne jedes Lächeln, warf einen überraschten, ja fast entsetzten Blick auf ihren Hut und bat sie dann, ohne dass sie sich selbst vorgestellt hätte, ihr zu folgen. Mandy ließ sich durch diese Frostigkeit nicht beirren. Offenbar hatte sie es hier mit der Privatsekretärin des Geschäftsführers zu tun, die von Anfang an ihren Statu‘s demonstrieren wollte. Mandy kannte den Typ.
Beim Betreten der Halle verschlug es ihr den Atem. Sie stand auf einem Mosaikfußboden aus farbigem Marmor, von dem sechs schlanke Säulen mit reichgeschnitzten Kapitellen zu einer verschwenderisch ausgemalten Decke emporstrebten. Ohne auf Miss Blackett zu achten, die ungeduldig am Fuß der Treppe wartete, blieb Mandy unbefangen stehen und drehte sich langsam im Kreis, den Blick starr nach oben gerichtet, wo die gewaltige illuminierte Kuppel sich scheinbar mit ihr drehte; Paläste sah sie dort, Türme mit wehendem Banner, Kirchen, Häuser, Brücken, unter denen sich, geschmückt mit den Segeln hochmastiger Schiffe, ein Fluss hindurchschlängelte, und kleine Putten, aus deren geschürzten Lippen in kleinen Pustewölkchen günstige Winde entströmten wie Dampf aus einem Kessel. Mandy hatte schon in allen möglichen Büros gearbeitet, von chromblitzenden, lederbestückten Glastürmen, ausstaffiert mit den neuesten Wundern der Technik, bis hin zu besseren Besenkammern mit nichts als einer uralten Schreibmaschine auf einem Holztisch darin, und sie hatte beizeiten gelernt, dass das Ambiente eines Büros nicht unbedingt auf die finanziellen Verhältnisse der Firma schließen lässt. Aber ein Bürogebäude wie Innocent House hatte sie noch nie gesehen.
Schweigend stiegen sie die breite, doppelläufige Treppe hinauf. Miss Etiennes Büro im ersten Stock war offenbar früher einmal die Bibliothek gewesen, doch nun hatte man eine Schmalseite des Raums abgetrennt und daraus ein kleines Vorzimmer gemacht. Eine junge Frau mit ernstem Gesicht, die so dünn war, dass sie schon magersüchtig wirkte, streifte Mandy nur mit einem flüchtigen Blick, während sie etwas in ihren Computer eingab. Miss Blackett öffnete die Verbindungstür. »Mandy Price ist da, das Mädchen von der Agentur, Miss Claudia«, meldete sie und ging.
Nach dem schlecht proportionierten Vorzimmer kam Mandy das eigentliche Büro sehr groß vor, als sie jetzt über eine ausgedehnte Parkettfläche auf den Schreibtisch zuging, der rechts vom Fenster am anderen Ende des Raums stand. Eine hochgewachsene, dunkelhaarige Frau erhob sich, begrüßte sie mit Handschlag und bedeutete ihr, auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch Platz zu nehmen.
»Sie haben Ihren Lebenslauf dabei?«, fragte sie.
»Ja, Miss Etienne.«
Mandy war noch nie nach einem Lebenslauf gefragt worden, aber Mrs. Crealey hatte recht gehabt; hier gehörte so etwas offenbar dazu. Sie langte in ihre quastengeschmückte, knallbunt bestickte Umhängetasche, ein Souvenir vom letztjährigen Kreta-Urlaub, und reichte drei sauber getippte Seiten über den Tisch. Miss Etienne studierte den Text, und Mandy studierte Miss Etienne.
Jung war sie ihrer Schätzung nach nicht mehr, bestimmt schon über dreißig. Sie hatte ein scharf geschnittenes Gesicht mit blassem, empfindlichem Teint, flach in den Höhlen liegende Augen mit dunkler, fast schwarzer Iris unter schweren Lidern. Die Brauen waren zu hohen, schmalen Bögen gezupft. Das kurze, glänzend gebürstete Haar trug sie links gescheitelt, ein paar widerspenstige Strähnen hatte sie hinters rechte Ohr zurückgestrichen. An den Händen, die auf Mandys Lebenslauf ruhten, trug sie keinen einzigen Ring, die Finger waren lang und schlank, die Nägel unlackiert.
Ohne aufzublicken, fragte Miss Etienne: »Heißen Sie Mandy oder Amanda Price?«
»Mandy, Miss Etienne.« In jedem anderen Fall hätte Mandy darauf hingewiesen, dass, wäre ihr Vorname Amanda, es auch so in ihrem Lebenslauf stünde.
»Haben Sie schon einmal in einem Verlag gearbeitet?«
»Ungefähr dreimal in den letzten beiden Jahren. Auf Seite drei meines Lebenslaufs finden Sie eine Liste der Firmen, für die ich bisher tätig war.«
Miss Etienne las weiter, dann blickte sie auf, und die klugen, leuchtenden Augen unter den geschwungenen Brauen musterten Mandy mit größerem Interesse, als sie bisher gezeigt hatte.
»Sie waren sehr gut in der Schule«, sagte sie, »aber dann haben Sie ungewöhnlich oft den Arbeitsplatz gewechselt. Sie sind nirgends länger als ein paar Wochen geblieben.«
Drei Jahre Praxis als Aushilfskraft hatten Mandy gelehrt, die meisten Tricks der Männerwelt zu durchschauen und abzuwehren, doch im Umgang mit dem eigenen Geschlecht hatte sie weniger Übung. Aber sie besaß einen hellwachen Instinkt, und der riet ihr, diese Miss Etienne mit Samthandschuhen anzufassen. Während sie also heimlich dachte: Darum heißt es ja Aushilfe, du blöde Kuh, weil man heute hier ist und morgen da, sagte sie laut: »Gerade das gefällt mir an der Zeitarbeit. Ich möchte nämlich möglichst breitgefächerte Erfahrungen sammeln, bevor ich mich irgendwo fest anstellen lasse. Aber wenn es einmal so weit ist, dann will ich auch bei der Stange bleiben und mich bewähren.«
Das war glatt gelogen. Mandy dachte gar nicht daran, sich eine feste Stellung zu suchen. Sie fühlte sich ausgesprochen wohl mit ihren Teilzeitjobs, die ihr, ohne Verträge und Dienstvorschriften, Vielfalt und Freiheit garantierten und obendrein die Gewissheit, dass auch die grässlichste Arbeit schlimmstenfalls nur bis zum nächsten Freitag dauern musste. Wenn sie Pläne hatte, dann auf einem ganz anderen Sektor. Mandy sparte für den Tag, an dem sie sich, zusammen mit ihrer Freundin Naomi, einen kleinen Laden in der Portobello Road würde leisten können, wo sie dann ganz rasch reich werden würden: Naomi mit ihrem selbstgebastelten Schmuck und Mandy mit ihren Hutkreationen.
Miss Etienne wandte sich wieder dem Lebenslauf zu. »Wenn Sie eine feste Anstellung anstreben, in der Sie sich auch noch bewähren wollen, dann sind Sie in Ihrer Generation bestimmt eine Ausnahme«, sagte sie trocken. Und als hätte sie es plötzlich eilig, reichte sie Mandy den Lebenslauf zurück, erhob sich und sagte: »Also schön, machen wir einen PC-Test. Mal sehen, ob Sie wirklich so gut sind, wie Sie behaupten. In Miss Blacketts Büro im Erdgeschoss steht ein zweiter PC. Dort wäre ohnehin Ihr Arbeitsplatz, also können Sie da auch gleich den Test machen. Mr. Dauntsey, der in unserem Haus das Lyrikprogramm betreut, hat ein Band besprochen, das abgetippt werden muss. Es liegt im kleinen Archiv.« Und während sie hinter dem Schreibtisch hervortrat, setzte sie hinzu: »Kommen Sie, wir holen es gemeinsam. Dann lernen Sie auch gleich das Haus ein bisschen kennen.«
Mandy wiederholte skeptisch: »Lyrik?« Gedichte nach Tonbanddiktat zu schreiben war eine heikle Sache. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass sich zumindest bei moderner Dichtung kaum erkennen ließ, wo eine Zeile aufhörte und die nächste begann.
»Nein, nein, auf dem Band sind keine Gedichte. Mr. Dauntsey macht derzeit eine Bestandsaufnahme unseres Archivs und überprüft, welche Dokumente von bleibendem Wert sind und welche vernichtet werden können. Peverell Press publiziert seit 1792, und da besitzen wir natürlich allerhand interessantes Material aus den Gründerjahren, das sich zu katalogisieren lohnt.«
Mandy folgte Miss Etienne über die breite Freitreppe in die Halle hinunter und von dort zur Rezeption. Anscheinend würden sie den Fahrstuhl nehmen, und der ging nur vom Parterre aus. Wohl kaum der geeignete Weg, das Haus kennenzulernen, dachte sie. Trotzdem war das vorhin eine vielversprechende Bemerkung gewesen, die sich anhörte, als sei der Job ihr schon sicher, vorausgesetzt, sie wollte ihn. Und dass sie ihn wollte, wusste Mandy, seit sie vorhin von der Terrasse aus die Themse gesehen hatte.
Der Lift war eng, maß kaum mehr als anderthalb Quadratmeter, und als die Kabine ächzend aufwärts ruckelte, spürte Mandy die beklemmende Nähe der stummen, hochgewachsenen Gestalt, deren Arm fast den ihren streifte. Zwar hielt sie den Blick starr auf das Fahrstuhlgitter gerichtet, aber natürlich roch sie trotzdem Miss Etiennes Parfum, einen zarten, leicht exotischen Duft, dabei aber so schwach, dass es vielleicht gar kein Parfum, sondern nur eine teure Seife war. Alles an Miss Etienne dünkte Mandy teuer: die Bluse, deren matter Glanz verriet, dass sie aus Seide war, die zweireihige Goldkette und die goldenen Ohrstecker, die lässig um ihre Schultern drapierte Strickjacke mit dem flauschigen Kaschmir-Look. Doch ihr von all den aufregenden neuen Eindrücken hier in Innocent House geschärfter Instinkt erriet auch, dass Miss Etienne unsicher und gehemmt war. Seltsam, wenn jemand hätte nervös sein sollen, dann höchstens sie, Mandy, stattdessen konnte sie es in der klaustrophobisch engen Kabine, die noch dazu aufreizend langsam nach oben schaukelte, vor Spannung förmlich knistern hören.
Der Lift kam ruckartig zum Stehen, und Miss Etienne zog mit einiger Kraftanstrengung das Scherengitter zurück. Mandy betrat hinter ihr einen schmalen Gang, von dem direkt gegenüber eine Tür abging und etwas weiter links eine zweite. Die Tür vis-à-vis stand offen und gab den Blick frei auf einen großen, vollgestopften Raum, in dem sich auf bis zur Decke reichenden Metallregalen Aktenordner und Papierstöße türmten. Zwischen den Regalen, die von den Fenstern bis zur Tür gingen, blieb nur ein schmaler Durchgang frei. Es roch nach altem Papier, die Luft war muffig und verbraucht. Mandy zwängte sich hinter Miss Etienne zwischen Aktengestell und Wand durch bis zu einer kleinen Tür, die geschlossen war.
Miss Etienne blieb davor stehen und sagte: »Hier drinnen arbeitet Mr. Dauntsey an unserer Verlagsgeschichte. Wir nennen diesen Raum das kleine Archiv. Mr. Dauntsey wollte das Band auf dem Tisch bereitlegen.«
Mandy wunderte sich über diese eigentlich unnötige Erklärung, und ihr war, als ob Miss Etienne, die Hand schon auf dem Türgriff, sich nicht zu öffnen traute. Dann aber stieß sie mit einer so heftigen Bewegung, als erwarte sie von drinnen Widerstand, die Tür weit auf.
Wie ein böser Geist entwich der Gestank und quoll ihnen entgegen; es roch nach Erbrochenem, gar nicht einmal stark, aber Mandy war so wenig darauf gefasst, dass sie im ersten Moment zurückschrak. Über Miss Etiennes Schulter hinweg erfasste sie mit einem Blick ein kleines Zimmer mit bloßen Dielen, einem quadratischen Tisch rechts von der Tür und einem einzigen hohen Fenster, das eigentlich nur eine Art Oberlicht war. Darunter stand ein schmales Bett, und darauf lag, der Länge nach ausgestreckt, eine Frau.
Mandy hätte auch ohne den Geruch gewusst, dass sie eine Tote vor sich hatten. Sie schrie nicht, sie hatte noch nie aus Angst oder vor Entsetzen geschrien; aber eine gepanzerte Riesenfaust hielt ihr Herz umklammert und drückte zu, bis sie so heftig zu zittern begann wie ein Kind, das man aus eiskaltem Wasser gezogen hat. Wortlos, mit leisen, fast unhörbaren Schritten, näherten sie sich dem Bett, Mandy dicht hinter Miss Etienne.
Die Frau lag oben auf der buntgewürfelten Tagesdecke, unter der sie nur das Kissen vorgezogen hatte, um ihren Kopf darauf zu betten, als ob sie dieses letzten Trostes bedurft hätte, ehe sie das Bewusstsein verlor. Neben dem Bett standen auf einem Stuhl eine leere Weinflasche, ein benutztes Glas und eine Arzneiflasche mit Schraubverschluss. Ein Paar braune Schnürschuhe waren ordentlich nebeneinander unter den Stuhl geschoben. Vielleicht hat sie die Schuhe ausgezogen, weil sie die Decke nicht schmutzig machen wollte, dachte Mandy. Aber nun war die Decke doch versaut und das Kissen auch. Erbrochenes klebte wie die Schleimspur einer Riesenschnecke an der linken Wange der Frau und war auf dem Kissenbezug zu einer steifen Kruste getrocknet. Hinter den halb geöffneten Lidern der Toten war die Iris nach oben verdreht, die grauaarige Ponyfrisur war kaum in Unordnung geraten. Die Frau trug einen braunen, hochgeschlossenen Pullover und einen Tweedrock, unter dem die dünnen, seltsam verrenkten Beine wie zwei Stöcke hervorragten. Ihr linker Arm war weit ausgestreckt und berührte fast den Stuhl, der rechte lag über ihrer Brust. Die rechte Hand hatte offenbar kurz vor dem Ende noch an dem dünnen Wollpullover herumgezupft und ihn dabei so weit hochgeschoben, dass jetzt ein paar Zentimeter des weißen Unterhemds herausschauten. Neben der leeren Arzneiflasche lag ein quadratischer Umschlag, der in energischer schwarzer Schrift adressiert war.
So ehrfürchtig, als wäre sie in der Kirche, flüsterte Mandy: »Wer ist das?«
Miss Etiennes Stimme klang gefasst. »Sonia Clements. Eine unserer Lektorinnen.«
»Hätte ich für sie arbeiten sollen?«
Kaum dass sie die Frage gestellt hatte, begriff Mandy, wie überflüssig das jetzt war, aber Miss Etienne antwortete trotzdem. »Zu Anfang ja, aber nur kurze Zeit. Sie wäre zum Monatsende ausgeschieden.«
Als sie den Brief an sich nahm, schien Miss Etienne ihn einen Moment lang wie prüfend in der Hand zu wiegen. Mandy dachte: Sie würde ihn gern aufmachen, aber nicht in meiner Gegenwart. Nach kurzem Zögern sagte Miss Etienne: »Adressiert an den Coroner, den gerichtsmedizinischen Gutachter. Aber es ist ja auch so klar, was hier passiert ist. Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen mussten, Miss Price. So ein Schock – wirklich rücksichtslos von ihr. Wenn man sich schon umbringen will, dann sollte man das in seinen eigenen vier Wänden tun.«
Mandy dachte an die enge Häuserzeile in Stratford East, an die Gemeinschaftsküche und das einzige Bad und an ihr kleines Hinterzimmer in einem Haus, in dem man schon eine Portion Glück bräuchte, um auch nur unbemerkt die Tabletten zu schlucken, geschweige denn daran sterben zu können, ohne dass einen vorher jemand fand. Sie zwang sich, der Frau noch einmal ins Gesicht zu sehen, und hatte plötzlich das Bedürfnis, ihr die Augen und den leicht offen stehenden Mund zu schließen. Das also war der Tod oder vielmehr so sah er aus, bevor der Leichenbestatter Hand anlegte. Mandy hatte bis jetzt erst einmal eine Leiche gesehen – ihre Großmutter, die in ihrem Totenhemd mit dem gefältelten Stehkragen so adrett im Sarg gelegen hatte wie eine Puppe im Geschenkkarton; nur viel kleiner hatte sie ausgesehen, und ihr Gesicht war so friedlich gewesen wie zu Lebzeiten niemals, vielleicht weil man ihr die klugen, rastlosen Augen geschlossen und die überfleißigen Hände in beschaulicher Ruhe gefaltet hatte. Plötzlich überfluteten sie Trauer und Mitleid, ausgelöst durch einen verspäteten Schock oder die unerwartet lebhafte Erinnerung an die Großmutter, die sie wirklich geliebt hatte. Als die ersten heißen Tränen hinter ihren Lidern brannten, wusste sie nicht einmal genau, ob sie der Großmama galten oder dieser Fremden, die ihren Blicken so wehrlos ausgeliefert war. Mandy weinte nicht oft, aber wenn ihr einmal die Tränen kamen, dann gab es kein Halten mehr. Nur ja hier nicht die Fassung verlieren! Die Blamage wäre nicht auszudenken. Verzweifelt sah sie sich um, und da fiel ihr Blick auf etwas Vertrautes, etwas, vor dem man sich nicht zu fürchten brauchte und womit sie umgehen konnte, gleichsam ein Garant dafür, dass draußen, jenseits dieser Todeszelle, die normale Welt weiterbestand. Auf dem Tisch lag ein kleines Diktiergerät.
Mandy ging hin und nahm es so andächtig in die Hand, als wäre es eine Ikone. »Ist da das Band drin, das ich abschreiben soll?«, fragte sie. »Ist es ein Verzeichnis? Möchten Sie es tabellarisiert?«
Miss Etienne musterte sie einen Moment lang schweigend und sagte dann: »Ja, schreiben Sie’s tabellarisch. Und drucken Sie auch gleich zwei Kopien aus. Sie können den PC in Miss Blacketts Büro benutzen.«
Und in dem Augenblick wusste Mandy, sie hatte den Job.
2
Eine Viertelstunde vorher verließ Gerard Etienne, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Peverell Press, den Sitzungssaal und wollte hinunter in sein Büro im Erdgeschoss. Plötzlich blieb er stehen, wich leichtfüßig wie eine Katze in den Schatten zurück und spähte hinter der Balustrade hervor. Unter ihm in der Halle drehte ein Mädchen Pirouetten und blickte dabei wie verzückt zur Decke hinauf. Sie trug nach oben ausgestellte Stiefel, die ihr bis weit über die Knie reichten, einen engen, beigefarbenen Minirock und eine mattrote Samtjacke. Ein schlanker, feingliedriger Arm war ausgestreckt und hielt den extravaganten Hut an der Krempe fest. Dieses anscheinend aus rotem Filz gefertigte Gebilde war mit dem wunderlichsten Putz garniert: Neben Blumen, Federn, Satin- und Spitzenbändern entdeckte Etienne sogar kleine Glasplättchen. Bei jeder Drehung des Mädchens blitzte, funkelte und glitzerte der Hut. Es müsste eigentlich lächerlich wirken, dachte er, dieses spitze Kindergesicht, halb verdeckt von zerzausten dunklen Haarsträhnen und obendrauf so eine aberwitzige Kreation. Stattdessen sah das Mädchen bezaubernd aus. Unwillkürlich lächelte er, ja lachte beinahe, und plötzlich überkam ihn eine so verrückte Anwandlung, wie er sie seit seinem zwanzigsten Lebensjahr nicht mehr gespürt hatte: Am liebsten wäre er die breite Treppe hinuntergerannt, hätte sie in die Arme genommen und wäre mit ihr über die Marmorterrasse hinausgetanzt bis ans Ufer des schimmernden Flusses. Aber da hatte sie ihr gemessenes Menuett auch schon beendet und folgte Miss Blackett durch die Halle zur Treppe. Er blieb noch einen Moment stehen und genoss diesen närrischen Taumel, der, wie er meinte, durchaus keine sexuelle Konnotationen hatte, sondern nur dem Wunsch entsprang, sich ein Andenken an die Jugend zu bewahren, eine Erinnerung an erste Liebe, Lachen, Ungebundenheit, an schiere animalische Sinnenfreude. Nichts davon hatte heute mehr Platz in seinem Leben. Er lächelte immer noch, als er, sobald die Halle leer war, langsam in sein Büro hinunterschlenderte.
Zehn Minuten später ging die Tür auf, und er erkannte am Schritt, dass seine Schwester hereingekommen war. Ohne aufzublicken, fragte er: »Wer ist denn die Kleine mit dem verrückten Hut?«
»Was für ein Hut?« Im ersten Moment schien Claudia gar nicht zu begreifen, doch dann sagte sie: »Ach, der Hut. Das ist Mandy Price, die neue Aushilfe.«
Ihre Stimme klang so merkwürdig gepresst, dass er sich zu ihr umdrehte und sie ansah. »Claudia«, sagte er, »was ist passiert?«
»Sonia Clements ist tot. Sie hat sich umgebracht.«
»Wo?«
»Hier. Im kleinen Archiv. Dieses Mädchen und ich, wir haben sie gefunden, als wir Gabriels Diktiergerät holen wollten.«
»Die Kleine hat sie gefunden?« Nach kurzem Zögern setzte er hinzu: »Und wo ist sie jetzt?«
»Ich sag dir doch, im kleinen Archiv. Wir haben die Leiche nicht angerührt. Wozu auch?«
»Ich wollte wissen, wo die Kleine ist!«
»Ach, die sitzt nebenan bei Blackie und schreibt das Band ab. Du brauchst sie übrigens nicht zu bedauern. Sie war ja nicht allein, außerdem ist die Sache zum Glück ganz unblutig abgegangen. Und dann ist diese Generation hart im Nehmen – die Kleine hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Ihr ging es bloß darum, dass sie den Job kriegt.«
»Und du bist sicher, dass es Selbstmord war?«
»Natürlich. Sie hat diesen Brief hinterlassen. Hier, er ist offen, aber ich habe ihn nicht gelesen.«
Sie reichte ihm den Umschlag, trat dann ans Fenster und sah hinaus. Nach kurzem Zögern schnippte er die Klappe aus dem Kuvert, zog vorsichtig das Blatt heraus und las laut vor: »›Ich bitte um Verzeihung für die Unannehmlichkeiten, aber dieser Raum schien mir am besten geeignet. Wahrscheinlich wird es Gabriel sein, der mich hier findet, und er steht mit dem Tod auf so vertrautem Fuß, dass es kein allzu großer Schock für ihn sein wird. Jetzt, da ich allein lebe, hätte man mich daheim womöglich erst entdeckt, wenn ich zu stinken anfange, und ich denke, ein gewisses Maß an Würde sollte der Mensch sich selbst im Tode noch bewahren. Meine Angelegenheiten sind geregelt, und auch an meine Schwester habe ich geschrieben. Ich bin nicht verpflichtet, meine Tat zu begründen, aber falls es irgendwen interessiert: Es ist ganz einfach so, dass ich ein rasches Ende dem Fortbestand dieses freudlosen Daseins vorziehe; meines Erachtens eine vernünftige Wahl und eine, die zu treffen uns allen freisteht.‹ Na, das ist eindeutig«, sagte er, »und noch dazu handgeschrieben. Wie hat sie’s denn angestellt?«
»Mit Tabletten und Alkohol. Es sieht nicht sehr wüst aus, wie gesagt.«
»Hast du schon die Polizei verständigt?«
»Die Polizei? Dazu hatte ich noch gar keine Zeit. Ich bin ja gleich zu dir gekommen. Aber ist das denn wirklich nötig, Gerard? Selbstmord ist doch kein Verbrechen. Könnten wir nicht einfach Dr. Frobisher anrufen?«
Er sagte kurz angebunden: »Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber es ist auf jeden Fall ratsam. An diesem Tod darf nichts fragwürdig erscheinen.«
»Fragwürdig?«, wiederholte sie. »Wer sollte denn daran etwas fragwürdig finden?«
Unwillkürlich hatten sie die Stimmen gesenkt, und nun flüsterten sie fast nur noch. Trotzdem strebten sie instinktiv von der Trennwand weg zum Fenster.
»Nenn es meinetwegen Tratsch«, sagte er, »Gerüchte, einen Skandal. Wir können die Polizei direkt von hier aus anrufen. Nicht nötig, das Gespräch über die Zentrale laufen zu lassen. Wenn man sie im Aufzug runterbringt, können wir sie womöglich aus dem Haus schaffen, bevor das Personal mitkriegt, was passiert ist. An George kommen wir natürlich nicht vorbei. Wahrscheinlich ist es sogar das Beste, die Polizei bei ihm an der Pforte reinzulassen. Man muss George eben einschärfen, dass er den Mund hält. Wo ist die Kleine von der Agentur jetzt?«
»Hab ich dir doch schon gesagt. Sie macht nebenan bei Blackie ihre Diktatprüfung.«
»Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie Blackie und jedem, der sonst noch drüben reinschaut, brühwarm erzählt, wie sie nach oben geführt wurde, um ein Tonband zu holen, und dabei über eine Leiche gestolpert ist.«
»Ich habe beide zum Stillschweigen verpflichtet, bis wir das gesamte Personal unterrichtet haben. Aber wenn du glaubst, du könntest die Geschichte auch nur für ein paar Stunden geheim halten, Gerard, dann irrst du dich gewaltig. Es wird eine gerichtliche Untersuchung geben, und das bedeutet Publicity. Außerdem muss man sie über die Treppe runterschaffen. Ein Leichensack auf einer Bahre passt auf gar keinen Fall in den Aufzug. Das hat uns weiß Gott gerade noch gefehlt! Zusammen mit der anderen Geschichte wird sich das ganz fabelhaft auf unser Betriebsklima auswirken.«
Einen Moment herrschte Schweigen. Weder er noch sie machten Anstalten, zum Telefon zu gehen; dann schaute sie ihn an und fragte: »Als du sie entlassen hast, letzten Mittwoch, wie hat sie’s da aufgenommen?«
»Sie hat sich jedenfalls nicht umgebracht, weil ich ihr gekündigt habe. Sie hatte genug gesunden Menschenverstand, um zu wissen, dass sie gehen musste. Seit dem Tag, an dem ich die Geschäftsleitung übernahm, muss sie das gewusst haben. Ich habe von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass wir nach meiner Ansicht einen Lektor zu viel beschäftigen und dass ich die überschüssige Arbeit außer Haus geben möchte, an einen freien Mitarbeiter.«
»Aber sie war dreiundfünfzig. Es wäre nicht leicht für sie gewesen, woanders unterzukommen. Und sie ist immerhin seit vierundzwanzig Jahren bei uns.«
»Als Teilzeitkraft.«
»Laut Vertrag ja, aber gearbeitet hat sie praktisch ganztags. Der Verlag war ihr Leben.«
»Claudia, das ist doch sentimentaler Quatsch. Sie hatte sehr wohl ein Leben außerhalb dieses Hauses. Und was tut das überhaupt zur Sache, verdammt noch mal? Entweder sie wurde hier gebraucht oder nicht.«
»Und mit dem Argument hast du’s ihr beigebracht? Dass sie nicht mehr gebraucht würde?«
»Ich war nicht brutal, wenn du das meinst. Ich habe ihr gesagt, dass ich einen Teil des Sachbuchlektorats einem freien Mitarbeiter übertragen möchte und dass ihre Stelle damit wegfallen würde. Aber ich habe ihr auch gesagt, dass wir, wenngleich sie rein rechtlich keinen Anspruch auf eine volle Abfindung hatte, finanziell bestimmt eine zufriedenstellende Regelung finden würden.«
»Eine finanzielle Regelung? Und was hat sie dazu gesagt?«
»Dass das nicht nötig wäre. Weil sie selbst eine Regelung treffen würde.«
»Was sie dann ja auch getan hat. Und zwar anscheinend mit Distalgesic und einer Flasche bulgarischem Rotwein. Na, wenigstens hat sie uns Geld erspart, aber ich hätte bei Gott lieber bezahlt, als nun mit so was konfrontiert zu sein. Ich weiß, ich sollte Mitleid mit ihr haben. Und das werde ich wohl auch, sobald ich den Schock überwunden habe. Aber im Moment tue ich mich noch schwer.«
»Claudia, es ist sinnlos, diese alte Diskussion noch mal zu führen. Ich musste sie entlassen, und genau das hab ich getan. Mit ihrem Tod hat das nichts zu schaffen. Ich habe nur getan, was im Interesse des Verlags getan werden musste, und seinerzeit warst du ja auch mit mir einig. Für ihren Selbstmord kann man weder dich noch mich verantwortlich machen, genauso wenig wie ihr Tod etwas mit dem anderen Unfug hier im Haus zu tun hat.« Er hielt inne und setzte dann hinzu: »Es sei denn, sie hätte selbst dahintergesteckt.«
Sein plötzlich so hoffnungsvoller Tonfall war Claudia nicht entgangen. Die Sache beunruhigte ihn also mehr, als er zugeben wollte. Erbittert sagte sie: »Dann wären wir fein raus, was? Aber wie könnte sie’s denn gewesen sein, Gerard? Als an den Stilgoe-Druckfahnen rumgepfuscht wurde, war sie krank, falls du dich erinnerst, und als die Illustrationen für das Guy-Fawkes-Buch abhandenkamen, da besuchte sie einen unserer Autoren in Brighton. Nein, nein, sie kann’s nicht gewesen sein.«
»Ja, natürlich, das hatte ich tatsächlich vergessen. Hör zu, ich werde jetzt die Polizei verständigen, und du kannst unterdessen die Runde machen und den Leuten erklären, was passiert ist. Das ist weniger dramatisch, als alle zu einer großangelegten Erklärung zusammenzutrommeln. Und sag ihnen, sie sollen in ihren Büros bleiben, bis die Leiche fortgeschafft ist.«
Sie entgegnete zögernd: »Da wäre noch was. Ich glaube, ich war die Letzte, die sie lebend gesehen hat.«
»Na und, einer muss das schließlich gewesen sein.«
»Es war gestern Abend, kurz nach sieben. Ich hatte etwas länger gearbeitet, und als ich im ersten Stock aus der Garderobe kam, da sah ich sie die Treppe raufgehen. Sie hatte eine Weinflasche und ein Glas in der Hand.«
»Und du hast sie nicht gefragt, was sie damit will?«
»Natürlich nicht. Sie war schließlich keine kleine Tippse. Ich dachte mir halt, sie würde den Wein mit rauf ins Archiv nehmen, um sich heimlich einen anzududeln. Und wenn sie das vorhatte, dann ging mich das ja kaum was an. Ich fand’s zwar komisch, dass sie so lange Überstunden machte, aber das ist auch alles.«
»Hat sie dich gesehen?«
»Das glaub ich nicht. Sie hat sich jedenfalls nicht umgeschaut.«
»Und sonst war niemand mehr da?«
»Nicht um diese Zeit, nein. Ich war die Letzte.«
»Dann behalt’s für dich. Es tut nichts zur Sache, und wenn du’s erzählst, wäre damit niemandem geholfen.«
»Ich hatte allerdings das Gefühl, dass sie sich irgendwie merkwürdig benahm. Sie hatte so was – na ja, Heimlichtuerisches. Und es schien mir fast, als ob sie’s eilig hätte.«
»Das kommt dir bloß im Nachhinein so vor. Du hast nicht vor dem Abschließen noch einen Rundgang durchs Haus gemacht?«
»Ich hab einen Blick in ihr Büro geworfen. Aber da brannte kein Licht mehr. Und es lag auch nichts da, weder Mantel noch Tasche. Wahrscheinlich hatte sie die in den Schrank geräumt. Ich dachte natürlich, sie habe inzwischen Feierabend gemacht und sei heimgegangen.«
»Das kannst du bei der gerichtlichen Untersuchung erwähnen, aber mehr nicht. Sag nichts davon, dass du sie vorher auf der Treppe gesehen hast. Sonst kommt der Coroner womöglich noch auf die Idee, dich zu fragen, warum du nicht im Obergeschoss nachgesehen hast.«
»Aber warum hätte ich das tun sollen?«
»Eben.«
»Aber Gerard, wenn man mich nun fragt, wann ich sie zuletzt gesehen habe …«
»Dann denk dir halt was aus. Nur lüg um Gottes willen überzeugend, und bleib vor allem auch dabei.« Er trat an den Schreibtisch und nahm den Telefonhörer ab. »Das Beste wird sein, ich wähle 999. Sonderbar, aber so weit ich mich entsinnen kann, ist dies das erste Mal, dass die Polizei nach Innocent House gerufen wird.«
Sie wandte sich vom Fenster ab und sah ihn offen an. »Wollen wir hoffen, dass es auch das letzte Mal ist.«
3
Im Vorzimmer saßen Mandy und Miss Blackett jede an ihrem PC und tippten, den Blick starr auf den Bildschirm gerichtet. Keine von beiden sprach. Anfangs hatten Mandys Finger sich der Arbeit verweigert und flatterten so unsicher über die Tasten, als wären die Buchstaben unerklärlicherweise vertauscht worden und hätten sich in einen Wirrwarr sinnentleerter Symbole verwandelt. Aber dann hielt sie die Hände eine halbe Minute lang fest im Schoß verschränkt und zwang sich mit äußerster Willensanstrengung, das Zittern zu unterdrücken. Als sie dann tatsächlich loslegte, kam ihr bald die Routine zu Hilfe, und alles war gut. Hin und wieder warf sie Miss Blackett einen verstohlenen Blick zu. Die Frau stand offenbar unter Schock. Das großflächige Gesicht mit den Hamsterbacken und dem kleinen, etwas starren Mund war so bleich, dass Mandy befürchtete, sie werde jeden Moment ohnmächtig vornüber auf die Tastatur sinken.
Miss Etienne und ihr Bruder waren vor über einer halben Stunde gegangen. Binnen zehn Minuten, nachdem sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, steckte Miss Etienne erneut den Kopf zur Tür herein und sagte: »Ich habe Mrs. Demery gebeten, Ihnen einen Tee zu bringen. Das ist für Sie beide sicher ein Schock gewesen.«
Der Tee war binnen weniger Minuten gekommen, serviert von einer rothaarigen Frau mit geblümter Schürze, die, als sie das Tablett auf einem Aktenschrank absetzte, ausrief: »Ich darf nicht reden, also werd ich den Mund halten. Aber wenn ich Ihnen sage, dass die Polizei eben gekommen ist, dann ist da ja wohl nichts dabei. Ist ganz schön flott gegangen. Bestimmt wollen die jetzt auch Tee haben.« Und dann war sie so eilig abgezogen, als wüsste sie, dass draußen bald mehr los sein würde als hier in dem kleinen Vorzimmer.
Miss Blacketts Büro war schlecht geschnitten, viel zu schmal für seine Höhe und auf keinen Fall der angemessene Rahmen für den prächtigen Marmorkamin mit der klassischen Einfassung und dem massiven Sims, getragen von den Häuptern zweier Sphinxe. Die hässliche Trennwand, im unteren Drittel aus Holz, darüber mit eingefassten Milchglasscheiben, halbierte nicht nur eines der schmalbrüstigen Bogenfenster, sondern auch das rautenförmige Deckenornament. Wenn es schon nötig war, dieses schöne große Zimmer zu teilen, dachte Mandy, dann hätte man dabei zumindest mehr Rücksicht auf die Architektur nehmen können, von Miss Blacketts Bequemlichkeit ganz zu schweigen. Die jetzige Regelung erweckte den Anschein, als gönne man ihr nicht einmal einen ausreichenden Arbeitsplatz.
Ein Kuriosum ganz anderer Art war die lange Schlange aus grün gestreiftem Samt, die sich um die Griffe der zwei obersten Fächer des stählernen Aktenschrankes kringelte. Über ihren leuchtenden Knopfaugen thronte ein winziger Zylinder, und die gespaltene Zunge von rotem Flanell hing aus einem leicht geöffneten Maul, das anscheinend mit rosa Seide ausgelegt war. Mandy hatte schon ähnliche Schlangen gesehen; ihre Großmutter hatte zum Beispiel auch so eine gehabt. Sie dienten dazu, die Zugluft abzuwehren, indem man Tür- oder Fensterritzen damit abdichtete. Man konnte aber auch eine Tür damit offen halten, wenn man die Schlange etwa um beide Klinkenhälften wickelte. Allerdings hätte sie nicht erwartet, so ein albernes Ding, das doch im Grunde eher ein Kinderspielzeug war, ausgerechnet in Innocent House zu finden. Gern hätte sie Miss Blackett danach gefragt, aber Miss Etienne hatte sich Stillschweigen ausbedungen, und Miss Blackett bezog dieses Gesprächsverbot offenbar auf jedes Thema, ausgenommen rein arbeitsbezogene Fragen.
Minuten verstrichen, ohne dass ein Wort gefallen wäre. Mandy war fast fertig mit ihrem Band, als Miss Blackett aufsah und sagte: »Das dürfte reichen. Ich werde Ihnen noch etwas diktieren. Miss Etienne hat mich gebeten, Ihre Stenographie zu prüfen.«
Sie nahm einen Verlagskatalog aus ihrer Schreibtischschublade, reichte Mandy einen Notizblock, rückte ihren Stuhl neben sie und begann mit leiser Stimme vorzulesen. Ihre fast blutleeren Lippen bewegten sich dabei kaum. Mandys Finger formten automatisch die vertrauten Kürzel, aber von den vorgestellten Neuerscheinungen aus dem Sachbuchprogramm bekam sie nur wenig mit. Miss Blacketts Stimme geriet von Zeit zu Zeit ins Stocken, und daran merkte Mandy, dass auch sie auf die Geräusche von draußen horchte. Nachdem es anfangs geradezu unheimlich still gewesen war, hörten sie jetzt Schritte, halb und halb erahntes Geflüster und dann lautere, auf dem Marmor widerhallende Schritte, begleitet von selbstsicheren Männerstimmen.
Miss Blackett, die unverwandt zur Tür sah, sagte tonlos: »Würden Sie mir jetzt bitte vorlesen, was Sie haben?«
Mandy las ihren stenographierten Text fehlerlos herunter. Abermals herrschte Schweigen. Dann öffnete sich die Tür, und Miss Etienne trat ein. »Die Polizei ist jetzt da«, sagte sie. »Die Beamten warten nur noch auf den Polizeiarzt, und dann werden sie Miss Clements wegbringen. Sie beide bleiben am besten hier, bis alles geregelt ist.« Und an Miss Blackett gewandt: »Sind Sie mit dem Test fertig?«
»Ja, Miss Claudia.«
Mandy reichte ihr den Block. Miss Etienne warf nur einen flüchtigen Blick darauf und sagte: »Gut, gut, Sie haben den Job. Morgen früh um halb zehn können Sie anfangen.«
4
Zehn Tage nach Sonia Clements’ Selbstmord und genau drei Wochen vor dem ersten der Innocent-House-Morde aß Adam Dalgliesh mit Conrad Ackroyd im Cadaver Club zu Mittag. Ackroyd hatte ihn gebeten und am Telefon jenen verschwörerischen und leicht ominösen Ton angeschlagen, der jede seiner Einladungen begleitete. Selbst eine Dinnerparty, mit der er lediglich ausstehende gesellschaftliche Verpflichtungen einlöste, wurde den wenigen auserkorenen Gästen wie eine Verheißung auf Geheimnisse, Intrigen und Rätsel angekündigt. Der vorgeschlagene Tag kam nicht gerade gelegen, und während Dalgliesh mit einigem Widerstreben seinen Terminkalender umstellte, sagte er sich, dass zu den Nachteilen des Älterwerdens nicht nur die wachsende Abneigung gegen gesellschaftliche Verpflichtungen gehöre, sondern auch die schwindende Kraft und Wendigkeit, ohne die man um manch rettende Ausrede verlegen war. Ihrer beider Freundschaft – er nahm an, dies sei das passende Wort dafür, denn bestimmt waren sie mehr als bloß flüchtige Bekannte –, ihre Freundschaft also gründete sich auf den Nutzen, den hin und wieder der eine vom anderen zog. Da diese Tatsache von beiden eingestanden wurde, hielten sie es auch nicht für nötig, sie zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Conrad, eines der berüchtigtsten und zuverlässigsten Klatschmäuler Londons, war Dalgliesh oft nützlich gewesen, vor allem im Fall Berowne. Diesmal wurde eindeutig von ihm erwartet, dass er sich revanchierte, aber Conrads Forderung an ihn würde vermutlich eher lästig als schwer zu erfüllen sein. Überdies war die Küche im Cadaver Club ausgezeichnet, und Ackroyd mochte einem zwar bisweilen albern vorkommen, war aber kaum je langweilig.
Im Nachhinein erschienen ihm all die Gräuel, die sich später ereigneten, wie Ausgeburten dieses ganz und gar alltäglichen Lunchs, und er ertappte sich immer wieder bei dem einen Gedanken: Wenn dies ein Roman und ich sein Autor wäre, dann würde die Geschichte genau hier ihren Anfang nehmen.
Der Cadaver Club genoss im Kreis der Londoner Privatclubs zwar kein allzu hohes Renommee, aber für seine Stammmitglieder zählte er zu den funktionstüchtigsten. Das Clubhaus, ein Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert, gehörte ursprünglich einem wohlhabenden, wenn auch nicht besonders erfolgreichen Rechtsanwalt, der es 1892, ausgestattet mit einer angemessenen Stiftungssumme, einem fünf Jahre zuvor gegründeten Privatclub vermachte, der sich bis dahin regelmäßig im Salon des Anwalts getroffen hatte. Der Cadaver Club war – und ist – ein reiner Herrenclub, und wer Mitglied werden möchte, muss in erster Linie ein berufliches Interesse für Mord nachweisen können. Damals wie heute zählen zu seinen Mitgliedern einige pensionierte Polizeibeamte aus dem höheren Dienst, praktizierende wie im Ruhestand befindliche Rechtsanwälte, fast alle wirklich hervorragenden Kriminologen (berufsmäßige wie Amateure), Gerichtsreporter und ein paar berühmte Kriminalschriftsteller, ausnahmslos männlichen Geschlechts und auch die nur geduldet, denn der Club vertritt die Ansicht, dass die Literatur, sofern es um Mord geht, nicht mit dem wirklichen Leben konkurrieren kann. Vor Kurzem nun war der Club Gefahr gelaufen, aus der Kategorie der Exzentriker in jene überzuwechseln, die man als »in« bezeichnet, ein Risiko, das der Vorstand unverzüglich dadurch bekämpft hatte, dass er den nächsten sechs Anwärtern die Mitgliedschaft versagte. Ein Schachzug, der seine Wirkung nicht verfehlte. Denn wie ein verstimmter Bewerber klagte: Vom Garrick abgelehnt zu werden, ist peinlich, aber eine Ablehnung vom Cadaver ist ganz einfach lachhaft. Der Club aber blieb klein und, nach den eigenen exzentrischen Maßstäben, exklusiv.
Der Tavistock Square lag im milden Septembersonnenschein, und während Dalgliesh den Platz überquerte, fragte er sich, wie wohl Ackroyd die Aufnahmebedingungen des Clubs erfüllt haben mochte. Doch dann fiel ihm das Buch ein, das sein Gastgeber vor fünf Jahren über drei berühmt-berüchtigte Mörder verfasst hatte, nämlich über Hawley Harvey Crippen, Norman Thorne und Patrick Mahon. Ackroyd hatte ihm seinerzeit ein signiertes Exemplar geschickt, und Dalgliesh, der es auch brav gelesen hatte, war beeindruckt gewesen von den sorgfältigen Recherchen und der noch sorgfältigeren Schreibe. Ackroyds nicht eben brandneue These lautete, alle drei seien unschuldig in dem Sinne, dass keiner seine Opfer vorsätzlich getötet habe, und er hatte dafür plausible, wenn auch nicht ganz überzeugende Argumente geliefert, die sich auf eine detaillierte Untersuchung der gerichtsmedizinischen Gutachten stützten. Dalgliesh hatte aus dem Buch vor allem die Empfehlung herausgelesen, ein Mordangeklagter, der freigesprochen werden wolle, möge es tunlichst vermeiden, seine Opfer zu zerstückeln, eine Praxis, gegen die britische Geschworene immer wieder den heftigsten Widerwillen bekundet haben.
Sie hatten sich vor dem Lunch in der Bibliothek auf einen Sherry verabredet. Ackroyd war schon da und hatte sich in einem der hochlehnigen Ledersessel niedergelassen. Für einen Mann seiner Größe erhob er sich jetzt erstaunlich flink und kam Dalgliesh mit kleinen, ja fast tänzelnden Schritten entgegen. Er sah nicht die Spur älter aus als an dem Tag, da sie sich kennengelernt hatten.
»Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Adam«, sagte er. »Ich weiß ja, wie beschäftigt Sie im Augenblick sind. Sonderberater des Polizeipräsidenten, Mitglied der Spezialeinheit zur regionalen Verbrechensbekämpfung und hin und wieder ein echter Mordfall, damit Sie nicht aus der Übung kommen. Dass Sie sich nur nicht überarbeiten, mein lieber Junge! Jetzt werde ich erst mal nach dem Sherry läuten. Eigentlich wollte ich Sie in meinen anderen Club einladen, aber Sie wissen ja selbst, dort zu speisen ist zwar eine gute Gelegenheit, den Leuten zu zeigen, dass man noch lebt, nur wird man dann von lauter Clubmitgliedern bestürmt, die einem zu ebendiesem Glück gratulieren wollen. Wir essen übrigens unten im kleinen Nebenzimmer.«
Ackroyd, der sich als schon recht betagter Junggeselle überraschend doch noch verheiratet hatte, was damals unter seinen Freunden zu Erstaunen, ja Bestürzung Anlass gab, lebte nun in ehelicher Selbstgenügsamkeit in einer hübschen Gründerzeitvilla in St. John’s Wood, wo und er Nelly Ackroyd sich neben Haus und Garten noch ihren beiden Siamkatzen widmeten sowie Ackroyds größtenteils eingebildeten Krankheiten. Er war Besitzer, Herausgeber und, vermöge stattlicher Privateinkünfte, auch Finanzier von The Paternoster Review, jener ikonoklastischen Mischung aus Essays, Rezensionen und einer Klatschkolumne, die stets sorgfältig recherchiert und bisweilen dezent, öfter jedoch ebenso bösartig wie treffsicher formuliert war. Wenn Nelly sich nicht um die Hypochondrie ihres Mannes kümmern musste, dann sammelte sie mit Begeisterung Schulgeschichten von Mädchen aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren. Es war eine glückliche Ehe, auch wenn Conrads Freunde immer noch Gefahr liefen, sich nach den Katzen zu erkundigen, bevor sie fragten, wie es Nelly ging.
Bei seinem letzten Besuch in der Bibliothek des Cadaver Clubs war Dalgliesh dienstlich gekommen und hatte Informationen einholen wollen. Aber da war es auch um Mord gegangen, und es hatte natürlich auch keinen Sherry gegeben. Ansonsten schien sich wenig verändert zu haben. Die Fenster gingen nach Süden, auf den Platz hinaus, und an diesem Morgen schien die Sonne so warm durch die dünnen weißen Vorhänge, dass man fast auf das kleine Feuer im Kamin hätte verzichten können. Ursprünglich hatte sich hier der Salon befunden, doch jetzt diente das Zimmer gleichzeitig als Aufenthaltsraum und Bibliothek. An den Wänden reihten sich Bücherschränke aus Mahagoni, welche die wohl umfassendste kriminalistische Privatsammlung ganz Londons enthielten, darunter die vollständige Ausgabe der Reihen Bedeutende Prozesse Großbritanniens und Berühmte Gerichtsverhandlungen, sowie Standardwerke der Gerichtsmedizin, Studien zur forensischen Pathologie und ihren Richtlinien nebst einigen Erstausgaben, die der Club von Conan Doyle, Poe, Le Fanu und Wilkie Collins besaß, welch Letztere aber, wie um die angestammte Minderwertigkeit der Literatur gegenüber der Realität zu demonstrieren, separat in einem kleineren Regal untergebracht waren. Die große Mahagonivitrine mit den Raritäten, die der Club im Lauf der Jahre gesammelt hatte oder die ihm gestiftet worden waren, stand ebenfalls noch am alten Platz. Unter den Exponaten waren das Gebetbuch mit Constance Kents Namenszug auf dem Vorsatzblatt; die Duellpistole mit Steinschloss, mit der Reverend James Hackman angeblich den Mord an Margaret Wray, der Geliebten des Earl of Sandwich, begangen hatte; ein Fläschchen weißen Pulvers, angeblich Arsen, das im Besitz von Major Herbert Armstrong gefunden worden war. Seit Dalgliesh’ letztem Besuch war ein weiteres Souvenir hinzugekommen, das, zusammengerollt und unheimlich wie eine todbringende Schlange, den Ehrenplatz einnahm und auf dem dazugehörigen Hinweisschildchen als Crippens Henkersseil ausgewiesen wurde. Als Dalgliesh sich anschickte, Ackroyd aus der Bibliothek zu folgen, gab er in sanftem Plauderton zu bedenken, dass es barbarisch sei, dieses widerliche Ding öffentlich zur Schau zu stellen, eine Kritik, die Ackroyd ebenso sanft zurückwies.
»Vielleicht könnte man’s eine Spur morbid nennen, aber barbarisch geht denn doch ein bisschen zu weit. Schließlich sind wir hier nicht im Athenaeum. Und ein paar von den älteren Mitgliedern dürfte es ganz guttun, hin und wieder daran erinnert zu werden, wozu ihre früheren beruflichen Aktivitäten in letzter Konsequenz geführt haben. Wären Sie denn noch bei der Polizei, wenn wir die Todesstrafe nicht abgeschafft hätten?«
»Das weiß ich nicht. Aber aus der moralischen Zwickmühle hilft mir persönlich die Abschaffung der Todesstrafe nicht heraus, denn was mich angeht, so wäre mir der Tod lieber als zwanzig Jahre Haft.«
»Aber doch nicht der Tod durch den Strang?«
»Das freilich nicht, nein.«