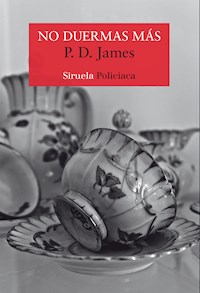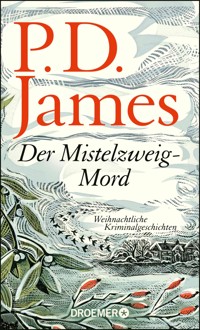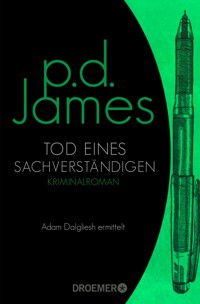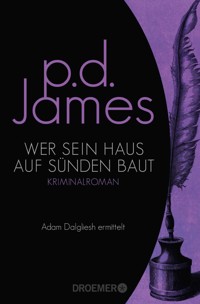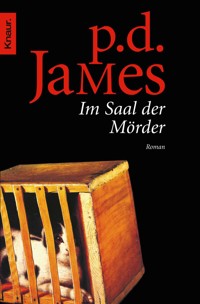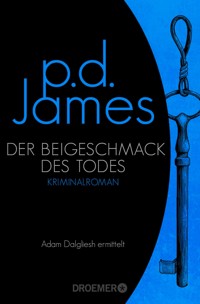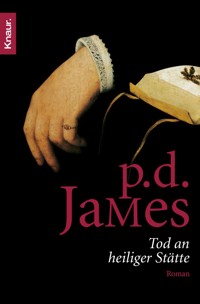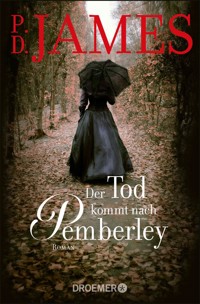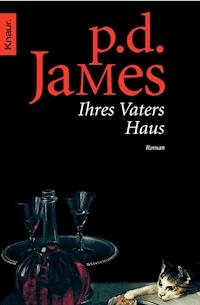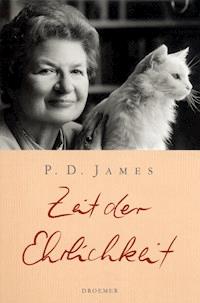6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dalgliesh-Romane
- Sprache: Deutsch
Die Kult-Reihe um Ermittler Adam Dalgliesh von »Queen of Crime« P. D. James: im deutschsprachigen Raum erstmals in modernisierten Neuausgaben und einheitlicher Ausstattung. Ein durchdringender Schrei stört die abendliche Ruhe. Superintendent Adam Dalgliesh verlässt überstürzt sein Literaten-Treffen, um in die nahegelegene psychiatrische Klinik zu eilen - wo er eine Frauenleiche mit einem Meißel im Herzen entdecken muss. Hinter der unauffälligen Fassade erweist sich die vornehme Nervenklinik bald als Intrigennest. Und der erfolgsverwöhnte Dalgliesh beginnt an sich zu zweifeln, als sich der Mörder als intellektuell ebenbürtig - und mehr als bereit zu weiteren Taten - erweist. Band 2 der Reihe um Commander Adam Dalgliesh. »P. D. James gehört zu den größten Schätzen britischer Erzählliteratur - Gott sei Dank ist hier die Welt des klassischen Detektivromans noch spürbar.« Mail on Sunday Ebenfalls als Neuausgabe lieferbar: »Ein Spiel zuviel« (Bd. 1) und »Ein unverhofftes Geständnis« (Bd. 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
P. D. James
EINE SEELE VON MÖRDER
KRIMINALROMANAdam Dalgliesh ermittelt
Aus dem Englischen von Thomas Schlück
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein durchdringender Schrei stört die abendliche Ruhe. Superintendent Adam Dalgliesh verlässt überstürzt sein Literaten-Treffen, um in die nahe gelegene psychiatrische Klinik zu eilen – wo er eine Frauenleiche mit einem Meißel im Herzen entdeckt. Hinter der unauffälligen Fassade erweist sich die vornehme Nervenklinik bald als Intrigennest. Und der erfolgsverwöhnte Dalgliesh beginnt, an sich zu zweifeln, als sich der Mörder als intellektuell ebenbürtig – und mehr als bereit zu weiteren Taten – erweist.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorbemerkung der Autorin
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Für Edward Gordon James
Vorbemerkung der Autorin
Es gibt in London nur wenige Kliniken, die ausschließlich der ambulanten psychiatrischen Behandlung dienen, und es versteht sich von selbst, dass diese Institute, die sich immerhin demselben medizinischen Fachgebiet widmen und dem vereinheitlichten Nationalen Gesundheitsdienst unterstehen, manche Behandlungsmethoden und Verwaltungsabläufe gemein haben. Einige dieser Berührungspunkte teilen sie mit der Steen-Klinik. Umso deutlicher muss gesagt werden, dass die Steen-Klinik eine erfundene Klinik an einem fiktiven Londoner Platz ist, dass keiner der Patienten oder Mitarbeiter, sei es das ärztliche oder sonstige Personal, einem lebenden Vorbild entspricht und dass die schrecklichen Dinge, die sich dort im Keller ereigneten, ihren Ursprung einzig und allein in einem ganz besonderen psychologischen Phänomen haben – in der Fantasie der Kriminalschriftstellerin.
P. D. J.
1. Kapitel
Dr. Paul Steiner, Psychotherapeut an der Steen-Klinik, saß im vorderen Sprechzimmer des Erdgeschosses und hörte sich an, wie außerordentlich rational sein Patient das Scheitern seiner dritten Ehe begründete. Mr Burge lag bequem auf der Couch, um die Verwicklungen seiner Psyche besser darlegen zu können. Dr. Steiner saß am Kopfende auf einem Stuhl jenen Typs, den der Verwaltungsrat nach eingehenden Tests für Konsultationen verordnet hatte. Es war ein funktionelles und nicht unansehnliches Möbel, das allerdings den Nacken nicht stützte. Wenn Dr. Steiner einen Augenblick lang abschaltete, rief ihn ein schmerzhaftes Zucken der Halsmuskeln wieder in die Wirklichkeit seiner psychotherapeutischen Sprechstunde zurück, die er jeden Freitagabend abhielt. Der Oktobertag war sehr warm gewesen. Nach zwei Wochen kräftigen Frostes, einer Zeit, in der das Klinikpersonal gefroren und gefleht hatte, war das offizielle Einschalten der Zentralheizung auf einen jener vollkommenen Herbsttage gefallen, da der Platz vor dem Gebäude von gelbem Licht überflutet war und die späten Astern in dem kleinen Vorgarten in hochsommerlicher Pracht bunt wie eine Palette geleuchtet hatten. Es war nun fast neunzehn Uhr. Draußen war die Wärme des Tages längst vergangen und hatte zuerst dem Nebel und dann einer kühlen Dunkelheit Platz gemacht. Doch hier im Innern der Klinik saß die Mittagshitze gefangen, und die Luft, die schwer und still in den Zimmern hing, schien von zu viel Reden verbraucht.
Mr Burge erging sich in nörgelndem Falsett über die Unreife, Kälte und Gefühllosigkeit seiner Frauen. Nicht unbeeinflusst von den Nachwirkungen eines umfangreichen Mittagessens und der unklugen Wahl eines Stücks Sahnekuchen zum Nachmittagstee, lief Dr. Steiners fachliches Urteil darauf hinaus, es sei noch nicht an der Zeit, auf den einen Fehler hinzuweisen, den die drei Damen Burge gemein hatten: den einzigartigen Mangel an Urteilsvermögen bei der Wahl ihres Partners. Mr Burge war noch nicht reif für die Konfrontation mit der eigenen Unzulänglichkeit.
Das Verhalten seines Patienten weckte in Dr. Steiner keine moralische Entrüstung. Es hätte sich auch mit dem Berufsethos schlecht vertragen, wenn ein derart unpassendes Gefühl sein Urteilsvermögen getrübt hätte. Nur wenige Dinge im Leben vermochten Dr. Steiners moralische Entrüstung anzustacheln, und die hatten meistens mit seiner Bequemlichkeit zu tun. Dabei ging es allerdings oft um die Steen-Klinik und ihre Verwaltung. So missbilligte er vor allen Dingen die Verwaltungschefin Ms Bolam, deren Interesse an der Anzahl der von ihm pro Sprechstunde empfangenen Patienten und an der Genauigkeit seiner Reisekostenabrechnungen er als Teil einer systematischen Verfolgungskampagne ansah. Er hatte auch etwas dagegen, dass seine Freitagabend-Sprechstunde mit Dr. James Baguleys Elektrokrampf-Therapie zusammenfiel, sodass seine Psychotherapie-Patienten, die ausnahmslos hochintelligent und sehr empfänglich waren für das Privileg, von ihm behandelt zu werden, das Wartezimmer mit dem gemischten Publikum aus depressiven Vorstadthausfrauen und ungebildeten Psychotikern teilen mussten, die Baguley geradezu sammelte. Dr. Steiner hatte es abgelehnt, eines der Sprechzimmer im dritten Obergeschoss zu benutzen. Die Zimmer oben waren durch Unterteilung der großen, eleganten georgischen Räume entstanden, und er hielt sie für schlecht proportionierte und unschöne Zellen, die weder seinem Rang noch der Bedeutung seiner Arbeit angemessen waren. Ebenso wenig hatte er es passend gefunden, seine Sprechstunde zu verlegen. Also hätte Baguley das tun müssen. Aber Dr. Baguley war stur geblieben, und auch hierin hatte Dr. Steiner den Einfluss Ms Bolams gesehen. Sein Antrag, die Sprechzimmer im Erdgeschoss schalldicht auszustatten, war vom Verwaltungsrat der Klinik aus Kostengründen abgelehnt worden. Es hatte jedoch keine Einwendungen gegeben, als es darum ging, Baguley ein neues und sehr teures Gerät zu genehmigen, mit dem er seine Patienten durch elektrische Impulse um das letzte bisschen Verstand brachte. Die Angelegenheit war natürlich im Ärzteausschuss der Klinik beraten worden, doch Ms Bolam hatte keinen Hehl daraus gemacht, wo ihre Sympathien lagen. In seinem Zorn über die Verwaltungschefin übersah es Dr. Steiner geflissentlich, dass sie nicht den geringsten Einfluss auf den Ärzteausschuss hatte.
Es war schwierig, den Ärger wegen der EKT-Sitzungen zu vergessen. Das Klinikgebäude stammte aus einer Zeit, da man noch für die Ewigkeit baute, doch selbst die dicke Eichentür des Sprechzimmers vermochte das lebhafte Kommen und Gehen an einem Freitagabend nicht zu dämpfen. Der Haupteingang wurde um achtzehn Uhr geschlossen, und die Patienten der Abendsprechstunden wurden sorgfältig notiert, seit einmal vor fünf Jahren eine Patientin unbemerkt ins Haus gekommen war, sich in der Kellertoilette versteckt und diesen ungesunden Ort zum Schauplatz ihres Selbstmordes gemacht hatte. Dr. Steiners psychotherapeutische Sitzungen wurden durch das Läuten an der Tür, durch Schritte der kommenden und gehenden Patienten und durch die lauten Stimmen von Verwandten und Begleitern unterbrochen, die dem Patienten Mut zusprachen oder sich von Schwester Ambrose verabschiedeten. Dr. Steiner fragte sich, warum es Verwandte für nötig hielten, die Patienten anzuschreien, als seien sie nicht nur psychotisch, sondern auch noch taub. Doch nach einer Behandlung durch Baguley und seine Teufelsmaschine musste man ja wohl mit allem rechnen. Am schlimmsten war jedoch die Hausgehilfin der Klinik, Mrs Shorthouse. Es musste doch einzurichten sein, dass Amy Shorthouse die Putzerei frühmorgens erledigte, wie es wohl der Norm entsprach. Auf diese Weise wäre das Klinikpersonal am wenigsten gestört worden. Aber Mrs Shorthouse vertrat den Standpunkt, dass sie die Arbeit nicht schaffte, ohne am Abend noch einmal zwei Stunden zuzulegen, und Ms Bolam war darauf eingegangen. Kein Wunder. Dr. Steiner hatte den Eindruck, als würde Freitagabend nicht viel geputzt. Mrs Shorthouse hatte nämlich ein Faible für die EKT-Patienten – Dr. Baguley hatte einmal sogar ihren Mann behandelt –, und während die Therapie im Gang war, trieb sie sich gewöhnlich im Flur und im Hauptbüro herum. Dr. Steiner hatte im Ärzteausschuss mehr als einmal die Sprache darauf gebracht und sich immer wieder über das Desinteresse seiner Kollegen geärgert. Mrs Shorthouse gehörte eigentlich hinter die Kulissen; sie durfte nicht herumstehen und mit den Patienten klatschen. Ms Bolam, die mit anderen vom Personal so unnötig streng verfuhr, dachte nicht daran, Mrs Shorthouse zur Ordnung zu rufen. Es war allgemein bekannt, dass gute Hausangestellte schwer zu kriegen waren, doch eine Verwaltungschefin, die sich auf ihre Arbeit verstand, hätte diese Hürde schon irgendwie genommen. Mit Schwäche ließ sich nichts erreichen. Aber Baguley war nicht dazu zu bringen, sich über Mrs Shorthouse zu beschweren, dabei hätte die Bolam niemals Kritik an Baguley geübt. Die arme Frau war wahrscheinlich in ihn verliebt. Es wäre an Baguley gewesen, eine strikte Haltung einzunehmen, anstatt in seinem lächerlich langen weißen Mantel, in dem er wie ein zweitklassiger Dentist aussah, in der Klinik herumzustolzieren. Wirklich, der Mann hatte keine Ahnung von dem Stil, in dem eine therapeutische Klinik geführt werden musste!
Stampf, stampf – wieder ging jemand durch den Flur. Wahrscheinlich der alte Tippett, ein chronischer Schizophreniepatient von Baguley, der schon seit neun Jahren jeden Freitagabend in der Abteilung für Ergotherapie verbrachte und Holzschnitzereien machte. Der Gedanke an Tippett steigerte Dr. Steiners Gereiztheit. Der Mann war in der Steen-Klinik fehl am Platz. Wenn es ihm so gut ging, dass er sich frei bewegen konnte – was Dr. Steiner eigentlich bezweifelte –, hätte er in einer Tagesklinik oder in einem Zentrum für Beschäftigungstherapie behandelt werden können. Patienten wie Tippett verschafften der Klinik einen zweifelhaften Ruf und stellten ihre wahre Funktion als analytisch orientiertes Psychotherapie-Zentrum infrage. Es war Dr. Steiner richtig peinlich, wenn einer seiner sorgfältig ausgesuchten Patienten freitags auf Tippett traf, wie der in der Klinik herumschlurfte. Tippett dürfte eigentlich gar nicht frei herumlaufen. Eines Tages würde etwas passieren, und dann steckte Baguley ordentlich in der Klemme.
Dr. Steiners heitere Vision von seinem Kollegen in der Klemme wurde durch die Klingel der Vordertür unterbrochen. Also wirklich, es war unmöglich! Diesmal handelte es sich anscheinend um einen Krankenfahrer, der einen Patienten abholen wollte. Mrs Shorthouse ging zur Tür, um die beiden zu verabschieden. Ihre schrille Stimme hallte unheimlich durch den Flur. »Macht’s gut, Leute! Bis nächste Woche! Bleibt sauber!«
Dr. Steiner zuckte unwillkürlich zusammen und schloss die Augen. Doch sein Patient, der sich zufrieden seinem Lieblingshobby widmete, über sich selbst zu sprechen, schien nichts gehört zu haben. Mr Burges quengelige Stimme hatte in den letzten zwanzig Minuten keinen Augenblick geschwiegen.
»Ich behaupte ja nicht, dass es leicht mit mir ist. O nein, ich bin höllisch kompliziert. Und das haben Theda und Sylvia nie begriffen. Das sitzt natürlich tief in mir. Erinnern Sie sich an unser Gespräch im Juni? Ich glaube, damals sind wir den Dingen auf den Grund gegangen.«
Sein Therapeut erinnerte sich nicht an das fragliche Gespräch, machte sich jedoch keine großen Sorgen. Bei Mr Burge lag das, was er für den Grund hielt, immer dicht unter der Oberfläche und tauchte auf jeden Fall auf. Eine unerklärliche Ruhe trat ein. Dr. Steiner kritzelte auf seinem Notizblock herum, betrachtete interessiert und besorgt seine Zeichnung, schaute sie sich noch einmal mit umgedrehtem Block an und beschäftigte sich einen Augenblick lang mehr mit dem eigenen Unbewussten als mit dem seines Patienten. Plötzlich drang neuer Lärm von außen in sein Bewusstsein, zuerst leise, dann immer lauter. Irgendwo schrie eine Frau. Es war ein schrecklicher Laut, hoch, anhaltend und animalisch. Dr. Steiner setzte er besonders unangenehm zu. Er war von Natur aus schüchtern und nervös. Obwohl ihn seine Arbeit gelegentlich mit Krisensituationen konfrontierte, lag es ihm doch mehr, Notfällen vorzubeugen, als damit fertigzuwerden. Seine Angst machte sich in Ärger Luft, und er sprang mit einem Aufschrei hoch.
»Nein! Wirklich, jetzt reicht es mir! Was denkt sich Ms Bolam eigentlich? Ist denn hier niemand zuständig?«
»Was ist los?«, erkundigte sich Mr Burge, richtete sich wie ein Springteufelchen auf und senkte seine Stimme um eine halbe Oktave in ihre normale Tonlage.
»Nichts. Nichts. Irgendeine Frau hat einen hysterischen Anfall, das ist alles. Bleiben Sie hier. Ich bin gleich zurück«, befahl Dr. Steiner.
Mr Burge ließ sich zurücksinken, behielt jedoch die Tür im Auge und spitzte die Ohren. Dr. Steiner trat in den Flur.
Sofort wandte sich eine kleine Gruppe um und blickte ihm entgegen. Jennifer Priddy, die jüngere Sekretärin, klammerte sich an einen der Pförtner, Peter Nagle, der ihr verlegen und mitleidig die Schulter tätschelte und verwirrt aussah. Auch Mrs Shorthouse war da. Das Schreien des Mädchens wurde zum Schluchzen, doch sie bebte noch am ganzen Körper und war leichenblass.
»Was ist los?«, fragte Dr. Steiner heftig. »Was hat sie?«
Ehe ihm jemand antworten konnte, ging die Tür zum EKT-Raum auf, und Dr. Baguley trat heraus, gefolgt von Schwester Ambrose und seiner Anästhesistin, Dr. Mary Ingram. Der Flur schien plötzlich voller Menschen zu sein. »Beruhigen Sie sich doch, ja, so ist’s brav«, sagte Dr. Baguley sanft. »Das hier ist eine Klinik.« Er wandte sich an Peter Nagle und fragte leise: »Was ist denn eigentlich los?«
Nagle schien etwas sagen zu wollen, doch da fing sich Ms Priddy plötzlich. Sie löste sich von Nagle, wandte sich an Dr. Baguley und sagte laut und deutlich: »Ms Bolam. Sie ist tot. Jemand hat sie umgebracht. Sie liegt im Archiv unten, ermordet. Ich habe sie gefunden. Enid ist ermordet worden!«
Sie klammerte sich an Nagle und fing erneut zu weinen an, doch diesmal ruhiger. Das schreckliche Zittern hatte aufgehört. Dr. Baguley sagte zu dem Pförtner: »Bringen Sie sie ins Sprechzimmer. Sie soll sich hinlegen. Am besten geben Sie ihr einen Schnaps. Hier ist der Schlüssel. Ich bin gleich zurück.«
Er ging zielstrebig auf die Kellertreppe zu, und die anderen überließen das Mädchen Nagles Obhut und folgten ihm dicht gedrängt. Das Kellergeschoss war gut beleuchtet; alle Räume wurden genutzt, weil die Klinik wie die meisten psychiatrischen Institute unter chronischem Raummangel litt. Hier befanden sich zusätzlich zum Heizraum, zur Telefonzentrale und zum Aufenthaltsraum der Pförtner die Abteilung für Ergotherapie, ein Archiv für Krankenakten und im vorderen Teil des Gebäudes ein Behandlungszimmer für LSD-Therapie. Als die kleine Gruppe am Fuß der Treppe ankam, öffnete sich die Tür zu diesem Zimmer, und Schwester Bolam, Ms Bolams Cousine, blickte heraus – in ihrer weißen Tracht wirkte sie vor der Dunkelheit des Zimmers wie eine geisterhafte Erscheinung. Ihre leise, verwirrte Stimme tönte den anderen durch den Korridor entgegen: »Stimmt was nicht? Mir war, als hätte ich vor ein paar Minuten einen Schrei gehört.«
Schwester Ambrose befahl brüsk: »Alles in Ordnung, Schwester. Gehen Sie wieder zu Ihrer Patientin.«
Die weiße Gestalt verschwand, und die Tür ging zu. Schwester Ambrose wandte sich an Mrs Shorthouse und fuhr fort: »Und Sie haben hier auch nichts verloren, Mrs Shorthouse. Bleiben Sie bitte oben. Ms Priddy möchte vielleicht eine Tasse Tee.«
Mrs Shorthouse murrte, zog sich jedoch, wenn auch widerstrebend, zurück. Die drei Ärzte, mit Schwester Ambrose im Schlepptau, eilten weiter.
Das Archiv lag zu ihrer Rechten, zwischen dem Aufenthaltsraum der Pförtner und der Abteilung für Ergotherapie. Die Tür stand offen, und das Licht brannte.
Dr. Steiner, dem jede Einzelheit überdeutlich auffiel, sah, dass der Schlüssel steckte. Niemand war zu sehen. Die mit Aktenheftern vollgepackten Stahlregale ragten bis zur Decke. Sie verliefen im rechten Winkel zur Tür und ließen ein paar schmale Gänge frei, die jeweils eine Neonröhre beleuchtete. Die vier hohen Fenster waren vergittert und durch die Regale unterteilt. Es war ein schlecht gelüfteter, kleiner Raum, der selten besucht und noch seltener sauber gemacht wurde. Die kleine Gruppe drängte sich durch den ersten Gang und wandte sich nach links, wo eine kleine fensterlose Fläche ausgespart war. Hier standen ein Stuhl und ein Tisch, auf dem die Ablage sortiert oder Akten eingesehen werden konnten. Es herrschte ein heilloses Durcheinander. Der Stuhl war umgeworfen. Auf dem Boden lagen Akten verstreut. Zum Teil waren die Deckblätter abgerissen, die Innenseiten zerfetzt; andere Mappen lagen in verrutschten Stapeln neben Lücken in den Regalen, die zu schmal aussahen, um ein solches Gewicht an Papier getragen zu haben. Im Zentrum des ganzen Durcheinanders ruhte auf der Papierflut wie eine plumpe, fehlbesetzte Ophelia Enid Bolams Leiche. An ihrer Brust lag eine groteske, große Holzpuppe. Ihre Hände waren um die Figur verschränkt, sodass sie wie das grausige Zerrbild einer Mutter mit dem Kind an der Brust aussah.
Kein Zweifel – sie war tot. Trotz Angst und Ekel drängte sich Dr. Steiner die unfehlbare Diagnose auf. Er starrte auf die Holzfigur und rief: »Tippett! Das ist sein Fetisch! Das ist die Schnitzarbeit, auf die er so stolz ist! Wo steckt er? Baguley, er ist Ihr Patient! Tun Sie was!«
Er sah sich nervös um, als erwarte er, Tippett erscheinen zu sehen – als personifizierte Gewalt, den Arm zum Schlag erhoben.
Dr. Baguley kniete neben der Toten und sagte leise: »Tippett ist heute Abend nicht hier.«
»Aber er kommt doch jeden Freitag! Das ist sein Fetisch! Das ist die Waffe!« Dr. Steiner schrie fassungslos gegen solche Begriffsstutzigkeit an.
Sanft hob Dr. Baguley mit dem Daumen Ms Bolams linkes Augenlid an. Ohne den Kopf zu heben, sagte er: »Das St. Luke hat heute Morgen hier angerufen. Tippett ist dort mit Lungenentzündung eingeliefert worden. Am Montag, glaube ich. Jedenfalls war er heute Abend nicht hier.« Plötzlich stieß er einen leisen Schrei aus. Die beiden Frauen beugten sich weiter vor. Dr. Steiner, der sich nicht dazu überwinden konnte, die Untersuchung zu verfolgen, hörte ihn sagen: »Sie ist außerdem noch erstochen worden! Sieht aus, als wäre ihr das Ding direkt ins Herz gedrungen, ein Meißel mit schwarzem Griff. Gehört der nicht zu Nagles Werkzeugen, Schwester?«
Eine Pause trat ein, und Dr. Steiner hörte die Stimme der Schwester: »Sieht ganz so aus, Herr Doktor. Seine Werkzeuge haben alle schwarze Griffe. Er hat sie drüben im Aufenthaltsraum.« Sie fügte verteidigend hinzu: »Da könnte jeder ran.«
»Es muss wohl einer drangekommen sein.« Dr. Steiner hörte, wie sich Dr. Baguley aufrichtete. Ohne den Blick von der Leiche zu wenden, sagte er: »Bitte rufen Sie Cully an der Pforte an, Schwester. Machen Sie ihn nicht nervös, aber sagen Sie ihm, niemand darf das Gebäude betreten oder verlassen. Auch die Patienten nicht. Dann verständigen Sie Dr. Etherege und bitten ihn herunterzukommen. Er müsste in seinem Sprechzimmer sein.«
»Sollten wir nicht die Polizei anrufen?«, fragte Dr. Ingram nervös, und ihr rosa Gesicht, das eine lächerliche Ähnlichkeit mit dem Gesicht eines Angorakaninchens aufwies, rötete sich noch mehr. Nicht nur in Augenblicken höchster Erregung wurde Dr. Ingram leicht übersehen, und Dr. Baguley starrte sie ausdruckslos an, als hätte er sie vorübergehend völlig vergessen.
»Wir warten auf den Chefarzt«, sagte er.
Schwester Ambrose verschwand, und ihre gestärkte Leinentracht raschelte bei jedem Schritt. Das nächste Telefon befand sich im Flur gleich neben der Tür des Archivs, doch durch die vielen Papierreihen von jeglichem Geräusch abgeschnitten, spitzte Dr. Steiner vergeblich die Ohren, um das Anheben des Hörers oder das Murmeln ihrer Stimme zu hören. Er musste sich dazu zwingen, noch einmal auf Ms Bolams Leiche zu schauen. Als sie noch lebte, hatte er sie für unverschämt und reizlos gehalten, und der Tod hatte ihr keine Würde verliehen. Sie lag mit angezogenen und gespreizten Knien auf dem Rücken, sodass man deutlich ein Stück rosa Wollschlüpfer sehen konnte, was viel unanständiger wirkte als nacktes Fleisch. Ihr rundes, schweres Gesicht war ganz friedlich. Die beiden dicken Zöpfe, die sie um den Kopf gewunden trug, schienen unbeeinträchtigt zu sein. Aber andererseits hatte nichts Ms Bolams altmodische Frisur durcheinanderbringen können. Dr. Steiner musste an seine private Fantasievorstellung denken, wonach die dicken, leblosen Zöpfe eigene geheimnisvolle Säfte absonderten und unverrückbar über der ruhigen Stirn festsaßen, in alle Ewigkeit. Während er die Gestalt betrachtete, die in der wehrlosen Schmach des Todes vor ihm lag, versuchte Dr. Steiner, Mitleid zu empfinden, und stieß dabei auf die Angst in seinem Herzen. An die Oberfläche drang jedoch nur der Ekel. Es war unmöglich, empfindsam auf etwas zu reagieren, das so lächerlich, so schockierend, so obszön war. Das hässliche Wort wirbelte ungebeten in sein Bewusstsein. Obszön! Er verspürte den lächerlichen Drang, ihr den Rock herabzuziehen, das aufgedunsene, klägliche Gesicht zu bedecken, die Brille zurechtzurücken, die ihr von der Nase gerutscht war und nun schräg am linken Ohr hing. Ihre Augen waren halb geschlossen, der kleine Mund geschürzt wie in Missbilligung eines so schmachvollen und unverdienten Endes. Dr. Steiner war mit diesem Blick durchaus vertraut; er hatte ihn oft erdulden müssen. Er dachte: Sie sieht aus, als hielte sie mir gerade meine Reisekostenabrechnungen vor.
Plötzlich erfasste ihn der unwiderstehliche Drang zu kichern. Zügelloses Gelächter brandete in ihm auf. Er erkannte, dass dieser schreckliche Impuls auf seine Nervosität und den Schock zurückzuführen war, doch dieses Begreifen brachte noch keine Kontrolle. Hilflos wandte er seinen Kollegen den Rücken zu und bemühte sich um Haltung, er ergriff die Kante eines Aktenregals und presste stützend die Stirn gegen das kalte Metall. Der trockene Staub der alten Akten stieg ihm unangenehm in Mund und Nase.
Er merkte nicht, dass Schwester Ambrose zurückkehrte, hörte sie aber plötzlich sprechen.
»Dr. Etherege ist schon unterwegs. Cully ist an der Pforte, und ich habe ihm gesagt, dass niemand gehen darf. Ihr Patient führt sich ziemlich schlimm auf, Dr. Steiner.«
»Dann sollte ich wohl zu ihm.« Als er nun eine Entscheidung treffen musste, bekam sich Dr. Steiner wieder in den Griff. Er hatte das Gefühl, es sei irgendwie wichtig, bei den anderen zu bleiben und zur Stelle zu sein, wenn der Chefarzt eintraf; es sei ratsam, dafür zu sorgen, dass ohne ihn nichts Wichtiges gesagt oder getan würde. Andererseits hatte er keine große Lust, bei der Leiche zu bleiben. Im Archiv, das grell erleuchtet war wie ein Operationssaal, zugleich aber klaustrophobisch eng und überhitzt, kam er sich wie ein gefangenes Tier vor. Die dicht stehenden Regale schienen ihn zu bedrängen und zwangen seinen Blick immer wieder zu der massigen Gestalt auf ihrer Totenbahre aus Papier.
»Ich bleibe hier«, entschied er. »Mr Burge muss sich eben gedulden wie alle anderen.«
Wortlos wartete die Gruppe. Dr. Steiner sah, dass Schwester Ambrose mit bleichem Gesicht, doch ansonsten offenbar unbewegt dastand, die Hände locker über der Schürze gefaltet. So musste sie in ihrer fast vierzigjährigen Laufbahn als Krankenschwester unzählige Male am Bett von Patienten gestanden und in stiller Ehrerbietung auf die Anordnungen des Arztes gewartet haben. Dr. Baguley nahm seine Zigaretten aus der Tasche, blickte die Packung einen Augenblick lang an, als sei er überrascht, sie in der Hand zu halten, und steckte sie wieder ein. Dr. Ingram schien lautlos vor sich hin zu weinen. Einmal glaubte Dr. Steiner sie murmeln zu hören: »Die arme Frau! Die arme Frau!«
Kurz darauf vernahmen sie Schritte, und dann war der Chefarzt da, gefolgt von der Psychologin Fredrica Saxon. Dr. Etherege kniete neben der Leiche nieder. Er berührte sie nicht, senkte aber den Kopf dicht vor Ms Bolams Gesicht, als wollte er sie küssen. Dr. Steiners wachen kleinen Augen entging der Blick nicht, den Ms Saxon Dr. Baguley zuwarf, ebenso wenig wie die instinktive Annäherung und das schnelle Zurückweichen der beiden.
»Was ist passiert?«, flüsterte sie. »Ist sie tot?«
»Ja. Anscheinend ermordet.« Baguleys Stimme war tonlos. Ms Saxon machte eine plötzliche Bewegung. Einen Augenblick lang hatte Dr. Steiner das verrückte Gefühl, sie wolle sich bekreuzigen.
»Wer hat es getan? Doch nicht der arme alte Tippett? Das ist doch sein Fetisch?«
»Ja, aber er ist nicht im Haus. Er liegt mit Lungenentzündung im St. Luke.«
»Oh, mein Gott! Wer dann?« Diesmal trat sie dicht neben Dr. Baguley, ohne dass die beiden wieder auf Distanz gingen. Dr. Etherege rappelte sich hoch.
»Sie haben natürlich recht. Sie ist tot. Anscheinend wurde sie zuerst betäubt und dann durch einen Stich ins Herz getötet. Ich gehe jetzt nach oben, um die Polizei anzurufen und das übrige Personal zu informieren. Wir halten die Leute am besten zusammen. Dann sollten wir drei das Gebäude durchsuchen. Natürlich dürfen wir nichts anfassen.«
Dr. Steiner wich Dr. Baguleys Blick aus. Dr. Etherege in seiner Rolle als ruhiger, allmächtiger Chef war ihm stets etwas lächerlich vorgekommen. Er vermutete, dass Baguley ähnlich dachte.
Plötzlich hörten sie Schritte, und die Sozialarbeiterin, Ms Ruth Kettle, erschien hinter den Aktenregalen und starrte kurzsichtig in die Runde.
»Ah, da sind Sie ja, Herr Direktor«, sagte Ms Kettle mit ihrer wohlklingenden, atemlosen Stimme. Dr. Steiner fiel ein, dass sie die Einzige war, die Dr. Etherege mit diesem lächerlichen Titel anredete, Gott allein wusste, warum. Hörte sich an, als wären sie in einem Sanatorium für Naturheilkunde.
»Cully hat mir gesagt, dass Sie hier unten sind. Ich hoffe, Sie sind nicht zu beschäftigt. Ich bin ganz verzweifelt. Ich will ja keinen Ärger machen, aber so geht das wirklich nicht! Ms Bolam hat mir für Montagmorgen um zehn Uhr einen neuen Patienten eingetragen. Ich habe den Termin gerade in meinem Kalender entdeckt. Natürlich hat sie nicht bei mir rückgefragt. Sie weiß genau, dass um die Zeit immer die Worrikers zu mir kommen. Es tut mir leid, aber ich glaube, das hat sie absichtlich getan. Ach, Herr Direktor, jemand muss endlich mal etwas gegen Ms Bolam unternehmen!«
Dr. Baguley trat zur Seite und sagte grimmig: »Schon geschehen.«
Auf der anderen Seite des Platzes nahm Superintendent Adam Dalgliesh von der Mordkommission an der traditionellen Sherry-Party seines Verlages teil, die im Herbst dieses Jahres zufällig mit der dritten Auflage seines ersten Gedichtbandes zusammentraf. Er überschätzte sein Talent oder den Erfolg seines Buches nicht. Die Gedichte, die seinen einsiedlerischen, ironischen und im Grunde ruhelosen Geist widerspiegelten, waren auf die richtige Stimmung im Publikum getroffen. Er glaubte nicht, dass auf lange Sicht mehr als ein halbes Dutzend bestehen würde, nicht einmal vor seinem Urteil. Doch zunächst fand er sich in den Untiefen eines unbekannten Meeres, in dem Literaturagenten, Honorarabrechnungen und Kritiken angenehme Gefahrenpunkte waren. Und jetzt diese Party. Er hatte sich darunter etwas vorgestellt, das er hinter sich bringen musste, doch der Abend war bisher unerwartet erfreulich verlaufen. Die Herren Hearne & Illingworth waren gleichermaßen unfähig, schlechten Sherry auszuschenken wie schlechte Bücher zu veröffentlichen. Dalgliesh schätzte, dass der Verlagsanteil an dem Gewinn aus seinem Buch in den ersten zehn Minuten vertrunken worden war. Der alte Sir Hubert Illingworth war kurz erschienen, hatte Dalgliesh traurig die Hand geschüttelt und war leise vor sich hin brummend weitergeschlurft, als beklage er es, dass schon wieder ein Autor des Hauses sich und seinen Verleger den zweifelhaften Freuden des Erfolgs aussetzte. Für ihn waren alle Autoren altkluge Kinder, die man ertragen und ermutigen musste, aber nicht zu sehr aufregen durfte, damit sie vor dem Zubettgehen nicht noch weinten.
Es gab auch weniger willkommene Ablenkungen als den kurzen Auftritt Sir Huberts. Nur wenige Gäste wussten, dass Dalgliesh Kriminalbeamter war, und nicht alle erwarteten, dass er über seine Arbeit sprach. Aber wie überall waren Leute darunter, die es unpassend fanden, dass ein Mann, der Mörder fing, auch Gedichte schrieb, und die diese Meinung mehr oder weniger taktvoll zum Ausdruck brachten. Wahrscheinlich wollten sie, dass Mörder gefangen wurden, wie sehr sie sich auch darüber streiten mochten, was hinterher mit ihnen geschehen sollte; doch zugleich offenbarten sie eine typische Zurückhaltung jenen gegenüber, die das Fangen besorgten. Dalgliesh war an diese Einstellung gewöhnt und fand sie weniger unangenehm als die weitverbreitete Annahme, dass es doch besonders ruhmvoll sein müsse, zur Mordkommission zu gehören. Aber wenn es auch die erwartete verstohlene Neugier und die Geistlosigkeiten gegeben hatte, die solchen Partys eigen sind, waren ihm doch auch angenehme Leute begegnet, die angenehme Dinge zu sagen wussten. Kein Autor, so uninteressiert an seinem Talent er sich auch gibt, ist immun gegen die leise Beruhigung beiläufig ausgesprochenen Lobes, und Dalgliesh, der den Verdacht bekämpfte, dass nur wenige sein Buch auch gekauft hatten, stellte fest, dass er sich ganz gut unterhielt, und war so ehrlich, sich den Grund dafür einzugestehen.
Die erste Stunde war ziemlich hektisch gewesen, doch kurz nach neunzehn Uhr stand er mit seinem Glas plötzlich allein neben dem reich verzierten James-Wyatt-Kamin. Ein kleines Holzfeuer brannte und erfüllte das Zimmer mit einem leichten Landduft. Es war einer jener unerklärlichen Augenblicke, da man inmitten einer Menschenmenge plötzlich völlig allein ist, da der Lärm gedämpft klingt und die herandrängenden Mitmenschen zurückzuweichen scheinen und zu entrückten, geheimnisvollen Schauspielern auf einer fernen Bühne werden. Dalgliesh lehnte den Hinterkopf an den Kaminsims und genoss die vorübergehende Abgeschiedenheit, wobei er zugleich die eleganten Proportionen des Zimmers bewunderte. Plötzlich sah er Deborah Riscoe. Sie musste unauffällig ins Zimmer gekommen sein. Er fragte sich, wie lange sie schon hier war. Sogleich wich das unbestimmte Gefühl des Friedens und Glücks einer so ausgeprägten und schmerzhaften Freude, als wäre er ein Junge, der sich eben zum ersten Mal verliebt hatte. Sie sah ihn sofort und kam mit dem Glas in der Hand quer durch den Raum auf ihn zu.
Ihr Erscheinen überraschte ihn sehr, doch er bildete sich nicht ein, dass sie etwa seinetwegen hier war. Nach ihrer letzten Begegnung war das kaum anzunehmen.
»Es ist schön, dass ich Sie hier treffe.«
»Ich wäre auch so gekommen«, erwiderte sie, »aber inzwischen arbeite ich hier. Felix Hearne hat mir den Posten verschafft, als Mutter starb. Ich mache mich hier nützlich, als Mädchen für alles. Auch Steno und Schreibmaschine. Ich habe einen Kurs belegt.«
Er lächelte. »So wie Sie’s sagen, hört es sich fast wie eine Kur an.«
»Na ja, irgendwie war’s das wohl auch.«
Er tat nicht, als hätte er das nicht verstanden. Beide schwiegen. Dalgliesh reagierte auf jede Erwähnung des Falles, der vor knapp drei Jahren zu ihrer ersten Begegnung geführt hatte, ungemein empfindlich. Diese Wunde vertrug auch nicht die geringste Berührung. Er hatte vor etwa sechs Monaten die Todesanzeige ihrer Mutter in der Zeitung gelesen, doch es war ihm damals unmöglich und anmaßend erschienen, ihr eine Nachricht zukommen zu lassen oder auch nur die üblichen Beileidsworte auszusprechen. Schließlich war er ja mitschuldig an ihrem Tod. Auch jetzt fiel es ihm nicht leichter. So unterhielten sie sich nur über seine Gedichte und ihre Arbeit. Er steuerte seinen Teil zu diesem entspannten und anspruchslosen Geplauder bei und fragte sich, was sie wohl sagen würde, wenn er sie jetzt zum Abendessen einlud. Wenn sie nicht sofort ablehnte – was sie wahrscheinlich tat –, mochte das für ihn der Anfang eines neuen Engagements sein.
Er machte sich nicht vor, er wolle vielleicht nur angenehm speisen mit einer Frau, die er zufällig für schön hielt. Er hatte keine Ahnung, was sie von ihm dachte, doch was ihn betraf, so war er seit ihrer letzten Zusammenkunft im Begriff, sich in sie zu verlieben. Wenn sie mitkam – heute oder sonst wann –, war sein Einsiedlerleben bedroht. Er erkannte dies mit absoluter Gewissheit, und dieses Wissen erschreckte ihn. Seitdem seine Frau im Wochenbett gestorben war, hatte er sich sorgfältig von allem ferngehalten, was ihm wehtun konnte; Sex war wenig mehr als eine Geschicklichkeitsübung, eine Liebesaffäre nur eine emotionale Pavane, die förmlich und nach den Regeln getanzt wurde, ohne dass man zu etwas verpflichtet war. Aber natürlich würde sie nicht zusagen. Er hatte absolut keinen Grund zu der Annahme, dass sie sich für ihn interessierte. Und nur diese Gewissheit verlieh ihm überhaupt die Kraft, solchen Gedanken nachzuhängen. Trotzdem war er in Versuchung, sein Glück auf die Probe zu stellen. Während sie sich unterhielten, ging er im Geist die Worte durch und war dabei nicht wenig amüsiert, dass er sich nach so vielen Jahren wieder unsicher fühlte wie ein junger Mann.
Die leichte Berührung an der Schulter überraschte ihn. Es war die Sekretärin des Verlagsleiters, die ihm mitteilte, dass er am Telefon verlangt werde. »Der Yard, Mr Dalgliesh«, sagte sie mit zurückhaltendem Interesse, als würden Autoren von Hearne & Illingworth jeden Tag vom Yard angerufen.
Er lächelte Deborah Riscoe entschuldigend an, und sie zuckte resigniert die Achseln.
»Dauert nicht lange«, sagte er, doch als er sich zwischen den plaudernden Partygästen hindurchdrängte, wusste er schon, dass er nicht zurückkommen würde.
Er nahm das Gespräch in einem kleinen Büro neben dem Konferenzzimmer entgegen. Dazu musste er sich zwischen Stühlen voller Manuskripte, zusammengerollter Fahnenabzüge und staubiger Akten zum Telefon durchkämpfen. Hearne & Illingworth pflegte eine Atmosphäre altmodischer Betulichkeit und allgemeinen Durcheinanders, hinter der sich – manchmal zum Leidwesen der Autoren – furchterregende Effizienz und Liebe zum Detail verbargen.
Die bekannte Stimme dröhnte ihm ins Ohr.
»Sind Sie das, Adam? Wie läuft die Party? Ach, gut. Tut mir leid, dass ich sie sprenge, aber ich wäre dankbar, wenn Sie sich mal in der Gegend einschalten. Steen-Klinik, Nummer 31. Sie kennen den Laden ja. Nur für Neurosen der Oberschicht. Anscheinend hat die Sekretärin oder Verwaltungschefin oder wie die das nennen, sich ermorden lassen. Im Keller auf den Kopf gehauen und dann fachmännisch durchs Herz gestochen. Die Jungs sind schon unterwegs. Ich habe Ihnen natürlich Martin geschickt. Er bringt Ihre Sachen mit.«
»Vielen Dank, Sir. Wann kam die Meldung?«
»Vor drei Minuten. Der Chefarzt hat angerufen. Er gab mir von praktisch allen Leuten ein präzises Alibi für die mutmaßliche Todeszeit und setzte mir dann auseinander, warum der Täter nicht zu seinen Patienten zählen könne. Dann kam ein Arzt namens Steiner an den Apparat. Er sagte, wir hätten uns vor fünf Jahren bei einem Abendessen seines inzwischen verstorbenen Schwagers kennengelernt. Dr. Steiner erklärte mir, warum er nicht der Täter sein könne, und beglückte mich dann mit seiner Interpretation vom Seelenleben des Mörders. Die Leute da haben alle gute Krimis gelesen. Niemand hat die Leiche angefasst, sie lassen niemanden rein oder raus und haben sich alle in einem Raum versammelt, um sich gegenseitig im Auge zu behalten. Beeilen Sie sich lieber, Adam, sonst haben sie den Mörder, ehe Sie drüben sind.«
»Wer ist der Chefarzt?«, fragte Dalgliesh.
»Dr. Henry Etherege. Sie haben ihn bestimmt schon im Fernsehen gesehen. Er ist der Psychiater des Establishments und lebt dafür, seinen Beruf ehrbar zu machen. Distinguierter Typ, unerschütterlich und eifrig bei der Sache.«
»Ich habe ihn vor Gericht erlebt«, sagte Dalgliesh.
»Ach ja. Erinnern Sie sich an seinen Auftritt beim Routledge-Fall? Er hat mich fast zu Tränen gerührt, dabei kannte ich Routledge doch besser als die meisten. Etherege ist der ideale Gutachter für die Verteidigung – wenn sie ihn kriegen kann. Sie kennen doch das Gerede. Gesucht: ein Psychiater, der ehrbar aussieht, Englisch spricht und weder die Jury schockiert noch den Richter gegen sich aufbringt. Antwort: Etherege. Na ja, viel Glück.«
Die Annahme des stellvertretenden Polizeichefs, sein Anruf könne die Party sprengen, war recht optimistisch. Das Fest war längst in einem Stadium, da das Verschwinden eines einzelnen Gastes niemanden mehr störte. Dalgliesh bedankte sich bei seinem Gastgeber, verabschiedete sich mit einer Handbewegung bei den wenigen Leuten, die ihm in den Weg liefen, und verließ fast unbemerkt das Gebäude. Deborah Riscoe sah er nicht mehr und gab sich auch keine Mühe, sie zu suchen. In Gedanken war er bereits bei der bevorstehenden Aufgabe, und er hatte das Gefühl, dass er irgendwie gerettet worden war – bestenfalls vor einer Zurückweisung und schlimmstenfalls vor einer Dummheit. Es war eine kurze, verlockende, ergebnislose und beunruhigende Begegnung gewesen, die aber bereits der Vergangenheit angehörte.
Er wanderte über den Platz auf das große georgische Gebäude zu, das die Steen-Klinik beherbergte, und rief sich dabei die wenigen Dinge ins Gedächtnis, die er über das Institut wusste. Es wurde oft gespottet, dass man schon ungewöhnlich normal sein musste, um zur Behandlung in der Steen-Klinik angenommen zu werden. Jedenfalls hatte das Haus den – nach Dalglieshs Meinung vielleicht unverdienten – Ruf, sich seine Patienten mehr unter dem Aspekt der Intelligenz und der Gesellschaftsschicht als nach dem Geisteszustand auszusuchen. Die Patienten wurden angeblich diagnostischen Verfahren unterworfen, die geeignet waren, alle weniger Begeisterten abzuschrecken. Die Unverdrossenen wurden dann, so hieß es, auf eine Warteliste gesetzt, die so lang war, dass die Zeit ihr heilendes Werk tun konnte, ehe der Patient endlich zu seiner ersten Psychotherapie-Sitzung erschien. Die Steen-Klinik, das fiel Dalgliesh jetzt ein, besaß auch einen Modigliani. Es war kein bekanntes Bild, auch stammte es nicht aus der besten Zeit des Künstlers, aber es war unleugbar ein Modigliani. Das Gemälde hing im Konferenzzimmer des ersten Stocks, gestiftet von einem dankbaren Patienten, und es war in mancher Hinsicht ein Symbol für das, was die Klinik in der öffentlichen Meinung darstellte. Andere Institute des Nationalen Gesundheitsdienstes schmückten ihre Wände mit Reproduktionen aus dem Bildkatalog des Roten Kreuzes. Das Steen-Personal jedoch machte keinen Hehl daraus, dass es ein zweitklassiges Original jederzeit einer erstklassigen Reproduktion vorzog. Und zum Beweis hatte man wirklich ein zweitklassiges Original anzubieten.
Das Gebäude war Teil einer ganzen georgischen Häuserreihe. Es stand an der Südecke des Platzes, angenehm, bescheiden und rundherum gefällig. Auf der Rückseite verlief eine schmale Gasse zur Lincoln Square Mews. Die Lichtschächte des Kellergeschosses waren umzäunt; an der Vorderfront zogen sich Geländer zu beiden Seiten der breiten Eingangstreppe empor, und darauf saßen zwei schmiedeeiserne Laternen. Rechts von der Tür trug ein unauffälliges Bronzeschild den Namen des Verwaltungsrats, der für dieses Institut zuständig war, und darunter die Worte »Steen-Klinik«. Weitere Informationen wurden nicht gegeben. Das Institut posaunte seine Funktion nicht in die vulgäre Welt hinaus und wünschte sich auch keinen Zustrom geisteskranker Laufkundschaft, die behandelt oder beruhigt werden wollte. Vier Wagen standen vor dem Gebäude, doch von der Polizei war noch nichts zu sehen. Das Haus wirkte sehr ruhig. Die Tür war geschlossen, doch durch die elegante Lünette über der Tür und hinter den zugezogenen Vorhängen im Erdgeschoss schimmerte Licht.
Die Tür wurde aufgerissen, kaum dass er den Finger vom Klingelknopf genommen hatte. Man erwartete ihn also schon. Ein stämmiger junger Mann in Pförtneruniform öffnete ihm die Tür und ließ ihn wortlos eintreten. Der Flur war hell erleuchtet und wirkte nach der Kühle des Herbstabends sehr warm. Links von der Tür befand sich ein verglaster Empfangstresen mit einer Telefonvermittlung. Ein zweiter und viel älterer Pförtner saß davor. Er wirkte ausgesprochen elend. Er sah sich um, musterte Dalgliesh kurz mit feuchten Augen und setzte dann seine Betrachtung der Telefonanlage fort, als vermehre die Ankunft des Superintendenten eine unerträgliche Last, die vielleicht, wenn er sie ignorierte, von ihm genommen würde. Von der Mitte des Flurs her näherte sich das Empfangskomitee, der Chefarzt mit ausgestreckter Hand, als hieße er einen Gast willkommen. »Superintendent Dalgliesh? Wir freuen uns. Ich möchte Ihnen meinen Kollegen Dr. James Baguley und den Sekretär des Verwaltungsrats, Mr Lauder, vorstellen.«
»Sie sind aber schnell gekommen, Sir«, sagte Dalgliesh zu Lauder. Der Sekretär erwiderte: »Von dem Mord habe ich erst erfahren, als ich vor zwei Minuten eintraf. Ms Bolam rief mich heute gegen Mittag an und sagte, sie müsse mich dringend sprechen. Irgendetwas gehe in der Klinik vor, und sie brauche meinen Rat. Ich kam so schnell wie möglich und muss nun feststellen, dass sie ermordet worden ist. Unter diesen Umständen hatte ich mehr als einen Grund, hierzubleiben. Anscheinend brauchte sie meinen Rat dringender, als sie ahnte.«
»Was immer es war, Sie sind wohl leider zu spät gekommen«, sagte Dr. Etherege.
Dalgliesh bemerkte, dass der Mann viel kleiner war, als er im Fernsehen wirkte. Sein großer, runder Kopf mit dem Heiligenschein aus weißem Haar, das weich und dünn war wie das eines Säuglings, wirkte zu schwer für den schmalen Körper, der unabhängig von seinem Gesicht gealtert zu sein schien und ihm ein seltsam aufgelöstes Aussehen verlieh. Es war schwierig, sein Alter zu schätzen, aber Dalgliesh hielt ihn eher für siebzig als fünfundsechzig, das normale Pensionsalter für einen Klinikarzt. Er hatte das Gesicht eines unverwüstlichen Zwergs, mit hektisch geröteten Wangen, sodass sie fast angemalt wirkten, und vorspringenden Brauen über stechend blauen Augen. Dalgliesh stellte sich vor, dass diese Augen und die leise, überzeugende Stimme nicht die unwichtigsten beruflichen Vorzüge des Chefarztes waren.
Im Gegensatz dazu war Dr. James Baguley einen Meter achtzig groß, fast so groß also wie Dalgliesh, und machte auf den ersten Blick einen überarbeiteten Eindruck. Er trug einen langen weißen Kittel, der ihm lose von den gebeugten Schultern hing. Obwohl er viel jünger war, hatte er nichts von der Vitalität des Chefarztes. Sein Haar war glatt und wurde bereits eisengrau. Von Zeit zu Zeit strich er sich mit langen, nikotinverfärbten Fingern eine Strähne aus dem Gesicht. Er hatte ein gut geschnittenes, knochiges Gesicht, doch Haut und Augen wirkten irgendwie matt, als habe er sich seit vielen Jahren nicht mehr richtig ausgeruht.
»Sie wollen natürlich sofort die Leiche sehen«, sagte der Chefarzt. »Ich möchte Peter Nagle, unseren zweiten Pförtner, bitten, uns zu begleiten, wenn Sie nichts dagegen haben. Sein Meißel war eine der vom Täter benutzten Waffen – nicht dass er etwas dafür könnte, der arme Bursche –, und sicher wollen Sie ihm Fragen stellen.«
»Ich möchte nach und nach alle hier befragen«, erwiderte Dalgliesh.
Kein Zweifel – der Chefarzt hatte die Zügel in die Hand genommen. Dr. Baguley, der noch kein Wort gesagt hatte, schien mit dieser Entwicklung der Dinge ganz einverstanden, während sich Lauder offenbar entschlossen hatte, den Beobachter zu spielen. Als sie sich der Kellertreppe im hinteren Teil des Flurs näherten, sahen sich die beiden Männer an. Lauders kurzer Blick war schwer zu deuten, doch Dalgliesh glaubte, einen amüsierten Schimmer und eine gewisse Neutralität darin zu erkennen.
Die anderen standen stumm herum, während Dalgliesh neben der Leiche kniete. Er berührte sie nicht, außer um Wolljacke und Bluse zur Seite zu heben, die beide aufgeknöpft waren, um den Meißelgriff freizulegen. Das Werkzeug war bis zum Heft in den Körper getrieben worden. Das Gewebe war kaum verletzt, und es gab kein Blut. Das Unterhemd der Frau war über ihre Brüste hochgerollt worden, um das Fleisch für den wohlberechneten Todesstoß freizulegen. Diese Vorsorge ließ darauf schließen, dass der Mörder über ausreichende anatomische Kenntnisse verfügte. Es gab leichtere Mordmethoden, als jemanden mit dem ersten Stoß ins Herz zu treffen. Doch wer das Wissen und die notwendige Körperkraft besaß – für den gab es kaum ein sichereres Verfahren.
Er richtete sich auf und wandte sich an Peter Nagle.
»Ist das Ihr Meißel?«
»Anscheinend. Das Ding sieht wenigstens so aus, und meiner ist nicht im Kasten.« Obwohl das übliche »Sir« fehlte, lag in der gebildeten und tonlosen Stimme keine Spur von Frechheit oder Entrüstung.
»Haben Sie eine Vorstellung, wie der Meißel hierhergekommen ist?«, fragte Dalgliesh.
»Absolut nicht. Aber wenn ich etwas wüsste, würde ich’s wohl kaum sagen, oder?«
Der Chefarzt runzelte die Stirn, blickte Nagle warnend an und legte ihm kurz die Hand auf die Schulter. Ohne sich mit Dalgliesh abzustimmen, sagte er leise: »Das wäre im Augenblick alles, Nagle. Bitte warten Sie draußen.«
Dalgliesh erhob keine Einwände, als sich der Pförtner still und leise aus der Gruppe löste und wortlos verschwand.
»Armer Junge! Die Verwendung seines Meißels hat ihn natürlich schockiert. Sieht ganz nach einem Versuch aus, ihn zu belasten. Aber Sie werden feststellen, Superintendent, dass Nagle einer der wenigen Klinikangehörigen ist, die ein lückenloses Alibi für die mutmaßliche Tatzeit haben.« Dalgliesh ging nicht darauf ein, dass dieser Umstand an sich sehr verdächtig war.
»Haben Sie berechnet, wann der Tod eingetreten ist?«, fragte er.
Dr. Etherege erwiderte: »Ich glaube, dass es noch nicht lange her sein kann. Das ist auch Dr. Baguleys Meinung. Es ist heute sehr warm in der Klinik – wir haben gerade unsere Zentralheizung in Betrieb genommen –, sodass die Leiche nur sehr langsam abkühlt. Ich habe sie auf Leichenstarre untersucht. Natürlich bin ich in diesen Dingen ein Laie. Aber ich konnte zumindest feststellen, dass die Frau höchstens eine Stunde zuvor gestorben war. Natürlich haben wir uns miteinander beraten, während wir auf Sie warteten, und es hat den Anschein, als sei Schwester Ambrose die Letzte gewesen, die Ms Bolam lebend gesehen hat. Das war um zwanzig nach sechs. Cully, unser älterer Pförtner, sagt, Ms Bolam habe ihn gegen achtzehn Uhr fünfzehn über das Haustelefon angerufen und ihm gesagt, sie gehe in den Keller, und wenn Mr Lauder da sei, solle er ihn in ihr Büro führen. Soweit sich Schwester Ambrose erinnert, kam sie ein paar Minuten später aus dem EKT-Raum im Erdgeschoss und ging über den Flur zum Wartezimmer, um einem Ehemann Bescheid zu geben, dass er seine Frau nun nach Hause bringen könnte. Schwester Ambrose sah Ms Bolam durch den Gang auf die Kellertreppe zugehen. Danach hat sie niemand mehr lebend gesehen.«
»Außer dem Mörder«, sagte Dalgliesh.
Dr. Etherege sah ihn überrascht an.
»Ja, das stimmt wohl. Natürlich. Ich meine, dass niemand von uns sie noch lebend gesehen hat. Ich habe Schwester Ambrose nach der Zeit gefragt, und sie ist ziemlich sicher …«
»Ich werde mich noch mit Schwester Ambrose und dem anderen Pförtner unterhalten.«
»Natürlich. Natürlich wollen Sie mit uns allen sprechen. Wir haben ja damit gerechnet. Während wir warteten, haben wir zu Hause angerufen und Bescheid gesagt, dass es heute wohl später würde, aber ohne einen Grund zu nennen. Wir haben bereits das Gebäude durchsucht und uns vergewissert, dass die Kellertür und der Hintereingang im Erdgeschoss verriegelt waren. Hier am Tatort ist natürlich nichts angefasst worden. Ich habe dafür gesorgt, dass das Personal im vorderen Sprechzimmer zusammenbleibt, außer Schwester Ambrose und Schwester Bolam, die mit den verbleibenden Patienten im Wartezimmer sitzen. Außer Mr Lauder und Ihnen ist niemand ins Haus gelassen worden.«
»Sie scheinen ja an alles gedacht zu haben, Doktor«, sagte Dalgliesh, erhob sich von den Knien und blickte auf die Leiche hinab.
»Wer hat sie gefunden?«, fragte er.
»Eine unserer Sekretärinnen, Jennifer Priddy. Cully, der ältere Pförtner, klagt schon seit heute Morgen über Magenschmerzen, und Ms Priddy ging Ms Bolam suchen, um zu fragen, ob er nicht früher nach Hause gehen könnte. Ms Priddy ist ziemlich durcheinander, doch sie konnte mir sagen …«
»Es wäre wohl besser, wenn ich das von ihr direkt erfahre. Ist diese Tür für gewöhnlich abgeschlossen?«
Obwohl er durchaus höflich sprach, spürte er Befremden. Der Chefarzt antwortete in unverändertem Ton: »Normalerweise ja. Der Schlüssel hängt mit anderen Klinikschlüsseln hier im Keller an einem Brett im Dienstzimmer der Pförtner. Dort wurde auch der Meißel aufbewahrt.«
»Und der Fetisch?«
»Der stammt aus dem Ergotherapieraum auf der anderen Seite. Einer unserer Patienten hat ihn geschnitzt.«
Noch immer gab der Chefarzt die Antworten. Bisher hatte Dr. Baguley kein Wort von sich gegeben. Plötzlich sagte er: »Sie ist mit dem Fetisch niedergeschlagen und dann durch einen Stich ins Herz getötet worden. Der Täter muss entweder sachkundig sein oder viel Glück gehabt haben. Das lässt sich schon erkennen. Nicht so klar ist, warum die beiden so in den Akten herumgewühlt haben. Ms Bolam liegt auf den Mappen, also muss das vor dem Mord geschehen sein.«
»Vielleicht das Ergebnis eines Kampfes«, meinte Dr. Etherege.
»Danach sieht es nicht aus. Die Akten sind aus den Regalen gezogen und absichtlich verstreut worden. Dafür muss es einen Grund geben. Dieser Mord ist keine impulsive Tat.«
In diesem Augenblick kam Peter Nagle, der offenbar vor der Tür gestanden hatte, wieder in den Raum.
»Es hat vorn geklingelt, Sir. Könnten das die übrigen Beamten sein?« Dalgliesh merkte sich, dass das Archiv schalldicht war. Obwohl die Haustürklingel ziemlich durchdringend läutete, hatte er sie nicht gehört.
»Gut«, sagte er. »Wir gehen nach oben.«
Als sie sich zusammen der Treppe näherten, sagte Dr. Etherege: »Superintendent, lässt es sich wohl einrichten, dass Sie erst mit den Patienten sprechen? Wir haben nur noch zwei im Haus, einen Psychotherapie-Patienten meines Kollegen Dr. Steiner und eine Frau, die hier im Keller mit LSD behandelt worden ist. Dr. Baguley kann Ihnen die Behandlung erklären – die Frau ist seine Patientin –, doch Sie können versichert sein, dass sie ihr Bett erst vor wenigen Minuten verlassen konnte und bestimmt nichts über den Mord weiß. Die Patienten sind bei dieser Behandlung immer völlig desorientiert. Schwester Bolam war den ganzen Abend bei ihr.«
»Schwester Bolam? Ist sie mit der Toten verwandt?«
»Ihre Cousine«, sagte Dr. Baguley kurz angebunden.
»Und Ihre desorientierte Patientin? Hätte sie etwas gemerkt, wenn Schwester Bolam während der Behandlung weggegangen wäre?«
»Das würde Schwester Bolam nicht tun«, sagte Dr. Baguley knapp.
Sie stiegen zusammen die Treppe hinauf. Vom Flur tönte ihnen bereits Stimmengewirr entgegen.