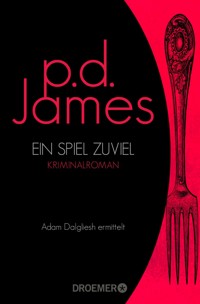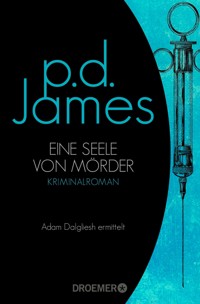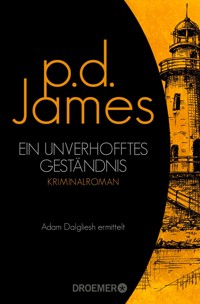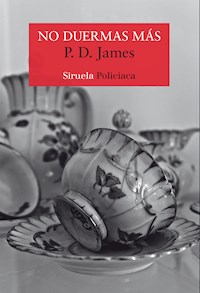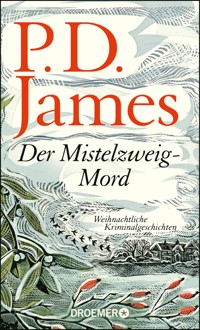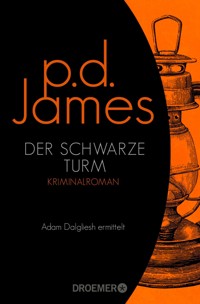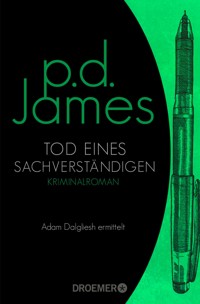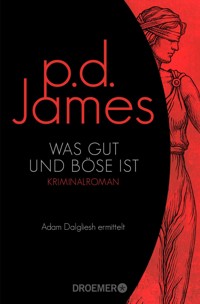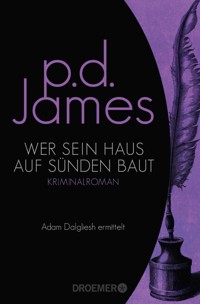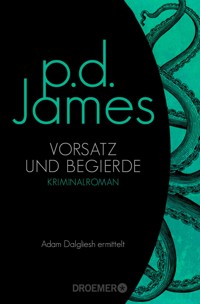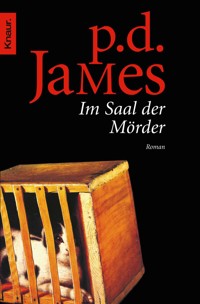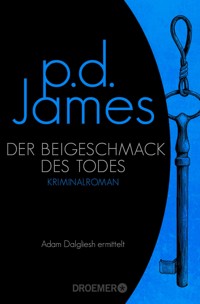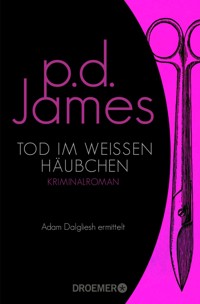
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dalgliesh-Romane
- Sprache: Deutsch
P. D. James' berühmteste Krimi-Reihe um Adam Dalgliesh zum Neu- und Wiederentdecken An der renommierten englischen Schwesternschule Nightingale House soll die Funktionsweise von künstlicher Ernährung demonstriert werden. Dafür hat sich eine Schwesternschülerin als »Patientin« zur Verfügung gestellt. Hilflos müssen ihre Mitschülerinnen kurz darauf mit ansehen, wie die junge Frau grausam zu Tode kommt. Unfall oder Mord? Als wenig später im Schwesternwohnheim eine weitere Leiche gefunden wird, ist klar: Im ländlichen England der 70er-Jahre muss Adam Dalgliesh einen Mörder stellen, der das Töten als Heilmittel für alle Übel dieser Welt versteht. Band 4 der Reihe um Commander Adam Dalgliesh. »Was P. D. James von allen anderen ›Queens of Crime‹ unterscheidet, ist die Wirklichkeitsnähe ihrer Geschichten. Zwar bedient sie sich der Spannungselemente der klassischen Detektivgeschichte, aber sie schreibt am Ende realistische Gesellschaftsromane.« Nina Grunenberg, DIE ZEIT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
P. D. James
Tod im weißen Häubchen
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Wolfdietrich Müller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
An der renommierten Schwesternschule Nightingale House soll die Funktionsweise von künstlicher Ernährung demonstriert werden. Dafür hat sich eine Schwesternschülerin als »Patientin« zur Verfügung gestellt. Hilflos müssen ihre Mitschülerinnen kurz darauf mit ansehen, wie die junge Frau unter grausamen Umständen zu Tode kommt. Unfall oder Mord? Als wenig später im Schwesternwohnheim eine weitere Leiche gefunden wird, ist klar: Im ländlichen England der 70er-Jahre muss Commander Adam Dalgliesh einen Mörder stellen, der das Töten als Heilmittel für alle Übel dieser Welt versteht.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorführung eines Todesfalls
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Windstille um Mitternacht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Fremde im Haus
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Fragen und Antworten
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Tischgespräch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Am Ende eines langen Tages
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Danse macabre
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Ein Kreis verbrannter Erde
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Sommerlicher Epilog
1. Kapitel
2. Kapitel
Für J. M. C.
Vorführung eines Todesfalls
1
Am Morgen des ersten Mordes wachte Ms Muriel Beale, Inspektorin der Krankenpflegeschulen bei der Allgemeinen Schwesternaufsicht, kurz nach sechs Uhr auf. Langsam wurde ihr bewusst, dass heute Montag, der zwölfte Januar, war und die Inspektion des John-Carpendar-Krankenhauses auf dem Programm stand. Noch im Halbschlaf hatte sie die ersten vertrauten Geräusche des neuen Tages wahrgenommen: Angelas Wecker, der zu läuten aufgehört hatte, bevor ihr das Läuten bewusst geworden war; Angela, die wie ein schwerfälliges, aber freundliches Tier durch die Wohnung schlurfte und brummelte; das angenehme Klirren des Geschirrs, das ihr sagte, dass der Morgentee im Entstehen war. Sie zwang sich, die Augen aufzumachen, und widerstand dem Drang, sich tiefer in die schützende Wärme ihres Bettes zu kuscheln und die Gedanken wieder in glückliche Bewusstlosigkeit treiben zu lassen.
Warum nur hatte sie Oberin Taylor mitgeteilt, sie würde kurz nach neun ankommen, um an der ersten Unterrichtsstunde des dritten Jahrgangs teilzunehmen? Es war lächerlich, unsinnig früh. Das Krankenhaus lag in Heatheringfield, an der Grenze zwischen Sussex und Hampshire, fast fünfzig Meilen von hier. Sie würde einen Teil der Strecke noch bei Dunkelheit fahren müssen. Und es regnete, wie es die ganze vergangene Woche mit trostloser Ausdauer geregnet hatte. Sie konnte das gedämpfte Zischen der Autoreifen auf der Cromwell Road hören, und ab und zu prasselte der Regen an die Fensterscheiben. Zum Glück hatte sie den Plan von Heatheringfield schon studiert und die genaue Lage des Krankenhauses ausfindig gemacht. Eine lebendige Marktstadt konnte einen Autofahrer, besonders wenn er fremd war, ziemlich viel Zeit kosten, bis er sich in dem Gewühl des Pendlerverkehrs an einem verregneten Montagmorgen zurechtgefunden hatte. Instinktiv fühlte sie, dass ihr ein schwieriger Tag bevorstand, und sie streckte sich unter der Bettdecke, wie um sich dafür zu wappnen. Sie dehnte ihre verkrampften Finger und genoss beinahe den kurzen scharfen Schmerz in den gespannten Gelenken. Ein leichter Anfall von Arthritis. Na ja, darauf musste man gefasst sein. Sie war schließlich neunundvierzig. Es war an der Zeit, ein wenig kürzerzutreten. Wie hatte sie nur meinen können, sie schaffe es, vor halb zehn in Heatheringfield zu sein?
Die Tür wurde aufgemacht, und ein Lichtstreifen vom Flur fiel herein. Ms Angela Burrows schlug die Vorhänge zurück, warf einen Blick auf den schwarzen Januarhimmel und das regenverspritzte Fenster und zog sie wieder zu. »Es regnet«, sagte sie mit der düsteren Genugtuung von jemandem, der Regen prophezeit hat und nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass seine Warnungen nicht beachtet wurden.
Ms Beale stützte sich auf die Ellbogen, knipste die Nachttischlampe an und wartete. Einen Augenblick später war ihre Freundin wieder da und setzte das Frühstückstablett ab. Auf dem Tablett lag ein besticktes Leinendeckchen, die geblümten Tassen standen hübsch nebeneinander mit parallel ausgerichteten Henkeln, auf den dazu passenden Tellern lagen vier Kekse ordentlich an ihrem Platz, und aus der Teekanne kam der köstliche Duft von frisch bereitetem indischem Tee. Die beiden Frauen liebten ihre Behaglichkeit und hatten einen Sinn für Sauberkeit und Ordnung. Die Maßstäbe, die sie früher auf der Privatstation ihres Lehrkrankenhauses durchgesetzt hatten, legten sie für ihr eigenes Wohlbefinden an, sodass das Leben in ihrer Wohnung nicht viel anders ablief als in einem teuren, großzügigen Privatsanatorium.
Seit sie vor fünfundzwanzig Jahren dieselbe Schwesternschule verlassen hatten, wohnten Ms Beale und ihre Freundin zusammen. Ms Angela Burrows war Erste Tutorin an einem Londoner Lehrkrankenhaus. Ms Beale hielt sie für das Muster aller Schwesternlehrerinnen und maß bei ihren Inspektionen die Qualität des Unterrichts unbewusst an den häufigen Äußerungen ihrer Freundin über die Prinzipien einer korrekten und fundierten Ausbildung. Ms Burrows fragte sich ihrerseits, wie die Allgemeine Schwesternaufsicht zurechtkommen sollte, wenn sich Ms Beale einmal zur Ruhe setzte. Die glücklichsten Ehen werden von solchen tröstlichen Illusionen getragen, und das ganz anders geartete, im Wesentlichen harmlose Verhältnis von Ms Beale und Ms Burrows hatte ähnliche Grundlagen.
Sah man von dieser Fähigkeit zur gegenseitigen, wenn auch unausgesprochenen Bewunderung ab, waren die beiden sehr verschieden. Ms Burrows war derb, robust und stattlich und verbarg eine verwundbare Sensibilität hinter ihrem barschen und nüchternen Auftreten. Ms Beale war klein und zierlich, präzise in Sprache und Bewegungen und legte eine überholte vornehme Höflichkeit an den Tag, die manchmal schon beinahe lächerlich wirken mochte. Auch in ihren Lebensgewohnheiten unterschieden sie sich. Die schwerfällige Ms Burrows war beim ersten Ton des Weckers sofort hellwach, rettete ihre Energie bis über den Nachmittag und schlaffte dann rapide ab, je mehr der Abend fortschritt. Ms Beale öffnete allmorgendlich mit Widerwillen die verklebten Augenlider, musste sich zunächst zu jeder Bewegung zwingen und wurde dann immer lebendiger und fröhlicher, je älter der Tag wurde. Es war ihnen aber gelungen, auch für diese unvereinbaren Gewohnheiten eine Lösung zu finden. Ms Burrows kochte nur zu gern den Morgentee, und Ms Beale wusch nach dem Abendessen ab und bereitete den abendlichen Kakao.
Ms Burrows goss Tee in beide Tassen, ließ zwei Zuckerstücke in die Tasse der Freundin fallen und nahm die eigene mit zu ihrem Stuhl am Fenster. Ihre Ausbildung gestattete ihr nicht, sich auf die Bettkante zu setzen. Sie sagte: »Du musst zeitig los. Ich lasse besser schon das Badewasser einlaufen. Wann fangen die dort an?«
Ms Beale murmelte, sie habe der Oberin gesagt, sie komme möglichst bald nach neun. Der Tee war köstlich und anregend. Es war falsch gewesen zu versprechen, so früh loszufahren, aber inzwischen meinte sie, sie könne es vielleicht bis Viertel nach neun schaffen.
»Ist dort nicht Ms Taylor? Sie hat eigentlich einen ganz guten Namen, und dabei ist sie nur Oberin an einem Provinzkrankenhaus. Eigentlich komisch, dass sie nie nach London gekommen ist. Sie hat sich nicht einmal um die Stelle beworben, als Ms Montrose ausschied.«
Ms Beale brummte etwas Unverständliches, aber da sie schon häufiger darüber gesprochen hatten, deutete ihre Freundin es ganz richtig als den Einwand, dass London nicht jedermanns Sache sei und dass die Leute zu leichtfertig behaupteten, aus der Provinz könne nichts Rechtes kommen.
»Sicher, da hast du recht«, gab ihre Freundin zu. »Und das John Carpendar liegt auf einem hübschen Fleckchen Erde. Ich mag die Gegend Richtung Hampshire. Schade, dass du nicht im Sommer hinfährst. Trotzdem, sie ist nun einmal nicht an einem größeren Lehrkrankenhaus, was sie bei ihrer Begabung leicht sein könnte. Sie hätte eine von den ganz großen Oberinnen werden können.«
Während ihrer Ausbildung hatten sie und Ms Beale unter einer der ganz großen Oberinnen gelitten, aber sie waren nie müde geworden, das Verschwinden dieser schrecklichen Spezies zu beklagen.
»Du solltest übrigens rechtzeitig losfahren. An der Straße wird gebaut, kurz bevor sie auf die Umgehung von Guildford stößt.«
Ms Beale fragte nicht, woher sie wusste, dass dort eine Baustelle war. So etwas wusste Ms Burrows einfach.
Die muntere Stimme fuhr fort: »Letzte Woche traf ich Hilda Rolfe, die Erste Tutorin im John Carpendar, in der Westminster-Bibliothek. Eine bemerkenswerte Frau! Klug natürlich und, wie man hört, eine erstklassige Lehrerin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ihren Schülerinnen Angst macht.«
Ms Burrows machte ihren eigenen Schülerinnen häufig Angst, ganz zu schweigen von den meisten ihrer Kolleginnen, wäre aber höchst erstaunt gewesen, wenn man es ihr gesagt hätte.
Ms Beale fragte: »Sagte sie etwas von der Inspektion?«
»Ja, beiläufig. Sie brachte nur ein Buch zurück und hatte es sehr eilig, deshalb unterhielten wir uns nicht lang. Anscheinend hat eine Grippewelle die Schule erwischt, und die halbe Belegschaft ist krank.«
Ms Beale kam es komisch vor, dass die Erste Tutorin Zeit hatte, nach London zu fahren und ein Buch in die Bibliothek zurückzubringen, wenn es solche Personalschwierigkeiten gab, aber sie sagte nichts. Vor dem Frühstück verwandte Ms Beale ihre Energie lieber aufs Denken als aufs Sprechen.
Ms Burrows ging um das Bett und füllte die Tassen ein zweites Mal. Sie sagte: »Bei diesem Wetter sieht es nach einem ziemlich langweiligen Tag für dich aus, noch dazu, wenn das halbe Lehrerkollegium krank ist.«
Sie hätte kaum etwas Unzutreffenderes sagen können, wie sich die beiden Freundinnen – mit jener Vorliebe für die Wiederholung von Altbekanntem, die zu den Freuden langer Vertrautheit gehört – in den kommenden Jahren immer wieder erzählen sollten. Ms Beale, auf nichts Schlimmeres gefasst als eine ermüdende Fahrt, eine anstrengende Inspektion und möglicherweise eine Kontroverse mit jenen Mitgliedern des Schwesternausbildungskomitees, die sich die Mühe machten zu erscheinen, warf sich den Morgenrock über, schlüpfte in ihre Hausschuhe und schlurfte ins Bad. Es waren die ersten Schritte auf dem Weg, einem Mord beizuwohnen.
2
Trotz des Regens war die Fahrt nicht so anstrengend, wie Ms Beale befürchtet hatte. Sie fuhr einen guten Schnitt und war kurz vor neun in Heatheringfield, gerade noch rechtzeitig, um in die letzte Welle des morgendlichen Berufsverkehrs zu geraten. Die breite Hauptstraße mit ihren King-George-Häuserfronten war von Fahrzeugen verstopft. Frauen fuhren ihre Männer zum Bahnhof oder die Kinder in die Schule, Lastwagen luden ihre Ware ab, Busse spuckten Fahrgäste aus und nahmen andere auf. Es fiel immer noch ein leichter Nieselregen. An den drei Ampeln strömten Fußgänger mit aufgespannten Regenschirmen über die Straße: Die Kinder herausgeputzt in den adretten Uniformen von Privatschulen, die meisten Männer trugen einen Bowlerhut und hatten eine Aktentasche unter dem Arm, und die Kleidung der Frauen zeigte den typischen Kompromiss zwischen großstädtischem Schick und provinzieller Ungezwungenheit.
Da Ms Beale genug damit zu tun hatte, auf die Ampeln und Fußgängerüberwege zu achten und einen Wegweiser zum Krankenhaus zu suchen, konnte sie nur einen flüchtigen Blick auf das schmucke Rathaus aus dem 18. Jahrhundert, die gut erhaltene Reihe der Fachwerkhäuser und die großartige, mit Kriechblumen verzierte Turmspitze der Dreieinigkeitskirche werfen. Sie gewann dennoch den Eindruck, dass es sich um eine blühende Gemeinde handelte, die Sorgfalt auf die Erhaltung ihres baugeschichtlichen Erbes verwandte, wenn auch eine ganze Reihe von Filialgeschäften am Ende der Hauptstraße den Gedanken nahelegte, dass die Sorgfalt dreißig Jahre früher hätte beginnen sollen.
Aber da kam endlich der Wegweiser. Die Straße zum John-Carpendar-Krankenhaus zweigte als breite Allee von der Hauptstraße ab. Auf der linken Seite verlief eine hohe Mauer, die das Krankenhausgelände eingrenzte.
Ms Beale hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Die dicke Aktentasche auf dem Rücksitz des Autos enthielt einen umfassenden Abriss über die Geschichte des Krankenhauses, außerdem eine Kopie des Berichts von der letzten Inspektion durch die Allgemeine Schwesternaufsicht und eine Stellungnahme des Verwaltungskomitees, inwieweit die optimistischen Vorschläge der damaligen Inspektorin hatten berücksichtigt werden können. Das Krankenhaus hatte eine lange Geschichte, wie sie aus ihrer Lektüre erfahren hatte. Es war 1791 von einem wohlhabenden Kaufmann gegründet worden, der in der Stadt geboren und als mittelloser junger Mann nach London gegangen war, um dort sein Glück zu machen. Später war er hierher zurückgekehrt und hatte sich darin gefallen, als Wohltäter seine Nachbarn zu beeindrucken. Er hätte den Ruhm auch kaufen und sein Seelenheil sichern können, indem er die Witwen und Waisen unterstützt oder die Kirche renoviert hätte. Aber das Zeitalter der Wissenschaft und Vernunft hatte das Zeitalter des Glaubens abgelöst, und es war Mode geworden, ein Krankenhaus für die Armen zu stiften. Und so wurde bei der beinahe obligatorischen Zusammenkunft in einem Café des Ortes das John-Carpendar-Krankenhaus ins Leben gerufen. Das ursprüngliche, architektonisch einigermaßen wertvolle Haus war schon lange ersetzt worden: zunächst durch ein massives viktorianisches Denkmal demonstrativer Frömmigkeit und später durch die funktionellere Schmucklosigkeit des 20. Jahrhunderts.
Dem Krankenhaus war es immer gut gegangen. Die Bevölkerung gehörte zum größten Teil der Mittelklasse an, sie war wohlhabend und gern bereit, etwas für wohltätige Zwecke auszugeben, fand aber nicht genug Objekte für ihre Spendenfreudigkeit. Kurz vor Kriegsausbruch war ein Flügel für eine gut ausgestattete Privatstation angebaut worden, die vor und nach der Schaffung des Staatlichen Gesundheitsdienstes reiche und folglich bedeutende Patienten aus London und aus noch größeren Entfernungen anzog. Ms Beale dachte, dass es schön und gut sei, was Angela über das Prestige eines Londoner Lehrkrankenhauses sagte, aber das John Carpendar hatte einen guten Ruf. Eine Frau konnte sehr wohl der Ansicht sein, es gebe schlechtere Stellen als die einer Oberin an einem allgemeinen Krankenhaus, von dem man in der Stadt viel hielt, das annehmbar gelegen war und fest in der lokalen Tradition wurzelte.
Sie war inzwischen am Haupteingang angelangt. Links lag die Pförtnerloge, ein schmuckes Puppenhaus aus kunstvoll versetzten Backsteinen, ein Überbleibsel des viktorianischen Krankenhauses, und rechts der Ärzteparkplatz. Ein Drittel der markierten Abstellplätze war bereits von Mercedes- und Rolls-Royce-Wagen besetzt. Es regnete nicht mehr, und die Dämmerung war der grauen Eintönigkeit eines Januartages gewichen. Alle Lichter im Krankenhaus waren angeschaltet. Es lag vor ihr wie ein großes Schiff vor Anker, hell erleuchtet, voller verborgener Aktivität und Macht. Linker Hand zogen sich die niedrigen Gebäude der ambulanten Abteilung mit ihren Glasfronten hin. Die ersten Patienten gingen in gedrückter Stimmung auf den Eingang zu.
Ms Beale lenkte ihr Auto vor das Fenster der Pförtnerloge, kurbelte die Scheibe herunter und meldete sich an. Der Pförtner ließ sich herab, ans Auto zu kommen, und baute sich gewichtig neben ihr auf.
»Sie sind sicher die Allgemeine Schwesternaufsicht, Miss«, stellte er großsprecherisch fest. »Was ein Pech, dass Sie diesen Eingang gewählt haben. Die Krankenpflegeschule ist im Nightingale House untergebracht, nur ungefähr hundert Meter vom Eingang an der Winchester Road entfernt. Wir benutzen zum Nightingale House immer den Hintereingang.«
In seiner Stimme schwang vorwurfsvolle Resignation mit, als beklage er diesen einmaligen Mangel an Einsicht, der ihn einiges an zusätzlicher Mühe kostete.
»Aber ich kann doch wohl auch von hier aus zur Schule kommen?«
Ms Beale hatte weder die Nerven, sich noch einmal dem Gewühl der Hauptstraße auszusetzen, noch die Absicht, auf der Suche nach einem verborgenen Hintereingang auf dem Krankenhausgelände herumzukurven.
»Das können Sie, Miss.« Der Pförtner gab durch seinen Tonfall zu verstehen, dass nur ein ganz besonders eigensinniger Mensch etwas Derartiges versuchen würde, und stützte sich auf die Autotür, als wolle er vertrauliche und komplizierte Anweisungen geben. Sie stellten sich jedoch als ziemlich einfach heraus. Nightingale House lag innerhalb des Krankenhausgeländes hinter der Aufnahme.
»Fahren Sie hier die linke Straße, Miss, und dann wieder geradeaus an der Leichenhalle vorbei, bis Sie an die Wohngebäude des Klinikpersonals kommen. Dann halten Sie sich rechts. An der Straßengabelung steht ein Wegweiser. Sie können es nicht verfehlen.«
Dieses eine Mal schien diese im Allgemeinen nichts Gutes verheißende Versicherung berechtigt. Das Grundstück des Krankenhauses war ausgedehnt und hatte einen reichen Baumbestand, eine Mischung aus angelegten Gärten, Rasenflächen und zerzausten Baumgruppen. Ms Beale fühlte sich an eine alte Nervenklinik erinnert. Ein so großzügig mit Grund ausgestattetes Krankenhaus war eine Seltenheit. Aber die vielen Straßen waren gut beschildert, und nur eine führte von der Ambulanz nach links. Die Leichenhalle war leicht zu erkennen, ein gedrungenes, hässliches kleines Gebäude, das taktvoll zwischen die Bäume gestellt war und durch seine absichtliche Isolierung noch düsterer wirkte. Das Ärztehaus war neu und unverkennbar. Ms Beale ließ ihrem üblichen, häufig ganz unangebrachten Unmut freien Lauf, dass Verwaltungskomitees von Krankenhäusern immer schneller bei der Hand waren, Wohnhäuser für die Ärzte zu bauen, als angemessene Räumlichkeiten für die Krankenpflegeschule bereitzustellen. Da sah sie auch schon den versprochenen Wegweiser. Ein weiß gestrichenes Brett zeigte nach rechts: »Nightingale House, Krankenpflegeschule«.
Sie schaltete herunter und bog langsam ein. Die neue Straße war schmal und gewunden. Das auf beiden Seiten aufgehäufte nasse Laub ließ kaum Platz für ein einziges Auto. Die Bäume standen bis dicht an den Weg heran, schlossen sich über ihm zusammen und bildeten mit ihren starken schwarzen Ästen einen dunklen Tunnel. Ab und zu ließ ein Windstoß Regentropfen auf das Autodach prasseln oder presste ein fallendes Blatt an die Windschutzscheibe. Die Rasenkante wurde von Blumenbeeten mit kümmerlichen Büschen unterbrochen. Regelmäßig und rechteckig, sahen sie wie Gräber aus.
Unter den Bäumen war es so dunkel, dass Ms Beale das Abblendlicht einschaltete. Die Straße vor ihr glänzte wie ein öliges Band. Sie hatte das Fenster offen gelassen. Ein widerwärtig süßlicher Modergeruch breitete sich im Auto aus und überdeckte sogar den normalen Autogeruch von Benzin und warmem Öl. Sie fühlte sich merkwürdig allein, und plötzlich überkam sie ein irrationales Unbehagen, ein wunderliches Gefühl, aus der Zeit in eine neue Dimension zu reisen und einem unfassbaren und unausweichlichen Entsetzen entgegenzugehen. Der Spuk dauerte nur einen Augenblick, und sie schüttelte ihn schnell ab. Sie dachte an die fröhliche Geschäftigkeit auf der Hauptstraße, die nicht einmal eine Meile von hier weg war, und an die Nähe von Leben und Betriebsamkeit. Aber es war ein seltsames, verwirrendes Erlebnis gewesen. Sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie sich dieser krankhaften Sinnestäuschung überlassen hatte, drehte das Fenster hoch und trat auf das Gaspedal. Der kleine Wagen fuhr mit einem Ruck weiter.
Kurz darauf hatte sie die letzte Kehre erreicht, und vor ihr lag Nightingale House. Vor Überraschung machte sie fast eine Vollbremsung. Es war ein außergewöhnliches Haus, ein erstaunlich großes viktorianisches Gebäude aus roten Ziegeln, burgartig angelegt und so überreich verziert, dass es schon versponnen wirkte. Die Krönung waren die vier großen Türme. Es war hell erleuchtet an diesem dunklen Januarmorgen, und nach der düsteren Straße glänzte es ihr wie ein Schloss aus Kinderträumen entgegen. An die rechte Seite des Hauses war ein riesengroßer Wintergarten angebaut, der für Ms Beale allerdings eher in die botanischen Gärten von Kew Gardens als zu diesem Gebäude gepasst hätte, das offensichtlich einmal ein privates Wohnhaus gewesen war. Er war weniger hell erleuchtet als das Haus, doch das gedämpfte Licht reichte aus, um durch das Glas die glänzenden Blätter der Schildblumen, das grelle Rot der Weihnachtssterne und die gelben und bräunlichen Kugeln der Chrysanthemen zu erkennen.
Die kurze Anwandlung von Panik unter den Bäumen war völlig vergessen, so sehr staunte Ms Beale über Nightingale House. Sie konnte sich zwar normalerweise auf ihren Geschmack verlassen, aber so ganz unempfänglich für modische Launen war sie nicht, und sie fragte sich beunruhigt, ob es in entsprechender Gesellschaft nicht angebracht sein könne, solche Spielereien zu bewundern. Es war ihr jedoch zur Gewohnheit geworden, jedes Gebäude nur auf seine Tauglichkeit als Schwesternschule hin zu betrachten – sie hatte einmal während eines Parisurlaubs zu ihrem eigenen Entsetzen den Élysée-Palast keines zweiten Blickes wert gehalten –, und als Schwesternschule war Nightingale House schon auf den ersten Blick ganz einfach unmöglich. Die Gründe sprangen geradezu ins Auge. Die meisten Räume mussten viel zu groß sein. Wo konnte es zum Beispiel gemütliche Büros für die Erste Tutorin, die klinische Lehrkraft und die Sekretärin der Schule geben? Außerdem war es sicher äußerst schwierig, das Haus richtig zu heizen, und diese Erkerfenster ließen nicht sehr viel Licht herein, mochten sie noch so hübsch für jemanden sein, der an so etwas Gefallen fand.
Noch schlimmer war, dass etwas Furchteinflößendes und Unheilvolles über dem Haus lag. Da der BERUF (Ms Beale schrieb ihn im Geiste immer in Großbuchstaben) mühsam seinen Weg ins 20. Jahrhundert gefunden und die Hürden überholter Gepflogenheiten und Methoden überwunden hatte – Ms Beale musste häufig Reden halten, und gewisse Lieblingssätze hafteten im Gedächtnis –, war es eine Schande, die jungen Schülerinnen in diesem viktorianischen Monstrum unterzubringen. Es würde nicht schaden, in ihrem Bericht auch die unbedingte Notwendigkeit einer neuen Schule zu betonen. Das Nightingale House war auf Ablehnung gestoßen, bevor sie es überhaupt betreten hatte.
Doch an ihrem Empfang war nichts auszusetzen. Als sie die letzte Stufe genommen hatte, ging die Tür auf und ließ einen Schwall warmer Luft und den Duft frischen Kaffees ins Freie. Ein Mädchen in Schwesterntracht trat respektvoll zur Seite, und sie sah die Oberin Mary Taylor mit ausgestreckter Hand die breite Eichentreppe herunterkommen – vor der dunklen Täfelung erinnerte sie an ein Renaissanceporträt in Grau und Gold. Ms Beale setzte ihr strahlendes Berufslächeln auf, das sich aus fröhlicher Erwartung und allgemeiner Ermunterung zusammensetzte, und trat zur Begrüßung auf sie zu. Die unheilvolle Inspektion der John-Carpendar-Schwesternschule hatte begonnen.
3
Eine Viertelstunde später gingen vier Personen die Haupttreppe zum Übungsraum im Erdgeschoss hinunter, um bei der ersten Unterrichtsstunde des Tages zuzuhören. Man hatte im Wohnzimmer der Oberin in einem der Turmanbauten Kaffee getrunken. Ms Beale war dort der Ersten Tutorin, Ms Hilda Rolfe, und einem Chirurgen, Mr Stephen Courtney-Briggs, vorgestellt worden. Sie kannte beide dem Namen nach. Ms Rolfes Anwesenheit war notwendig, und sie hatte sie erwartet, aber Ms Beale war ein wenig überrascht, dass Mr Courtney-Briggs so viel Zeit für die Inspektion opferte. Er war ihr als Vizepräsident des Schwesternausbildungskomitees des Krankenhauses vorgestellt worden, und sie hätte eher erwartet, ihn zusammen mit den anderen Mitgliedern des Komitees bei der abschließenden Diskussion am Ende des Tages zu sehen. Es war ungewöhnlich für einen Chefarzt, an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen, und sie begrüßte es, dass er so großes persönliches Interesse an der Schule zeigte.
Auf den breiten holzgetäfelten Korridoren konnte man zu dritt nebeneinandergehen, und Ms Beale kam sich zwischen den großen Gestalten der Oberin und Mr Courtney-Briggs’ wie eine kleine, überführte Straftäterin vor. Mr Courtney-Briggs ging auf der linken Seite. Er war eine beeindruckende Erscheinung in seinen überkorrekten gestreiften Hosen. Ein Duft von Aftershave umgab ihn. Ms Beale nahm ihn trotz des durchdringenden Geruchs nach Desinfektionsmitteln, Kaffee und Möbelpolitur wahr. Sie fand es überraschend, aber nicht unangenehm.
Die Oberin, die Größte von den dreien, strahlte heitere Ruhe aus. Ihr strenges graues Gabardinekleid war hochgeschlossen mit einem weißen Leinenbändchen am Hals und den Ärmelaufschlägen. Das strohblonde Haar hob sich kaum von ihrer Hautfarbe ab. Es war aus der hohen Stirn zurückgekämmt und von einem riesigen Dreieck aus Musselin gebändigt, dessen Spitze fast bis an das Kreuz reichte. Die Haube erinnerte Ms Beale an die Kopfbedeckungen, die während des letzten Krieges die Schwestern der Heereskrankenpflege getragen hatten. Sie hatte sie seitdem selten gesehen. Aber in ihrer Schlichtheit passte sie zu Ms Taylor. Dieses Gesicht mit den hohen Wangenknochen und den großen vorstehenden Augen – Ms Beale fühlte sich ganz unehrerbietig an helle geäderte Stachelbeeren erinnert – hätte unter den Rüschen einer orthodoxeren Kopfbedeckung vielleicht grotesk gewirkt.
Hinter sich spürte Ms Beale die störende Anwesenheit von Oberschwester Rolfe, die ihnen in unangenehmer Nähe folgte.
Mr Courtney-Briggs redete: »Diese Grippeepidemie ist uns denkbar ungelegen gekommen. Wir mussten die nächste Unterrichtsgruppe im Stationsdienst lassen und hatten kurzzeitig sogar befürchtet, dass auch die jetzige Gruppe einspringen müsste. Es hat gerade noch so geklappt.«
Wie gewohnt, dachte Ms Beale. Wenn die Lage im Krankenhaus kritisch wurde, hatten zuerst die Schwesternschülerinnen darunter zu leiden. Das Unterrichtsprogramm konnte jederzeit unterbrochen werden. Es war einer ihrer wunden Punkte, aber sie hielt es im Augenblick nicht für angebracht, dagegen zu protestieren. Sie murmelte irgendetwas Verständnisvolles.
Sie kamen jetzt an die letzte Treppe. Mr Courtney-Briggs fuhr in seiner Rede fort: »Ein Teil des Unterrichtspersonals ist ebenfalls ausgefallen. Die heutige Übung wird von unserer klinischen Lehrschwester, Mavis Gearing, übernommen. Wir mussten sie in die Schule zurückholen. Für gewöhnlich unterrichtet sie natürlich nur auf der Station. Es ist ein relativ neuer Gedanke, dass eine ausgebildete Lehrschwester die Mädchen auf den Stationen unterrichtet und die Patienten als klinisches Material benutzt. Den Stationsschwestern bleibt dazu heutzutage einfach keine Zeit. Die Einführung des Blockunterrichts ist ja überhaupt ziemlich neu. Während meiner Studienzeit wurden die Lehrlinge, wie wir sie nannten, ausschließlich auf der Station ausgebildet und bekamen nur gelegentlich in ihrer freien Zeit ein paar Stunden von den Ärzten. Es gab kaum theoretischen Unterricht. Jedenfalls wurden sie nicht jedes Jahr eine Zeit lang aus dem Stationsbetrieb herausgenommen und auf die Schwesternschule geschickt. Das gesamte Konzept der Schwesternausbildung hat sich geändert.«
Ms Beale war die Letzte, die es nötig gehabt hätte, sich über Funktion und Pflichten einer klinischen Lehrschwester oder die Entwicklung der Unterrichtsmethoden aufklären zu lassen. Sie überlegte, ob Mr Courtney-Briggs vergessen hatte, wer sie war. Diese elementare Einführung wäre eher bei neuen Mitgliedern des Verwaltungskomitees angebracht gewesen, die von der Schwesternausbildung genauso wenig wussten wie von allem anderen, was mit Krankenhäusern zusammenhing. Sie hatte das Gefühl, dass dahinter eine Absicht steckte. Oder das alles hatte gar keinen Bezug zum Zuhörer, sondern war nur das ziellose Geplauder eines Egozentrikers, der nicht ertragen konnte, auch nur einen Augenblick das angenehme Echo seiner eigenen Stimme zu vermissen. Falls Letzteres zutraf, wäre es am besten für alle Betroffenen, wenn er möglichst schnell zu seinen ambulanten Patienten oder zur Visite ginge und die Inspektion ohne seine gnädige Anwesenheit über die Bühne gehen ließ.
Die vier gingen durch die mit Fliesen ausgelegte Halle auf einen Raum an der Stirnseite des Hauses zu. Ms Rolfe lief voraus, um die Tür zu öffnen, und ließ die anderen eintreten. Mr Courtney-Briggs komplimentierte Ms Beale hinein. Sie war sofort in ihrem Element. Obgleich der Raum an sich ungewöhnlich war – die zwei großen Fenster mit den bunten Glasscheiben, der massive Marmorkamin mit dekorativen Figuren, die den Sims stützten, die hohe stuckverzierte Decke, die von drei Neonröhren entweiht wurde –, erinnerte diese durch und durch vertraute Welt sie anheimelnd an ihre eigene Ausbildungszeit. Da war alles Zubehör ihres Berufes: die Reihen von Glasschränken mit glänzenden Instrumenten, die fein säuberlich an ihrem Platz lagen; die Wandkarten mit gespenstischen Diagrammen, die den Blutkreislauf und die unglaublichen Verdauungsvorgänge erläuterten; die unordentlich gewischte Wandtafel, auf der die Notizen vom Vortag verschmiert waren; die fahrbaren Instrumententische mit den Leinentüchern; die lebensgroße Puppe in den Kissen eines der beiden Vorführbetten; das unvermeidliche Skelett, das in hilfloser Hinfälligkeit an seinem Galgen baumelte. Über allem lag der starke, durchdringende Geruch von Desinfektionsmitteln. Ms Beale sog ihn ein wie eine Süchtige. Welche Mängel sie auch immer an dem Zimmer, an der Zweckmäßigkeit der Unterrichtsmittel, der Beleuchtung oder der Einrichtung noch entdecken würde: Sie fühlte sich von Anfang an in dieser einschüchternden Atmosphäre zu Hause.
Sie bedachte die Schülerinnen und die Lehrerin mit einem kurzen beruhigenden und aufmunternden Lächeln und setzte sich auf einen der vier Stühle, die an der einen Seite des Zimmers aufgereiht waren. Oberin Taylor und Ms Rolfe nahmen links und rechts von ihr Platz, so ruhig und unauffällig, wie es angesichts Mr Courtney-Briggs’ Absicht, den Damen übertrieben galant die Stühle zurechtzurücken, möglich war.
Die Ankunft der kleinen Gesellschaft hatte trotz aller Rücksichtnahme die Tutorin anscheinend ein wenig aus dem Konzept gebracht. Eine Inspektion bedeutete kaum eine normale Unterrichtssituation, und es war immer aufschlussreich zu sehen, wie lange die Lehrkraft brauchte, um ihre Klasse wieder in den Griff zu bekommen. Ms Beale wusste aus Erfahrung, dass eine erstklassige Lehrerin sogar bei einem schweren Bombenangriff die Aufmerksamkeit einer Klasse fesseln konnte, geschweige denn bei dem Besuch einer Inspektorin der Schwesternaufsichtsbehörde. Sie hatte allerdings nicht das Gefühl, dass Mavis Gearing zu dieser seltenen begnadeten Gattung gehörte. Dem Mädchen – oder vielmehr der Frau – fehlte es an Autorität. Sie machte einen unterwürfigen Eindruck und sah aus, als tendiere sie dazu, einfältig zu lächeln. Außerdem war sie um einiges zu stark geschminkt für eine Frau, die ihre Gedanken auf weniger vergängliche Künste richten sollte. Aber sie war schließlich nur die klinische Lehrschwester und keine qualifizierte Tutorin. Sie hatte die Klasse kurzfristig und unter besonderen Umständen übernehmen müssen. Ms Beale beschloss für sich, sie nicht zu streng zu beurteilen.
Die Klasse sollte die Ernährung eines Patienten mittels einer Magensonde üben. Die Schülerin, die Patientin spielen sollte, lag bereits in einem der Betten. Ein Gummilatz schützte ihr kariertes Kleid. Ihr Kopf lag auf einer Rückenstütze und einem Kissenpolster. Sie war ein unscheinbares Mädchen mit einem energischen, eigensinnigen, merkwürdig reifen Gesichtsausdruck. Das glanzlose Haar hatte sie unvorteilhaft aus der hohen unebenen Stirn nach hinten gekämmt. Sie lag ganz still unter dem harten Neonlicht und sah ein wenig lächerlich aus, doch seltsam feierlich, als konzentriere sie sich auf eine innere Welt und löse sich durch ihre Willenskraft von der ganzen Prozedur. Plötzlich ging Ms Beale durch den Kopf, dass das Mädchen vielleicht Angst hatte. Der Gedanke war absurd, aber sie wurde ihn nicht los. Sie verspürte auf einmal eine Abneigung, dieses resolute Gesicht weiter zu betrachten. Verwirrt von ihrer eigenen Empfindlichkeit, wandte sie ihre ganze Aufmerksamkeit der Tutorin zu.
Oberschwester Gearing warf einen ängstlichen fragenden Blick auf die Oberin, erhielt ein bejahendes Nicken als Antwort und nahm die Stunde wieder auf.
»Schwester Pearce hat heute Morgen die Rolle der Patientin übernommen. Wir haben gerade die Krankengeschichte durchgesprochen. Es handelt sich um Mrs Stokes, fünfzig Jahre, Mutter von vier Kindern. Ihr Mann arbeitet bei der städtischen Müllabfuhr. Sie hatte eine Kehlkopfoperation wegen Krebs.«
Sie wandte sich an eine Schülerin auf ihrer rechten Seite.
»Schwester Dakers, beschreiben Sie bitte Mrs Stokes’ bisherige Behandlung.«
Schwester Dakers begann pflichtbewusst zu sprechen, wobei das blasse, magere Mädchen unschön errötete. Sie sprach sehr leise, wusste aber über den Fall Bescheid und erläuterte ihn gut. Ein gewissenhaftes junges Ding, dachte Ms Beale, vielleicht nicht besonders intelligent, aber fleißig und zuverlässig; schade, dass sie nichts gegen ihre Akne unternahm. Ihr Gesicht strahlte weiter berufliches Interesse aus, während Schwester Dakers Mrs Stokes’ fiktive Krankengeschichte vortrug. Inzwischen sah sie sich die übrigen Schülerinnen in der Klasse etwas näher an. Gewohnheitsmäßig stellte sie dabei Mutmaßungen über ihren Charakter und berufliche Fähigkeiten an.
Die Grippewelle hatte zweifellos ihre Opfer gefordert. Insgesamt waren nur sieben Mädchen im Übungsraum. Die zwei, die links und rechts neben dem Vorführbett standen, fielen sofort auf. Sie waren offensichtlich eineiige Zwillinge, frische, kräftige Mädchen mit kupfernem Haar, das sich in einem dicken Pony über auffallend blauen Augen bauschte. Ihre Hauben mit dem gefältelten Mützchen waren, wie es sich gehörte, nach vorn gerückt, die riesigen Flügel aus weißem Leinen standen nach hinten weg. Ms Beale wusste noch aus früheren Tagen, was man mit zwei Hutnadeln mit den weißen Spitzen fertigbringen konnte. Dennoch war sie von der Geschicklichkeit fasziniert, mit der ein derart bizarres und körperloses Gebilde so sicher auf einem widerspenstigen Haarschopf befestigt werden konnte.
Die Tracht am John Carpendar war auffallend unzeitgemäß. Fast alle Krankenhäuser, die sie besuchte, hatten diese altmodischen Flügelhauben durch kleinere amerikanischer Machart ersetzt, die leichter zu tragen, schneller zu richten, für weniger Geld zu kaufen und einfacher zu waschen waren. Einige Krankenhäuser hatten sogar, allerdings zu Ms Beales Bedauern, Wegwerfhauben aus Papier eingeführt. Aber die Schwesterntracht eines Krankenhauses wurde immer eifersüchtig verteidigt und nur sehr widerwillig geändert, und das John Carpendar war offensichtlich seiner Vergangenheit besonders eng verbunden. Auch die Kleider waren nicht mehr ganz zeitgemäß. Die kräftigen sommersprossigen Arme der Zwillinge steckten in Ärmeln aus rosa karierter Baumwolle, die Ms Beale an die eigene Jugend erinnerte. Auch die Rocklänge verriet keine modischen Zugeständnisse, und ihre derben Füße steckten in flachen schwarzen Schnürschuhen.
Sie warf einen schnellen Blick auf die übrigen Schülerinnen. Da war zum Beispiel ein stilles bebrilltes Mädchen mit einem offenen, klugen Gesicht. Ms Beales erster Gedanke war, dass sie ein Glücksfall für eine Station sein musste. Daneben saß ein dunkles, stark geschminktes Mädchen, das mürrisch dreinblickte und sich alle Mühe gab, möglichst wenig Interesse an der Übung zu zeigen. Ziemlich gewöhnlich, dachte Ms Beale.
Ms Beale liebte solche unmodernen Attribute und brachte ihre Vorgesetzten damit gelegentlich in Verlegenheit. Sie gebrauchte sie ganz selbstverständlich und wusste genau, was sie damit ausdrücken wollte. Ihr Spruch »Die Oberin stellt eine sehr nette Art von Mädchen ein« besagte, dass sie aus respektablen Familien der Mittelklasse kamen, eine höhere Schule absolviert hatten, ihre Röcke knielang oder länger trugen und genau wussten, welches Vorrecht es war, Schwesternschülerin zu sein, und welche Verantwortung das mit sich brachte.
Die letzte Schülerin der Klasse war ein sehr hübsches Mädchen. Ihr blonder Pony über dem kessen Gesicht fiel bis auf die Augenbrauen. Sie war attraktiv genug für ein Werbeplakat, dachte Ms Beale, aber irgendwie war es das letzte Gesicht, das man in diesem Beruf dafür wählen würde. Während sie noch überlegte, warum, war Schwester Dakers mit ihrem Vortrag fertig.
»Gut, Schwester«, sagte Oberschwester Gearing. »Wir haben also eine postoperative Patientin, die bereits bedenklich an Gewicht verloren hat und jetzt keine Nahrung durch den Mund zu sich nehmen kann. Und das bedeutet? Ja, bitte?«
»Ernährung mit der Magensonde oder rektal, Schwester.«
Die Antwort kam von dem dunklen, mürrisch aussehenden Mädchen, das sich bemühte, nur keine Begeisterung oder gar Interesse durch seine Stimme zu verraten. Gewiss kein ansprechendes Mädchen, dachte Ms Beale.
Von der Klasse kam ein Murmeln. Oberschwester Gearing hob fragend eine Augenbraue. Die bebrillte Schülerin sagte: »Nicht rektal, Oberschwester. Das Rektum kann nicht genügend Nährstoffe aufnehmen. Ernährung mit der Magensonde durch Mund oder Nase.«
»Stimmt, Schwester Goodale, genau das hat der Chirurg für Mrs Stokes verordnet. Fahren Sie bitte fort, Schwester. Und erklären Sie jeden Schritt.«
Eine der Zwillingsschwestern zog den Wagen nach vorn und führte die notwendigen Geräte auf dem Tablett vor: die Reibschale mit dem doppeltkohlensauren Natrium zur Reinigung von Mund oder Nasenlöchern; den Kunststofftrichter mit dem zugehörigen Röhrchen; die Verbindungsklemme; das Gleitmittel; die Nierenschale mit Zungenspatel, Zungenhalter und Mundsperre. Sie hielt den Speiseröhrenschlauch hoch. Er baumelte ekelhaft wie eine gelbe Schlange von ihrer sommersprossigen Hand.
»Schön«, sagte Oberschwester Gearing aufmunternd.
»Und jetzt zur Nahrung. Was geben Sie ihr?«
»In Wirklichkeit ist es gewöhnliche warme Milch, Oberschwester.«
»Aber wenn wir es mit einem echten Patienten zu tun hätten?«
Der Zwilling zögerte. Das Mädchen mit der Brille antwortete ruhig und bestimmt: »Wir können Protein, Ei, Vitaminpräparate und Zucker beigeben.«
»Richtig. Wenn länger als achtundvierzig Stunden künstlich ernährt wird, müssen wir dafür sorgen, dass die Diät die richtige Menge an Kalorien, Proteinen und Vitaminen enthält. Mit welcher Temperatur geben Sie die Nahrung?«
»Körpertemperatur, Oberschwester, 38 °C.«
»In Ordnung. Und da unsere Patientin bei Bewusstsein ist und schlucken kann, geben wir ihr die Nahrung durch den Mund. Vergessen Sie nicht, Ihre Patientin zu beruhigen. Erklären Sie ihr ganz einfach, was Sie als Nächstes machen werden und warum. Merken Sie sich das, fangen Sie nie etwas an, ohne den Patienten darüber aufzuklären.«
Sie sind immerhin im dritten Jahr, dachte Ms Beale. Das sollten sie mittlerweile wissen. Aber das Zwillingsmädchen, das ganz sicher mit einem echten Patienten gut zurechtgekommen wäre, war verlegen und fand es schwierig, einer Mitschülerin die Prozedur zu erläutern. Sie musste sich anstrengen, nicht loszukichern, sagte ein paar undeutliche Worte zu der reglosen Gestalt im Bett und warf den Schlauch beinahe nach der Patientin.
Schwester Pearce blickte immer noch starr geradeaus. Sie tastete mit der linken Hand nach dem Schlauch und führte ihn zum Mund. Dann schloss sie die Augen und schluckte. Ihre Halsmuskeln zogen sich krampfhaft zusammen. Sie machte eine Pause, atmete tief und schluckte weiter. Der Schlauch wurde kürzer. Es war sehr still im Übungsraum. Ms Beale merkte, dass ihr unwohl wurde, aber sie wusste nicht, warum. Es war sicher etwas ungewöhnlich, die künstliche Ernährung auf diese Art an einer Schülerin zu erproben, aber es war nicht unbekannt. An einem Krankenhaus führte wohl eher ein Arzt den Schlauch ein, aber eine Schwester konnte doch auch einmal dafür verantwortlich sein; es war immerhin besser, das an einer Mitschülerin zu lernen als an einem Schwerkranken, und die Übungspuppe war kein wirklich zufriedenstellender Ersatz für das lebende Objekt. Sie hatte zu Schulzeiten selbst einmal die Patientin gespielt und es erstaunlich einfach gefunden, den Schlauch zu schlucken. Während sie die krampfartigen Bewegungen von Schwester Pearce’ Kehle beobachtete und in unwillkürlichem Mitgefühl mitschluckte, spürte sie beinahe wieder, nach dreißig Jahren, das plötzliche Kältegefühl, als der Schlauch über den weichen Gaumen glitt, und den leichten Schrecken vor Überraschung, wie einfach das alles ging. Aber es lag etwas Rührendes und Verwirrendes über dieser reglosen bleichen Gestalt auf dem Bett mit dem Babylatz. Sie hatte die Augen fest geschlossen, und der dünne Schlauch ringelte sich aus den Mundwinkeln. Ms Beale fühlte, dass sie einem unverdienten Leiden zusah, dass die ganze Vorführung entsetzlich war. Einen Augenblick lang hatte sie große Lust, dagegen Einspruch zu erheben.
Einer der Zwillinge steckte jetzt eine 20-ml-Spritze auf das Schlauchende, um Magensaft anzusaugen und so festzustellen, ob das andere Ende den Magen erreicht hatte. Das Mädchen hatte völlig ruhige Hände. Vielleicht bildete sich Ms Beale bloß ein, dass es unnatürlich still im Raum war. Sie warf einen Blick auf Ms Taylor. Die Oberin hatte ihre Augen auf Schwester Pearce geheftet. Sie runzelte leicht die Stirn. Ihre Lippen bewegten sich, und sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Ms Beale fragte sich, ob sie protestieren wolle. Aber die Oberin blieb stumm. Mr Courtney-Briggs beugte sich auf seinem Stuhl nach vorn. Seine Hände umklammerten die Knie. Sein Blick war gespannt, aber er sah nicht Schwester Pearce an, sondern das Tropfrohr, als habe ihn das sanfte Pendeln des Schlauches hypnotisiert. Ms Beale hörte, wie er schwer atmete. Ms Rolfe saß kerzengerade, die Hände im Schoß gefaltet, ohne Ausdruck in den schwarzen Augen. Aber Ms Beale sah, dass ihr Blick nicht dem Mädchen im Bett galt, sondern der hübschen blonden Schülerin. Und einen winzigen Augenblick lang sah das Mädchen ebenso ausdruckslos zu ihr herüber.
Der Zwilling, der die Nahrung einflößen sollte, hatte offensichtlich festgestellt, dass das Schlauchende im Magen angekommen war, hob den Trichter hoch über Schwester Pearce’ Kopf und begann, langsam die milchige Flüssigkeit einzugießen. Die Klasse schien den Atem anzuhalten.
Und dann geschah es. Ein hoher, schriller Schrei, entsetzlich unmenschlich, und Schwester Pearce schnellte vom Bett hoch, wie von einer unwiderstehlichen Kraft getrieben. Einen Moment lag sie unbeweglich gegen den Kissenberg gestützt, im nächsten war sie aus dem Bett, machte ein paar schwankende Schritte auf gekrümmten Füßen wie in einer Ballettparodie und griff vergebens in die Luft, als suche sie verzweifelt den Schlauch. Und die ganze Zeit schrie sie, schrie unaufhörlich, wie eine festgeklemmte Klingel. Ms Beale hatte vor Entsetzen kaum Zeit, das verzerrte Gesicht und den Schaum auf den Lippen zu registrieren, bevor das Mädchen auf den Boden schlug und sich zusammenkrümmte wie ein Reifen. Ihre Stirn berührte den Boden, der ganze Körper wand sich im Todeskampf.
Eines der Mädchen schrie auf. Einen Augenblick waren alle wie gelähmt. Dann sprangen sie auf einmal auf. Oberschwester Gearing zog dem Mädchen den Schlauch aus dem Mund. Mr Courtney-Briggs schob sich mit ausgestreckten Armen resolut in das Durcheinander. Die Oberin und Oberschwester Rolfe beugten sich über den zuckenden Körper und verbargen ihn vor den Blicken. Dann richtete sich Ms Taylor auf und drehte sich nach Ms Beale um.
»Die Schülerinnen … Könnten Sie sich bitte um sie kümmern? Nebenan ist ein leeres Zimmer. Halten Sie sie zusammen.«
Sie versuchte, ruhig zu bleiben, aber die Eile gab ihrer Stimme einen scharfen Klang. »Bitte schnell.«
Ms Beale nickte. Die Oberin beugte sich wieder über die verzerrte Gestalt. Das Schreien hatte aufgehört. Man hörte jetzt nur noch ein klägliches Stöhnen und das schreckliche Stakkato von Absätzen, die auf die Holzdielen trommelten. Mr Courtney-Briggs zog das Jackett aus, warf es in die Ecke und rollte sich die Hemdsärmel auf.
4
Ms Beale schob die kleine Gruppe vor sich her über den Flur und murmelte leise etwas Aufmunterndes. Ein Mädchen, sie war nicht sicher, welches, sagte mit hoher Stimme: »Was ist ihr passiert? Was ist passiert? Was ist schiefgegangen?« Niemand gab eine Antwort. Sie gingen betäubt von dem Schock in das Zimmer nebenan. Es lag an der Rückseite des Hauses. Der kleine unproportionierte Raum war offenbar, wie man an der hohen Decke sah, von dem ursprünglichen Salon abgeteilt worden und diente jetzt der Ersten Tutorin als Büro.
Ms Beale warf einen Blick auf die Einrichtung: ein großer Schreibtisch, eine Reihe grüner Aktenschränke aus Stahl, eine volle Pinnwand, ein mit Haken versehenes Brett, an dem eine Reihe unterschiedlicher Schlüssel hing. Eine ganze Wand wurde von einem Plan eingenommen, auf dem das Unterrichtsprogramm stand und die Fortschritte jeder einzelnen Schülerin eingetragen waren. Die eingezogene Zwischenwand halbierte das einzige Fenster, sodass das Büro außer seinem ungefälligen Zuschnitt auch unzureichend beleuchtet war. Eine der Schülerinnen drückte auf den Lichtschalter, und die Neonröhre in der Mitte des Zimmers flackerte auf. Wirklich ein höchst ungeeignetes Zimmer für eine Erste Tutorin oder überhaupt für eine Lehrkraft, dachte Ms Beale, die verzweifelt versuchte, ihre Gedanken nicht von den gewohnten Bahnen abschweifen zu lassen.
Diese kurze Erinnerung an den eigentlichen Zweck ihrer Anwesenheit verschaffte ihr vorübergehend Erleichterung. Aber beinahe sofort war die furchtbare Realität wieder da. Die Schülerinnen, dieses klägliche, durcheinandergebrachte Häuflein, standen mitten im Zimmer, unfähig, etwas zu tun. Mit einem schnellen Blick sah Ms Beale, dass nur drei Stühle vorhanden waren. Einen Augenblick fühlte sie sich verlegen und verwirrt wie eine Gastgeberin, die nicht weiß, wie sie ihre Gäste unterbringen soll. Ihre Sorge war nicht ganz abwegig. Sie musste zusehen, dass die Mädchen es sich bequem machen und sich entspannen konnten. Das war die einzige Möglichkeit, ihre Gedanken von den Vorgängen nebenan abzulenken. Und vielleicht würden sie eine Zeit lang hier eingesperrt sitzen müssen.
»Helfen Sie mir«, sagte sie fröhlich. »Wir schieben einfach den Schreibtisch an die Wand, dann können sich vier daraufsetzen. Ich nehme den Schreibtischstuhl, und zwei können sich in die Sessel setzen.«
Jetzt gab es wenigstens etwas zu tun. Ms Beale sah, dass die magere blonde Schülerin zitterte. Sie schob ihr den einen Sessel unter, und das dunkle, mürrisch aussehende Mädchen setzte sich schnell in den anderen. Das sieht ihr ähnlich, sich gleich zu bedienen, dachte Ms Beale. Sie half den anderen Schülerinnen, den Schreibtisch abzuräumen und an die Wand zu rücken. Wenn sie doch nur eine wegschicken könnte, um Tee zu kochen. Obwohl Ms Beale moderneren Methoden der Schockbehandlung theoretisch zustimmte, setzte sie immer noch ihr größtes Vertrauen auf heißen, starken, süßen Tee. Aber es war keiner zu bekommen. Es kam nicht infrage, auch noch das Küchenpersonal durcheinanderzubringen.
»Ich schlage vor, wir machen uns erst einmal miteinander bekannt«, sagte sie fröhlich. »Ich bin Ms Muriel Beale. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass ich im Auftrag der Schwesternaufsicht hier bin. Ich kenne schon ein paar Namen, aber ich weiß nicht genau, zu wem sie gehören.«
Fünf Augenpaare starrten sie erstaunt und verständnislos an. Doch die tüchtige Schülerin, wie Ms Beale sie in Gedanken immer noch nannte, stellte sie mit ruhiger Stimme vor.
»Die Zwillinge sind Maureen und Shirley Burt. Maureen ist ungefähr zwei Minuten älter und hat mehr Sommersprossen. Ansonsten sind sie schwer auseinanderzuhalten. Neben Maureen sitzt Julia Pardoe. Christine Dakers sitzt in dem Sessel hier, das in dem anderen ist Diane Harper. Ich bin Madeleine Goodale.«
Ms Beale hatte kein gutes Namensgedächtnis und ging wie gewohnt alle noch einmal im Geiste durch. Die Burt-Zwillinge. Nett und drall. Ihre Namen würde sie sich leicht merken können, aber es schien unmöglich zu sagen, wer von beiden wer war. Julia Pardoe. Ein attraktiver Name und ein attraktives Mädchen. Sehr anziehend, wenn man diese Art blonde, katzenhafte Schönheit mochte. Ms Beale sah ihr lächelnd in die teilnahmslosen, veilchenblauen Augen und kam zu dem Schluss, dass sie einigen, und nicht nur Männern, wohl tatsächlich sehr gut gefallen musste. Madeleine Goodale. Ein vernünftiger Name für ein vernünftiges Mädchen. Goodale würde sie wohl ohne Schwierigkeiten behalten. Christine Dakers. Da stimmte etwas ganz und gar nicht. Das Mädchen hatte während der ganzen Übung krank gewirkt und schien jetzt einem Zusammenbruch nahe. Sie hatte eine schlechte Haut, ziemlich ungewöhnlich für eine Schwester. Ihr Gesicht war jetzt gerötet, sodass die Flecken um den Mund und auf der Stirn wie ein entzündeter Ausschlag aussahen. Sie hatte sich tief in den Sessel gekauert, und mal strich sie mit den schmalen Händen die Schürze glatt, mal zupfte sie daran. Schwester Dakers war sicher am meisten mitgenommen von der ganzen Gruppe. Vielleicht war sie eine enge Freundin von Schwester Pearce gewesen. Abergläubisch korrigierte Ms Beale schnell im Geiste die Zeitform: Vielleicht war sie eine enge Freundin. Wenn man dem Mädchen nur einen heißen, belebenden Tee geben könnte!
Schwester Harper, deren Lippenstift und Lidschatten in dem blass gewordenen Gesicht noch stärker auffielen, sagte unvermittelt: »Irgendwas muss in der Nahrung gewesen sein.«
Die Zwillinge drehten sich gleichzeitig nach ihr um. Maureen sagte: »Natürlich! Milch war drin.«
»Ich meine, etwas außer der Milch.« Sie zögerte. »Gift.«
»Aber das ist ausgeschlossen! Shirley und ich haben gleich heute Morgen eine frische Flasche Milch aus dem Kühlschrank in der Küche genommen. Ms Collins war da, ihr könnt sie fragen. Wir haben sie in den Übungsraum gebracht und dort stehen lassen und sie erst unmittelbar vor der Übung in den Messbecher umgefüllt, nicht wahr, Shirley?«
»Doch, so war’s. Es war eine frische Flasche. Wir haben sie gegen sieben geholt.«
»Und ihr habt nicht aus Versehen etwas dazugeschüttet?«
»Was denn? Natürlich nicht.«
Die Zwillinge sprachen einstimmig, völlig selbstsicher, beinahe sorglos. Sie wussten genau, was sie getan hatten und wann, und sie ließen sich wahrscheinlich von niemandem beirren, dachte Ms Beale. Sie waren nicht der Typ, der von unnötigen Schuldgefühlen geplagt wurde oder an dem die irrationalen Zweifel nagten, die weniger gleichgültige, mit mehr Fantasie ausgestattete Persönlichkeiten heimsuchten. Ms Beale glaubte, sie sehr gut zu verstehen.
Julia Pardoe sagte: »Vielleicht hat sich jemand anderes an der Nahrung zu schaffen gemacht.«
Sie sah ihre Mitschülerinnen herausfordernd und ein wenig amüsiert aus halb geschlossenen Augen an.
Madeleine Goodale sagte ruhig: »Aber warum?«
Schwester Pardoe zuckte mit den Achseln und spitzte den Mund zu einem kleinen, verstohlenen Lächeln. »Aus Versehen. Oder jemand wollte ihr einen Streich spielen. Oder es war vielleicht Absicht.«
»Aber das wäre versuchter Mord!« Diane Harper hatte das gesagt. Ihre Stimme klang ungläubig.
Maureen Burt lachte. »Sei nicht albern, Julia. Wer würde die Pearce ermorden wollen?«
Keiner antwortete. Es war anscheinend logisch und unwiderleglich. Man konnte sich unmöglich vorstellen, dass jemand Schwester Pearce ermorden wollte. Sie gehörte entweder zu der von Natur aus harmlosen Sorte, stellte Ms Beale fest, oder sie hatte zu wenig Persönlichkeit, um den wilden Hass hervorzurufen, der zum Mord führen kann.
Schließlich sagte Schwester Goodale trocken: »Die Pearce war nicht nach jedermanns Geschmack.«
Ms Beale sah das Mädchen überrascht an. Es war eine seltsame Bemerkung für Schwester Goodale, ein wenig gefühllos unter diesen Umständen. Das passte eigentlich nicht zu ihr. Sie registrierte auch, dass sie in der Vergangenheit sprach. Sie erwartete also nicht, Schwester Pearce noch einmal lebend zu sehen.
Schwester Harper wiederholte hartnäckig: »Es ist Blödsinn, an Mord zu glauben. Niemand könnte den Wunsch haben, die Pearce umzubringen.«
Schwester Pardoe zuckte mit den Schultern: »Vielleicht war Pearce gar nicht gemeint. Jo Fallon hätte doch heute die Patientin spielen sollen. Sie stand als Nächste auf der Liste. Wäre sie nicht gestern Abend krank geworden, hätte sie heute in dem Bett gelegen.«
Alle waren still. Schwester Goodale wandte sich an Ms Beale.
»Sie hat recht. Wir halten uns genau an die Reihenfolge. Pearce wäre heute tatsächlich nicht als Patientin dran gewesen. Aber Josephine Fallon wurde gestern Abend auf die Krankenstation gebracht – Sie haben sicher gehört, dass wir hier eine Grippeepidemie haben –, und Pearce stand als Nächste auf der Liste. Sie ist für die Fallon eingesprungen.«
Ms Beale geriet langsam in Verlegenheit. Sie fühlte, dass sie diesem Gespräch ein Ende setzen sollte, dass sie dafür verantwortlich war, die Gedanken von dem Unfall abzulenken, und es war ganz sicher nichts anderes als ein Unfall. Aber sie wusste nicht, wie sie das anstellen sollte. Außerdem hatte es einen schrecklichen Reiz, ein paar Fakten zu erfahren. So war es ihr immer gegangen. Vielleicht war es doch besser, wenn die Mädchen diesem unvoreingenommenen, nachforschenden Interesse nachgaben, anstatt hier herumzusitzen und unnatürliche und sinnlose Konversation zu machen. Sie sah bereits, dass der Schock nachließ und der ein wenig schamhaften Aufregung Platz machte, die einem schrecklichen Ereignis folgen kann, zumindest wenn es sich um das Unglück eines anderen handelt.
Julia Pardoe mit ihrer ruhigen, etwas kindlichen Stimme fuhr fort: »Wenn also Fallon das Opfer hätte sein sollen, dann kann es jedenfalls keine von uns gewesen sein. Wir wussten, dass die Fallon heute Morgen nicht die Patientin sein würde.«
Madeleine Goodale sagte: »Ich denke, das wussten alle. Wenigstens das ganze Nightingale House. Beim Frühstück wurde lang und breit darüber geredet.«
Wieder waren alle still und überdachten diese Wendung. Ms Beale fiel auf, dass keines der Mädchen beteuerte, dass niemand Interesse daran haben könnte, Schwester Fallon zu ermorden.
Schließlich sagte Maureen Burt: »So schlecht kann es der Fallon gar nicht gehen. Sie war nämlich heute Morgen ungefähr um zwanzig vor neun hier in Nightingale House. Shirley und ich haben gesehen, wie sie durch den Nebeneingang hinausschlüpfte, kurz bevor wir nach dem Frühstück in den Übungsraum gingen.«
Schwester Goodale fragte rasch: »Was hatte sie an?«
Maureen schien diese eigentlich unwesentliche Frage nicht zu überraschen. »Hosen. Mantel. Und dieses rote Kopftuch, das sie immer trägt. Warum?«
Schwester Goodale war sichtlich verwirrt, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. Sie sagte: »Das hat sie angezogen, bevor wir sie gestern Abend auf die Station brachten. Ich nehme an, sie hat etwas aus ihrem Zimmer geholt, das sie dringend brauchte. Aber sie hätte das Bett nicht verlassen sollen. Das war wirklich leichtsinnig. Sie hatte 39,9 Fieber, als sie eingeliefert wurde. Ein Glück, dass Oberschwester Brumfett sie nicht gesehen hat.«
Schwester Pardoe sagte gehässig: »Ziemlich seltsam, was?«
Niemand antwortete. Es war tatsächlich seltsam, dachte Ms Beale. Sie hatte den langen, nasskalten Weg vom Krankenhaus zur Schwesternschule vor Augen. Die Straße verlief in Serpentinen, und sicher gab es eine Abkürzung querfeldein durch die Bäume. Trotzdem war es so früh an einem Januarmorgen ein ungewöhnlicher Spaziergang für ein krankes Mädchen. Es musste einen zwingenden Grund dafür gegeben haben, dass sie ins Nightingale House gekommen war. Schließlich hätte sie doch bloß darum bitten müssen, wenn sie etwas aus ihrem Zimmer haben wollte. Ihre Mitschülerinnen hätten es ihr bestimmt ans Bett gebracht. Und das war nun das Mädchen, das an diesem Morgen eigentlich die Rolle der Patientin hätte übernehmen sollen, das folglich nebenan in dem Durcheinander von Schläuchen und Leintüchern liegen müsste.
Schwester Pardoe sagte: »Es gibt auf jeden Fall eine Person, die ganz sicher wusste, dass die Fallon heute Morgen nicht als Patientin auftreten würde. Schwester Fallon selbst!«
Schwester Goodale sah sie mit weißem Gesicht an.
»Wenn du unbedingt dumm und boshaft daherreden willst, kann ich dich wohl nicht daran hindern. Aber an deiner Stelle würde ich den Mund halten.«
Schwester Pardoe schien ungerührt, eher ein wenig belustigt. Ms Beale fing ihr verstohlenes, zufriedenes Lächeln auf und entschied, dass es höchste Zeit sei, diese Unterhaltung zu beenden. Sie suchte krampfhaft nach einem anderen Thema, als aus dem Sessel die schwache Stimme von Schwester Dakers kam: »Mir ist schlecht.«
Sofort richtete sich das Interesse auf sie. Nur Schwester Harper machte keine Anstalten zu helfen. Die anderen standen um das Mädchen herum und waren froh, sich endlich mit etwas beschäftigen zu können. Schwester Goodale sagte: »Ich gehe mit ihr runter auf die Toilette.«
Sie führte das Mädchen aus dem Zimmer. Zu Ms Beales Überraschung ging Schwester Pardoe mit. Offenbar waren die Meinungsverschiedenheiten schon wieder vergessen, als sie Schwester Dakers in die Mitte nahmen. Ms Beale blieb mit den Zwillingen und Schwester Harper allein. Wieder trat Stille ein. Aber Ms Beale hatte aus der Situation gelernt. Sie war unverzeihlich verantwortungslos gewesen. Es durfte nicht mehr von Tod und Mord geredet werden. Wenn sie schon unter ihrer Aufsicht waren, konnten sie genauso gut arbeiten. Sie sah Schwester Harper streng an und forderte sie auf, die Anzeichen, Symptome und die Behandlung eines Lungenkollapses zu beschreiben.
Zehn Minuten später kamen die drei anderen wieder zurück. Schwester Dakers sah immer noch blass aus, aber sie war jetzt etwas ruhiger. Dafür machte Schwester Goodale ein bestürztes Gesicht. Als könne sie es nicht länger für sich behalten, sagte sie: »Die Flasche mit dem Desinfektionsmittel ist nicht mehr im Waschraum. Ihr wisst, welche ich meine. Sie steht sonst immer auf dem kleinen Wandbrett. Pardoe und ich konnten sie nirgends finden.«
Schwester Harper unterbrach ihren gelangweilten, aber überraschend sachkundigen Vortrag und sagte: »Meinst du die Flasche mit dem milchigen Zeug? Gestern nach dem Abendessen stand sie noch da.«
»Das ist auch schon eine Weile her. War eine von euch heute Morgen unten auf der Toilette?«
Anscheinend keine. Sie sahen sich schweigend an.
In diesem Augenblick ging die Tür auf, die Oberin kam leise herein und schloss sie hinter sich. Gestärktes Leinen knisterte, als die Zwillinge vom Schreibtisch rutschten und strammstanden. Schwester Harper erhob sich schlaksig aus ihrem Sessel. Alle sahen Ms Taylor erwartungsvoll an.
»Kinder«, begann sie, und das unerwartet liebevolle Wort sagte ihnen die Wahrheit, bevor sie weitergesprochen hatte. »Kinder, Schwester Pearce ist vor wenigen Minuten gestorben. Wir wissen noch nicht, wie und warum, aber wenn etwas Unerklärliches dieser Art passiert, müssen wir es der Polizei melden. Der Verwalter ist gerade dabei, das zu tun. Ich möchte, dass Sie tapfer und vernünftig sind, aber darauf kann ich mich sicher verlassen. Bis die Polizei hier ist, halte ich es für besser, nicht über den Vorfall zu sprechen. Nehmen Sie Ihre Bücher mit und lassen Sie sich von Schwester Goodale in mein Wohnzimmer bringen. Ich schicke Ihnen gleich einen starken Kaffee nach oben. Sind Sie einverstanden?«
Ein leises, gemurmeltes »Ja, Oberin!« war die Antwort.
Ms Taylor wandte sich an Ms Beale. »Es tut mir außerordentlich leid, aber Sie werden auch noch etwas hierbleiben müssen.«
»Natürlich, Frau Oberin, das versteht sich doch von selbst.«
Über den Köpfen der Schülerinnen trafen sich ihre ratlosen Blicke in wortlosem Mitgefühl.
Im Nachhinein bekam Ms Beale einen leichten Schrecken, als sie sich an die Banalität und Unwichtigkeit ihres ersten bewussten Gedankens erinnerte: Das wird mein kürzester Inspektionsbericht. Was um Himmels willen soll ich der Schwesternaufsicht bloß erzählen?
5
Ein paar Minuten zuvor hatten sich die vier Personen im Übungsraum aufgerichtet und einander mit weißen Gesichtern und bis aufs Äußerste erschöpft angesehen. Heather Pearce war tot. Sie war tot nach klinischem und juristischem Befund. Sie hatten es während der letzten fünf Minuten gewusst, aber sie hatten weitergearbeitet, verbissen und stumm, als hätte noch eine Chance bestanden, das schlaffe Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Mr Courtney-Briggs’ Weste war voller Blut. Er starrte mit gerunzelter Stirn und krausgezogener Nase auf das verkrustende Blut, als sei es eine fremde Substanz für ihn. Die Herzmassage war eine ebenso schmutzige wie wirkungslose Angelegenheit gewesen. Erstaunlich schmutzig für Mr Courtney-Briggs, dachte die Oberin. Aber der Versuch war doch sicher gerechtfertigt gewesen? Sie hatten zu wenig Zeit gehabt, sie in den Operationssaal zu schaffen.
Dummerweise hatte Oberschwester Gearing die Magensonde herausgezogen. Es war vielleicht eine natürliche Reaktion gewesen, aber möglicherweise hatte sie Schwester Pearce um die einzige Überlebenschance gebracht. Wäre der Schlauch noch an seinem Platz gewesen, hätten sie wenigstens umgehend eine Magenspülung versuchen können. Wegen der heftigen Zuckungen des Mädchens war es unmöglich gewesen, einen anderen Schlauch durch die Nase einzuführen, und als die Krämpfe aufgehört hatten, war es zu spät gewesen. Mr Courtney-Briggs hatte die Thoraxwand öffnen müssen und die letzte mögliche Maßnahme versucht. Mr Courtney-Briggs’ heroische Bemühungen wurden allgemein anerkannt. Nur war es ein Jammer, dass sie den Leichnam so kläglich entstellt hatten. Im Übungsraum roch es wie in einem Schlachthaus. So etwas ließ sich im Operationssaal besser an, wo es vom rituellen Zubehör der Chirurgie verschleiert und geweiht wurde.
Er sprach als Erster: »Das war kein natürlicher Tod. In der Lösung war etwas anderes als Milch. Nun, ich meine, das ist uns allen klar. Wir sollten die Polizei verständigen. Ich benachrichtige Scotland Yard. Zufällig kenne ich dort jemanden persönlich. Einen der Abteilungsleiter.«
Er kennt überall jemanden, dachte die Oberin. Sie spürte einen Drang zu widersprechen. Als der Schock nachgelassen hatte, kam eine Gereiztheit in ihr hoch, die sich grundlos gegen den Arzt richtete. Sie sagte ruhig: »Die hiesige Polizei muss geholt werden, und ich meine, das ist Sache des Verwalters. Ich versuche jetzt, Mr Hudson über das Haustelefon zu erreichen. Die Polizei wird Scotland Yard einschalten, wenn sie es für notwendig hält. Ich sehe allerdings keinen Grund, warum. Aber das muss die Polizei entscheiden, nicht wir.«
Auf dem Weg zum Telefon musste sie einen Bogen um die zusammengekauerte Gestalt von Ms Rolfe machen. Die Erste Tutorin kniete immer noch vor der Leiche. Mit ihren glühenden Augen in dem totenbleichen Gesicht, mit dem schwarzen Haar, das unter dem gefältelten Häubchen ein wenig durcheinandergeraten war, und den besudelten Händen erinnerte sie die Oberin an eine Gestalt aus einem viktorianischen Melodram. Sie drehte langsam die Hände um und betrachtete die rote Masse mit wissenschaftlichem Interesse, als könne auch sie kaum glauben, dass es wirklich Blut war. Sie fragte: »Wenn der Verdacht besteht, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dürfen wir denn dann die Leiche wegbringen?«
Mr Courtney-Briggs erwiderte scharf: »Ich habe keineswegs vor, sie wegzubringen.«
»Aber wir können sie doch nicht hier liegen lassen, wenigstens nicht so!«, widersprach Ms Gearing. Sie war nahe daran zu weinen.
Der Chirurg starrte sie an. »Gute Frau, das Mädchen ist tot! Tot! Spielt es eine Rolle, wo wir die Leiche liegen lassen? Sie fühlt nichts. Sie weiß nichts davon. Werden Sie um Gottes willen nicht sentimental, was den Tod angeht. Dass wir überhaupt sterben, ist unwürdig, nicht, was mit unserem Leichnam geschieht.«
Er wandte sich brüsk ab und ging hinüber zum Fenster. Oberschwester Gearing machte eine Geste, als wolle sie hinter ihm hergehen, dann ließ sie sich auf den nächsten Stuhl fallen und begann leise schnüffelnd, vor sich hin zu weinen. Keiner achtete auf sie. Oberschwester Rolfe richtete sich steif auf. Mit vorgestreckten Händen ging sie in der rituellen Haltung einer OP-Schwester an das Waschbecken in der Ecke, drückte mit dem Ellbogen den Wasserhahn auf und begann, sich die Hände zu säubern. Am Telefon wählte die Oberin eine fünfstellige Nummer. Sie hörten ihre ruhige Stimme.
»Verwaltung? Ist Mr Hudson da? Hier spricht die Oberin.« Es dauerte eine Weile. »Guten Morgen, Mr Hudson. Ich rufe vom Übungsraum im Nightingale House aus an. Könnten Sie bitte sofort rüberkommen. Ja. Sehr dringend. Es ist leider etwas Tragisches, etwas Entsetzliches passiert. Sie werden die Polizei anrufen müssen. Nein, ich möchte Ihnen das nicht am Telefon erzählen. Danke.« Sie legte auf und sagte leise: »Er kommt sofort. Er muss auch den Vizepräsidenten ins Bild setzen – zu dumm, dass Sir Marcus in Israel ist –, aber als Erstes muss die Polizei benachrichtigt werden. Und jetzt muss ich es wohl den anderen Schülerinnen sagen.«
Oberschwester Gearing versuchte, sich zu fassen. Sie schnäuzte lautstark in ihr Taschentuch, verstaute es in der Tasche und hob ihr verquollenes Gesicht.
»Es tut mir leid. Der Schock vermutlich. Es war alles so grässlich. Dass so etwas Schreckliches passieren muss. Und wo ich gerade zum ersten Mal eine Klasse hatte. Und alle haben sie dagesessen und es mit angesehen. Die Schülerinnen ja auch. So ein entsetzlicher Unfall.«
»Unfall, Oberschwester?« Mr Courtney-Briggs wandte sich vom Fenster ab. Er ging langsam auf sie zu und beugte seinen bulligen Kopf über sie. Seine Stimme klang rau, fast geringschätzig, als er ihr seine Worte entgegenschleuderte. »Ein Unfall? Wollen Sie etwa behaupten, dass ein Ätzmittel zufällig in die Nährlösung gekommen ist? Oder dass ein Mädchen bei vollem Verstand sich ausgerechnet auf diese grausame Art und Weise umbringen würde? Kommen Sie, Oberschwester, machen wir uns doch nichts vor. Was wir gerade miterlebt haben, war Mord!«
Windstille um Mitternacht