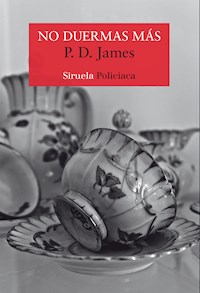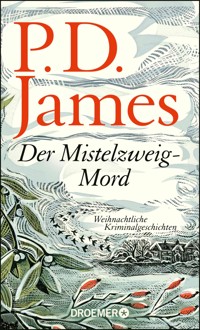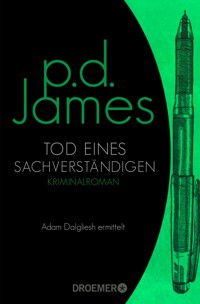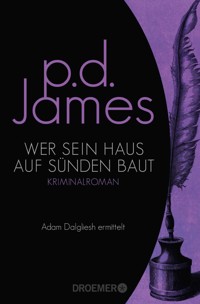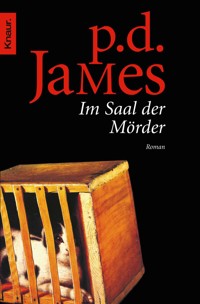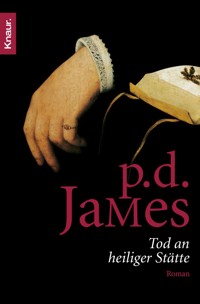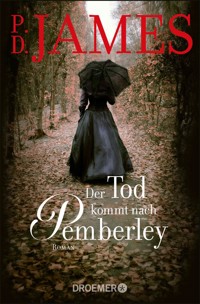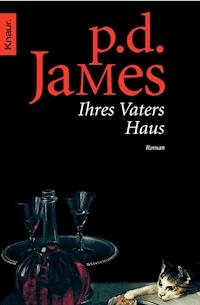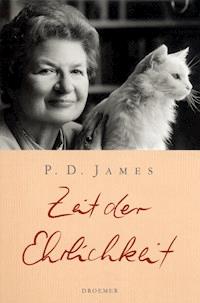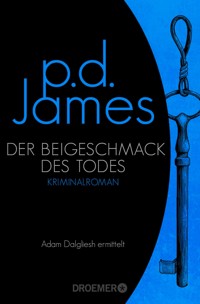
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dalgliesh-Romane
- Sprache: Deutsch
In der Sakristei einer Londoner Kirche werden zwei Leichen mit durchgeschnittener Kehle gefunden: ein konservativer Abgeordneter und ein Stadtstreicher. Mord mit anschließendem Selbstmord? Zweifacher Mord? Oder Doppelselbstmord? Commander Adam Dagliesh steht vor einem Rätsel. "Wer süffiges Erzählen zu schätzen weiß, wird zweifellos seine Freude an dieser bitterbösen Erzählerin haben." Cosmopolitan Der Beigeschmack des Todes von P. D. James: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
P. D. James
Der Beigeschmack des Todes
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Georg Auerbach
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zwei Leichen, die Kehlen mit brutaler Präzision durchschnitten, liegen in der schmuddligen Sakristei von St Matthew, Paddington, in ihrem Blut. Einer der Männer ist ein alkoholisierter Stadtstreicher; der andere, Sir Paul Berowne, ein Baronet und seit kurzem im Ruhestand befindlicher Minister der Königin. Auf der Suche nach der Wahrheit verstrickt sich Adam Dalgliesh zusammen mit seiner neuen Assistentin in eine der kompliziertesten Ermittlungen seiner Karriere. Er wird die düsteren Winkel der Berowne’schen Familiengeschichte auszuleuchten haben, die lange hinter dem Glanz von Wohlhabenheit und Eleganz verborgen lagen.
Inhaltsübersicht
Motto
Vorwort
Erstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Zweites Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Drittes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Viertes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Fünftes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Sechstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Siebtes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Manche können mit offenen Augen durch die Welt laufen,
ohne dass ihnen schlecht wird.
Doch ich habe das nie gelernt.
Eins kann man vom Leben wirklich sagen:
Für den Menschen hat es einen Beigeschmack des Todes.
A. E. Housman
Vorwort
Bei den Bewohnern von Campden Hill Square möchte ich mich für die Kühnheit entschuldigen, mit der ich ein Haus von Sir John Soane errichtet und die Symmetrie der Häuserreihe gestört habe, und bei der Londoner Diözese für die Erweiterung des seelsorgerischen Bedarfs um eine Basilika von Sir Arthur Blomfield sowie deren Kirchturm am Ufer des Grand-Union-Kanals. Die anderen hier beschriebenen Örtlichkeiten gehören erkennbar zu London. Umso wichtiger ist es daher festzuhalten, dass alle im Roman geschilderten Ereignisse fiktiv und alle toten und lebenden Personen vollkommen frei erfunden sind.
Dem Direktor und den Angestellten des Gerichtsmedizinischen Labors der Metropolitan Police möchte ich für ihre großzügige Hilfe bei den wissenschaftlichen Details danken.
Erstes Buch
Tod eines Baronets
1
Entdeckt wurden die Toten um Viertel vor neun – am Mittwoch, dem 18. September – von Miss Emily Wharton, einer 65-jährigen alten Jungfer aus der Londoner Pfarrei St. Matthew in Paddington, und dem erst zehnjährigen Darren Wilkes, der seines Wissens keinem bestimmten Sprengel angehörte, falls ihn das überhaupt interessierte. Das ungleiche Paar hatte Miss Whartons Wohnung in Crowhurst Gardens knapp vor halb acht verlassen, um die wenigen hundert Meter längs des Grand-Union-Kanals zur St.-Matthew-Kirche zu Fuß zu gehen. Wie jeden Mittwoch und Freitag wollte Miss Wharton die verwelkten Blumen aus der Vase vor der Muttergottesstatue entfernen, die Messingleuchter von heruntergelaufenem Wachs und Kerzenstümpfen befreien, in der Marienkapelle von den beiden Stuhlreihen, die für die wenigen zur Morgenmesse erwarteten Gläubigen völlig ausreichten, den Staub wischen und alles Übrige für die Ankunft von Hochwürden Barnes um zwanzig nach neun vorbereiten.
Vor sieben Monaten hatte sie auf dem Weg zu solchen Verrichtungen Darren erstmals getroffen. Er spielte gerade allein auf dem einstigen Treidelpfad, sofern man so etwas Unsinniges wie das Schleudern leerer Bierdosen in den Kanal überhaupt als Spiel bezeichnen kann. Sie blieb stehen, um ihm einen guten Morgen zu wünschen. Es mochte ihn erstaunt haben, dass ihn eine erwachsene Frau ansprach, ohne ihm Vorhaltungen zu machen oder ins Gewissen zu reden. Nach seiner anfänglichen Verblüffung schloss er sich ihr aus irgendeinem unerfindlichen Grund an. Zuerst folgte er ihr zögernd, dann umkreiste er sie wie ein streunender Hund. Nach einer Weile trottete er neben ihr her, und bedenkenlos ging er ihr ins Innere der St.-Matthew-Kirche nach, als wären sie an jenem Morgen gemeinsam aufgebrochen.
Miss Wharton war schon am ersten Tag aufgefallen, dass er noch nie in einer Kirche gewesen sein konnte. Aber weder damals noch bei einem der nachfolgenden Kirchenbesuche bekundete er die geringste Wissbegier, fragte nach Sinn und Zweck. Während sie ihre Arbeit verrichtete, strolchte er in der Sakristei und im Glockenraum umher, sah mit kritischem Gesichtsausdruck zu, wie sie die sechs Narzissen samt Zierlaub in der Vase zu Füßen der Marienstatue arrangierte, und registrierte mit der gelassenen Gleichgültigkeit eines Kindes ihr häufiges Niederknien. Für ihn waren diese unerwarteten Verrenkungen offenbar nur eine weitere Manifestation des befremdlichen Verhaltens der Erwachsenen.
In den beiden folgenden Wochen hatte sie ihn abermals auf dem Treidelpfad getroffen. Nach dem dritten Kirchenbesuch ging er unaufgefordert mit in ihre Wohnung, wo sie gemeinsam eine Tomatensuppe und Fischstäbchen verzehrten. Und dieses Mahl begründete wie eine sakrale Handlung das sonderbare, mit keinem Wort erwähnte Zusammengehörigkeitsgefühl, das sie seither aneinanderband. Aber schon vorher war ihr in einer Aufwallung von Dankbarkeit und Scheu bewusst geworden, dass sie ihn nicht mehr missen wollte. Bei ihren gemeinsamen Besuchen verschwand er jedes Mal urplötzlich aus der Kirche, sobald die ersten Gemeindemitglieder eintrafen. Doch nach der Messe begegnete sie ihm abermals auf dem Treidelpfad, wo er sich irgendwie die Zeit vertrieben hatte. Er schloss sich ihr wieder an, als hätten sie sich nie getrennt. Miss Wharton hatte über ihn weder mit Pfarrer Barnes noch mit einem anderen Mitglied des Sprengels von St. Matthew gesprochen. Und soviel sie wusste, hatte auch er in seiner kindlichen Verschlossenheit mit niemandem über sie geredet. Sie wusste über ihn, seine Eltern, sein Leben ebenso wenig wie bei ihrer ersten Begegnung. Das war vor sieben Monaten gewesen. An einem kalten Vormittag Mitte Februar, als die Büsche, die die sich anschließende Sozialsiedlung vom Kanalweg abschirmten, einem leblosen, dornenstarrenden Dickicht glichen. Die schwarzen Knospen an den Eschenzweigen waren noch so starr, dass man sich nur schwer vorstellen konnte, sie würden sich einmal zu grünem Laub entfalten. Die dünnen, nackten Weidenruten hatten das zu neuem Leben erwachende Kanalwasser gestreift und gekräuselt.
Doch jetzt begann der Spätsommer die Natur braun einzufärben, allmählich wurde es Herbst. Miss Wharton schloss kurz die Augen, während sie über das herabgefallene Laub schritt, und meinte, sie könne trotz des von dem träge dahinströmenden Kanalwasser und der feuchten Erde aufsteigenden Geruchs den berauschenden Duft der Holunderblüten im Juni wahrnehmen. Dieser Duft eines Sommermorgens erinnerte sie eindringlich an ihre in Shropshire verbrachte Kindheit. Es graute ihr vor dem bevorstehenden Winter. Als sie heute Morgen erwacht war, hatte sie sich eingebildet, sie verspüre bereits seinen eisigen Atem. Obwohl es seit einer Woche nicht geregnet hatte, war der Pfad mit einer glitschigen Laubschicht bedeckt, die ihre Schritte dämpfte. In beklemmender Stille gingen sie unter den Baumkronen weiter. Selbst das helle Tschilpen der Spatzen war verstummt. Der Graben zu ihrer Rechten, der den Kanal säumte, war noch üppig grün. Dichte Grasbüschel wuchsen zwischen geborstenen Autoreifen, weggeworfenen Matratzen und Kleidungsstücken, die in der Mulde allmählich verrotteten. Die Weiden ließen die zerzausten Zweige mit den zierlichen Blättern ins ölige, stehende Wasser hängen.
Es war Viertel vor neun, als sie sich der Kirche näherten. Sie mussten nur noch einen der niedrigen Tunnels durchqueren, die unter dem Kanal hindurchführten. Darren, dem dieser Teil des Weges am besten gefiel, rannte hinein und stieß einen wilden Schrei aus, um ein Echo hervorzurufen. Mit den Händen, die an fahle Seesterne erinnerten, strich er über die Backsteine. Miss Wharton folgte dem vorauseilenden Jungen und ängstigte sich zugleich vor dem Augenblick, da sie durch den Ziegelsteinbogen in die beengende, feuchte, nach fauligem Flusswasser riechende Finsternis treten musste und überlaut hören würde, wie das Wasser gegen die Steinplatten schwappte und von der niedrigen Decke Tropfen schwer herabfielen. Sie schritt rascher aus. Nach einiger Zeit wurde der helle Halbmond am Tunnelende immer größer, und sie traten endlich ins Tageslicht. Darren, den es zu frösteln schien, trottete wieder an ihrer Seite.
»Es ist kalt heute, Darren«, sagte sie. »Wäre es da nicht besser gewesen, du hättest deinen Parka angezogen?«
Er hob die mageren Schultern und schüttelte den Kopf. Es verwunderte sie immer wieder, dass ihm die Kälte offensichtlich nichts ausmachte, obwohl er unzureichend bekleidet war. Anscheinend machte es ihm Spaß, wenn ihn ständig fröstelte. Sich an einem herbstlich kühlen Morgen wärmer anzuziehen konnte doch nicht unmännlich sein. Zudem stand ihm der Parka. Es hatte sie irgendwie erleichtert, als er erstmals darin erschienen war. Er war hellblau mit roten Streifen, ein teures, offensichtlich neues Kleidungsstück, ein beruhigendes Anzeichen dafür, dass seine Mutter, die sie bisher noch nicht kennengelernt hatte und von der er nie sprach, für ihn sorgte.
Mittwochs wechselte Miss Wharton zuerst die Blumen aus. Heute hatte sie, in dünnes Papier eingeschlagen, einen Strauß hellroter Rosen und einen kleineren aus weißen Chrysanthemen dabei. Die Stiele waren noch feucht, und sie spürte, wie die Nässe durch ihre Wollhandschuhe drang. Die Blüten waren noch geschlossen. Nur eine war halb geöffnet, beschwor für einen flüchtigen Augenblick die Pracht des Sommers herauf und machte Miss Wharton dennoch ein wenig beklommen.
Darren schenkte ihr häufig Blumen, wenn sie zur Kirche gingen. Sie stammten, wie er ihr versicherte, von seinem Onkel Frank, der in Brixton einen Blumenstand hatte. Aber stimmte das auch? Letzten Freitag hatte er ihr vor dem Abendessen geräucherten Lachs in die Wohnung gebracht. Er sei von Onkel Joe, der in der Nähe von Kilburn eine Gaststätte betreibe. Aber die saftigen, delikaten Scheiben waren mit Pergamentpapier voneinander getrennt, und die weiße Porzellanplatte, auf der sie lagen, erinnerte sie an das Geschirr im Schaufenster von Marks and Spencer’s, das sie einmal mit unerfüllbarem Verlangen gemustert hatte. Nur das Firmenetikett fehlte. Angewidert verzog er das Gesicht, als sie ihm auch etwas anbot, und beobachtete sie weiterhin mit einer geradezu trotzigen Befriedigung. Wie eine Mutter, dachte sie, die zusieht, wie ihr Kind nach überstandener Krankheit erstmals wieder etwas zu sich nimmt. Aber da sie alles aufaß und noch eine Weile später den köstlichen Nachgeschmack verspürte, wäre sie sich undankbar vorgekommen, hätte sie ihn eingehender befragt. Doch die Geschenke häuften sich. Sollte er ihr wieder einmal etwas schenken, würde sie ernsthaft mit ihm reden müssen.
»Darren, hat deine Mutter wirklich nichts dagegen, wenn du mir in der Kirche hilfst?«, fragte sie ihn.
»Nee. Das geht in Ordnung. Hab ich Ihnen ja schon gesagt.«
»Du besuchst mich auch so oft in meiner Wohnung. Ich finde das zwar schön, aber bist du sicher, dass es sie nicht stört?«
»Ach was! Das ist okay.«
»Wäre es nicht besser, wenn ich sie mal besuchte, sie kennenlernte, damit sie weiß, mit wem du zusammen bist?«
»Das weiß sie. Außerdem ist sie nicht zu Haus. Sie ist nach Romford zu meinem Onkel Ron gefahren.«
Ein weiterer Onkel. Wie sollte sie sich nur alle merken können? Ein peinigender Gedanke überfiel sie. »Wer kümmert sich denn jetzt um dich, Darren? Ist sonst noch jemand in eurer Wohnung?«
»Nein, niemand. Bis zu ihrer Rückkehr schlafe ich bei einer Nachbarin. Mir fehlt es an nichts.«
»Hast du denn heute keinen Unterricht?«
»Hab ich Ihnen doch schon gesagt. Heute ist keine Schule. Wir haben frei. Ich hab’s Ihnen doch gesagt.« Seine Stimme klang dünn, überschlug sich fast. Als sie darauf nichts erwiderte, passte er sich ihrem Schritttempo an und sagte in normalem Tonfall: »In Notting Hill gibt’s Küchenkrepp für 48 Pence die Doppelrolle. In dem neuen Supermarkt. Ich könnte Ihnen ein paar Rollen besorgen, wenn Sie wollen.«
Er muss sich häufig in Supermärkten herumtreiben, dachte sie. Vielleicht kaufte er auf dem Heimweg von der Schule für seine Mutter ein. Er hatte auch ein bewundernswertes Gespür für billige Sachen und berichtete ihr immer wieder von Sonderangeboten und erstaunlichen Preisnachlässen.
»Ich werde mich dort selbst mal umsehen, Darren«, sagte sie. »Denn das ist wirklich preiswert.«
»Ja, das denke ich auch. Echt billig. Unter 50 Pence habe ich noch keine gesehen.«
Fast die ganze Zeit über hatten sie ihr Ziel vor Augen gehabt: die 1870 von Arthur Blomfield im romanischen Stil erbaute Basilika mit ihrem hohen Glockenturm, den ein grünspaniges Runddach zierte. Jetzt ragte der mächtige Bau unmittelbar vor ihnen auf. Sie zwängten sich durch das Drehkreuz im Gitterzaun und schlugen den Kiesweg zum überdachten Südportal ein, für das Miss Wharton einen Schlüssel hatte. Dahinter lagen die kleine Sakristei, in der sie ihren Mantel aufhängen konnte, und die Küche, wo sie immer die Vasen auswusch und die frischen Blumen arrangierte. Als sie vor dem Portal standen, warf sie noch kurz einen Blick auf das kleine Blumenbeet, das gärtnerisch begabte Gemeindemitglieder mit mehr Optimismus denn Erfolg dem kümmerlichen Boden längs des Kiesweges abzutrotzen suchten.
»Schau mal, Darren!«, rief sie. »Sind sie nicht hübsch? Die ersten Dahlien. Ich hätte nie gedacht, dass sie hier blühen würden. Nicht doch, pflück sie nicht! Sie sind doch so schön!«
Er hatte sich über das Beet gebeugt, und seine Hand tastete suchend zwischen den Pflanzen. Nach ihrer Ermahnung richtete er sich auf und steckte die erdbeschmierte Hand in die Hosentasche. »Können Sie die denn nicht für die Marienstatue brauchen?«
»Die Muttergottes bekommt die Rosen von deinem Onkel«, erwiderte sie. Wenn sie doch nur tatsächlich von seinem Onkel kämen! Ich muss mal ernstlich mit ihm reden, dachte sie. Ich kann doch der Muttergottes keine gestohlenen Rosen zumuten! Aber vielleicht sind sie gar nicht gestohlen. Was ist, wenn sie’s nicht sind und ich ihn des Diebstahls bezichtige? Damit zerstöre ich doch alles, was zwischen uns ist. Ich will ihn nicht verlieren. Außerdem könnte er erst dadurch zum Diebstahl verleitet werden. Längst vergessen geglaubte Phrasen kamen ihr in den Sinn: Man darf die kindliche Unschuld nicht verderben, keinen Anlass zur Sünde bieten. Das muss ich mir genau überlegen, dachte sie. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür.
Sie kramte in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel an dem Holzring und versuchte ihn ins Schloss zu stecken. Es gelang ihr nicht. Als sie verwirrt, aber keineswegs beunruhigt den Türknauf drehte, ging das schwere, eisenbeschlagene Portal langsam auf: Es war nicht verschlossen. Innen steckte ein Schlüssel. Im Gang war kein Laut zu hören. Es brannte auch kein Licht. Die Eichentür zur kleinen Sakristei auf der linken Seite war zu. Pfarrer Barnes musste also schon da sein. Merkwürdig, dass er vor ihr gekommen war. Warum hatte er nicht das Ganglicht brennen lassen? Während sie mit behandschuhter Hand nach dem Schalter tastete, zwängte sich Darren vorbei und rannte zu dem Gusseisengitter, das den Gang vom Kirchenschiff trennte. Es bereitete ihm offensichtlich Spaß, gleich nach ihrer Ankunft eine Kerze anzuzünden. Wenn er seine dünnen Arme durch das Gitter steckte, konnte er den Kerzenständer und den Opferstock gerade noch erreichen. Schon zu Beginn ihres Spaziergangs hatte sie ihm wie gewöhnlich ein Zehn-Penny-Stück zugesteckt. Sie hörte ein leises Klirren und sah, wie er die Kerze in die Halterung schob und nach den Streichhölzern in dem Messinghalter griff.
Erst in diesem Augenblick verspürte sie so etwas wie Furcht. Eine dumpfe Vorahnung überkam sie. Eine gewisse Unruhe und ein vages Gefühl von Bedrohung vermischten sich zu Angst. Da war dieser schwache Geruch, der ihr fremd, aber auch irgendwie erschreckend vertraut vorkam. Jemand musste vor Kurzem hier gewesen sein. Was hatte das unversperrte Portal zu bedeuten? Warum brannte im Gang kein Licht? Plötzlich war sie sich sicher, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste.
»Darren!«, rief sie.
Er drehte sich um, musterte ihr Gesicht und rannte zu ihr.
Sie öffnete zunächst ganz sachte, dann mit einem Ruck die Tür. Das grelle Licht blendete sie. Die lange Neonröhre, die die Decke verunstaltete, war eingeschaltet. Ihre Helligkeit verdrängte das sanfte Tageslicht im Gang. Miss Wharton erschauerte.
Zwei waren es, und sie wusste sogleich und mit unerschütterlicher Gewissheit, dass sie tot waren. Der Raum glich einer Stätte des Grauens. Mit durchschnittenen Kehlen lagen die Toten in einer Blutlache, wie hingeschlachtete Tiere. Unwillkürlich schob sie Darren hinter sich. Aber es war zu spät. Auch er hatte die Toten erspäht. Er hatte zwar nicht aufgeschrien, aber sie spürte, wie er zitterte. Er stieß einen leisen, dumpfen Klagelaut aus wie ein kleiner, in die Enge getriebener Hund. Sie schob ihn in den Gang hinaus, schloss die Tür und lehnte sich dagegen. Sie nahm nur wahr, dass ihr erschreckend kalt war und ihr Herz wie rasend pochte. Es schien aufzuquellen, kam ihr riesig vor, schien zu glühen. Das schmerzende Hämmern ließ ihren schmächtigen Körper erzittern, als würde er gleich bersten. Und der Geruch, der zunächst ganz schwach, geradezu flüchtig gewesen war, schien ihr hinaus auf den Gang gefolgt zu sein, als ließe sich der Tod nicht aufhalten.
Sie stemmte sich gegen die Tür und fand es tröstlich, dass das dicke, mit Schnitzereien verzierte Eichenholz nicht nachgab. Aber weder dieser Halt noch ihre fest geschlossenen Augen konnten sie den grauenhaften Anblick vergessen machen. Hell erleuchtet wie auf einer Theaterbühne sah sie noch immer die Leichen vor sich liegen, deutlicher, in noch grellerem Licht als vorhin. Der eine Tote war von der niedrigen Liege rechts zur Tür hin geglitten und schien sie – den Mund weit aufgerissen, den Kopf fast vom Körper getrennt – anzustarren. Sie sah die durchschnittenen Blutgefäße, die wie zerfranste Kanülen aus dem geronnenen Blut ragten. Der zweite Tote lehnte wie eine unförmige Stoffpuppe an der Wand gegenüber. Der Kopf hing herab, und wie ein vorgebundenes rotes Lätzchen bedeckte ein großer Blutfleck die Brust. Eine braunblaue Wollhaube saß schief auf dem Kopf. Das rechte Auge war verdeckt, das linke glotzte sie mit einem abscheulich wissenden Ausdruck an. Die Verstümmelungen schienen die Toten nicht nur des Lebens, sondern auch jeglicher Identität, jeglicher Menschenwürde beraubt zu haben. Sie glichen keinen Menschen mehr. Und überall diese Blutspritzer. Es kam ihr vor, als ertrinke sie in Blut. Blut pochte in ihren Ohren, zwängte sich in ihren Mund, spritzte in hellroten Tropfen gegen die Netzhaut ihrer geschlossenen Augen. Das Bild des Todes, dem sie sich nicht entziehen konnte, drängte sich ihr in einem blutigen Schwall auf, der sich auflöste, neu bildete und abermals verschwand. Plötzlich hörte sie Darrens Stimme und merkte, dass er sie am Ärmel zog.
»Wir müssen abhauen, bevor die Bullen kommen«, flüsterte er. »Kommen Sie schon! Wir haben einfach nichts gesehen, gar nichts. Wir sind nie hier gewesen.«
Seine Stimme klang angsterfüllt. Er packte ihren Arm. Wie spitze Zähne gruben sich seine schmutzigen Finger durch den dünnen Tweed. Behutsam löste sie sich aus seinem Griff. Sie war selbst überrascht, dass sie trotz allem so gleichmütig sprechen konnte.
»Das ist Unsinn, Darren. Uns werden sie schon nicht verdächtigen. Wenn wir aber weglaufen, könnte das Verdacht erregen.« Sie schob ihn weiter in den Gang hinaus. »Ich bleibe hier. Du holst Hilfe. Wir müssen die Tür abschließen. Niemand darf eintreten. Ich warte hier, und du holst Pfarrer Barnes. Du weißt doch, wo die Pfarrwohnung ist? Es ist die Eckwohnung in dem großen Mietshaus in der Barrow Road. Pfarrer Barnes weiß schon, was zu tun ist. Er wird die Polizei benachrichtigen.«
»Aber Sie können doch nicht so ganz allein hierbleiben! Wenn er noch immer da ist! Wenn er irgendwo in der Kirche lauert und alles beobachtet! Nein, wir bleiben zusammen. Okay?«
Der gebieterische Tonfall seiner kindlichen Stimme verwirrte sie. »Aber es gehört sich nicht, die Toten allein zu lassen, Darren. Einer muss hierbleiben. Es wäre gefühllos, unanständig. Ich muss dableiben.«
»Das ist doch Blödsinn! Sie können ohnehin nichts tun. Die beiden sind tot, mausetot. Sie haben’s doch selbst gesehen.« Er machte eine rasche Bewegung mit der Hand, als würde er sich mit einem Messer über die Kehle fahren, verdrehte die Augen und röchelte. Der Laut hörte sich grässlich realistisch an, als bekäme er tatsächlich einen Blutsturz.
»Nicht doch, Darren!«, rief sie. »Lass das bitte!«
Sogleich versuchte er, sie zu beruhigen. Auch seine Stimme klang gelassener. Er ergriff ihre Hand. »Sie gehen jetzt mit mir zu Pfarrer Barnes.«
Ängstlich schaute sie auf ihn herab, als sei sie das Kind. »Wenn du meinst, Darren.«
Er hatte sich durchgesetzt. Sein schmächtiger Körper schien größer geworden zu sein. »Ja, das meine ich. Sie kommen jetzt mit.« Er war der Situation gewachsen. Sie schloss es aus seinem Tonfall, sah es dem Ausdruck seiner leuchtenden Augen an. Er war nicht länger entsetzt, ja nicht einmal verwirrt. Ihre Regung, ihn vor dem schrecklichen Anblick schützen zu müssen, war unangebracht gewesen. Er hatte den Anflug von Angst bei dem Gedanken, der Polizei zu begegnen, längst überwunden. Vertraut mit all den Gewalttätigkeiten im Fernsehen konnte er zwischen ihnen und der Wirklichkeit sehr wohl unterscheiden. Vielleicht wäre es aber besser gewesen, er hätte das in seiner kindlichen Unschuld noch nicht gekonnt. Er legte seinen dünnen Arm um ihre Schultern und geleitete sie zur Tür. Sie stützte sich auf ihn. Wie besorgt er um mich ist, dachte sie. Ein lieber Junge, dieser Darren. Trotzdem musste sie mit ihm mal über die vielen Blumen und den Lachs reden. Aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken.
Sie traten ins Freie. Die frische, kühle Luft kam ihr wie eine belebende Meeresbrise vor. Doch nachdem sie vereint das schwere, eisenbeschlagene Portal geschlossen hatten, schaffte sie es nicht mehr, den Schlüssel ins Schloss zu stecken, so zitterten ihr die Hände. Darren nahm ihr den Schlüssel ab, reckte sich und schob ihn ins Schloss. Plötzlich knickten ihre Beine ein, und sie sank langsam und ungraziös wie eine erschlaffte Marionette auf die Steinstufe. Er musterte sie forschend.
»Ist Ihnen nicht gut?«, fragte er.
»Ich fürchte, ich kann nicht mehr gehen, Darren. Das ist gleich vorüber. Aber so lange muss ich hierbleiben. Du musst allein Pfarrer Barnes holen. Beeil dich!« Als er zögerte, sagte sie: »Der Mörder kann nicht mehr in der Kirche sein. Das Portal war nicht verschlossen, als wir kamen. Er ist geflüchtet, nachdem er … Er würde doch nicht bleiben und riskieren, geschnappt zu werden, oder?«
Sonderbar, dachte sie, wie mein Verstand noch funktioniert, während mein Körper mich im Stich lässt. Aber die Annahme war doch logisch. Er konnte nicht mehr da sein und sich, das Messer in der Faust, irgendwo in der Kirche verbergen. Es sei denn, der Tod wäre erst vor Kurzem eingetreten. Aber das viele Blut sah nicht danach aus. Oder doch? Ihr wurde plötzlich flau im Magen. Lieber Gott, bat sie, erspar mir das! Bis zur Toilette schaffe ich es nicht mehr. Ich wage es nicht, da noch einmal hineinzugehen. Es wäre so demütigend, wenn dann noch Pfarrer Barnes und die Polizei einträfen. Es war schon peinlich genug, hier zu liegen wie ein Bündel alter Kleider.
»Beeil dich!«, flüsterte sie. »Mir geht’s gleich besser. Lauf schon, Darren!«
Er hetzte davon. Nachdem er verschwunden war, kämpfte sie weiter gegen das quälende Gurgeln in ihrem Magen und gegen den Brechreiz an. Sie versuchte zu beten, aber sonderbarerweise fielen ihr nicht die richtigen Worte ein. »Gütiger Gott, schenk den Seelen der Gerechten in deiner Barmherzigkeit die ewige Ruhe!« Aber vielleicht waren die beiden keine Gerechten gewesen. Es musste doch ein Gebet geben, das auf alle Menschen, auf alle Ermordeten zutraf. Bestimmt. Sie musste Pfarrer Barnes fragen. Er kannte sicherlich eins.
Ein neuer Schrecken überfiel sie. Wo hatte sie nur ihren Schlüssel gelassen? Sie musterte den Schlüssel in ihrer Hand. An ihm hing ein Holztäfelchen, das an einer Ecke versengt war, weil Pfarrer Barnes es versehentlich zu nahe an die Gasflamme gehalten hatte. Das war der Ersatzschlüssel, den er in der Pfarrwohnung aufbewahrte. Der hatte im Schloss gesteckt, und sie hatte ihn Darren gegeben, damit er das Portal wieder zusperrte. Aber was hatte sie nur mit ihrem getan? Sie wühlte wie von Sinnen in ihrer Handtasche, als sei der Schlüssel ein ungemein wichtiger Gegenstand, sein Verlust eine Katastrophe.
Sie sah schon deutlich, wie sie eine Phalanx von Augen argwöhnisch musterte, die Polizei schroff Rechenschaft von ihr verlangte, während Pfarrer Barnes sich müde und niedergeschlagen abwandte. Doch dann fanden ihre tastenden Finger den Schlüssel zwischen der Geldbörse und dem Taschenfutter, und sie holte ihn mit einem Seufzer der Erleichterung hervor. Sie musste ihn geistesabwesend eingesteckt haben, als sie feststellte, dass das Portal bereits aufgeschlossen war. Sonderbar war nur, dass sie sich nicht mehr darauf besinnen konnte. Was sich zwischen ihrer Ankunft und dem Augenblick, als sie die Tür zur kleinen Sakristei öffnete, zugetragen hatte, war wie weggewischt.
Plötzlich merkte sie, dass eine dunkle, hochgewachsene Gestalt neben ihr stand. Sie schaute auf und erkannte Pfarrer Barnes. Ein Gefühl der Geborgenheit überkam sie.
»Haben Sie die Polizei benachrichtigt, Herr Pfarrer?«, fragte sie.
»Noch nicht. Ich wollte mich selbst überzeugen. Der Junge hätte mir ja auch einen Streich spielen können.«
Sie mussten an ihr vorbei in die Kirche, in diesen grauenhaften Raum gegangen sein. Und sie hatte es, an die Mauer geschmiegt, überhaupt nicht bemerkt. Ungeduld wallte in ihr hoch wie ein würgender Brechreiz. Am liebsten hätte sie ausgerufen: Jetzt haben Sie’s ja endlich gesehen! Sie hatte angenommen, mit seinem Erscheinen würde sich alles zum Besten wenden. Nein, nicht zum Besten, aber der Vorfall würde sich klären lassen, einen Sinn ergeben. Pfarrer Barnes würde schon die passenden Worte finden. Aber wenn sie ihn so ansah, wurde ihr klar, dass er nichts Tröstliches zu sagen hatte. Sie musterte sein Gesicht: die rötlichen Flecken, die von der morgendlichen Kühle herrührten, die farblosen Bartstoppel, die starren Haare am Mundwinkel, den dunklen Tupfer geronnenen Blutes im linken Nasenloch, der wohl auf Nasenbluten zurückzuführen war, die noch vom Schlaf verklebten Augen. Wie dumm von ihr, dass sie sich eingebildet hatte, er könnte sie aufmuntern, das Grauen irgendwie erträglicher machen. Er wusste nicht einmal, was er tun sollte. So war es auch schon damals bei der Weihnachtsdekoration gewesen. Seit Pfarrer Collins’ Weggang hatte Mrs. Noakes immer die Kanzel geschmückt. Doch dann hatte Lilly Moore gemeint, das sei ungerecht, sie sollten einander beim Schmücken der Kanzel und des Taufsteins abwechseln. Pfarrer Barnes hätte eine klare Entscheidung treffen und auch zu ihr stehen sollen. Es war immer das Gleiche. Aber jetzt war wohl kaum der geeignete Zeitpunkt, an die Weihnachtsdekoration zu denken, selbst wenn ihr ihre Fantasie blutrote Stechpalmenbeeren und Weihnachtssterne vorgaukelte. Außerdem war das da drinnen gar nicht blutrot gewesen, eher ein rötliches Braun.
Armer Pfarrer Barnes, dachte sie, als ihre Gereiztheit in Rührseligkeit umschlug. Er ist eben ein Versager wie ich. Wir sind beide Versager. Jetzt wurde ihr auch bewusst, dass Darren neben ihr stand und zitterte. Jemand sollte ihn nach Hause bringen. Gütiger Himmel, wie mag sich all das nur auf ihn auswirken, dachte sie. Auf uns beide. Pfarrer Barnes stand noch immer unschlüssig neben ihr und drehte den Schlüssel in seinen unbehandschuhten Händen.
»Herr Pfarrer, wir müssen die Polizei benachrichtigen!«, mahnte sie leise.
»Die Polizei. Selbstverständlich. Ja, wir müssen die Polizei benachrichtigen. Ich werde sie von der Pfarrwohnung aus anrufen.« Als er weiterhin zögerte, kam ihr ein Einfall. »Kennen Sie die Toten, Herr Pfarrer?«
»Ja. Der Tippelbruder ist Harry Mack. Armer Harry! Er hat zuweilen unterm Vordach genächtigt.«
Diese Angabe hätte er sich sparen können. Als ob sie nicht wüsste, dass Harry gelegentlich unterm Vordach die Nacht verbrachte! Schließlich hatte sie danach schon öfter den ganzen Unrat fortschaffen müssen, die Essensreste, die Einkaufstüten, die herumliegenden Weinflaschen, hin und wieder auch abscheulichere Dinge. An der Wollmütze, der Jacke hätte sie Harry eigentlich erkennen müssen. Sie verdrängte den Gedanken, warum sie ihn nicht wiedererkannt hatte.
»Und der andere, Pfarrer Barnes? Kennen Sie den auch?«, fragte sie mit der gleichen Sanftmut wie vorhin.
Er schaute auf sie herab. Sie ahnte seine Angst, seine Bestürzung, seine Verwirrung wegen all der Misslichkeiten, die nun auf ihn zukamen. Er wandte den Blick ab und sagte stockend: »Der andere ist Paul Berowne, Sir Paul Berowne. Er ist … er war Minister in der Regierung Ihrer Majestät.«
2
Sobald Commander Adam Dalgliesh nach der Besprechung mit dem Polizeichef wieder in sein Büro kam, rief er Chief Inspector John Massingham an. Der Hörer wurde beim ersten Läutton abgehoben. Massingham meldete sich mit kaum gebändigter Ungeduld.
»Der Polizeichef hat mit dem Innenministerium gesprochen«, sagte Dalgliesh. »Wir sollen den Fall übernehmen, John. Da die neue Sonderkommission offiziell vom nächsten Montag an einsatzbereit ist, ziehen wir die Sache eben sechs Tage früher durch. Außerdem gilt Paul Berowne rechtlich gesehen noch als Abgeordneter des Wahlbezirks Hertfordshire North East. Er hat zwar am Samstag in einem Brief an den Finanzminister sein Amt zur Verfügung gestellt, aber niemand scheint zu wissen, ob nun sein Rücktritt vom Ankunftstag des Briefes an gilt oder von dem Tag an, an dem der Finanzminister das Abschiedsgesuch bewilligte. Aber das sind nur Spitzfindigkeiten. Wir haben den Fall zu bearbeiten.«
Massingham war die genaue Prozedur bei der Aufgabe eines Parlamentssitzes ohnehin gleichgültig. »Steht es fest, dass der Tote Sir Paul Berowne ist, Sir?«
»Einer der Toten. Vergessen Sie den Stadtstreicher nicht. Ja, es handelt sich um Paul Berowne. Noch am Tatort konnte seine Identität festgestellt werden. Er war dem Gemeindepfarrer bekannt. Es war nicht das erste Mal, dass Berowne die Nacht in der Sakristei der St.-Matthew-Kirche verbrachte.«
»Ein seltsamer Ort zum Übernachten.«
»Oder zum Sterben. Haben Sie schon Inspector Miskin informiert?«
Zwar wurde Inspector Miskin seit ihrem ersten Einsatz von beiden nur »Kate« genannt, aber diesmal erwähnte Dalgliesh auch ihren Rang.
»Sie hat heute dienstfrei, Sir«, antwortete Massingham. »Ich habe sie jedoch in ihrer Wohnung erreichen können. Ich habe Robins beauftragt, ihre Ausrüstung mitzubringen. Sie stößt am Tatort zu uns. Auch die übrigen Teammitglieder sind informiert.«
»In Ordnung, John. Nehmen Sie den Rover. Wir treffen uns draußen. In vier Minuten.«
Massingham hätte sicher nichts dagegen gehabt, dachte Dalgliesh, wenn er Kate Miskin in ihrer Wohnung nicht erreicht, sie nicht hätte benachrichtigen können. Die neue Sonderkommission war in Zusammenarbeit mit C1 gebildet worden und sollte Verbrechen aufklären, die aus politischen und anderen Gründen ein gewisses Fingerspitzengefühl erforderten. Dalgliesh war es von Anfang an klar gewesen, dass der Sonderkommission auch eine erfahrene Polizeibeamtin angehören musste. Deshalb war es ihm wichtiger gewesen, die beste auszuwählen, als darüber nachzudenken, ob sie auch ins Team passte. Er hatte die siebenundzwanzigjährige Kate Miskin aufgrund ihrer dienstlichen Beurteilung und ihres Verhaltens beim Vorgespräch genommen. Sie besaß die Qualitäten, die er vor allem schätzte: Intelligenz, Mut, Diskretion und gesunden Menschenverstand, lauter Eigenschaften, die einen Polizeifahnder auszeichnen sollten. Man musste abwarten, was sie sonst noch einbrachte. Er wusste, dass sie und Massingham vorher schon einmal zusammengearbeitet hatten. Er war damals gerade zum Detective Inspector befördert worden, während sie als Sergeant Dienst tat. Es hieß, die Zusammenarbeit sei nicht ohne Reibungen abgelaufen. Doch seitdem hatte Massingham gelernt, seine Vorurteile – trotz seiner allseits bekannten Eigenwilligkeit – zu zügeln. Überdies konnte eine neue, unvoreingenommene Denkungsart, selbst eine gesunde Rivalität der Lösung ihrer Aufgaben förderlicher sein als die abschottende Macho-Mentalität, die zumeist ein nur aus Männern bestehendes Team zusammenband.
Dalgliesh räumte rasch, aber methodisch die Akten auf seinem Schreibtisch beiseite und überprüfte noch seine Tasche mit den Einsatzutensilien. Massingham hatte er vier Minuten gegeben, und die wollte auch er einhalten. Als hätte er sich bewusst programmiert, befand er sich bereits in einer Welt, in der Zeitangaben eine wichtige Rolle spielen, Details genau registriert werden, die Sinne auf Geräusche, Gerüche, optische und sonstige Wahrnehmungen, auf das Zucken eines Augenlids etwa, den Tonfall einer Stimme überscharf reagieren. Er war schon zu so vielen Leichen beordert worden, zu so vielen Tatorten, war auf so viele Stadien körperlicher Verwesung gestoßen. Er hatte alte und noch junge Menschen tot daliegen sehen, die Mitleid oder Grauen erregten. Ihr einziges gemeinsames Merkmal war, dass sie durch einen anderen Menschen ein gewaltsames Ende gefunden hatten. Dieser Fall jedoch war anders. Es war das erste Mal, dass er das Opfer kannte, dass er den Ermordeten gemocht hatte. Er sagte sich, es sei sinnlos, darüber nachzudenken, ob das die Untersuchung beeinflussen könne. Aber dass es diesmal irgendwie anders war, war ihm zutiefst bewusst.
»Vielleicht hat er sich auch selbst die Kehle durchgeschnitten«, hatte der Polizeichef gemeint. »Aber da gibt es noch einen Toten, einen Stadtstreicher. Der Fall ist in mehr als nur einer Hinsicht überaus heikel.«
Seine Empfindungen auf diese Eröffnung hin waren teils voraussehbar, teils komplex und deswegen verwirrend gewesen. Selbstverständlich bestürzte es ihn zunächst einmal, als er von dem gänzlich unerwarteten Tod eines Menschen hörte, den er, wenn auch nur flüchtig, gekannt hatte. Seine Gefühle wären kaum anders gewesen, wenn man ihm mitgeteilt hätte, Berowne wäre einem Herzinfarkt erlegen oder bei einem Autounfall umgekommen. Doch gleich darauf empfand er so etwas wie Empörung, eine Leere, eine Aufwallung von Melancholie, die zwar nicht so bedrückend war, als dass man sie hätte Trauer nennen können, aber immerhin ausgeprägter als nur eine Regung des Bedauerns. Aber so stark war das Gefühl nun auch wieder nicht gewesen, dass er gesagt hätte: Ich kann den Fall nicht übernehmen, Chef. Ich bin persönlich betroffen. Er geht mir zu nahe.
Während er auf den Fahrstuhl wartete, machte er sich klar, dass sein Engagement keineswegs größer war als in irgendeinem anderen Fall. Berowne war tot. Es war seine Aufgabe herauszufinden, wie und warum er gestorben war. Er fühlte sich seinem Job verpflichtet, den Lebenden, nicht den Toten.
Massingham fuhr mit dem Rover an der Rampe vor, als er die Schwingtür passierte.
»Sind die Spurensicherer und der Fotograf schon unterwegs?«, fragte Dalgliesh beim Einsteigen.
»Ja, Sir.«
»Und was ist mit den Leuten vom Labor?«
»Sie schicken uns eine erfahrene Gerichtsmedizinerin. Wir treffen uns am Tatort.«
»Haben Sie Doktor Kynaston erreicht?«
»Nein, Sir. Nur seine Haushälterin. Er hat seine Tochter in Neuengland besucht. Das macht er jeden Herbst. Die BA-Maschine sollte um sieben Uhr fünfundzwanzig in Heathrow eintreffen. Sie ist sicherlich schon gelandet, aber er wird auf dem Westway im Verkehr stecken geblieben sein.«
»Versuchen Sie’s noch einmal. Vielleicht ist er jetzt zu Hause.«
»Doktor Greeley ist verfügbar, Sir. Kynaston macht sicher die Zeitumstellung noch zu schaffen.«
»Ich möchte Kynaston haben, gleichgültig, ob ihm die Zeitumstellung zu schaffen macht oder nicht.«
»Bei diesem Kadaver muss anscheinend die Elite ran«, murmelte Massingham.
Etwas in seiner Stimme, ein Unterton von Belustigung, möglicherweise Verachtung, irritierte Dalgliesh. Reagiere ich etwa jetzt schon überempfindlich in diesem Fall, noch bevor ich den Toten gesehen habe, fragte er sich.
Wortlos legte er den Gurt an, während der Rover sich in den Verkehr auf dem Broadway einfädelte. Diese Straße hatte er vor knapp vierzehn Tagen genommen, um sich mit Sir Paul Berowne zu treffen.
Während er geradeaus blickte, die Welt außerhalb des beengenden Wageninneren kaum wahrnahm, auch nicht, wie Massingham fast geräuschlos von einem Gang in den anderen schaltete, wie die Verkehrsampeln ihre Signale wechselten, unterdrückte er jeden Gedanken an die Gegenwart und seine bevorstehende Arbeit und bemühte sich angestrengt, als sei jede Kleinigkeit bedeutsam, sich seine letzte Begegnung mit dem nun Verstorbenen ins Gedächtnis zurückzurufen.
3
Es war am Donnerstag, dem 5. September gewesen. Er wollte eben sein Büro verlassen, um zum Police College in Bramshill zu fahren, wo er vor höheren Polizeibeamten ein Referat halten sollte, als der Anruf kam. Berownes Privatsekretär redete, wie es ihm seine Stellung abverlangte. Sir Paul wäre überaus dankbar, wenn Commander Dalgliesh für eine kurze Unterredung ein paar Minuten erübrigen könnte. Es wäre reizend, könnte er gleich kommen. Denn Sir Paul müsse in etwa einer Stunde im House of Commons eine Besuchergruppe aus seinem Wahlkreis treffen.
Die Aufforderung kam ihm ungelegen, obgleich er Berowne sympathisch fand. Da man ihn erst nach dem Lunch in Bramshill erwartete, hatte er eine Fahrt nach Nord-Hampshire geplant, um die Kirchen in Sherborne St. John und Winchfield zu besichtigen. Den Lunch wollte er danach in einem Pub in der Nähe von Stratfield Saye einnehmen.
Er ließ die Reisetasche im Büro, zog wegen der herbstlichen Morgenkühle seinen Tweedmantel an und fuhr an der St.-James-Station vorbei zum Ministerium.
Kaum war er durch die Schwingtür eingetreten, stellte er erneut fest, dass ihm der alte Bau in Whitehall samt seiner neugotischen Pracht weitaus besser gefallen hatte. Die Arbeit in dem alten Kasten war sicherlich mit mehr Unzulänglichkeiten und weniger Komfort verbunden gewesen. Denn er war in einer Zeit errichtet worden, als die Räume noch mit Kohleöfen beheizt wurden, deren Bedienung einer Heerschar dienstbarer Geister oblag. Damals konnte man noch mit wenigen handgeschriebenen Sitzungsprotokollen, penibel angefertigt von jenen legendären Sonderlingen im Ministerium, all die Ereignisse steuern, für die man heute drei gesonderte Abteilungen und etliche Staatssekretäre benötigte. Das neue Gebäude war zweifellos in seiner Art gelungen. Doch wenn es unerschütterliche Autorität mit menschlicher Note suggerieren sollte, so war sich Dalgliesh nicht sicher, ob derlei dem Architekten auch geglückt war. Es schien ihm eher für einen multinationalen Konzern tauglich zu sein denn für ein weitläufiges Staatsministerium. Vor allem vermisste er die riesigen Porträts, die dem imposanten Treppenhaus in Whitehall eine unbestreitbare Würde verliehen hatten. Von jeher hatte ihn die Darstellungskunst beeindruckt, mit der Maler von unterschiedlichem Talent einer unscheinbaren, bisweilen auch reizlosen Gestalt durch imposante Gewandung, einem rundlichen Gesicht durch den Ausdruck imperialer Macht eine gewisse Noblesse bescheren konnten. Doch zumindest hatte man inzwischen das großformatige Konterfei der Prinzessin entfernt, das noch unlängst die Eingangshalle geschmückt hatte. Die Fotografie hätte ohnehin besser in einen Coiffeursalon im Londoner West End gepasst.
Obwohl man Dalgliesh am Empfangsschalter wiedererkannte und mit einem Lächeln begrüßte, wurde sein Ausweis eingehend überprüft. Man ersuchte ihn, auf einen der Ministeriumsdiener zu warten, der ihn eskortieren werde. Dabei hatte er schon an mehreren Besprechungen in dem Gebäude teilgenommen, sodass ihm die vielen Korridore ministerieller Macht durchaus vertraut waren. Von den betagten Dienern waren nur noch wenige im Amt, und seit einigen Jahren stellte das Ministerium auch Frauen ein. Sie geleiteten die ihnen Anvertrauten mit einer fröhlichen, matronenhaft wirkenden Selbstsicherheit, als wollten sie allen klarmachen, dass der Bau vielleicht zwar wie ein Gefängnis aussehe, in Wirklichkeit aber ebenso wohltuend sei wie ein Sanatorium und ihnen nur zum Vorteil gereiche.
Man führte ihn ins Vorzimmer. Da im Ministerium wegen der Parlamentsferien nicht die sonstige Betriebsamkeit herrschte, war es in dem Raum ungewohnt ruhig. Die Schreibmaschinen waren mit Schutzhüllen bedeckt, und eine einzige Sekretärin überprüfte irgendwelche Akten ohne den gewichtigen Ernst, der üblicherweise die Büroflucht eines Ministers prägte.
Nach einer Weile erschien Sir Paul und streckte ihm zur Begrüßung die Hand entgegen, als träfen sie einander zum ersten Mal. Sein Gesicht wirkte wie immer ernst, sogar ein wenig melancholisch, was sich aber änderte, wenn er lächelte. Und das tat er jetzt.
»Es tut mir leid, dass ich Sie so überstürzt hergebeten habe. Ich bin froh, dass wir Sie überhaupt noch erreichen konnten. Bis jetzt ist die Angelegenheit nicht ernst, sie könnte es aber werden.«
Jedes Mal, wenn Dalgliesh ihn wiedersah, musste er an das Bild seines Vorfahren Sir Hugo Berowne in der National Portrait Gallery denken. Sir Hugo hatte sich im Grunde nur durch seine unerschütterliche, wenn auch wenig wirkungsvolle Treue zum Königshaus ausgezeichnet. Seine einzige bemerkenswerte Leistung bestand darin, dass er van Dyck beauftragt hatte, ein Porträt von ihm zu malen. Das hatte ausgereicht, ihm zumindest in Form eines Gemäldes eine gewisse Unsterblichkeit zu sichern. Das Herrenhaus in Hampshire befand sich schon längst nicht mehr im Besitz der Familie. Das Vermögen hatte sich erheblich verringert. Aber noch immer blickte Sir Hugos längliches und melancholisches, von einem kostbaren Spitzenkragen gesäumtes Gesicht mit arroganter Herablassung auf die vorbeiziehenden Galeriebesucher, der perfekte royalistische Landedelmann des 17. Jahrhunderts. Es war geradezu unheimlich, wie ähnlich ihm der jetzige Baronet war: das gleiche langgezogene Gesicht, die hoch angesetzten, zu einem spitzen Kinn zulaufenden Wangenknochen, die weit auseinanderstehenden Augen mit dem etwas herabhängenden linken Augenlid, die fahlen Hände mit den langgliedrigen Fingern, der gleiche prüfende, ein wenig ironisch wirkende Blick.
Dalgliesh bemerkte, dass der Schreibtisch des Ministers leer war. Eine Notwendigkeit für einen mit Arbeit überhäuften Mann, der sich nicht um seinen Verstand bringen wollte. Man widmete sich einer bestimmten Sache, vertiefte sich in sie, erledigte sie und gab sie weiter. Im Augenblick vermittelte Sir Paul den Eindruck, die einzige Angelegenheit, die seine volle Aufmerksamkeit erforderte, sei eine mehr oder minder unbedeutende, kurzgefasste Mitteilung auf einem weißen Papierbogen von DIN-A4-Format. Er überreichte sie Dalgliesh.
»Der Parlamentsabgeordnete für den Wahlkreis Hertfordshire North East«, las Dalgliesh, »zeigt ungeachtet seiner faschistischen Tendenzen eine lobenswert liberale Einstellung, wenn es um die Rechte der Frauen geht. Trotzdem sollten sich die Frauen vorsehen. Denn der Umgang mit dem eleganten Baronet könnte tödliche Folgen haben. Seine erste Frau kam bei einem Autounfall ums Leben; er steuerte den Wagen. Theresa Nolan, die seine Mutter pflegte und in seinem Haus wohnte, tötete sich nach einer Abtreibung. Er wusste, wo man die Tote entdecken würde. Diana Travers, seine Hausangestellte, fand man nackt und ertrunken in der Themse unweit des Ortes, wo seine Frau eine Party anlässlich ihres Geburtstages gab, zu der auch er erwartet wurde. Wenn derlei einmal vorkommt, ist es eine private Tragödie. Beim zweiten Mal sieht es nach einer Unglückssträhne aus. Beim dritten Mal mag sich der Eindruck von Fahrlässigkeit aufdrängen.«
»Das ist mit einer elektrischen Kugelkopfmaschine geschrieben«, meinte Dalgliesh. »Diese Modelle lassen sich schlecht identifizieren. Und das Papier stammt von einem Schreibblock, wie er zu Tausenden verkauft wird. Das bringt uns nicht weiter. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen das hier zugeschickt haben könnte?«
»Nicht die geringste. Zudem gewöhnt man sich an die alltäglichen Schmähbriefe oder pornografischen Schreiben. Das bringt meine Arbeit so mit sich.«
»Aber das ist doch fast eine Mordanklage. Wenn man den Absender aufspürt, wird Ihnen Ihr Anwalt sicher zu einer Anzeige raten.«
»Mag sein.«
Wer immer den Brief geschrieben hat, dachte Dalgliesh, besitzt eine gewisse Schulbildung. Die Interpunktion stimmte, der Text las sich flüssig. Die Fakten waren verständlich geordnet, die Informationen reichten aus. Das Niveau lag zweifellos über dem des üblichen unflätigen, anonymen Geschreibsels, das sich unter der Post eines Ministers befinden mochte. Deswegen war es auch umso gefährlicher.
»Das ist nicht das Original«, sagte Dalgliesh und gab das Blatt zurück. »Es ist eine Fotokopie. Haben nur Sie allein diesen Brief erhalten, Sir Paul, oder wissen Sie das nicht?«
»Er wurde auch der Presse zugesandt. Einer Zeitung zumindest: der Paternoster Review. Sie bringt ihn in der heutigen Ausgabe. Ich habe sie vorhin gelesen.«
Berowne zog eine Schreibtischschublade heraus und entnahm ihr eine Zeitung, die er Dalgliesh gab. Seite 8 war mit einer Büroklammer markiert. Dalgliesh überflog die Kolumne. Die Paternoster Review brachte seit einiger Zeit eine Artikelserie über die jüngere Politikergeneration. Diesmal war Paul Berowne an der Reihe. Der erste Teil des Artikels war harmlos und sachlich. Der Verfasser streifte Berownes Karriere als Rechtsanwalt, seinen ersten, vergeblichen Versuch, Parlamentsabgeordneter zu werden, schließlich seinen Durchbruch bei der Wahl von 1979, den erstaunlichen Aufstieg zum Regierungsmitglied und seine mutmaßliche Beziehung zum Premier. Erwähnt wurde ferner, dass er zusammen mit seiner Mutter, Lady Ursula Berowne, und seiner zweiten Frau in einer der wenigen noch erhalten gebliebenen Villen, die Sir John Soane erbaut hatte, wohne und seine Tochter aus erster Ehe, die vierundzwanzigjährige Sarah Berowne, für eine linke Politik eintrete und sich ihrem Vater entfremdet habe. Ein auffallend hämischer Unterton klang aus der Passage über seine zweite Ehe heraus. Nachdem sein älterer Bruder, Major Sir Hugo Berowne, in Nordirland ums Leben gekommen war, hatte Sir Paul knapp fünf Monate nach dem Unfalltod seiner Frau die Verlobte seines Bruders geehelicht. »Es mag durchaus statthaft sein, dass die hinterbliebene Verlobte und der Witwer beieinander Trost suchten, obgleich niemand, der die schöne Barbara Berowne kennt, auf den Gedanken verfallen könnte, die Eheschließung sei lediglich brüderlichem Verantwortungsgefühl entsprungen.« Danach ließ sich der Verfasser mit einiger Sachkenntnis, aber wenig Sympathie über Sir Pauls politische Zukunft aus. Es war kaum mehr als Parlamentariergeschwätz.
Die Spitze verbarg sich im letzten Absatz, über dessen Quelle es keinen Zweifel gab. »Es ist bekannt, dass er eine Schwäche für Frauen hat. Die meisten finden ihn auch attraktiv. Aber die Frauen, die ihm besonders nahestanden, erlitten ein trauriges Schicksal. Seine erste Frau verlor ihr Leben bei einem Autounfall; er steuerte den Wagen. Theresa Nolan, eine junge Krankenschwester, die seine Mutter, Lady Ursula Berowne, pflegte, verübte nach einer Abtreibung Selbstmord. Paul Berowne entdeckte die Tote. Vor vier Wochen wurde eine junge Frau, Diana Travers, die in seinen Diensten stand, ertrunken aufgefunden. Das war unmittelbar nach einer Party, die anlässlich des Geburtstages seiner Frau stattfand und der er gleichfalls beiwohnen sollte. Wird ein Politiker vom Unglück verfolgt, so ist ihm das ebenso wenig förderlich wie Mundgeruch. Denn es könnte durchaus seine politische Karriere beeinträchtigen. Viel eher als der Argwohn, er sei sich über seine Ziele keineswegs im Klaren, könnte der bittere Beigeschmack des Unglücks der Voraussage, hier stehe der übernächste Premierminister der Konservativen Partei, jede Grundlage entziehen.«
»Die Paternoster Review ist im Ministerium keine Pflichtlektüre«, sagte Berowne. »Vielleicht sollte das anders sein. Nach dem hier zu urteilen, entgeht uns anscheinend einiges an Unterhaltung, wenn nicht sogar an Information. Gelegentlich lese ich die Review im Club wegen der interessanten Buchbesprechungen. Wissen Sie etwas Genaueres über dieses Blatt?«
Warum wendet er sich nicht an die PR-Abteilung seines Ministeriums, fragte sich Dalgliesh. Schon merkwürdig, dass er es offenbar nicht getan hat. »Ich kenne Conrad Ackroyd, den Verleger und Herausgeber der Paternoster Review, seit Jahren«, sagte er. »Schon sein Großvater und Vater haben die Zeitung herausgegeben. Damals wurde sie noch am Paternoster Place in der City gedruckt. Ackroyd verdient damit kein Geld. Sein Vater hat ihm durch gewinnträchtigere Investitionen ein Vermögen hinterlassen, doch ich glaube, die Review bringt einigermaßen die Unkosten herein.
Ackroyd veröffentlicht zwar gelegentlich Klatsch, aber das ist nicht sein Metier. Dazu fehlt ihm die nötige Dreistigkeit. Ich glaube nicht, dass er jemals einen Verleumdungsprozess riskiert hat. Deswegen ist auch die Zeitung weniger reißerisch und spritzig als ein Boulevardblatt, bis aufs Feuilleton. Das ist dafür herrlich bissig … Die aufgeführten Fakten werden sicherlich stimmen, so was wird vorher stets nachgeprüft. Trotzdem ist der Artikel für die Paternoster Review erstaunlich bösartig.«
»Ja, die Fakten stimmen«, bestätigte Berowne. Er sagte es gelassen, beinahe traurig. Er ließ sich nicht weiter darüber aus, noch schien er eine Erklärung abgeben zu wollen.
Welche Fakten denn, wollte Dalgliesh schon nachhaken. Die in dem Artikel oder die in dem anonymen Brief? Aber er unterdrückte die Frage. Bis jetzt war es weder ein Fall für die Polizei noch für ihn. Vorläufig lag die Initiative ganz bei Berowne. »Ich kann mich an die Untersuchung im Zusammenhang mit dem Tod dieser Theresa Nolan erinnern. Vom Tod Diana Travers’ weiß ich nichts«, sagte er. »Der Fall wurde von der überregionalen Presse nicht aufgegriffen«, erklärte Berowne. »Nur das Lokalblatt berichtete kurz über die Untersuchung. Meine Frau wurde nicht erwähnt. Diana Travers nahm an der eigentlichen Geburtstagsparty nicht teil. Aber es war dasselbe Restaurant: das ›Black Swan‹ an der Themse bei Cookham. Man handelte wohl nach der Devise der Versicherungsfirmen: Warum soll man aus einer Krise gleich ein Drama machen?«
Die Angelegenheit war also vertuscht worden, und Berowne hatte davon gewusst. Wenn eine junge Frau, die als Hausangestellte für einen Minister arbeitete, den Tod durch Ertrinken fand, nachdem sie im selben Restaurant gegessen hatte wie die Frau des Ministers – war er nun selbst zugegen oder nicht –, hätte normalerweise eine der überregionalen Zeitungen zumindest in einem kurzen Absatz darüber berichtet.
»Was erwarten Sie nun von mir, Sir Paul?«, fragte Dalgliesh.
»Das weiß ich selbst nicht genau«, erwiderte Berowne lächelnd. »Behalten Sie die Sache im Auge. Ich erwarte nicht, dass Sie die Angelegenheit selbst übernehmen. Das wäre zu viel verlangt. Aber sollte sich das zu einem offenen Skandal ausweiten, muss sich jemand dieser Sache annehmen. Im jetzigen Stadium wollte ich Sie lediglich darüber informieren.«
Und das hatte er eigentlich nicht getan. Bei jedem anderen hätte Dalgliesh mit einiger Schärfe darauf hingewiesen. Dass er es bei Berowne nicht tat, irritierte ihn. Über beide Untersuchungen wird es doch Abschlussberichte geben, dachte er dann. Die meisten Fakten kann ich ja den offiziellen Quellen entnehmen. Mit dem Rest muss er herausrücken, wenn die Sache zu einer öffentlichen Anklage aufgebauscht wird. Und sollte das eintreten, hängt es vom Ausmaß des Skandals ab, von der Stichhaltigkeit und dem genauen Inhalt der Anklage, ob Sir Paul die nötigen rechtlichen Schritte einleiten muss oder ob die neugebildete Sonderkommission eingreifen wird. Er überlegte, was Berowne von ihm erwartete. Sollte er den Briefschreiber, der vermutlich eine Erpressung plante, aufspüren oder Berownes Schuld hinsichtlich der beiden Todesfälle feststellen? Wahrscheinlich würde es zu einem Skandal kommen. Wenn schon die Paternoster Review den anonymen Brief erhalten hatte, war er auch an andere Blätter und Gazetten geschickt worden, sicherlich auch an die überregionalen Zeitungen. Vermutlich hielten diese sich noch zurück. Aber das bedeutete noch lange nicht, dass der Brief in den Papierkorb gewandert war. Nein, sie hatten ihn vorläufig beiseitegelegt und berieten sich erst einmal mit ihren Anwälten. In der Zwischenzeit war es am klügsten, wenn er die weitere Entwicklung abwartete. Aber ein Gespräch mit Conrad Ackroyd würde nicht schaden. Ackroyd war einer der ergiebigsten Klatschkolporteure von ganz London. Eine halbe Stunde im eleganten, behaglichen Salon seiner Frau brachte zumeist mehr ein und war weitaus unterhaltsamer als stundenlanges Sichten von offiziellen Dokumenten.
»Ich treffe mich gleich mit einer Wählergruppe im House of Commons«, sagte Berowne. »Ich soll die Leute ein wenig herumführen. Falls Sie Zeit haben, könnten Sie mich dorthin begleiten.« Das Ansinnen hörte sich eher nach einem Befehl an. Aber sobald sie das Ministerium verlassen hatten, wandte sich Berowne ohne jede Erklärung nach links und ging die Treppe zum Birdcage Walk hinunter. Offenbar wollte er den längsten Weg zum House of Commons, am St.-James-Park entlang, einschlagen. Dalgliesh überlegte, ob es Dinge geben könnte, die ihm sein Begleiter lieber außerhalb des Büros anvertrauen wollte.
Doch falls das Berownes Absicht gewesen sein sollte, wurde sie vereitelt. Kaum hatten sie den Birdcage Walk überquert, rief ihnen jemand mit aufgekratzter Stimme etwas zu. Sie erkannten Jerome Mapleton, der – rundlich, verschwitzt, ein wenig außer Atem – auf sie zueilte. Er war Abgeordneter von Süd-London, einem sicheren Wahlkreis, den er dennoch nur selten verließ, als befürchte er, selbst eine einwöchige Abwesenheit könnte ihn gefährden. Zwanzig Jahre Parlamentszugehörigkeit hatten die Begeisterung für seine Arbeit wie sein Erstaunen, dass er tatsächlich einen Sitz errungen hatte, nicht dämpfen können. Redselig, gesellig, dickfellig, schloss er sich, als würde er magnetisch angezogen, jeder Gruppierung an, die größer oder bedeutsamer war als die, der er gerade angehörte. Er trat vor allem für Recht und Ordnung ein, ein Bemühen, das ihn bei seinen Wählern aus dem prosperierenden Mittelstand, die sich hinter Sicherheitsschlössern und dekorativen Fenstergittern verschanzt hielten, überaus populär machte. Er zwängte sich nun zwischen Berowne und Dalgliesh und begann ausschweifend über ein kürzlich ernanntes Komitee zu reden.
»Und was haben Sie Großes vor, Commander?«, fragte er Dalgliesh nach einer Weile.
»Ein Woche voller Referate vor führenden Polizeioffizieren in Bramshill. Danach muss ich wieder zurück, um die neue Sonderkommission zusammenzustellen.«
»Da haben Sie ja reichlich zu tun. Was würde übrigens geschehen, sollte ich den Parlamentsabgeordneten von Chesterfield West ermorden, bevor die neue Sonderkommission einsatzbereit ist?«, fragte er und lachte scheppernd über diese abstruse Vorstellung.
»Ich hoffe nur, Sie werden dieser Versuchung widerstehen, Sir«, erwiderte Dalgliesh.
»Ich werde mir alle Mühe geben. Aber da wir schon von Mord sprechen – in der heutigen Ausgabe der Paternoster Review steht ein überaus befremdlicher Artikel über Sie, Berowne. Man springt nicht eben freundlich mit Ihnen um.«
»Ja«, erwiderte Berowne kurz angebunden. »Ich hab ihn gelesen.« Er beschleunigte seinen Schritt, sodass Mapleton, der noch immer etwas außer Atem war, sich entweder aufs Reden oder aufs Schritthalten verlegen musste. Als sie das Finanzministerium erreichten, musste er zu dem Schluss gelangt sein, es sei die Mühe nicht wert, und bog, ihnen noch einmal zuwinkend, in die Parliament Street ein. Falls Berowne wirklich vorgehabt hatte, etwas Vertrauliches zu sagen, war der passende Augenblick verstrichen. Die Fußgängerampel schaltete auf Grün. Kein Fußgänger am Parliament Square zögert, wenn die Ampel zu seinen Gunsten umschaltet. Berowne warf Dalgliesh einen bedauernden Blick zu, als wollte er sagen: Sie sehen’s ja selbst, auch die Verkehrsampeln haben sich gegen mich verschworen! – und ging schnellen Schritts auf die andere Seite. Dalgliesh sah zu, wie er die Bridge Street überquerte, mit einem Kopfnicken auf den Gruß des diensthabenden Polizisten reagierte und dann im New Palace Yard verschwand. Es war eine kurze und nicht besonders ergiebige Begegnung gewesen. Er hatte das dumpfe Gefühl, dass Berowne in größeren, beunruhigenderen Schwierigkeiten steckte, als solche Schmähbriefe auslösen konnten. Auf dem Weg zum Yard sagte er sich, dass Berowne sich schon melden würde, falls er ihm etwas Vertrauliches mitteilen wollte.
Doch dazu war es nie gekommen. Als er eine Woche später auf der Rückfahrt von Bramshill das Radio einschaltete, hörte er von Berownes Rücktritt als Minister. Einzelheiten wurden nicht genannt. Berownes einzige Erklärung war, dass für ihn der Zeitpunkt gekommen sei, seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Das Schreiben des Premiers, am nächsten Tag in der Times veröffentlicht, bekundete in konventionelle Floskeln verpacktes Verständnis, fiel aber befremdend kurz aus. Die englische Leserschaft versuchte in einem der verregnetsten Sommer seit Jahren etwas Sonne zu erhaschen und nahm das Ausscheiden eines Neulings im Ministeramt mit Gleichgültigkeit hin; den meisten wäre es ohnehin schwergefallen, auch nur die Namen dreier Kabinettsmitglieder dieser oder irgendeiner Regierung zu nennen. Und die Kolporteure von parlamentarischem Klatsch, die trotz der langweiligen Sauregurkenzeit in London ausharrten, warteten hochgespannt auf den Ausbruch des Skandals. Auch Dalgliesh wartete. Aber es kam zu keinem Skandal. Berownes Rücktritt blieb geheimnisumwittert.
Dalgliesh hatte sich noch in Bramshill die Abschlussberichte über die Fälle Theresa Nolan und Diana Travers zuschicken lassen. Auf den ersten Blick gab es keinen Anlass zur Besorgnis. Theresa Nolan hatte nach einer Abtreibung mit medizinischer Indikation ihren Großeltern einen Brief hinterlassen, in dem sie ihren Selbstmord ankündigte; diese hatten bezeugt, dass es ihre Handschrift war. An ihrer Absicht, in den Tod zu gehen, konnte folglich nicht gezweifelt werden. Und Diana Travers war, nachdem sie reichlich gegessen und gezecht hatte, in die Themse gesprungen, um zu ihren Freunden zu schwimmen, die sich in einem Kahn vergnügten. Dabei war sie ertrunken. Dalgliesh hatte das ungute Gefühl, dass beide Fälle nicht so eindeutig waren, wie es die Abschlussberichte darstellten, aber offensichtlich stand keiner der Todesfälle mit einem Mord in Verbindung. Er war sich nicht im Klaren, ob er jetzt noch weiter nachhaken sollte, ob das nach Berownes Rücktritt überhaupt noch sinnvoll war. Er entschied, vorläufig nichts zu unternehmen und die Initiative Berowne zu überlassen.
Und nun war Berowne, der Vorbote des Todes, selbst tot. Entweder war er freiwillig aus dem Leben geschieden, oder jemand hatte ihn umgebracht. Falls er ihm damals auf dem Weg zum House of Commons ein Geheimnis hatte anvertrauen wollen, bliebe das für immer ungesagt. Sollte er aber tatsächlich ermordet worden sein, würde nun vieles ans Tageslicht kommen – durch die Untersuchung der Leiche, die Schattenseiten seines Lebens, die wahrheitsgetreuen, verlogenen, stockenden, widerwilligen Aussagen der Familienangehörigen, seiner Feinde, seiner Freunde. Ein Mord zerstört nun mal die Privatsphäre, wie auch vieles andere. Es ist eine Ironie des Schicksals, dachte Dalgliesh, dass ausgerechnet ich, dem Berowne offenbar vertraut hat, nun im Zuge der Ermittlungen den unaufhaltsamen Zerstörungsprozess einleiten muss.
4
Dalgliesh schreckte aus seinen Grübeleien hoch, als sie sich der St.-Matthew-Kirche näherten. Massingham war während der Fahrt ungewohnt wortkarg gewesen, als ahnte er, dass sein Chef Zeit brauchte, sich auf die kommende Aufgabe vorzubereiten. Außerdem musste er sich nicht nach dem Weg erkundigen. Wie immer hatte er vor der Fahrt die Route festgelegt. Sie fuhren die Harrow Road hoch und hatten gerade das weitläufige St.-Mary-Hospital passiert, als nun zu ihrer Linken der Glockenturm von St. Matthew auftauchte.
Schweigend bog Massingham nach links ein und fuhr eine schmale Straße entlang, die auf beiden Seiten von kleinen Häusern gesäumt war. Mit ihren kleinen Fenstern, niedrigen Veranden und verwinkelten Erkern sahen sie alle gleich aus, aber die Straße schien zunehmend an Respektabilität zu gewinnen. Nur wenige Häuser zeigten noch Spuren der obskuren Beschäftigung ihrer Bewohner, wiesen ungepflegten Rasen, herabblätternden Putz oder verschämt zugezogene Vorhänge auf. Ihnen folgten helle kleine Vorzeigestücke sozialen Wohlstands: frisch gestrichene Türen, Lampen am Eingang, ab und zu ein Hängekorb. Die Vorgärten waren gepflasterten Abstellplätzen für den Familienwagen gewichen. Verglichen mit dieser kleinbürgerlichen Gediegenheit wirkte der mächtige Kirchenbau am Ende der Straße mit seinen rauchgeschwärzten Ziegelmauern ein wenig verwahrlost.
Das riesige Nordportal, das eher zu einer Kathedrale passen würde, war geschlossen. Auf der schmuddeligen Tafel daneben standen Name und Adresse des Gemeindepfarrers und die Gottesdienstzeiten, doch sonst deutete nichts darauf hin, dass das Portal jemals geöffnet wurde. Massingham ließ den Wagen auf dem schmalen asphaltierten Streifen zwischen der Südmauer der Kirche und dem am Kanal entlangführenden Geländer ausrollen. Niemand war zu sehen. Offenbar hatte sich der Mord noch nicht herumgesprochen. Vor dem überdachten Südeingang parkten nur zwei Autos. Der eine gehörte vermutlich Detective Sergeant Robins, der rote Metro Kate Miskin. Dass sie schon vor ihnen am Tatort war, wunderte Dalgliesh nicht. Noch bevor Massingham auf den Klingelknopf drücken konnte, öffnete sie die Tür. Ihr hübsches ovales Gesicht, umrahmt von hellbraunem Haar, war gefasst. In ihrer Hemdbluse, der Stoffhose und dem Lederblouson wirkte sie lässig-elegant, als sei sie eben von einem Landausflug zurückgekehrt.
»Der Inspector lässt sich entschuldigen, Sir. Er musste wieder zurück ins Polizeirevier. Bei Royal Oak wurde jemand umgebracht. Er verließ den Tatort, sobald Sergeant Robins und ich eingetroffen waren. Von Mittag an steht er zu Ihrer Verfügung. Die Toten sind hier, Sir. In der sogenannten kleinen Sakristei.«
Dass Inspector Glyn Morgan sich in den Fall nicht einmischen wollte, war bezeichnend für ihn. Dalgliesh schätzte zwar Morgan als Menschen und Kriminalbeamten, war aber dankbar, dass ihn Pflicht, Taktgefühl oder beides vertrieben hatte. Es erleichterte ihm die Arbeit, dass er sich nicht um die Empfindungen eines erfahrenen Polizisten kümmern musste, dem es sicher nicht gelegen kam, wenn ihm der Commander der neugegründeten C1-Sonderkommission ins Handwerk pfuschte.
Kate Miskin öffnete die erste Tür zur Linken und ließ Dalgliesh und Massingham den Vortritt. Die kleine Sakristei war grell ausgeleuchtet wie eine Filmszene. Im gleißenden Licht der Neonröhre wirkte der seltsame Anblick – Berownes dahingestreckter Körper mit der durchschnittenen Kehle, all das geronnene Blut, der wie eine zusammengesackte Marionette an die Wand gelehnte Stadtstreicher – einen Moment lang völlig irreal, wie der Schlussakt in einem Grand-Guignol-Drama, zu übertrieben und gekünstelt, um jemanden zu überzeugen. Dalgliesh warf einen Blick auf Berownes Leiche, stakte dann vorsichtig über den Teppich hinüber zu dem toten Harry Mack und ging in die Hocke.
»Brannte das Licht, als diese Miss Wharton die Toten entdeckte?«, fragte er, ohne sich umzuwenden.
»Im Gang nicht, Sir. Aber hier war das Licht an. Der Junge hat es bestätigt.«
»Wo sind die beiden?«
»In der Kirche, Sir. Pfarrer Barnes ist bei ihnen.«
»Nehmen Sie sich die beiden mal vor, Massingham! Sagen Sie, ich werde sie befragen, sobald ich Zeit habe. Und versuchen Sie, die Mutter des Jungen ausfindig zu machen. Wir müssen ihn möglichst rasch hier wegbringen. Dann kommen Sie wieder zu mir!«
Harry sah im Tod ebenso verwahrlost aus wie im Leben. Wenn der Brustlatz aus verkrustetem Blut nicht gewesen wäre, hätte man sich einbilden können, er schliefe – die Beine ausgestreckt, den Kopf gesenkt, die Wollmütze übers rechte Auge gezogen. Als Dalgliesh Harry am Kinn fasste und vorsichtig seinen Kopf hob, befürchtete er einen Augenblick lang, er würde sich vom Körper lösen und ihm in die Hände kullern. Wie er erwartet hatte, klaffte am Hals eine einzige Schnittwunde, vermutlich von links nach rechts gezogen. Der Schnitt hatte die Luftröhre durchgetrennt und reichte fast bis zu den Halswirbeln. Die Leichenstarre war längst eingetreten. Die Haut war eiskalt und fühlte sich an wie Gänsehaut, da sich die Haare beim Einsetzen der Starre aufrichteten. Welche Verkettung von Zufällen oder Umständen Harry Mack auch hierhergeführt haben mochte, die Ursache seines Todes stand jedenfalls fest.