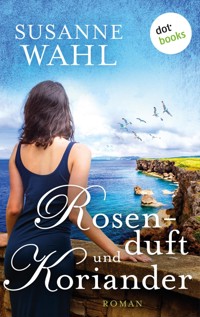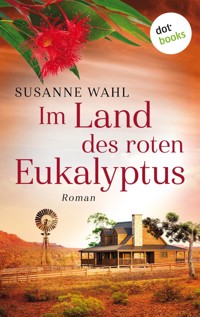
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bewegendes Frauenschicksal im frühen 19. Jahrhundert: Der Australien-Roman »Im Land des roten Eukalyptus« von Susanne Wahl als eBook bei dotbooks. Australien im Jahre 1839: Voller Hoffnung auf eine glückliche Zukunft hat Friederike mit ihrer Familie Preußen verlassen, um sich auf dem fünften Kontinent ein neues Leben aufzubauen. Und obwohl die Arbeit auf der Farm hart ist, weiß Friederike, dass ihr Fleiß und ihre Zähigkeit sich lohnen werden – und in dem weltgewandten Daniel findet sie noch dazu die große Liebe, von der sie immer geträumt hat. Doch immer häufiger ziehen dunkle Wolken über ihr auf. Es scheint fast so, als gäbe es jemanden, der ihr Schaden zufügen will … und gleichzeitig scheint Friederike einen Schutzengel zu haben. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte? Der harte Kampf ums Überleben, die Geheimnisse der Aborigines und die Faszination der großen Weiten Australiens: Ein fesselnder Roman, der jeden Fan von »Down Under« begeistern wird! Jetzt als eBook kaufen und genießen: das Australien-Epos »Im Land des roten Eukalyptus« von Susanne Wahl. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Australien im Jahre 1839: Voller Hoffnung auf eine glückliche Zukunft hat Friederike mit ihrer Familie Preußen verlassen, um sich auf dem fünften Kontinent ein neues Leben aufzubauen. Und obwohl die Arbeit auf der Farm hart ist, weiß Friederike, dass ihr Fleiß und ihre Zähigkeit sich lohnen werden – und in dem weltgewandten Daniel findet sie noch dazu die große Liebe, von der sie immer geträumt hat. Doch immer häufiger ziehen dunkle Wolken über ihr auf. Es scheint fast so, als gäbe es jemanden, der ihr Schaden zufügen will … und gleichzeitig scheint Friederike einen Schutzengel zu haben. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte?
Über die Autorin:
Susanne Wahl, geboren 1955 in Erlangen, studierte Ethnologie und Antropologie. Sie bezeichnet sich selbst als »Spätberufene« und unternahm erst nach ihrem 46. Geburtstag erste Schreibversuche. Seitdem hat sie zahlreiche Romane unter ihrem eigenen Namen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Susanne Wahl lebt mit ihrer Familie in Aach unweit der Schweizer Grenze.
Die Autorin im Internet: www.susannewahl.com
Bei dotbooks veröffentlichte Susanne Wahl bereits den Roman »Rosenduft und Koriander«.
***
eBook-Neuausgabe August 2019
Dieses Buch erschien bereits 2009 unter dem Titel »Roter Eukalyptus« im Wilhelm Heyne Verlag, München.
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von Adobe Stock/Sascha Burkard, Adobe Stock/mbolina und Shutterstock/Sarah Winter
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-430-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Land des roten Eukalyptus« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Susanne Wahl
Im Land des roten Eukalyptus
Roman
dotbooks.
Bastian Schlück, dem besten aller Agenten
Prolog
Heute war der Tag, an dem die Großmutter mit ihr zu den heiligen Steinen gehen würde. Kartanya hatte vor lauter Aufregung nicht schlafen können. Eng an ihren Dingo gekuschelt hatte sie auf das leise Schnarchen der alten Frau neben ihr unter dem Windschirm gehorcht und auf das gelegentliche Grunzen der älteren Männer auf der anderen Seite des Feuers. Dabei versuchte sie sich vorzustellen, wie es sein würde: Würden Geisterstimmen zu ihr sprechen? Oder würde sie Traumbilder sehen? Großmutter hatte nur gesagt, dass sie dort erfahren würde, welches Schicksal die Ahnengeister für sie ausersehen hatten.
Großmutter war keine gesprächige Frau. Die letzten Wochen, in denen sie mit ihr auf dem Traumpfad der Heilerinnen ihrer Kararu-Moiety gewandert war, waren sie meist schweigend hintereinander hergegangen. Nur wenn die alte Frau ihr einen der speziellen Orte zeigte, an denen Heilpflanzen zu finden waren, brach sie ihr Schweigen.
Kartanya wusste, ohne dass die Alte es ausgesprochen hatte, dass sie unzufrieden war, sehr unzufrieden. Es hatte etwas damit zu tun, dass ihr Vater die Mutter immer öfter den Schafhirten in der Umgebung anbot, um sich das Jagen zu sparen. Die weißen Männer gaben ihm dafür, dass sie den Körper der Mutter gebrauchen durften, totgeborene Lämmer. Oder das brennende Wasser, das ihren Vater in ein hilfloses Kleinkind verwandelte, das nicht einmal alleine urinieren konnte. Dabei bot ihr Pangkarra, das angestammte Revier der Sippe hier an den Ufern des großen Flusses, ausreichend Nahrung für die Familie. Niemand von ihnen musste Hunger leiden, selbst wenn Vater und Onkel ohne Jagdbeute oder nur mit einer Eidechse ins Lager kamen. Die Frauen hatten dann immer schon die Kochgruben voller Yamsknollen und anderer Pflanzenteile vorbereitet, und an den meisten Tagen erbeuteten Kartanya und die anderen Kinder zumindest ein paar Vögel.
Als sie vor ein paar Tagen von ihrem Traumpfad-Trail zurückgekehrt waren, war das Lager bis auf zwei alte Männer leer und verlassen gewesen. Die beiden hatten sich halb verhungert auf die unterwegs von den Frauen gesammelten Maden und Früchte gestürzt. Erst nachdem ihre Mägen gefüllt waren, berichteten sie ihnen, was sich im Lager abgespielt hatte.
Eine Familie aus dem Süden hatte darum gebeten, nur eine einzige Nacht im Schutz ihres Lagerfeuers übernachten zu dürfen. Sie waren auf der Flucht vor dem Dämon Nokunna, der bereits einige von ihnen getötet hatte, und sie hofften, bei Verwandten im Norden vor ihm in Sicherheit zu sein. Man hatte ihnen Unterkunft gewährt, und am nächsten Morgen waren sie wie versprochen weitergezogen. Aber der Nokunna musste ihre Spur aufgenommen haben und hatte sich andere Opfer gesucht: Kartanyas Familie.
Zuerst erkrankten die Kinder. Sie klagten morgens über bohrende Schmerzen im Kopf, bald danach fühlte ihre Haut sich glühend heiß an und in der darauffolgenden Nacht starben sie.
Auch die Erwachsenen konnten dem Dämon nur wenige Tage länger standhalten. Einer nach dem anderen war ihm erlegen. Aus Angst, die Toten zu berühren, verzichteten sie sogar auf die Totenzeremonien und übergaben die Gestorbenen einfach dem Fluss. Sie hofften, den tödlichen Geist so von den noch Lebenden abzulenken. Vergebens.
Starr vor Entsetzen lauschte Kartanya dem Bericht der Männer. Ihr Verstand schien sich zu weigern, das Gehörte zu begreifen. Das Blätterpaket mit den bunten Vogelfedern, die sie unterwegs für ihre kleine Schwester gesammelt hatte, glitt ihr aus den plötzlich schlaffen Händen. Warooyoo liebte es, sich zu schmücken, und Kartanya hatte sich schon auf das Strahlen in ihrem Gesicht gefreut, wenn sie ihr Geschenk auspacken würde. Stumme Tränen flossen ihr über die Wangen, als ihr bewusst wurde, dass sie auch ihre Mutter erst im Geisterreich wiedersehen würde.
Ihre Mutter mit dem fröhlichen Lachen und den geschickten Händen, die jeden Dorn fanden und aus der Haut ziehen konnten. Kartanya presste die Lippen zusammen, um die Schreie, die in ihrer Kehle aufstiegen, zurückzuhalten. Sie schloss die Augen, als könne sie so die Realität und die Worte der Alten für einen Moment aussperren. Dann fiel ihr Name und riss sie aus ihrer stillen Trauer.
»Jetzt, wo ihr wieder da seid, können wir Kartanya zu den Weißen schicken«, schlug der Großonkel ihres Vaters vor. »Sie ist alt genug, und die weißen Männer werden sicher auch mit ihr zufrieden sein.«
»Das kommt überhaupt nicht infrage«, wehrte die Großmutter entschieden ab. »Kartanya haben die Geister ein anderes Schicksal bestimmt. Sie wird nicht zu den Weißen gehen. Noch nicht.«
»Woher willst du das wissen?« Der weißhaarige Onkel mit den milchigen Augen legte den Kopf schief, als versuche er, durch den Schleier zu schielen, der seine Augäpfel überzog. »Haben die Geister zu dir gesprochen?«
»Ja, das haben sie.«
Verächtlich drehte sie ihnen den Rücken, eine unverzeihliche Geste der Missachtung gegenüber den ehrwürdigen Männern. Kartanya hielt den Atem an aus Furcht, der kräftigere der beiden würde die Großmutter gleich mit dem Wurfholz auf den Kopf schlagen. Aber nichts war geschehen.
Die folgenden Tage waren nicht einfach für sie gewesen. Großmutter hatte ihr die Versorgung der beiden Großonkel überlassen und aus Ärger darüber, dass Kartanya nicht zu den Weißen ging, kniffen oder schlugen die Männer sie bei jeder Gelegenheit. Sie wollten Fleisch, nicht die Wurzeln und Knollen, die Kartanya mit ihrem Katta mühselig aus dem steinharten Boden grub und in ihrem Yammaru aus geflochtenem Gras ins Lager schleppte. Dabei tat Kartanya ihr Bestes: Nicht eine der fetten Maden und Honigameisen behielt sie für sich. Aber alleine für das tägliche Essen von vier Menschen zuständig zu sein, war harte Arbeit. Warum half die Großmutter ihr nicht? Die verschwand im Morgengrauen und kehrte oft genug erst bei Anbruch der Nacht zurück. Achtlos aß sie dann, was Kartanya vor den gierigen Alten hatte verbergen können, aber sie wirkte dabei so geistesabwesend, dass Kartanya nicht wagte, sie anzusprechen.
Gestern allerdings war sie zum ersten Mal wieder so gewesen, wie Kartanya sie von früher kannte. Ihre hellen Augen unter den runzligen Lidern hatten wach und liebevoll auf ihrer Enkelin geruht. »Es ist so weit«, hatte sie fast erleichtert verkündet. »Morgen nehme ich dich mit zu den heiligen Steinen der Frauen.«
Der Schwarm Kakadus, der sich laut kreischend aus einem der nahen Eukalyptusbäume erhob, zog Kartanyas Aufmerksamkeit auf sich. Hatte eine Schlange auf Beutezug sie aufgeschreckt? Im fahlen Licht der Morgendämmerung flatterten die Vögel wie Geisterschatten, schwarze Silhouetten vor dem hellgrauen Horizont. Neben ihr begann die Großmutter sich zu regen und im Schlaf zu stöhnen. Gleich würde sie erwachen. Eilfertig schob Kartanya den Dingo beiseite und erhob sich möglichst geräuschlos, um mit den dafür vorgesehenen großen Muschelschalen Wasser zu holen. Mit ein paar Eukalyptusblättern und einigen heißen Kieselsteinen aus der Glut war der Trunk zum Tagesanbruch im Nu zubereitet.
Noch bevor die Alten fertig gehustet und ihren Auswurf in die nahen Büsche gespuckt hatten, stand der dampfende Tee neben dem Feuer.
»Nimm alles mit, was du für einen Trail brauchen könntest«, wies die Großmutter sie an, während sie langsam und genüsslich schlürfte. »Auch die Wurfhölzer und Speere! Von unserer Sippe lebt keiner mehr, dem sie etwas nützen.«
Kurze Zeit später folgte Kartanya ihr mit den gewohnten vier Schritten Abstand. Dass sie dabei neben ihrem gesamten Besitz auch die Waffen ihres Vaters trug, beschwerte sie nicht übermäßig. Außer der kuntye, der geflochtenen Taillenschnur, und dem Umhang aus Opossumfell ging sie nackt wie alle Kaurna-Frauen. Nur ihr Yammaru wog mehr als sonst. Die Utensilien zum Feuerbohren, einige Flintsteine und eine Wassermuschel waren darin verstaut. Die Speere, Wurfhölzer und ihr Katta hatte sie mit Bast umwickelt, und das Bündel trug sie in der Hand.
Das Frauenheiligtum lag in der einen halben Tagesmarsch entfernten Hügelkette verborgen. Niemand außer den erwachsenen Kaurna-Frauen durfte es betreten, und auch Kartanya würde es heute anlässlich ihrer Initiation zum ersten Mal sehen. Am liebsten wäre sie gerannt. Nur mühsam zügelte sie ihre Ungeduld über die Langsamkeit der Großmutter. Sonst schlich sie doch auch nicht wie eine Schnecke. Und jetzt blieb sie auch noch stehen!
Tatsächlich hatte sie sich auf die Fersen gehockt und betrachtete etwas, das vor ihr auf dem Boden lag. Auch der Dingo schien sehr interessiert daran, aber sie verscheuchte ihn mit ein paar gezielten Stockschlägen.
»Das ist ein weiteres Zeichen«, murmelte die alte Frau zufrieden. »Hier, schau!« Sie wies auf den dunkelbraunen Haufen, der auf den ersten Blick wie die Exkremente eines Kängurus aussah. Aber Kartanya wusste es besser: In dieser ekelerregenden Umhüllung versteckten sich äußerst wohlschmeckende Puppen. Erfreut streckte sie die Hand aus, um die dünne Blätterschicht beiseitezuschieben und sie einzusammeln.
»Nein, rühr es nicht an!« Die Großmutter schlug ihren Arm beiseite. »Es ist ein Zeichen der Geister.«
»Was für ein Zeichen?« Verständnislos starrte Kartanya auf das schmackhafte Mahl, auf das die Großmutter so ohne weiteres verzichtete.
»Du wirst es bald erfahren.« Mehr sagte sie nicht.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als sie endlich vor einem engen Felsspalt stehen blieben. Versteckt hinter dichtlaubigen Sträuchern war der Eingang erst aus nächster Nähe als solcher zu erkennen.
»Hier legen wir alles ab«, teilte die Großmutter ihr mit. »Zieh dich aus und binde den Dingo gut fest, damit er uns nicht folgt. Wir betreten die heilige Höhle so nackt, wie wir auf die Welt gekommen sind.« Ohne eine weitere Erklärung holte sie den Rindenbehälter mit dem geriebenen Ocker von Uluru, eine große Austernschale und den Stößel aus Känguruknochen aus ihrem Yammaru und winkte ihrer Enkelin, ihr zu folgen. Im nächsten Augenblick war sie zwischen den Felsen verschwunden, als hätte der Berg sie verschluckt. Mit klopfendem Herzen betrat Kartanya die Felsspalte. Es war eng im Tunnel; so eng, dass man sich manchmal fast mit Gewalt zwischen den unnachgiebigen Steinwänden durchzwängen musste. Und dunkel, beängstigend dunkel. Kartanya legte den Kopf weit in den Nacken und konnte dennoch keinen noch so schmalen Streifen Licht über sich erkennen. Je weiter sie sich vom Eingang entfernten, desto finsterer wurde es um sie. Die Dunkelheit schien sie zu verschlingen, aufzusaugen. Kartanyas Unbehagen steigerte sich. Was, wenn die Geister sie nicht mehr hinausließen? Auf einmal fielen ihr Erzählungen von Menschen ein, die im heiligen Felsen Uluru verschwunden waren und nie wieder gesehen wurden. Ihre Hände tasteten über kaltes, feuchtes Gestein, während sie immer zögernder ihre Füße auf dem harten Boden vorwärtsschob. Gerade, als ihre Furcht nahezu unerträglich wurde und sie schon den Mund geöffnet hatte, um nach der Großmutter zu rufen, nur um ihre tröstliche Stimme zu hören, nahmen ihre Augen allmählich wieder Umrisse wahr. Mit jedem Schritt wurde es heller. Die Wände wichen zurück, verbreiterten sich zu einer geräumigen Höhle, die sich auf eine sonnendurchflutete Lichtung hinaus öffnete.
Neugierig betrachtete Kartanya die Höhlenwände, die über und über mit Zeichnungen bedeckt waren. Sie erkannte die Regenbogenschlange und andere Tiergottheiten aus den Traumzeiterzählungen. Und in einem der hinteren Bereiche seltsame helle Figuren. Die Farbe leuchtete so frisch, als wären sie erst vor kurzem gemalt worden.
Gerade wollte sie die Malereien genauer betrachten, als die Großmutter sie zu sich rief. Die alte Frau hatte sich neben einem leise plätschernden Rinnsal niedergelassen. Es wurde von Quellwasser gespeist, das direkt aus dem Gestein zu sickern schien. Manchmal floss es wohl reichlicher als heute, denn am Fuß der Felswand hatte es ein flaches Becken ausgewaschen, in dem es sich sammelte.
Das Wasser darin war so klar, dass man jeden noch so winzigen Stein auf dem Grund erkennen konnte. Durstig beugte Kartanya sich vor, um direkt von der Oberfläche zu schlürfen. Das Wasser aus dem Bauch der Erde schmeckte erstaunlich frisch und süß. Als sie sich wieder aufrichtete, sah sie, dass die Großmutter gerade ein wenig von dem kostbaren, hellen Ocker vom Uluru-Berg in die Austernschale gab. Ocker vom Uluru war besonderen Gelegenheiten vorbehalten, und Kartanya verspürte Stolz darüber, dass sie seiner für würdig befunden worden war.
Mit ihren vom Alter steifen Fingern griff die Großmutter nach dem Stößel aus Känguruknochen und machte sich daran, das Pulver mit tropfenweise zugegebenem Quellwasser zu einer Paste zu verrühren. Dabei summte sie leise vor sich hin. Kartanya erkannte die Melodie eines Lieds, das gewöhnlich zu einer Heirat gesungen wurde. Das überraschte sie nicht. Sie hatte bereits erwartet, dass sie erfahren würde, in welche Sippe sie gehen müsste. Es war üblich, dass man sehr bald nach der Initiation einem Mann gegeben wurde. Deswegen hatte Großmutter sie ja wohl auch angewiesen, all ihre Habe mit sich zu nehmen.
Insgeheim hoffte sie, dass es der hübsche Cousin aus dem Norden sein würde, mit dem sie beim letzten Frühlingsfest zusammengelegen hatte, und nicht der Alte, der ebenfalls großes Interesse an ihr gezeigt hatte. Stumm und dem äußeren Anschein nach desinteressiert, wie es sich für ein Mädchen gehörte, hockte sie neben der Großmutter und wartete, dass diese das Wort an sie richtete. Schließlich ließ die alte Frau den Stößel sinken.
»Steig in das Wasser und reinige dich!«, befahl sie. »Kein Staubkorn von dort draußen darf noch an dir haften.«
Alles in Kartanya sträubte sich dagegen, so kostbares Trinkwasser zu verschmutzen, aber sie gehorchte. Erst als sie überzeugt war, vollkommen rein zu sein, stieg sie aus dem Becken. Die Großmutter saß mit zurückgelegtem Kopf und geschlossenen Augen an die Felswand gelehnt da. Kartanya erschrak bei ihrem Anblick. So gebrechlich und abgezehrt hatte sie die alte Frau bisher noch nie wahrgenommen. Würde sie bald zu den Geistern gehen?
»Ich bin so weit, Großmutter«, sagte sie leise und kniete vor ihr nieder, während die Tropfen noch an ihr hinunterrannen. Die alte Frau seufzte tief auf und öffnete die Augen. Dann griff sie bedächtig nach der Muschel mit der Ockerfarbe und fing an, Kartanya von Kopf bis Fuß damit zu bemalen.
»Mein Kind«, begann sie nach einer Weile stockend. »Was ich dir zu eröffnen habe, wird dich erschrecken. Aber wenn du nicht stark genug wärst, hätten die Ahnengeister dich nicht erwählt. Du bist von ihnen bestimmt worden, dein Volk zu verlassen und bei einer weißen Sippe zu leben.«
Kartanya konnte sie nur sprachlos anstarren. War die Großmutter verrückt geworden? Sie sprach klar und verständlich, aber was sie sagte, war so ungeheuerlich, dass Kartanya sich fragte, ob sie etwa von Dämonen besessen war, die ihren Geist verwirrten.
»Was ich sage, ist die Wahrheit«, fuhr die Großmutter fort, als hätte sie die Gedanken ihrer Enkelin gelesen. »Ich habe es erst nicht verstanden und die Trancesitzungen deswegen mehrmals wiederholt. Aber jetzt bin ich mir sicher: Die Ahnen wollen, dass du dich einer weißen Sippe anschließt.«
Kartanya hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren.
»Warum?«, brachte sie schließlich krächzend heraus.
»Das wissen nur sie.« Großmutter hob in einer Geste der Ratlosigkeit beide Hände und schüttelte dabei den weißen Lockenkopf. »Aber sieh selbst!« Sie zog ihre Enkelin vor den Abschnitt der Wand mit den frischen Malereien. Davor standen noch die Schälchen mit den Farbpulvern: schwarze Holzkohle, rote Erde, gelber Ocker und weißer Ton. Und ein Lederbeutel, den Kartanya gut kannte. Ihre Großmutter bewahrte darin das Opossumfett auf, das sie für Heilsalben benötigte.
»Hier, mein Kind«, flüsterte die Großmutter ehrfürchtig. »Hier habe ich gemalt, was die Geister unserer ehrwürdigen Ahnen mir in der Trance gezeigt haben.«
Verwirrt versuchte Kartanya sich einen Reim auf die Zeichnungen zu machen. Sie erkannte mehrere menschliche Figuren. Eine kleine, braune Figur stand da umringt von doppelt so großen weißen, die alle die Hände nach ihr ausstreckten. »Du wirst zu ihnen gehören«, sagte die Großmutter entschieden und übermalte die kleine, braune Figur sorgfältig mit dem letzten Rest Ocker, bis sie fast genauso hell leuchtete wie die anderen um sie herum. »Deine Kinder werden die Kraft der Weißen in sich tragen, und unser Blut wird in ihnen weiterleben.«
»Wie soll ich es denn anstellen, dass eine Sippe der Weißen mich aufnimmt?«, wandte Kartanya verzagt ein. Bei den Corroborees auf dem Tanzplatz vor der Stadt hatte sie weiße Frauen unter den Zuschauern gesehen. Sie waren äußerst seltsam gekleidet gewesen und hatten sehr darauf geachtet, ihnen nicht zu nahe zu kommen. »Ihre Sitten und Gebräuche sind mir fremd. Ich kann noch nicht einmal mit ihnen sprechen.« Die Frauen hatten keinen sehr freundlichen Eindruck gemacht. Bei ihnen zu leben würde sicher noch schlimmer sein als im Harem eines alten Mannes.
Die Großmutter verzog unwillig das Gesicht. »Hast du nicht begriffen? Du wirst dich versteckt halten wie die Schmetterlingspuppen, bis die Ahnengeister dich deiner neuen Familie zuführen werden. Wenn es so weit ist, werden sie dir auch einen Weg in ihre Mitte zeigen.«
Kapitel 1
Die Kirchenglocke von Friedrichsdorf, dem kleinen lutheranischen Weiler im Hinterland von Krossen an der Oder, hatte seit langem nicht mehr geläutet. Das geradezu verzweifelte Gebimmel, das der Ostwind an diesem kalten, klaren Märzabend des Jahres 1839 in die Küche der Thieles trug, sorgte daher für einige Irritation bei den fünf Personen, die sich darin aufhielten.
»Friederike, ich brauche unbedingt ein neues Hörrohr«, beschwerte Großmutter Thiele sich bei ihrer Enkelin, während sie verärgert den polierten Holztrichter gegen die Armlehne ihres Lehnstuhls schlug. »Ich höre schon die Glocke zum Gottesdienst rufen, und das kann doch gar nicht sein.«
Die siebzehnjährige Friederike hatte die Wollsocke mit dem riesigen Loch in der Ferse samt Stopfei in den Nähkorb fallen lassen und war zum Fenster gestürzt, um nach einer Rauchsäule Ausschau zu halten. Es konnte sich eigentlich nur um einen Feueralarm handeln, denn seit nunmehr fünf Jahren waren Gottesdienste nach der alten Agenda strengstens verboten. Pastor Fichte war entlassen worden, und an seiner Stelle hatte man ihnen einen jungen Pastor der unierten Kirche geschickt. Aber die Gemeinde hatte ihm die kalte Schulter gezeigt, und so war er zurückgekehrt nach Krossen. In der ersten Zeit hatten die Gemeindeältesten die Gottesdienste noch in der Kirche abgehalten. Nachdem eine Brudergemeinde für ihren Ungehorsam gegenüber der königlichen Kabinettsorder jedoch mit der exorbitant hohen Strafe von 3000 Talern hatte büßen müssen, war man dazu übergegangen, sich abwechselnd in den Wohnstuben der größeren Häuser zu treffen. Die Kirchentür war verschlossen geblieben, die Glocke stumm.
»Dein Hörrohr ist völlig in Ordnung, Großmutter«, sagte Friederike besänftigend, während sie sich den Hals verrenkte, um bis zur Straße zu sehen. »Die Glocke wurde geläutet. – Vielleicht ein Feuerschaden?«
»Wo? Wo? Siehst du etwas, Rieke?« Ihr Bruder Heinrich, ein magerer Junge mit wirren, braunen Locken, der am Küchentisch Schreibübungen gemacht hatte, steckte die Feder ins Tintenfass und drängte sich neben sie, um ebenfalls hinauszuspähen.
»Heinrich, hilf mir hoch«, befahl die Großmutter herrisch. Gehorsam eilte er zum Ohrensessel und bot ihr seinen Arm. Auf ihren Enkel und einen geschnitzten Gehstock gestützt, schlurfte die Großmutter ans Fenster. Friederike wich beiseite. Aus dem Kokon aus schwarzen Röcken stieg ein so aufdringlicher Geruch nach Patschouli und Urin auf, dass sie unbewusst den Atem anhielt. Die nächste Wäsche war überfällig. Großmutters Angewohnheit, üble Gerüche mit Unmengen Parfüm zu überdecken, war schon eine schwere Prüfung. Sie seufzte stumm und trat ein paar Schritte in den Raum zurück, um der Duftwolke zu entkommen.
»Rieke, es macht mir Angst«, klagte ihre jüngere Schwester Marie-Luise und schmiegte sich schutzsuchend an ihre Seite. »Warum ist es so laut?« Die Achtjährige hatte keine Erinnerung mehr an die Zeit, als die Glocke die Frommen täglich zum Gebet gerufen hatte.
»Das bedeutet nichts Gutes«, prophezeite ihre Großmutter düster, ehe Friederike die Kleine beruhigen konnte. Ihre klauenartigen, von der Gicht entstellten Hände umklammerten den Griff des Gehstocks. »Ach, warum sind sie nur so starrsinnig? Als ob es unserem lieben Herrgott wichtig wäre, mit welchem Buch wir ihn preisen. Sicher schicken sie jetzt Dragoner, um uns ins Gefängnis zu schleifen.«
Marie-Luise quiekte erschreckt auf und drückte sich noch enger an ihre große Schwester. Friederike strich ihr beruhigend über die blonden Zöpfe, während sie angestrengt lauschte. Inbrünstig hoffte sie, dass die Großmutter Unrecht haben möge. »Wenn es Dragoner wären, müsste man schon etwas hören«, meinte sie schließlich erleichtert. »Und ich kann auch keine Rauchsäule sehen. – Heinrich, du?«
Ihr Bruder schüttelte den Kopf. »Ich sehe auch nichts. Nicht das Geringste.«
»Nein?« Die Stimme der Großmutter klang fast enttäuscht. »Weshalb könnten sie sonst die Glocke läuten? Vielleicht ist jemand im Eis eingebrochen? – Jetzt, wo es zu tauen begonnen hat.«
»Ich will auch ans Fenster!« Der kleine Georg war so vertieft in das Spiel mit seinem neuen Kreisel gewesen, dass die Aufregung der Älteren nicht zu ihm durchgedrungen war. Doch jetzt ließ er die Peitsche fallen, mit der er den Kreisel auf dem Fliesenboden hatte tanzen lassen, und das Spielzeug rollte unbeachtet unter die Anrichte, während er sich zwischen Heinrich und die Großmutter drängte. Georg war gerade fünf geworden: Ein stämmiger, kleiner Bursche, der am liebsten mit den Nachbarshunden herumtollte.
»Ich habe doch schon gesagt, dass da nichts zu sehen ist, du Kindskopf!«, fuhr Heinrich ihn an, trat vom Fenster zurück und sah fragend zu Friederike hinüber. »Ich könnte schnell zur Kirche laufen und mich erkundigen. Was meinst du?«
Friederike überlegte kurz. Auch sie hätte zu gerne gewusst, weswegen die Glocke geläutet wurde. Aber falls tatsächlich Dragoner im Anmarsch sein sollten, wäre es nicht ungefährlich, sich auf der Straße aufzuhalten.
»Nein, bleib lieber hier«, entschied sie. »Ich bin sicher, wir werden es bald erfahren. – Ist das nicht schon Vater?«
Rasche Schritte näherten sich der Seitentür. Mit einem Schwall eisiger Luft, in der der Geruch nach aufgebrochener Erde schon den Frühling verhieß, stürmte Gärtnermeister Christian Thiele in die behaglich warme Küche. »Es heißt, unsere Bewilligung samt der Pässe sei da«, stieß er atemlos hervor, während er sich auf einen Hocker direkt neben der Tür setzte, um die mit Erde verkrusteten Arbeitsstiefel gegen ein Paar einfache, aber saubere Schnürschuhe auszutauschen. »Und dass Pastor Fichte alle in die Kirche ruft, um uns die frohe Botschaft zu verkünden.«
»Die Auswanderungspapiere?« Friederike stockte der Atem. Als im Frühjahr 1836 dieser seltsame Engländer auf dem Weg nach Klemzig bei ihnen in Friedrichsdorf Station gemacht hatte, war ihnen eine Auswanderung nach Australien, wie sie die Klemziger planten, noch viel zu abenteuerlich erschienen. Damals war allerdings auch noch nicht abzusehen gewesen, dass die Repressalien gegen die Lutheraner ein solches Ausmaß annehmen würde. Die Klemziger hatten den Unmut des Königs als Erste in voller Härte zu spüren bekommen. Fast zwei Jahre hatten sie auf ihre Ausreisepapiere warten müssen, und einige, die ihr Hab und Gut vorschnell verkauft hatten, waren völlig verarmt auf die große Reise gegangen. Viele andere Gemeinden waren ihnen inzwischen gefolgt. Nach einigem Zögern hatten auch die Friedrichsdorfer sich schweren Herzens dazu entschlossen, Preußen zu verlassen und dort, am anderen Ende der Welt, eine neue Heimat zu suchen. Nicht alle waren zu diesem Schritt bereit, aber der größte Teil der Familien wollte gemeinsam nach Südaustralien auswandern und dort siedeln.
Christian Thiele stand auf, streckte den vom stundenlangen Graben schmerzenden Rücken und wandte sich an seine Zweitälteste. Die Familienähnlichkeit der beiden war unübersehbar. Beide besaßen das gleiche nussbraune Haar, die gleichen wachen Augen, und Christian Thieles schön geschnittener Mund verzog sich zum gleichen strahlenden Lächeln wie die vollen Lippen seiner Tochter. »Endlich! – Sag Charlotte Bescheid. Und sputet euch!«
Mit diesen Worten eilte er aus der Küche, und gleich darauf schlug die Haustüre ins Schloss.
»Aber Charlotte ist doch gar nicht da. Sie ist vorhin zu Liebelts gegangen«, sagte Marie-Luise verständnislos. Charlottes Besuche bei Grete, der Schneiderstochter, waren ihren Geschwistern nur zu vertraut. Meist beschränkten sie sich auf das gemeinsame Studium der neuesten Modeblätter. Deren Anregungen hätten die beiden jungen Frauen nur zu gerne umgesetzt. Allerdings blieb es bei sehnsüchtigen Träumereien, denn für künstlichen Blumenschmuck oder Spitzenbordüren gab niemand in Friedrichsdorf auch nur einen Pfennig, geschweige denn zehn oder gar fünfzehn Silbergroschen aus! Heinrich schnaubte laut und verächtlich, enthielt sich jedoch eines weiteren Kommentars.
»Putz und Tand, Putz und Tand, reicht dem Leichtsinn Herz und Hand.« Großmutter Thiele schlurfte zu ihrem Sessel zurück und ließ sich erschöpft schnaufend in die durchgesessenen Polster fallen. »Euer Vater dachte sicher, sie wacht oben. Charlotte wird uns noch viele Sorgen bereiten!«
Friederike biss sich auf die Lippen. Ihre Schwester zu verteidigen, würde sie jetzt nur aufhalten, und sie brannte darauf, ebenfalls die Neuigkeiten zu erfahren. Sie riss ihr Umschlagtuch vom Haken und war schon fast draußen, als ein kaum hörbares Säuglingsgreinen aus dem oberen Stockwerk sie an der Haustür innehalten ließ. Im oberen Stockwerk lagen die Schlafzimmer und im größten ruhte Mutter Sabine mit dem vor drei Wochen geborenen Jüngsten, Friedemann. Nach Friedrichsdorfer Maßstäben war das Anwesen der Thieles großzügig angelegt. Zwei Stockwerke waren nicht die Norm, aber Großvater Thieles Freundschaft mit dem Hofgärtner Ferdinand Fintelmann in Berlin hatte ihm in den Jahren nach den napoleonischen Kriegen ein gutes Einkommen gesichert. Ein Großteil der lukrativen Georginen-Kultur wurde damals über die Gärtnerei Thiele abgewickelt. Hier, weit weg von Berlin und den gierigen Blicken der Konkurrenz, lagen die Versuchsfelder, auf denen die Sämlinge gezogen, begutachtet und die erfolgversprechenden Sorten vermehrt wurden. Jeweils im Herbst fuhr dann ein voll beladener Oderkahn nach dem anderen Richtung Berlin, wo die kostbaren Knollen an zahlungskräftige Kunden in aller Welt verschickt worden. Es war ein gutes Geschäft, denn eine einzige Georginen-Knolle wurde für zwei Goldstücke gehandelt!
Die erfolgreiche Zusammenarbeit hatte Großvater Thiele in die finanzielle Lage versetzt, die alte Kate abreißen und ein neues, aus gebrannten Ziegeln gemauertes Haus errichten zu lassen, wie es hier in der Umgebung nur wenige gab. Ja, er war sogar nicht davor zurückgeschreckt, im Elternschlafzimmer im ersten Stock einen Kachelofen einbauen zu lassen. Und so empfing Friederike dumpfe, feuchte Wärme, sobald sie die weiß gestrichene Tür aufstieß. Von dem Eimer neben der Tür, in dem die Windeln eingeweicht wurden, ging ein stechender Geruch aus. Eigentlich wäre es Charlottes Aufgabe gewesen, heute Nachmittag die Windeln zu waschen. Friederike kniff verärgert die Lippen zusammen, als sie den Eimer griff und auf den Flur hinausstellte. Charlotte verstand es immer, sich vor unangenehmen Arbeiten zu drücken.
»Was ist geschehen? Warum läutet die Glocke?« Ihre Mutter saß aufrecht im Bett, die Nachthaube verrutscht, das schlichte Leinennachthemd noch geöffnet, weil sie gerade den Säugling in ihren Armen gestillt hatte. In den vergangenen achtzehn Jahren hatte sie neun Kindern das Leben geschenkt, von denen sechs noch lebten: Charlotte, Friederike, Heinrich, Marie-Luise, Georg und der kleine Friedemann. Sie war noch keine vierzig, aber ihr hellbraunes Haar wurde von silbernen Strähnen durchzogen, und scharfe Falten der Erschöpfung ließen sie älter aussehen.
»Vater meinte, es gäbe gute Nachrichten aus Berlin.« Friederike nahm ihr den in ein Steckkissen eingeschnürten kleinen Bruder ab und legte ihn in die Wiege neben dem großen Pfostenbett. »Er ist schon zur Versammlung. – Möchtest du etwas Zuckerwasser?« Besorgt registrierte sie die blassen Wangen und fiebrig glänzenden Augen der sonst immer so lebhaften Mutter. Nach Georgs Geburt vor fünf Jahren war sie doch rasch wieder zu Kräften gekommen. Warum war sie jetzt so lange bettlägerig?
»Nein, lass nur. Mutter Weidner hat mir vorhin warmes Bier gebracht.« Mutter Weidners Kenntnisse heilkräftiger Kräuter und ihre geschickten Hände waren so bekannt, dass der Doktor aus Krossen stets sie rief, wenn in schwierigen Fällen eine erfahrene Pflegerin gesucht wurde. Als direkte Nachbarin der Thieles gehörte sie beinahe zur Familie. Selber hatte sie keine Kinder; umso größeren Anteil nahm sie an den Kindern der Thieles. Sabine Thiele ließ sich müde zurücksinken. »Geh du ruhig auch, ich sehe doch, dass du es kaum noch erwarten kannst, loszulaufen.« Mit einem Abglanz ihres früheren Lächelns fügte sie hinzu: »Aber wechsle vorher die Schürze, mein Kind. Sonst muss Pastor Fichte dich wieder wegen unbotmäßigen Betragens tadeln.«
Ihre Tochter verzog das Gesicht zu einer Grimasse des Widerwillens. »Er findet immer einen Grund, mich zu tadeln.« Eine Haarsträhne hatte sich aus dem zu einem Knoten am Hinterkopf gewundenen Zopf gelöst. Sie strich sie achtlos hinters Ohr zurück, bevor sie zärtlich die abgearbeitete Hand ihrer Mutter streichelte. »Aber heute wird er mich gar nicht beachten. Mach dir keine Gedanken, Mama!«
Ihrer Mutter zuliebe machte sie dennoch den Umweg über ihr Zimmer, das sie sich mit Charlotte teilte, um dort eine frisch gestärkte Schürze aus ihrer Kommodenschublade zu holen und ihr Haar neu zu flechten. Wie so manches Mal, wenn sie sich in dem halbblinden Spiegel betrachtete, so durchzuckte sie auch diesmal die Frage, warum sie nicht so hübsch war wie ihre Schwester. Friederike entsprach absolut nicht dem gängigen Schönheitsideal, das Charlotte so perfekt verkörperte. Schlank und rank wie eine Weidengerte fehlten ihr die begehrten Grübchen in Armen und Wangen; und ihr schmales Gesicht mit den intelligenten Augen und dem festen Mund strahlte wenig weibliche Ruhe und Sanftmut aus. Im Gegenteil: Der Körper in dem verschlissenen, dunkelblauen Wollkleid und der schwarzen Arbeitsschürze schien vor mühsam gebändigter Energie zu vibrieren, als sie die Treppenstufen hinunterhastete.
Die Sonne versank gerade hinter dem Horizont, als Friederike endlich die Hauptstraße erreichte, die geradewegs auf die Kirche zuführte. Vor ihr waren nur noch ein paar andere Nachkömmlinge unterwegs, die allesamt eilig auf das hell strahlende Portal zustrebten. Zahlreiche Wachskerzen erhellten das Kircheninnere, wie es früher nur zu Weihnachten und an den Adventssonntagen üblich gewesen war. Im kalten, abweisenden Grau der Abenddämmerung schien diese Lichtinsel alle anzuziehen wie eine Kerzenflamme die Motten. Der Küster fing bereits an, die schweren Torflügel zu schließen. Friederike raffte ihre Röcke und begann zu rennen. Atemlos keuchte sie die letzten Stufen hinauf und wurde mit einem missbilligenden Blick bedacht. Sie lächelte dem alten Mann entschuldigend zu und stellte sich bescheiden hinter die bis auf den letzten Platz gefüllten Bankreihen. Erregtes Gemurmel füllte den hohen Raum und erinnerte Friederike an die Geräusche in einem Bienenstock, wenn ein Teil des Volkes sich bereitmacht, einer neuen Königin zu folgen. Gerne hätte sie sich zu ihrem Vater gesetzt, aber in der Menge war er nicht auszumachen.
Das Gemurmel verstummte schlagartig, als ein magerer Mann mit Hakennase und lichtem Haar die Wendeltreppe zur Kanzel betrat: Pastor Fichte. Seit Jahren lebte er im Verborgenen, immer auf der Flucht, während er von einem Versteck zum anderen zog. Die Spuren dieses Vagabundenlebens waren unübersehbar. Seine Kleidung war abgerissen und notdürftig geflickt, sein Bart ungepflegt, die Wangen eingefallen – aber seine Augen strahlten immer noch so intensiv wie damals, als er zum ersten Mal hier gepredigt hatte. Ein strenger Gottesmann, aber von einer Belesenheit und Eloquenz, dass sein Ruf sogar viele Nachbarn aus der Umgebung angezogen hatte. In Scharen waren sie gekommen, nur um Pastor Fichtes Predigten zu lauschen.
In der erwartungsvollen Stille dröhnte jeder seiner Schritte auf den hölzernen Stufen wie ein schicksalhafter Paukenschlag.
»Brüder und Schwestern in Christo«, begann er, sobald er oben auf der Kanzel angelangt war. »Ich habe euch heute davon in Kenntnis zu setzen, dass unser allergnädigster Herrscher, König Friedrich Wilhelm III. von Gottes Gnaden, uns seine endgültige Erlaubnis erteilt hat, Preußen zu verlassen. Ich werde nun verlesen, was er uns geschrieben hat.« In dem spannungsgeladenen Schweigen, das seinen Worten folgte, hörte man bis zur hintersten Reihe deutlich das Siegel brechen, als er feierlich den Brief des Königs öffnete und den Bogen schweren Büttenpapiers entfaltete.
»Es hat Mich tief geschmerzt, die Erfahrung machen zu müssen, dass einzelne Meiner Untertanen, sonst gute und religiös gesinnte Menschen, durch Fanatismus und Irrlehren verblendet und verleitet, nicht vertrauend Meinen väterlichen Erklärungen und Ermahnungen, sich hartnäckig dem Wahn hingeben, als solle die alte lutherische Lehre verdrängt werden, woran doch nie gedacht wurde, und nicht achtend auf alles das, was dazu hätte dienen müssen, sie vom Gegenteil auf das vollständigste zu überzeugen, sich jetzt sogar anschicken, ihre heimatlichen Wohnplätze zu verlassen, um, wie sie meinen, das alte Luthertum in Südaustralien, tausende von Meilen von ihrer Heimat entfernt, aufzusuchen, wohin fanatische Obere sie zu führen beabsichtigen, und dort ihren religiösen, fanatischen Plänen chimärischer Unabhängigkeit, wie sie sich in ihrer Phantasie ausgebildet haben, umso freieren Lauf lassen zu können, während die getäuschten, wenn sie Kraft besäßen, sich von diesen Scheinfrommen, welchen es gelungen ist, sie zu verstricken und durch Gewissensskrupeln zu ängstigen, loszureißen, nach wie vor der alten, wahren, unverfälschten lutherischen Lehre, wie sie in der Augsburgischen Konfession enthalten ist, treu und ergeben bleiben könnten.«
Als leises Protestgemurmel aufflammte und sich zu empörten Zwischenrufen steigerte, warf Pastor Fichte seiner Gemeinde einen strengen Blick zu.
»Silentium, liebe Brüder und Schwestern. – Auf keinen Fall konnte die Furcht, im Glauben beeinträchtigt zu werden, entstehen, da ihnen bereits oftmals die Versicherung gegeben worden ist, dass, wenn sie es wünschen sollten, ihre Geistlichen sich förmlich gegen sie verpflichtet haben würden, keine andere als die oben genannte lutherische Lehre zu lehren und zu predigen. Kehrt also zurück, Ihr Irregeleiteten! Noch ist es Zeit, einen Schritt zu unterlassen, den Ihr künftig sicher zu bereuen haben werdet, und der weder Euer ewiges noch Euer zeitliches Heil fördern kann. Solltet Ihr aber dennoch in Eurem Starrsinn bei dem, was Ihr beschlossen habt, verharren, so habt Ihr Euch den über die Auswanderung bestehenden Vorschriften genau zu unterwerfen, da Ich Euch alsdann wohl bedauern und bemitleiden kann, Euch aber Euerm Schicksal überlassen muss.«
Einige Augenblicke lang schien die ganze Versammlung zu Stein erstarrt. Pastor Fichte nickte lächelnd auf seine Gemeinde herab, bevor er mit seiner tragenden Stimme fortfuhr: »Ja, so ist es: Unsere inbrünstigen Gebete haben beim Herrn Gehör gefunden und unsere Beharrlichkeit hat Früchte getragen. Unser König lässt uns endlich ziehen. Lasset uns den Herrn preisen!« Und damit stimmte er lautstark »Mir nach, spricht Christus, unser Held« an. Nach den ersten Takten fiel einer nach dem anderen in das Lied ein, bis das Kirchenschiff zu bersten schien von jubelnden Stimmen. Auch Friederike sang aus voller Kehle, ließ sich mitreißen von der Melodie, den anfeuernden Worten.
Bald schon würden sie das wunderbare, ferne Land Australien mit eigenen Augen sehen!
Die Erleichterung darüber, dass alle Sorgen nun ein Ende haben würden, überstrahlte alles andere. Es war für die Familie Thiele ein rabenschwarzer Tag gewesen, als die Gärtnerei Fintelmann vor nunmehr bald vierzehn Monaten ihre Zusammenarbeit aufgekündigt hatte. Solange sie denken konnte, hatten die Georginen zu Friederikes Leben gehört. Plötzlich aber hieß es aus Berlin, der Anbau rentiere sich nicht mehr. Seit jeder Bauer sie in seinem Garten hätte, ziehe die vornehme Kundschaft andere Pflanzen vor. Die Geschäfte gingen schlecht, man bedauere es zutiefst, aber für eine weitere Kooperation fehle es an den Voraussetzungen.
Christian Thiele hatte vergeblich versucht, mit Gemüseanbau und ein wenig Samenhandel die finanziellen Lücken zu schließen. Doch mit Blumenkohl, Gurken und Levkojen waren keine großen Gewinne zu erzielen. Notgedrungen hatte er auf die sorgsam gehüteten Ersparnisse zurückgreifen müssen. In der Hoffnung auf die baldige Abreise hatte ihn das anfangs noch nicht sehr belastet, aber in den letzten Monaten war er zunehmend niedergeschlagener gewesen. Wie gravierend die Sorgen waren, die er sich machte, hatte Friederike eher zufällig aufgeschnappt, als ihr Vater sich mit einem Nachbarn über das Ausbleiben der Reisepässe unterhalten hatte. »Das ist sicher das Werk von diesem Herrn von Altenstein!«, hatte der Nachbar im Brustton der Überzeugung behauptet. »Ein Onkel von mir lebt in Potsdam, und er schrieb mir neulich, dieser Herr Minister versuche dem König einzureden, wir würden dem Ansehen Preußens in der Welt Schaden zufügen.«
»Warum das denn? Wir sind alles rechtschaffene Leute!«, hatte ihr Vater entrüstet ausgerufen.
»Es wird nicht gern gesehen, dass wir unseres Glaubens wegen auswandern wollen. Man glaubt, es wirft ein schlechtes Licht auf Preußen. Von wegen Religionsfreiheit et cetera, et cetera«, hatte der Mann bedeutungsvoll gesagt.
»Warum lassen sie uns dann nicht einfach in Ruhe? Wir tun doch nichts Böses.« Christian Thiele hatte verständnislos den Kopf geschüttelt. »Außerdem sagte Pastor Fichte, dass wir seit Hunderten von Jahren das Recht zur Auswanderung aus Glaubensgründen hätten. Das können sie uns nicht einfach verweigern.«
»So sicher wäre ich mir da nicht, Nachbar Thiele. – Jedenfalls würde ich nichts unternehmen, bis wir tatsächlich die Pässe in Händen halten.«
»Wenn ich bis dahin überhaupt noch etwas zu verkaufen habe«, hatte ihr Vater bitter geäußert. »Wir leben jetzt schon von unseren Ersparnissen. Ich weiß nicht, wie lange ...« Plötzlich hatte er Friederike auf der Bank hinter dem Fliederbusch bemerkt und mitten im Satz abgebrochen.
Danach waren die beiden in den Schuppen gegangen. Friederike hatte noch einige Zeit über diesen Wortwechsel gegrübelt.
Ein lautes »Halleluja!« riss sie aus ihren Erinnerungen. Oben auf der Kanzel setzte Pastor Fichte zu einem fulminanten Dankgebet an, und Friederike konzentrierte sich darauf, an den richtigen Stellen voller Inbrunst in die Liturgie mit einzustimmen. Den Erwachsenen ging es anscheinend nicht besser als ihr. Auch von ihnen schienen die meisten noch halb betäubt von der Nachricht. So lange hatte man vergeblich darauf gewartet, dass man nun völlig überrumpelt worden war. Wie Schlafwandler erhoben sie sich von den Bänken, um den Abendsegen zu empfangen. Ihre Mienen waren seltsam erstarrt, als sie sich langsam nach draußen schoben. Friederike ließ sich mittreiben. Erst oben an der Treppe scherte sie aus und hielt Ausschau nach der hohen Gestalt ihres Vaters.
»Rieke, da bist du ja.« Charlottes helle Stimme ließ sie den Kopf wenden. Sie stand dicht neben ihrem Vater. Neben Christian Thiele, der seine Geschlechtsgenossen um beinahe Haupteslänge überragte, wirkte ihre Schwester noch zarter als sonst. Ihre Hände flatterten wie aufgeregte Vögel, als sie in Friederikes Richtung gestikulierte. Gespenstisch blass im fahlen Mondlicht schien sie die frohe Botschaft noch nicht so recht verinnerlicht zu haben. Auch das Friederike zugewandte Profil ihres Vaters, der gerade mit einem der Kirchenältesten sprach, zeigte statt Freude eher Besorgnis. Entschlossen drängte sie sich durch die zähe Menge der in dunkles Wolltuch gekleideten Körper; murmelte hier eine Entschuldigung, dort einen flüchtigen Gruß, bis sie endlich neben ihrem Vater stand.
»... nicht reisefähig. Was soll ich nur tun?«, hörte sie ihn sagen.
»Bruder Christian, unser aller Leben und Wohlergehen liegt allein in Gottes Hand«, beschied ihn der hagere Mann streng. »Er wacht auch über Eure Frau – immer und überall. Zweifelt nicht daran! Euch und Eurer Familie einen gesegneten Abend.« Mit diesen Worten nickte er dem Gärtnermeister kurz zu und ging davon. Christian Thiele sah ihm hilflos hinterher, ehe er schweren Schrittes den Heimweg antrat, ohne seine Töchter weiter zu beachten. Friederike packte Charlottes Ärmel, um deren Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. »Worum ging es? Um Mutter?«
»Vater macht sich große Sorgen um Mutters Zustand«, flüsterte Charlotte zurück. »Eine solche Reise könnte ihr Tod sein. Deshalb hat er gefragt, ob es möglich ist, sich einer späteren Reisegruppe anzuschließen.«
»Und?«
Charlotte schüttelte niedergeschlagen den Kopf. »Sie befürchten, dass es uns ergehen könnte wie den Klemzigern, deshalb will niemand warten. Pastor Fichte wird schon morgen nach Hamburg aufbrechen, um eine Überfahrt für uns zu suchen. Wir sollen dann nachfolgen, sobald die Oder wieder schiffbar ist. »
»So rasch?« Friederike stockte der Atem. Der März ging seinem Ende zu. Bald schon würden die täglich kräftigeren Strahlen der Frühlingssonne das Eis schmelzen lassen. Im Schutz des Mistbeets schoben sich bereits die ersten Triebe der frühen Tulpen ans Tageslicht, und die Knospen der Kirschbäume waren dick geschwollen. Auf dem Sims in der Küche standen in langen Reihen die Tongefäße mit den getopften Maiglöckchentrieben und auf allen Fensterbänken des Hauses mit Papierhütchen versehene Hyazinthenzwiebeln. Ware für den Verkauf in Krossen. »Wie sollen wir innerhalb weniger Wochen alle Vorbereitungen treffen?«
Charlotte hob bloß die Schultern. Bedrückt versuchten sie mit dem Vater Schritt zu halten, der in fast panischer Eile nach Hause strebte. Heinrich erwartete sie bereits in der offenen Haustür.
»Vater!« Seiner Stimme war deutlich die Aufregung anzuhören. Christian Thiele strich seinem Sohn geistesabwesend über die dichten Locken, blieb aber nicht stehen. Zwei Stufen auf einmal nehmend stürmte er die Treppe hinauf und verschwand im Elternschlafzimmer.
»Rieke, ich habe schrecklichen Hunger«, beklagte Marie-Luise sich weinerlich.
»Ich auch«, stimmte Georg ein.
»Was wurde beschlossen? Ging es wirklich um die Auswanderung? Lässt der König uns gehen?« Heinrichs Stimme überschlug sich fast in dem Bemühen, seine beiden jüngeren Geschwister zu übertönen.
»Kinder soll man nur sehen, nicht hören!«, ertönte Großmutter Thieles Stimme scharf aus ihrer Ecke. »Charlotte, hilf mir ins Bett. Dabei kannst du mir alles Wichtige erzählen. Friederike, sobald das Essen fertig ist, kannst du es mir von Heinrich hinaufbringen lassen.« Damit humpelte sie, auf Charlottes widerwillig gereichten Arm gestützt, zur Tür. Gleich darauf hörte man ihre schweren Tritte auf den Stufen.
Friederike hängte ihr Tuch an einen der Haken. »Ja, Heinrich, wir werden nach Australien fahren. Schon sehr bald.« Sie streckte sich, um die Kanne mit der Bunzlauer Glasur vom Bord zu holen, und gab eine Handvoll getrockneter Melissenblätter hinein. Dann griff sie nach der Schöpfkelle, um mit dem kochend heißen Wasser aus dem Wasserschiff den Abendtee aufzubrühen. »Hört auf zu jammern, ihr beiden. Ich hole uns das Schmalz aus der Kammer. Dann können wir sofort essen.«
»Schmalzbrot!« Die Augen von Marie-Luise strahlten vor Begeisterung über das unverhoffte Festmahl.
Jetzt im Frühjahr war der Speiseplan ziemlich eintönig geworden. Graubrot, Marmelade und Zichorienkaffee zum Frühstück, Kartoffeln und Sauermilch zum Mittag, Kartoffel- oder Graupensuppe zum Abend. Die Borde der Speisekammer, die sich im Herbst unter den Binsenkörben voller Trockenfrüchte und Säcken von Bohnen und Linsen gebogen hatten, waren nur noch spärlich bestückt. Dazu einige Leinwandsäckchen getrockneter Pilze und als besondere Kostbarkeit eine irdene Kasserolle mit Griebenschmalz. An die hatte Friederike sich eben erinnert. Gab es einen besseren Tag als heute, um sie anzubrechen?
»Zur Feier des Tages.«
Friederike schlüpfte durch die schmale Tür zur Speisekammer und griff behutsam mit beiden Händen den schweren Topf. Er war eiskalt und wog mehr, als sie erwartet hatte. Mit äußerster Vorsicht trug sie ihn zum großen Küchentisch, wo Heinrich bereits begonnen hatte, einen Laib Brot in Scheiben zu schneiden. Sobald sie die Schweinsblase, die den Steinguttopf verschlossen hatte, entfernt hatte, stieg ein würziger Duft auf, der allen das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Von drei Augenpaaren scharf beobachtet bemühte Friederike sich, möglichst gleich große Schmalzhäufchen auf die acht Brotscheiben vor sich zu verteilen. Sorgfältig strich sie das Messer jedes Mal am Rand ab, um nur ja kein Bröckchen Schmalz zu verschwenden. Zuletzt gab sie auf jede Scheibe eine Prise Salz. Unter den ungeduldigen Blicken ihrer Geschwister richtete Friederike das Tablett mit dem Nachtessen für die Großmutter: Ein Schmalzbrot, von dem sie die Rinde abgeschnitten hatte, weil die alte Frau kaum noch beißen konnte, und einen Becher Tee.
»Hier, Heinrich, bring ihr das.« Friederike reichte ihm das Tablett. »Und frag Mutter, ob ich ihr noch einen Krug Bier wärmen soll.«
Sie mussten nicht lange auf Charlotte und Heinrich warten. Schon einige Augenblicke später polterte ihr Bruder die Treppe hinunter, Charlotte auf den Fersen. »Puh, ich habe das Gefühl, zu stinken wie ein Biber«, maulte Charlotte und schnüffelte demonstrativ an ihren Ärmeln. »Warum muss ich ihr immer helfen?«
»Weil du die Älteste bist«, erwiderte Friederike, nicht zum ersten Mal froh darüber, es nicht zu sein. »Sie ist eben altmodisch. Was ist mit Mutters Bier, Heinrich? Und sollen wir auf Vater warten mit dem Essen?«
»Mutter und Vater beten gerade«, sagte ihr Bruder entschuldigend. »Da wollte ich nicht stören.« Hungrig starrte er auf den Tisch mit den sechs Gedecken. Aus den Bechern dampfte der duftende Tee und überdeckte beinahe, aber nicht ganz, den würzigen Geruch des Griebenschmalzes.
Wie auf ein geheimes Kommando hin senkten sich fünf Köpfe über die gefalteten Hände, während Charlotte als die Älteste das Tischgebet sprach.
Komm, Herr Jesu, sei unser Gast,und segne, was du uns bescheret hast.
»Amen«, stimmten alle lauthals ein, Stuhlbeine schurrten über den Boden, als sie sich um den Tisch verteilten, und dann wurde es still. Nichts war mehr zu hören als ein gelegentliches leises Schmatzen und genüssliches Schnaufen.
Ein kurzes Pochen an der Haustür ließ sie aufhorchen. Friederike, die dem unerwarteten Besucher die Tür öffnete, wich merklich zurück. »Einen gesegneten Abend, Onkel Georg. Was führt dich zu uns?«
Der jüngere Bruder ihres Vaters nahm die Mühen eines Fußmarsches von Krossen nach Friedrichsdorf nur selten auf sich. Und auch wenn er dann betonte, dass er sich nur seiner alten Mutter wegen von seinen zahlreichen Verpflichtungen in der Stadt freimachte, ging es doch meist um ein Darlehen. Georgs Tischlergeschäft lief schlecht, die Kinder waren ständig krank, das Geld reichte vorne und hinten nicht. Friederike mochte ihn nicht besonders. Er hatte die Angewohnheit, seine Neffen und Nichten zur Begrüßung äußerst schmerzhaft in die Wangen zu kneifen.
»Ich habe etwas mit deinem Vater zu besprechen«, sagte er kurz angebunden, ohne ihre Begrüßung zu erwidern. »Bring mich zu ihm.«
Alles in ihr sträubte sich dagegen, ihn in das Schlafzimmer ihrer Eltern, das Refugium ihrer Mutter, eindringen zu lassen. Am liebsten hätte sie sich geweigert, ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen – aber das war natürlich unmöglich. Also biss sie die Zähne zusammen und führte ihn hinauf.
Im flackernden Licht der Petroleumlampe sah die Mutter noch kränklicher aus als vorhin. Der Vater ließ nur zögernd ihre schmale Hand los und erhob sich von der Bettkante. Beide wirkten nicht allzu erfreut, als Georg sich selbstzufrieden lächelnd ins Zimmer schob. Er hielt sich weder mit Fragen nach der Gesundheit noch mit Glückwünschen zur Geburt auf. »Ist das Gerücht wahr, dass die Auswanderung jetzt kurz bevorsteht?«
Beide nickten stumm.
»Dann muss ich dringend etwas mit dir besprechen, Bruder.«
Christian Thiele hob resigniert die Hände. »Dann sprich, Georg. Aber es ist kaum noch Geld da. Und das brauchen wir für die Reise.«
Georg musterte seinen Bruder unter gesenkten Lidern. Mit seinen rötlichen, struppigen Haaren und der spitzen Nase erinnerte er Friederike an einen Fuchs, der seine nichtsahnende Beute belauert.
»Es geht um das Anwesen«, sagte er schließlich heiser. »Hast du es schon jemandem versprochen?«
Christian Thiele verneinte, und Georg stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Dann musst du es mir verkaufen«, forderte er. »Wie viel willst du dafür?«
»Mehr als du hast«, war die kurze Antwort. »Komm mit hinunter, meine Frau ist erschöpft und braucht ihre Ruhe.«
Friederike atmete auf, als die beiden Männer das Zimmer verlassen hatten. »Soll ich dir warmes Bier und ein Schmalzbrot bringen, Mama?«, fragte sie eifrig. »Zur Feier des Tages?«
Ihre Mutter lächelte schwach. »Allmählich muss ich mir Mühe geben, wieder zu Kräften zu kommen, meinst du? Mach dir keine Gedanken, Kind, der Herr hält seine Hand über die, die ihm vertrauen. Es wird sich alles zum Guten wenden. Du weißt doch: ›Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.‹«
»Amen«, sagte Friederike leise und wünschte sich insgeheim, Gott so zweifelsfrei vertrauen zu können wie ihre Mutter.
»Ich kann dir das Haus nicht lassen! Ich brauche einen ordentlichen Verkaufspreis«, sagte Christian Thiele gerade leise, aber entschieden zu seinem Bruder, als Friederike in die Küche zurückkehrte. Die beiden Männer saßen sich am Küchentisch gegenüber, und Georg Thiele ließ sich gerade das für seine Schwägerin vorbereitete Schmalzbrot schmecken. »Im letzten Brief schrieb Pastor Kavel, dass dieser Engländer von der Companie uns Land zu sehr günstigen Bedingungen verkaufen würde. Gutes, fruchtbares Land. Er rät jedem, der etwas Geld erübrigen kann, dort so viele Morgen wie möglich zu erstehen.«
Charlotte und die beiden Kleinen waren verschwunden. Friederike trat neben Heinrich, der am Spülstein das benutzte Geschirr abwusch. »Er versucht, Vater das Anwesen abzuschwatzen«, flüsterte ihr Bruder ihr mit vor Ärger blitzenden Augen zu. »Dieser Schlemihl!« Die beiden Geschwister sahen sich an, einig in ihrer Ablehnung des gierigen Verwandten.
»Wie selbstsüchtig von dir!« Georg Thiele verzog verächtlich den Mund. »Also stimmt es, wenn behauptet wird, ihr, die ihr auswandern wollt, wärt nur auf euer eigenes Wohlergehen aus.«
»Wer sagt das?«, brauste Christian Thiele zutiefst gekränkt auf.
»Viele standhafte Fromme«, antwortete Georg ausweichend. »Und sie sind offenbar im Recht, wenn sie euch Schwäche im Glauben vorwerfen. Wenn ihr so fest davon überzeugt seid, dass es Gottes Wille ist, dass ihr nach Australien geht, warum klammert ihr euch dann an weltliche Güter? Der Herr wird schon für euch dann sorgen. Es soll dort nicht schwer sein, es mit seiner Hände Arbeit zu etwas zu bringen.«
»Auch in Australien wächst das Brot für meine Kinder nicht an Bäumen. Und die Überfahrt ist kostspielig«, wies Christian Thiele den Vorwurf zurück. Aber es war ihm anzusehen, dass die Worte seines Bruders ihn getroffen hatten.
Friederikes Blick schweifte über die Wände des Raums, der ihr, solange sie denken konnte, Geborgenheit und Wärme vermittelt hatte. Die meisten der Teller und Becher aus Steingut auf den Borden waren angeschlagen; die Eisenkessel, die an der Stange über dem Herd hingen, verbeult. Es fehlte das Geld, sie durch neue zu ersetzen. Aber alles blitzte vor Sauberkeit, kein Stäubchen trübte die Glasscheiben zwischen den grün gestrichenen Fenstersprossen. Hier war sie aufgewachsen, hier hatte sie sich zu Hause gefühlt. Bald würde es nur noch Erinnerung sein. Wie sie wohl in Australien leben würden?
Sie hatte versucht, sich aus den spärlichen Berichten, die nach Friedrichsdorf gelangt waren, ein Bild zu machen. Es sollte dort sehr viel wärmer sein als hier in der preußischen Provinz. Eis und Schnee gab es nicht. Der harte Winter, der sich eben seinem Ende zuneigte, würde wohl der letzte Winter sein, den sie erlebte. Es erschien ihr schwer vorstellbar, ohne die vertraute Abfolge der Jahreszeiten zu leben. Wie merkte man in Australien, ob es Frühling oder Herbst war?
Die Landschaft sollte angeblich der hiesigen ähneln. Mit lichten Wäldern und großen Weideflächen, auf denen riesige Schafsherden umherzogen. Es gab auch wilde Tiere, aber die bekäme man nicht oft zu Gesicht, hatte es geheißen. Kängurus, die auf den Hinterbeinen hüpften wie Hunde, die gerade Männchen machten; Vögel, die nicht fliegen konnten und Tiere, die halb wie ein Biber und halb wie eine Ente aussahen.
Am sonderbarsten aber waren ihr die Schilderungen der einheimischen Heiden erschienen: Angeblich gingen sie nackt, wie Gott sie geschaffen hatte, und wohnten nicht in Häusern, sondern in hohlen Baumstämmen. Und tagsüber streiften sie auf der Suche nach Nahrung umher wie ein Rudel Rehe. Eine seltsame Art zu leben!
Onkel Georg war nicht nach Krossen zurückgekehrt, wie sie am nächsten Tag feststellen mussten. Stattdessen hatte er sich einen Strohsack ins Zimmer seiner Mutter gelegt und war dort offensichtlich auf offene Ohren für seinen Plan gestoßen, das Anwesen von seinem Bruder zu übernehmen. Selbstverständlich nicht zum marktüblichen Preis. Den konnte er nicht aufbringen. Dafür aber würde die Witwe Thiele in ihren eigenen vier Wänden bleiben können, in ihrem eigenen Bett, umsorgt von ihrem jüngeren Sohn und dessen Familie.
Dreieinhalb Tage leistete Christian Thiele Widerstand, dann gab er dem vereinten Drängen von Mutter und Bruder nach.
»Ich wünsche denen viel Spaß mit dem Versorgen«, zischte Charlotte erbost ihrer Schwester zu, als sie den beiden Männern nachsahen, die am vierten Tag nach Krossen zum Notar gingen. »Der Duft aus ihren Röcken kann es mit der Schweinejauche von Nachbar Teichmann aufnehmen!« Angewidert drückte sie die anstößigen Kleidungsstücke mit dem Stößel tief in die dampfende Lauge. Bereits im Morgengrauen hatten sie damit begonnen, den großen Kessel in der Waschküche anzuheizen, in dem die Weißwäsche über Nacht in Sodalauge gelegen hatte, um die hartnäckigen Flecken einzuweichen. Sobald die Flüssigkeit blubberte und brodelte, dass einem angst und bange werden konnte, wurden die Wäschestücke mit dem hölzernen Rührholz immerzu im Kreis herum bewegt – eine mühselige Arbeit, bei der man sich abwechseln musste. Während Friederike rührte, übernahm Charlotte die Feinwäsche für den Zuber mit dem neuen Waschbrett. Auch das war keine angenehme Arbeit: Jetzt im Frühjahr, wo Zwiebelsaft nicht mehr zur Verfügung stand, mussten die Tintenflecken an Heinrichs Ärmelaufschlägen mit Schweinejauche herausgelöst werden und deren Gestank war ziemlich widerlich. Man musste lange spülen, bis auch der letzte Geruch nach Ammoniak verflogen war. Charlottes Schimpfen über die Leichtfertigkeit ihres Bruders, mit der er seinen Schwestern unnötige Mühe bereitete, war weithin zu hören. Zu seinem Glück war er, ebenso wie Marie-Luise und Georg, im Schulhaus, in dem der Gemeindeälteste die Kinder in Lesen, Schreiben, Rechnen und Bibelkunde unterrichtete. Seit sie die Auswanderung beantragt hatten, war der Lehrer aus Berlin nicht mehr erschienen. In Friedrichsdorf war man nicht unzufrieden mit dieser Entwicklung gewesen. Wie der Älteste Teichmann festgestellt hatte, bot sie ihnen die Möglichkeit, die empfindsamen Seelen vor dem schädlichen Einfluss der Moderne zu bewahren.
Als Christian Thiele aus Krossen zurückkehrte, wirkte er sonderbar abwesend. Charlotte und Friederike, die im Hinterhof in der frischen Frühlingsbrise die Wäsche aufhängten, wunderten sich über seine ungewohnt kurz angebundene Art.
»Meinst du, es reut ihn?«, fragte Charlotte nachdenklich.
»Was denn? Dass er dem Fuchsgesicht nachgegeben hat?«
»Nein, das Auswandern«, gab Charlotte zurück. »Es gibt nicht wenige Stimmen, die zum Bleiben raten. Man würde dabei mehr verlieren als gewinnen.«
»Das ist die Ansicht von Furchtsamen«, entgegnete Friederike. »Wenn Gott uns diese Möglichkeit bietet, dann dürfen wir nicht zaudern. Und Australien soll wunderbar sein. Du hast es doch auch gehört.«
»Ja, das habe ich. Dennoch würde ich lieber hierbleiben«, murrte Charlotte. »Dieses Land ist so schrecklich weit weg.«
Friederike sah verwundert ihre Schwester auf der anderen Seite der Wäscheleine an. Bisher war sie davon ausgegangen, dass diese sich genauso auf Australien freute wie sie selbst. »Na und? Das ist ja der Sinn vom Auswandern, dass man weit wegzieht.«
»Es macht mir Angst«, gestand Charlotte leise. »Die lange Reise, die Fremde.«
»Dann musst du doch nur sagen, dass du lieber hierbleiben willst!« Friederike schüttelte verständnislos den Kopf. »Du bist über achtzehn Jahre alt.« Die Behörden hatten verfügt, dass die Ehefrau und Kinder über achtzehn Jahren einer Auswanderung zustimmen mussten.
»Natürlich könnte ich mich weigern. Und was würde dann aus mir werden?« Charlotte kniff die Lippen zusammen, dass ihr rosiger Mund ganz hart und blass aussah. »Soll ich bei Onkel Georg bleiben und Großmutters Dienstmagd spielen, bis ich alt und klapprig bin?«
»Du wirst sehen: Es wird alles gut«, sagte Friederike ein wenig hilflos und legte ihr tröstend den Arm um die Schultern. Sie war sicher, wenn sie erst in Australien wären, würde Charlotte sich schon an das neue Leben gewöhnen. Bis dahin wollte sie sich ihre eigene Vorfreude nicht verderben lassen.
Kapitel 2
Christian Thiele war nicht der Einzige, der sein Anwesen weit unter Wert abgeben musste. Kaum machte in der Umgebung die Nachricht von der geplanten Auswanderung die Runde, stürzten sich die Aasgeier auf das waidwunde Dorf. Die Ersten waren die Viehhändler: eine Kuh nach der anderen wurde am Strick davongeführt. Dann die Schweine. Die Preise sanken von einem Tag zum anderen, und die Friedrichsdorfer gaben aus Angst, am folgenden Tag noch weniger zu bekommen, die Tiere für einen Spottpreis ab.
Dann kamen die Bauern der umliegenden Dörfer und die Verwalter der großen Güter. Wer Glück hatte, konnte wenigstens für sein Land noch einen erträglichen Preis erzielen. Wer kein Land zu verkaufen hatte, der musste erleben, wie sein Inventar von Trödlern geschätzt und für nahezu geschenkt übernommen wurde.
»Was wollt ihr?«, verteidigte sich einer von ihnen, als der Älteste Teichmann ihm vorwarf, sich an der Notlage der Friedrichsdorfer zu bereichern. »Was soll ich mit zwanzig, dreißig Hausständen? Niemand hier braucht so viele Sachen. Ich muss das Zeug also nach Frankfurt oder nach Berlin schaffen. Das kostet mich mehr, als es bringt. Seid froh, dass ich ein weiches Herz habe und euch überhaupt noch etwas dafür gebe!«
Und so verschwanden seit Generationen gehegte Familienschätze wie die Schäferin aus Meißener Porzellan, das Ölbild mit dem niederländischen Stillleben oder das silberne Kaffeeservice in den schmuddeligen Karren der Trödler.
»Wenigstens bleibt es uns erspart, diese Menschen durch unser Haus schleichen zu sehen«, seufzte Sabine Thiele, die gerade vor dem großen Schrank kniete und das Leinen sortierte. »Hier, Lotte, diesen Stapel nehmen wir mit. Pack ihn zuunterst in die schwarze Kiste. – Rieke, Kind, steh nicht herum und träum vor dich hin. Geh und hilf deinem Vater.«
»Sofort, Mutter. – Aber willst du dich nicht ein wenig hinlegen?«, schlug. Friederike vor und musterte besorgt die roten Flecken auf den Wangen ihrer Mutter. Auch wenn diese ständig versicherte, wieder völlig genesen zu sein, bezweifelte Friederike im Stillen, dass das der Wahrheit entsprach. Im Medizinschrank im Kontor, in fest verschlossenen Steingutkrügen, bewahrten sie nicht nur getrocknete Kamillenblüten, gerebelten Beifuß und Bertramsgarbe gegen Magenbeschwerden, Holunderblüten für den Fiebertee und Mädesüßblüten für einen Tee gegen Schmerzen und Entzündungen auf. Daneben standen auch noch einige Flaschen mit Tinkturen des Apothekers in Krossen. Und eine dieser Tinkturen, die gegen starke Schmerzen, war in letzter Zeit rapide weniger geworden.
»Mir geht es gut«, sagte ihre Mutter mit solcher Entschiedenheit, dass Friederike nicht zu widersprechen wagte.
Als sie das Kontor betrat, stand ihr Vater vor den weit geöffneten Türen des wurmstichigen Holzschranks mit den Blumensamen und musterte die säuberlich beschrifteten Spanschachteln mit leiser Wehmut. »Was meinst du, Rieke, sollen wir auch davon welche mitnehmen?«, fragte er, ohne sich umzudrehen. »Sie sind zwar nicht gerade nützlich, aber vielleicht freut sich deine Mutter über eine Erinnerung an ihr altes Heim.«
»Ich kann sie in Papiertüten umfüllen und zwischen das Leinen legen«, schlug Friederike vor. »Dann nehmen sie nicht so viel Platz weg wie die Gemüsesamen in den Blechkästen.« Gestern hatten sie gemeinsam, fast andächtig, all ihre Vorräte an Gemüse- und Kräutersamen – der Grundstock für die zukünftige Gärtnerei – in eigens angefertigte Blechkisten verpackt. Damit die Feuchtigkeit auf See sie nicht zum Keimen brachte, hatten sie sie zusammen mit einigen Stücken Holzkohle in Öltuch eingeschlagen, um sie trocken zu halten. Zur Sicherheit hatte Christian Thiele sogar die Lötnähte der Blechbehälter mit Pech verstrichen. Derart versiegelt müssten sie die lange Überfahrt unbeschadet überstehen.