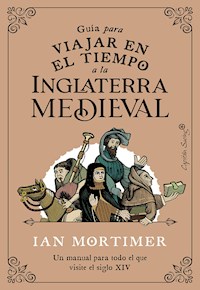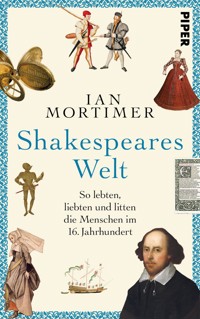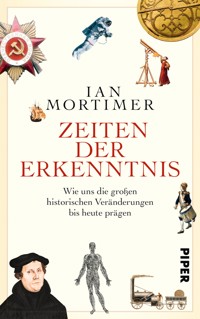13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
So haben wir die Zeit von Jane Austen noch nie gesehen...
Es ist der Übergang vom 17. ins 18. Jahrhundert, Jane Austen und die Dichter der Romantik schlendern durch die Gassen. Die britische Landschaftsmalerei entsteht, und die Menschen genießen viele Freiheiten, bevor die erdrückende viktorianische Moral schließlich ihren Alltag bestimmt. Einmal mehr nimmt Ian Mortimer uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit – er zeigt, wie die Menschen während der Regency lebten, woran sie glaubten, wovor sie sich fürchteten – und haucht damit dieser unvergleichlich aufregenden Epoche neues Leben ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 781
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Aus dem Englischen von Karin Schuler
Für meinen Cousin Stephen Read und seine Frau Edori Fertig in tiefer Zuneigung
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel The Time Traveller’s Guide
to Regency Britain bei The Bodley Head, London
© Ian Mortimer, 2020
Für die deutsche Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildungen: akg-images; picture alliance / United Archives / WHA; akg-images / INTERFOTO / HERMANN HISTORICA GmbH; Heritage Images / Fine Art Images / akg-images; akg-images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Anmerkung des Autors
Einleitung: Willkommen im Regency – einer Zeit der Widersprüche
1 Die Landschaft, durch die Sie reisen
Brighton und die Ferienorte an der Küste
Größere Städte
Kleinstädte und das Land
2 London – das Herzstück des Königreichs
1790
1810
1830
3 Die Bevölkerung und deren Gesellschaftsordnung
Die Gesellschaftsordnung
Die Monarchie
Der Hochadel
Der Landadel
Der Kleinadel
Industrielle und Finanziers
Die akademischen Berufe
Ladenbesitzer und städtische Handwerker
Die ländliche untere Mittelschicht
Die Arbeiterschicht
Die Mittellosen
Frauen
4 Das Wesen der Menschen zur Zeit Jane Austens
Der Geist des Zeitalters
Religiosität und Verkündigung
Radikalismus und Repression
Grausamkeit und Mitleid
Brutale Schinder und Tierfreunde
Duelle
Empfindsamkeit
Köstliche Ungewissheit
Sexuelle Sittenlosigkeit
Bildung
Bildung für Jungen
Höhere Bildung für junge Männer
Bildung für Mädchen
Selbststudium
Einstellungen gegenüber Ausländern
Homosexualität
Transvestitismus
Rassismus und Antisemitismus
Der Verkauf von Ehefrauen
Frauenrechte
Aberglaube
Naturwissenschaften
Romantik und Geschichte
Sinn für Humor
5 Grundlegende Aspekte des Alltags
Das Wetter
Tageszeiten
Weihnachten
Innenbeleuchtung
Feuer und Brandversicherung
Zeitungen
Geschwindigkeit der Kommunikation
Das Postwesen
Sprache und Höflichkeit
Geld
Einkaufen
Steuern
6 Wie Sie sich kleiden
Herrenmode
Brillen
Die Kleidung der männlichen Arbeiterschicht
Damenkleidung
Kosmetik
Die Kleidung der weiblichen Arbeiterschicht
Regionale Trachten
Schmutzwäsche
7 Wie Sie durch das Königreich reisen
Auf Schusters Rappen
Reiten
Private Fuhrwerke
Öffentliche Verkehrsmittel
Die Postkutsche
Die Fahrpost
Sicherheit
Neue Formen des Straßenverkehrs
Wasserwege
Seeschifffahrt
Dampfschiffe
Sicherheit auf See
8 Wo Sie Unterkunft finden
Gasthäuser
Hotels
Stadthäuser
Handwerker und Händler
Die Reichen
Die städtischen Armen
Häuser auf dem Land
Die Mittelschicht
Die Arbeiterschicht
Die oberen Schichten
9 Was Sie essen, trinken und rauchen
Das Essen der Mittelschicht
Das Essen der Arbeiterschicht
Das Essen der Oberschicht
Essen gehen
Alkohol
Alkoholfreie Getränke
Tabak und Drogen
10 Von Hygiene, Krankheit und Medizin
Das Verständnis von Gesundheit und Infektion
Persönliche Hygiene
Zahnreinigung und Zahnheilkunde
Die Bandbreite der Krankheiten
Die medizinische Welt
Krankenhäuser und »Polikliniken«
Irrenanstalten
11 Von Recht und Ordnung
Die Polizeiarbeit
Das Justizsystem
Strafen
Gefängnis
Körperstrafen
Deportation
Die Todesstrafe
12 Was Sie zum Zeitvertreib unternehmen können
Wettkampfsport
Tierkämpfe
Karten-, Würfel- und Brettspiele
Shows
Häuser mit schlechtem Leumund
Lesen
Museen und Galerien
Tanz
Das Theater
Opern und Konzerte
Die Diven
Haydn und Beethoven
Schluss
Dank
Anhang
Abkürzungshinweise zu den Anmerkungen
Bildteil
Bildnachweis
Stichwortverzeichnis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Register
Wir betrachten selbst die gewöhnlichsten Artikel des häuslichen Lebens mit einem gewissen Interesse, wenn sie wieder ans Licht kommen, nachdem sie lange verschollen waren; und wir verspüren eine natürliche Neugier, wenn es darum geht, was unsere Vorfahren getan und gesagt haben, obwohl es womöglich nicht klüger oder besser war als das, was wir selbst täglich tun oder sagen. Manche aus dieser Generation sind sich vielleicht kaum bewusst, wie viel Annehmlichkeiten, die heute als selbstverständliche Notwendigkeiten gelten, ihren Großvätern und Großmüttern unbekannt waren.
James Edward Austen-Leigh, A Memoir of Jane Austen(1869)
Das Gedächtnis ist kein Buch, in welchem alles gedruckt stehen bleibt, es ist vielmehr ein Acker, in welchem der Saame keimt, wächst, reift und stirbt, und was man hineinsäet, verändert sich unaufhörlich.
Louis Simond, Reise eines Gallo-Amerikaners durch Großbritannien (1815)
Anmerkung des Autors
In diesem Buch geht es um die britische Insel – England, Wales und Schottland – zwischen 1789 und 1830. Ich bezeichne diese ganze Epoche in Übereinstimmung mit den meisten Historikern, Literaturkritikern und Kunstexperten als »das Regency«. Man sollte sich allerdings klarmachen, dass die Bezeichnung offiziell nur die Jahre 1811 bis 1820 umfasst, in denen Prinz George anstelle seines geisteskranken Vaters König George III. regierte. Den Beginn meiner längeren Regency-Zeit markieren zwei Faktoren: Im Februar 1789 kam der Vorschlag, dass der Prinz die Regierung übernehmen solle, erstmals im Parlament auf. Sein Vater erlangte seine geistige Gesundheit zwar zunächst wieder zurück, doch der Prinz war von da an der Regent in Wartestellung für den Fall, dass der König erneut erkranken würde. Natürlich nahm sein Einfluss nur noch zu, als er 1820 als George IV. den Thron bestieg. Der zweite Grund für den Startpunkt 1789 ist die Französische Revolution, die in jenem Sommer ausbrach und nicht nur auf dem Kontinent, sondern auch in Großbritannien zu intensiven Diskussionen über eine Verfassungsreform führte. Auch das Ende unserer Zeit ist von der Reformfrage geprägt. George IV. verabscheute jeden Gedanken an konstitutionelle Veränderungen, vor allem weil ihm das Schicksal der französischen Königsfamilie vor Augen stand. Deshalb tat er alles, um sie zu verhindern. Erst nach seinem Tod konnte die dann eingesetzte Regierung das dringend nötige Reformgesetz formulieren und einige der gesellschaftlichen Probleme anpacken, die im Zuge der Französischen Revolution aufgekommen waren. Deshalb bildet der Tod des Königs am 26. Juni 1830 in meinen Augen das Ende dieser Zeit.
Einleitung:Willkommen im Regency – einer Zeit der Widersprüche
Am Donnerstag, dem 28. Januar 1790, wischte sich der Reverend Thomas Puddicombe den Schmutz von den Händen und kehrte in sein Pfarrhaus im Dorf Branscombe an der Küste von Süd-Devon zurück. Die Zeremonie, die er gerade geleitet hatte, war in vielerlei Hinsicht Routine. Die Worte des Beerdigungsgottesdienstes waren uralt und wohlvertraut; die dunkle Kleidung der Teilnehmenden vom Brauch vorgeschrieben, ihre Trauer nicht überraschend. Nicht weniger normal war seine letzte Pflicht an diesem Tag – der Eintrag des Datums und des Namens des Toten in das Sterberegister seines Kirchenbuchs. Doch als er sich an seinen Schreibtisch setzte und den Federkiel in die Tinte tunkte, schrieb er keinen ganz normalen Eintrag. Er fügte die Todesursache hinzu:
White, John, 77 Jahre alt. Dieser Mann verlor sein Leben durch einen ganz banalen Unfall: Er schnitt seinen Zehennagel mit einem Federmesser etwas zu kurz, sodass es leicht blutete: Die offene Stelle wucherte, und eine einsetzende Entzündung machte ihm innerhalb weniger Tage den Garaus.
Diese Detailfülle wird jeden überraschen, der englische Kirchenbücher kennt. Doch Mr Puddicombe schrieb oft etwas über die Todesursachen seiner Schäfchen. Nachdem Joseph Hooke, der dreizehnjährige Sohn eines Bauern im Dorf, 1803 einem Unfall zum Opfer gefallen war, fühlte sich der Pfarrer verpflichtet festzuhalten, dass der Junge »auf einem durchgegangenen Pferd saß, an der Straßenecke beim Hangman’s Stone hinunterfiel; eine halbe Meile weit mitgeschleift und auf der Straße ein Stückchen oberhalb von Higher Watercombe tot gefunden wurde«. Und als Jane Toulmin, eine fünfundzwanzigjährige Frau, im Mai 1798 ins Wasser ging, schrieb er eine Dreiviertelseite über die letzten beiden Tage ihres Lebens. Seine Abschlusssätze lauteten:
Bevor sie das Haus ihrer Schwester verließ, holte sie all ihr Geld hervor und ließ es in ihrem Schlafzimmer, und in diesem Zustand, ohne einen Sixpence in der Tasche, wanderte sie bis zum Dienstagmorgen umher, dem Tag, an dem sie, so ist zu befürchten, ihrer Existenz ein Ende bereitete. Sie wurde in Beer gesehen, wie sie zwischen drei und vier Uhr sehr schnell die Common Lane hinaufging; und um etwa Viertel nach fünf Uhr wurde sie von einem gewissen John Parrett, einem Zimmermann, im Wasser gefunden.
Solche Schilderungen passen irgendwie so gar nicht zu unserem Bild der Jane-Austen-Zeit – zu den vornehmen Häusern, den Kleidern und Kutschen. Doch natürlich gehören auch Friedhöfe auf dem Dorf, Reitunfälle und junge Frauen in tiefster Verzweiflung in diese Epoche. Und jeder ausführliche Eintrag in Thomas Puddicombes Sterberegister führt uns zu weiteren Fragen. War es im Jahr 1790 üblich, dass sich die Menschen ihre Zehennägel mit dem Federmesser schnitten? Passierten häufiger Reitunfälle wie der von Joseph Hooke? Und wussten die Menschen in den 1790er-Jahren etwas über psychische Krankheiten? Bei Jane Austen findet man auf diese Fragen keine Antworten, und doch erzählen sie von der Welt, in der sie lebte, ebenso viel wie die komplizierten Interaktionen der Figuren in ihren Büchern.
Mr Puddicombes ausführliche Sterberegistereinträge enden abrupt im Jahr 1812. Von da an wurde er von offizieller Seite stark eingeschränkt: Die Regierung führte ein gedrucktes Formular ein, auf dem die Einzelheiten einer Beisetzung festgehalten wurden. Jede Seite bestand aus einer Reihe von Kästchen, in die der diensttuende Geistliche den Namen des Toten, sein Alter, seinen Wohnort und sein Beisetzungsdatum schreiben sollte – und sonst nichts.
Diese Verschiebung vom überschwänglichen Individualismus hin zu einer von oben aufgezwungenen Standardisierung verweist auf die größeren Veränderungen der Epoche. In den 1860er-Jahren erschien der Anfang des Jahrhunderts vielen Menschen als die letzte Zeit wahrer Freiheit, bevor die Regulierung der Gesellschaft ernsthaft begann. Das Reformgesetz von 1832 signalisierte den Anfang vom Ende der politischen Herrschaft des Hochadels und der landbesitzenden Gentry. 1833 beschränkte das Fabrikgesetz die Zahl der Stunden, die Kinder jeden Tag arbeiten durften. Im selben Jahr wurde in allen britischen Kolonien die Sklaverei abgeschafft. Seit 1834 wurden Mörder nicht mehr am Galgen aufgeknüpft. Der einst so vertraute Anblick öffentlicher Hinrichtungen wurde zur Seltenheit, da ihre Gegner mit wachsendem Erfolg gegen die Todesstrafe zu Felde zogen. Grausame Sportarten wie Hahnenkampf und Bärenhatz wurden 1835 verboten. Die verpflichtende staatliche Registrierung von Geburten, Eheschließungen und Todesfällen begann 1838. Die Standardisierung des Schraubengewindes wurde 1841 eingeführt und bahnte der Massenfertigung den Weg. Seit Mitte der 1840er-Jahre sorgte der Telegraf dafür, dass man Botschaften über weite Entfernungen senden konnte. Züge ersetzten die Postkutschen und machten die Straßenräuber arbeitslos. Die Fotografie begann der Malerei Konkurrenz zu machen, wenn es darum ging, Szenen und Porträtbilder festzuhalten.
Und zu all diesen Veränderungen kam noch, dass in der frühviktorianischen Zeit eine neue Moral die Gesellschaft erfasste und die Freiheiten der Menschen einschränkte. Vor allem die Einstellungen zu Ehebruch, Spielleidenschaft und ungezahlten Schulden verhärteten sich. Man kann verstehen, dass diejenigen, die von den 1860ern aus zurückblickten, ihre Vorfahren um die Jahrhundertwende als eine zügellose, wilde Gesellschaft sahen. Damals konnten Gentlemen und Ladys, Bettler und Geistliche, Soldaten und Herumtreiber, Unternehmer und Kurtisanen in einer Welt voller Gold und Heldentum, Alkohol und Sex, Begeisterung und Möglichkeiten im großen Ganzen tun und lassen, was sie wollten.
Unsere eigenen Eindrücke der Jahre zwischen 1789 und 1830 sind eigentlich ganz ähnlich. Noch heute gilt diese Phase als eine Zeit des Überschwangs und des ungeahndeten schlechten Benehmens. Wegen der Zügellosigkeit des Prinzregenten und seiner Gefährten erscheint uns die Oberschicht als besonders unmoralisch. Die Inschrift auf dem antiken Apollontempel in Delphi mochte den Weisen geraten haben, »nichts im Übermaß« zu tun, doch die klassisch gebildete englische Oberschicht schien diesen Ratschlag als Herausforderung zu verstehen, alles im Übermaß zu tun.
Wir haben es also mit einem Königshof voller Wüstlinge, Dandys und Höllenhunde zu tun, die sich mit teurem Essen vollstopften, gewaltige Mengen Portwein in sich hineinschütteten und bis in die frühen Morgenstunden ganze Vermögen verspielten. Dann gingen sie entweder mit ihren Geliebten ins Bett oder legten sich auf dem Weg nach Hause irgendwo zum Schlafen nieder – »in den Stiefeln auf den Sofas schnarchend«, wie Prinzessin Caroline es ausdrückte –, bis sie irgendwann aufwachten und verkatert ins Parlament gingen, wo sie Reden über die Zukunft des Landes hielten.
Neben diesen privilegierten Taugenichtsen gab es eine große Palette anderer zweifelhafter Charaktere: schneidige Wegelagerer, gerissene Schmuggler, Gentleman-Faustkämpfer und politische Duellanten aller Couleur. Kurz gesagt, diese Zeit war für viele schlichtweg das Zeitalter des Übermaßes. Eingekeilt zwischen der leicht langweiligen Eleganz des 18. Jahrhunderts und der prüden moralischen Überlegenheit der Frühviktorianer wirkt es liederlich, unanständig, grell, gefährlich, schockierend, anstößig – und doch so unterhaltsam und anziehend.
Moment mal, könnten Sie sagen: War das nicht auch die Zeit, in der John Nash Regent Street und Regent’s Park in London mit ihren prächtigen Häuserzeilen baute? War das nicht das Zeitalter, in dem George Stephenson seine bahnbrechenden Dampfmaschinen konstruierte und Michael Faraday den Elektromotor entwickelte? Und habe ich vergessen, dass das frühe 19. Jahrhundert die Gründung der National Gallery erlebte, die Entzifferung der Hieroglyphen und den Aufbau der Elgin Marbles im British Museum? Stehen das zügellose Wesen der Zeit und diese kulturellen Errungenschaften nicht im Widerspruch zueinander? Ja, das stimmt. Und man könnte diese Argumentation noch weiter treiben. Was die neuen Häuser überall im Lande angeht, nun, genau in diesen herrschaftlichen Anwesen, an diesen städtischen Plätzen und halbmondförmigen Straßenzügen lebten die zügellosesten Menschen. Denken Sie an die Landschaftsgärten der großen Häuser, die Humphry Repton und Lancelot »Capability« Brown anlegten. Rufen Sie sich die nach Entwürfen von George Hepplewhite und Thomas Sheraton geschreinerten Möbel in Erinnerung. Und lassen Sie die Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Musikinstrumente und das Porzellan vor Ihrem inneren Auge vorbeiziehen.
Viele betrachten den Stil des Regency noch immer als den Höhepunkt des guten Geschmacks und der Eleganz. Die Vorstellung, dass diese Zeit auch mit den Wüstlingen, Gestrauchelten und Aufrührern der Gesellschaft verbunden war, ist durchaus eine Überraschung.
Doch gerade hier liegt unser Schlüssel zum Verständnis des Regency. Nur wer auf die offensichtlichen Widersprüche eines Themas stößt, kann es voll und ganz erfassen. Da die Reichen offenbar fest entschlossen waren, alles im Übermaß zu tun, gaben sie natürlich auch übermäßig viel Geld aus in dem Bemühen, ihren Platz in der Gesellschaft durch immer prächtigere Häuser und immer schönere Möbel unter Beweis zu stellen. Und was die intellektuellen und kulturellen Innovationen angeht, so kann es kaum überraschen, dass Künstler und Handwerker ihr Bestes gaben, wenn so gewaltige finanzielle Anreize winkten. Die Oberschicht, fest entschlossen, das Geld mit vollen Händen auszugeben, schuf ein Umfeld, in dem die brillantesten Künstler, Architekten, Wissenschaftler und Erfinder aufblühen konnten, und hinterließ so den Eindruck eines Goldenen Zeitalters. Dass der Lebensstandard der Arbeiter, die am Entstehen dieser Vermögen beteiligt waren, nur mäßig stieg und sie dagegen mehr als einmal mit Aufständen protestierten, ist eine andere Sache. Zweihundert Jahre später sind die Aufstände dem modernen Betrachter deutlich weniger augenscheinlich als die prächtigen, hübsch ausgestatteten Häuser, die die Reichen zurückließen.
Die Spannungen in der Gesellschaft waren nicht auf die Gegensätze zwischen Privilegien und Armut oder zwischen Individualismus und staatlicher Kontrolle beschränkt. Sie waren auch die Folge tiefgreifender sozialer und ökonomischer Veränderungen. Die Bevölkerung Großbritanniens wuchs schneller als je zuvor in der Geschichte (und übrigens auch jemals danach). Und sie wurde urbaner.
Da stoßen wir auf einen weiteren Widerspruch: Feierten die Künstler der Zeit das Wachstum der Industriestädte? Nein, ganz im Gegenteil: Sie feierten die Natur, die gerade verloren ging. John Constables berühmtestes Gemälde The Hay Wain (Der Heuwagen), das er 1821 fertigstellte, zeigt zwei Männer, die mitten in einem Fluss ganz entspannt auf einem leeren Heukarren sitzen und sich unterhalten. Sie scheinen alle Zeit der Welt zu haben und sehen den Veränderungen um sie herum offenbar unbesorgt entgegen. Ihr Umfeld ist vom Rhythmus der Jahreszeiten und einem Fluss geprägt, der immer fließen wird. Keine Rauchsäulen verdunkeln den Horizont, keine städtischen Hinterhöfe begrenzen ihre Welt.
Ähnlich greift auch John Clares Dichtung auf ein ländliches Idyll zurück, umgeben nur von der Natur und dem Dorfleben seiner Kindheit. Wo Künstler und Dichter einmal direkt die Kräfte ansprechen, die die Landschaft umformen, tun sie das nur selten auf eine positive, verklärende Weise. William Blakes »dunkle, teuflische Mühlen« schickten Rauchschwaden über »Englands grünen und lieblichen Grund«: Da gab es nichts, das das Herz des Dichters erfreuen konnte. Das alte biblische Bild vom Feuer, das sich vom Himmel herunter ergoss, hatte sich umgedreht: Jetzt reichten die Feuer bis zum Himmel hinauf.
Die vielleicht genialsten künstlerischen Schilderungen der Epoche finden wir in der Musik, vor allem in den überall beliebten Werken Ludwig van Beethovens, doch selbst hier stoßen wir auf einen kulturellen Konflikt. Wie ein gewaltiger Motor dröhnte der Donner von Beethovens berühmter 5. Symphonie zum ersten Mal am 15. April 1816 in London. Es ist schwer, das majestätische, durchdringende Thema mit der zarten Empfindsamkeit von Jane Austens im selben Jahr erschienenen Roman Überredung in Einklang zu bringen.
Dass die Realität der Vergangenheit immer komplexer und vielfältiger ist als unser Bild von ihr, ist eine Binsenweisheit. In diesem Fall ist schon das Wort »Regency« mit all seinen hochherrschaftlichen Konnotationen Teil des Problems: Es lässt alles so vornehm und luxuriös klingen. Viktorianische Romantiker, die auf eine Zeit scheinbar größerer individueller Freiheit zurückblickten, sahen eher nicht, wie wenige Möglichkeiten Arbeitern und ihren Familien in den wachsenden Industriestädten dieser Zeit offenstanden.
Wenn wir uns die hübschen Münzen und Banknoten des Regency ansehen, ist es heilsam, auch einmal daran zu denken, dass die meisten Menschen ihr Leben lang kein Gold- oder Papiergeld in die Hände bekamen. Bei der Erwähnung von Nelsons Kriegsmarine dachten sie an Zwangsrekrutierungen und die Bedingungen an Bord dieser schweren Holzschiffe, die ohrenbetäubenden Kanonenschläge und das splitternde Holz im Gefecht, den kalten Wind, der durch die Takelage strich, und die Aussicht auf ein feuchtes Grab.
Wenn man dagegen die Worte »Nelsons Kriegsmarine« gegenüber einem Engländer des späten 19. Jahrhunderts fallen ließ, hatte er wahrscheinlich einen Kupferstich vor Augen, der den dramatischen Tod Nelsons an Bord der Victory zeigte. Um diese überaus vielfältige und widersprüchliche Zeit zu verstehen, müssen wir uns also von früheren Versuchen freimachen, sie zu romantisieren oder als das letzte Zeitalter »wahrer Freiheit« zu feiern. Wir dürfen nicht einfach vom Ufer aus auf den Fluss der Zeit schauen. Wir müssen hineinspringen und ganz eintauchen.
Doch das ist leichter gesagt als getan. Wie stellen wir das an? Wir brauchen genügend Quellen, und wir müssen – genauso wichtig – ihren Kontext und ihre Bedeutung verstehen. Für die Zeit um 1800 ist das nicht allzu schwierig: Unzählige Dokumente, Bücher, Bilder, Gegenstände und Bauwerke sind erhalten geblieben. Ein in dieser Hinsicht besonders nützlicher Text ist Letters from England by Don Manuel Alvarez Espriella, erstmals 1807 in drei Bänden veröffentlicht. Dieser angebliche Reisebericht eines spanischen Gentleman stammt tatsächlich aus der Feder des englischen Hofdichters Robert Southey: Von der Idee her unterscheidet er sich damit gar nicht so sehr von unserem Buch hier, und da er von einem kenntnisreichen Zeitgenossen verfasst wurde, habe ich ihn als Leitfaden benutzt.
Doch das Sammeln und Bewerten von Quellen allein bringt uns noch nicht zum Ziel. Die Analyse historischer Quellen ist eine Wissenschaft, die aussagekräftige Rekonstruktion der Vergangenheit eine Kunst. Wir müssen auf unsere eigenen Erfahrungen zurückgreifen, um den Quellen Leben einzuhauchen, und dazu dürfen wir uns nicht allein auf die Dokumente, Bilder und Gebäude konzentrieren, sondern auch auf die Handlungen, Bedürfnisse, Vorstellungen dahinter. Wenn man als Historiker ein Dokument als die höchste wissbare Wahrheit betrachtet, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, sich vorzustellen, was die Menschen zum Weinen, Schreien und Beten brachte, dann ist das einfach eine akademische Übung.
Verstehen Sie mich nicht falsch, akademische Übungen sind unglaublich wertvoll: Sie sind die Grundlage, um die Vergangenheit richtig zu verstehen. Aber sie haben ihre Grenzen. Nelsons Knochen könnten uns vieles über den Mann erzählen, aber nicht unbedingt das, was uns besonders interessiert. Nur anhand eines Skeletts kämen wir nie auf den Gedanken, dass ein Mensch lächeln kann.
Darin liegt der Wesenskern unseres Buchs. Wir wollen uns das Leben hinter den Quellen ansehen, inklusive all seiner Widersprüche. Wie sollte man sich im Jahr 1790 seine Zehennägel schneiden, wenn man nicht an Blutvergiftung sterben will? Wo bekommt man Hilfe, wenn ein Familienmitglied 1798 an einer psychischen Krankheit leidet? Wie reist man sicher? Was zieht man an, wo kommt man unter, was sollte man unbedingt probieren, und wie amüsiert man sich? Ich kann zwar nicht sagen, was Jane Austen über Sie denken würde, wenn Sie im Jahr 1803 an die Tür von 4 Sydney Place, Bath, klopfen würden, doch ich kann eine Idee davon vermitteln, was Sie sehen würden, wenn Sie die Stadt in diesem Jahr besuchten, und was Sie wohl über den Lebensstandard Jane Austens und ihrer Familie denken würden und über den Geist, mit dem sie und ihre Zeitgenossen jeden Tag der Welt entgegentraten.
Hier ist also ein Reiseführer für vier der aufregendsten und kulturell wichtigsten Jahrzehnte der britischen Geschichte. Es war ein Zeitalter der Eleganz und der Gewalt, der Freiheit und des Protests, des altmodischen Heldentums und der Verstädterung. Und es war ein Zeitalter des Krieges: Mehr als die Hälfte dieser Zeit kämpften die Briten gegen die Franzosen. Das Regency sah Feldzüge für Freiheit, politische und gesellschaftliche Reformen und größeres Mitgefühl gegenüber den weniger vom Glück begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft. Es war ein Zeitalter der Industrialisierung, in der Großbritannien zur größten Wirtschaftsmacht der Welt aufstieg. Und es war ein großes Zeitalter der Erfindungen, von der Dampflokomotive zur elektrischen Uhr und der ersten Fotografie. Und natürlich war es eine Zeit, in der Millionen normale Menschen ein normales Leben lebten – darunter auch die, die Mr Puddicombe in seinem Sterberegister aufführte, und der Pfarrer selbst, bis die Sonne schließlich über seiner Welt unterging.
1 Die Landschaft, durch die Sie reisen
Mein Leben in Yorkshire war so weit weg von allem, ja wirklich zwölf Meilen von der nächsten Zitrone entfernt.
Sydney Smith[1]
Sobald sich Ihr Schiff der Südküste Englands nähert, halten Sie sicher unwillkürlich Ausschau nach Land. Wenn Sie von Frankreich her segeln, sind die Kreidefelsen von Dover wahrscheinlich während der meisten Zeit der Überfahrt zu sehen. Wenn Sie aus Amerika anreisen, starren Sie womöglich tagelang auf den Horizont, suchen nach dem blauen Höhenrücken der Südwesthalbinsel und sehen nichts als öden weißen Schaum auf graugrünen Wogen. Allerdings wird die Langeweile nicht Ihre größte Sorge sein. Seeleute wie Passagiere haben Angst, in den Ärmelkanal einzufahren, besonders nach Anbruch der Dunkelheit. Oft fühlt man nur einen Stoß und liegt schon ohne Vorwarnung auf dem Deck, begleitet von ohrenbetäubendem Ächzen, während der Rumpf des Schiffs auseinanderbricht. Nachts sucht man ständig die Dunkelheit ab, während der Wind an den Tauen rüttelt und die Wellen gegen den Bug schlagen. Dann, endlich, sieht man zwei Lichter in der Ferne. Ein Seemann versichert, das seien die Zwillingstürme des Lizard Lighthouse an der Südküste Cornwalls. Und das nächste Licht, so sagt er, wird das vom Eddystone sein, einem Felsen vierzehn Kilometer vor der Küste. »Würden wir näher heransegeln«, erklärt er, »könnten Sie die Lichter von Falmouth und Looe sehen. Östlich davon liegt Plymouth. Und weiter den Ärmelkanal hinauf dann Teignmouth, Dawlish, Exmouth und Sidmouth. Das sieht dann aus, als hätte jemand alle Lampen zur Begrüßung angezündet.«
Dieses Aufleuchten der Küstenstädte ist etwas Neues. In der Mitte des 18. Jahrhunderts hätten Sie nur hin und wieder ein winziges Licht von den wenigen großen Häusern an der Küste wahrgenommen. Jetzt gibt es zum Meer hin ausgerichtete Stadthäuser mit Kronleuchtern in den Salons. Und selbst wenn sie durch Vorhänge oder Fensterläden verdunkelt sind, so sieht man doch die hellen Laternen über den Haustüren. Draußen warten Kutschen mit leuchtenden, hinten verspiegelten Glaslampen. Und vor allem hat um 1800 fast jede größere Stadt mit Öl betriebene Straßenlampen. Einzeln kann man sie vielleicht erst erkennen, wenn man auf zwei oder drei Kilometer herankommt, aber in der Menge sieht man sie schon aus viel größerer Entfernung.[2] Mitte der 1820er-Jahre sind einige Orte an der Südküste sogar schon mit Gas beleuchtet – darunter auch Brighton, Portsea und Dover. Wenn man einen Zeitrafferfilm der englischen Südküste bei Nacht zwischen 1789 und 1830 machen würde, könnte man zusehen, wie Zehntausende Lichter aufflammen und immer heller leuchten, während die Küste allmählich aus der Dunkelheit auftaucht.
Sie sollten ruhig ein bisschen über diese Lichter nachdenken, während Ihr Schiff endlich sicher vor Anker liegt. Sie helfen den Menschen nicht nur, nachts ihren Weg zu finden. Sie bedeuten auch, dass Männer und Frauen nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr zu Hause um das Feuer sitzen, sondern gern ausgehen und sich treffen, trinken, spielen und tanzen, Konzerten lauschen und Theaterstücke anschauen. Ein Lebensstil, den man zuvor nur in den größeren Städten genießen konnte, verbreitet sich jetzt in vielen Kleinstädten überall im Land. Die Menschen sind nicht mehr aufs Tageslicht angewiesen. Viele von ihnen arbeiten auch nachts. Die Kutscher warten, um müde Konzertbesucher nach Hause zu fahren. Bei Straßenhändlern mit heißen Pasteten und anderen Snacks stehen die spätabendlichen Kunden jetzt Schlange. Und die einst so gefährlichen Straßen sind sicherer, weil mehr Leute unterwegs sind. Das Land, das Sie jetzt besuchen werden, ist im wahrsten Sinne »erleuchtet« worden.
Brighton und die Ferienorte an der Küste
Ganz sicher zaubert Ihnen der Anblick ein Lächeln auf die Lippen, wenn Sie an einem Sommermorgen Mitte der 1820er-Jahre nach Brighton hineinreiten. Zunächst einmal sind da die Offiziere der Grenadier-Garde in ihren knallroten Uniformjacken, die zwischen der Stadt und den Kasernen an der Lewes Road unterwegs sind. Dann sehen Sie die Pleasure Gardens zu Ihrer Rechten mit ihrem gotischen Turm, der Voliere, der Grotte, dem Irrgarten, den Spazierwegen, Bowlinggreens, Teegärten und Versammlungssälen. Der Cricket-Pitch schließt sich an, auf dem der König und seine Freunde in ihren jüngeren Jahren spielten. Daneben liegt das Hanover Arms, das, ungewöhnlich für eine Gaststätte, auch über einen offenen Platz für das Ballspiel Fives verfügt. Ein Stück weiter sehen Sie eine riesige Baustelle, aus der die große Kirche St. Peter’s stetig emporwächst. Schon jetzt haben Sie den Eindruck, dass Sie in eine moderne, von Unterhaltung und Wachstum geprägte Stadt kommen.
Reiten Sie noch ein wenig weiter, und Sie werden zu Ihrer Linken Richmond Place entdecken: eine Zeile eleganter vierstöckiger Häuser. Direkt vor Ihnen liegt ein langer, öffentlicher Rasenplatz, eingefasst von einem niedrigen Holzgeländer und an beiden Seiten von hohen Häusern mit Schiebefenstern und überdachten Balkonen gesäumt. Sie können die Hufe Ihres Pferdes auf der Schotterstraße hören, die aufgeregten Rufe spielender Kinder und die Musik aus einem offenen Fenster, hinter dem eine junge Dame beharrlich Klavier übt. Da ist das ferne Hämmern von den Baustellen in den Seitenstraßen und hin und wieder ein Befehl, mit dem ein Diener, der die Hunde seines Herrn ausführt, sie zu bändigen sucht. Gentlemen in Frack und Zylinder gehen vorbei, in Gespräche vertieft. Damen in langen Kleidern schlendern an den Häusern entlang. Eine Postkutsche rast mit ratternden Rädern um die andere Seite des Platzes. Üblicherweise fährt man links, aber es gibt kein entsprechendes Gesetz. Und in Brighton ist genug Platz, vor allem auf so breiten Straßen wie dieser.
Ein paar Hundert Meter weiter öffnen sich die Häuserzeilen noch ein bisschen mehr und rahmen einen weiteren großen Rasenplatz ein. Links von Ihnen verläuft die Grand Parade mit ihren vierstöckigen, ganz unterschiedlich aussehenden Luxusgebäuden: Manche sind mit Feuerstein verkleidet, andere mit Stuck oder Ziegeln und wieder andere mit sogenannten mathematischen Fliesen, die wie Ziegel aussehen sollen. Die meisten haben Erkerfenster mit jeweils einem Dutzend oder mehr Glasscheiben. Ein paar sind noch im Bau: Männer klettern auf Holzgerüsten herum, ziehen mit Winden und Flaschenzügen Mörteleimer hinauf. Trotz des Sammelsuriums von Fassaden wirkt jede einzelne elegant. Sie sehen aus wie reiche Zuschauer hinter den Absperrungen am Zieleinlauf eines Rennens, die alle begierig auf den Sieger warten.
Die »Ziellinie« in unserem Fall ist der Royal Pavilion auf der anderen Seite des Rasens – eine extravagante Mischung aus cremefarbenem Stuck und Minaretten, zeltähnlichen Dächern und Zwiebeltürmen, mit indisch inspirierten Brustwehren, gotischen Bögen und maurischen Arkaden. Vom Torhaus im Mogulstil bis zu den klassischen Säulen wirkt der Palast wie eine chaotische Mischung der besten und schlimmsten Stile dreier Kontinente – aber gleichzeitig sieht jeder Teil so aus, als sei er genau so gewollt. Nichts daran ist schludrig, auf den reinen Nutzen ausgelegt oder selbstgefällig traditionell. Er nimmt seinen Platz selbstsicher ein und kündet jedem Betrachter von seinem reichen, mächtigen, exzentrischen und in seinen Ansprüchen völlig unmäßigen Besitzer. Nachts werden die Fassaden von Gaslichtern beleuchtet, die ihn modern und gleichzeitig fremd erscheinen lassen. In Brighton wirkt er fehl am Platze – wo auch nicht! –, aber genau das will George IV. Natürlich finden ihn nicht alle schön. Der deutsche Fürst Hermann Pückler-Muskau, der im Februar 1827 vorbeischaut, schreibt, der König überlege, das Sammelsurium wieder einreißen zu lassen, »was auch eben nicht sehr zu bedauern seyn würde«.[3] Und doch – es ist der Inbegriff alles Exotischen in der britischen Architektur.
Anders als in vielen anderen britischen Städten ist das Herz Brightons kein Rathaus und keine Burg, kein Marktplatz und keine große Kirche. Es ist vielmehr dieser unregelmäßige Rasenfleck, auf dem Sie jetzt stehen und der »Steine« genannt wird. Schauen Sie sich um: Nicht nur der Royal Pavilion ist auf diesen Platz ausgerichtet, sondern auch viele Häuser des Adels. Eine breite Straße führt rundherum, auf der die Menschen ihre schönsten Kleider ausführen. Aus der Art, wie die Spaziergänger und Reiter einander mustern, können Sie schließen, dass dies der Ort ist, um zu sehen und gesehen zu werden. Offiziere begutachten interessiert die jungen Demoiselles, die hier unter den wachsamen Augen ihrer Anstandsdamen promenieren. Gut gekleidete junge Lebemänner erregen die Aufmerksamkeit der Damen, die im Stillen hoffen, dass einer von ihnen die Kühnheit besitzen wird, sie zu einem Ball einzuladen. Hier finden Sie auch viele Annehmlichkeiten der Reichen und der Leute mit Beziehungen: Kaffeehäuser, Badehäuser und die besten Bibliotheken. Und dann gibt es noch die stramme Reihe der Prominentenhäuser. In einem wohnt sogar seit 1804 Mrs Fitzherbert, die inoffizielle Gemahlin des Königs. Das ganze Gelände wirkt wie ein Dorfplatz, bevölkert von den Reichen und Berühmten, mit dem einen oder anderen eleganten Abenteurer oder verführerischen Glücksritter dazwischen.
Zweihundert Meter weiter liegt Brightons Quelle des Wohlstands: das Meer. Wenn Sie an die Küste kommen, fällt Ihnen sicher eine mit aufwendigen Eisentoren geschlossene Wagenzufahrt ins Auge. Das ist der Zugang zum Royal Chain Pier, der 1823 eröffnet wurde und sich mehr als dreihundert Meter weit über die Wellen ins Meer erstreckt.[4] Der neun Meter breite Steg hängt an vier hohen gusseisernen Türmen und endet in einer Anlegestelle aus Stein, von der aus man die Dampfschiffe besteigt, die täglich nach Dieppe fahren.
Selbst wenn Sie nicht ins Ausland reisen, empfehle ich Ihnen, die zwei Pence Eintritt zu investieren und den Pier entlangzuspazieren. In den Türmen finden Sie Stände, in denen Sie Drucke der Stadt, exotische Muschelschalen oder ein Camera-Obscura-Bild von sich selbst kaufen können. Wenn Sie aber am Ende des Piers umdrehen und wieder die Häuserfront an der Küste im Blick haben, wird sich Ihr Amüsement angesichts der aufkeimenden Souvenirindustrie in Verblüffung verwandeln. Die Häuser ziehen sich in jede Richtung eine Meile an der Küste entlang und sind architektonisch ebenso beeindruckend wie die schönsten Londoner Plätze. Rechts vom Pier sehen Sie die Marine Parade, die mit einer Reihe bezaubernder Pensionen beginnt und sich in einer Zeile sehr beeindruckender Wohnhäuser fortsetzt. Dort finden Sie die Wohnsitze des Marquess of Bristol, des Duke of Devonshire und der Countess of Molande in Brighton. Links vom Pier zieht sich eine andere lange Reihe prächtiger Häuser die Küste entlang. Hier wohnen die Duchess of St. Albans, die Countess of Aldborough, der Earl of Munster und eine ganze Reihe Ritter, Damen, Baronets und pensionierter Admiräle und Generäle.
Ihnen wird es wahrscheinlich ganz normal erscheinen, dass die meisten dieser großen Häuser zum Meer hin ausgerichtet sind – doch noch vor wenigen Jahrzehnten wäre dies der allerletzte Ort gewesen, an dem die Reichen und Eleganten hätten leben wollen. Das Meer wurde als Bedrohung wahrgenommen, es brachte Invasoren und schlechtes Wetter. Nur wer musste, lebte an der Küste. In den meisten Hafenstädten wohnten Kaufleute und Hafenarbeiter, Fischer und Netzmacher, Schiffszimmerleute, Hilfsarbeiter und ihre Familien. Im 18. Jahrhundert jedoch begann sich das zu ändern. Ärzte empfahlen immer häufiger, im Meer zu baden und Meerwasser zu trinken. Also packten die Reichen ihre Taschen und begaben sich an die Küste, um ihre Leiden zu lindern. Sie versammelten sich an ein paar bevorzugten Orten, in denen sie während ihrer Meerwasserbehandlung ihre gesellschaftlichen Kontakte pflegen konnten.
Der erste dieser Kurorte, der schon in den 1730er-Jahren an Popularität gewann, war Scarborough in Yorkshire; bald folgten Brighton, Hastings, Margate und Weymouth. 1750 veröffentlichte Dr. Richard Russell einen überraschenden Bestseller über die Meerwasserbehandlung von »Drüsenkrankheiten«, in dem er den gesundheitsfördernden Eigenschaften des Meerwassers bei Brighton besondere Aufmerksamkeit widmete. Drei Jahre später baute er ein großes Haus mit Sprechzimmer an der Küste, und die Patienten kamen in Scharen. Sie kommen noch heute, obwohl er schon lange tot ist. Besuchen Sie die Stadt im Jahr 1789, und Sie werden feststellen, dass sich die Einwohnerzahl seit Dr. Russells Zeit auf etwa 4000 verdoppelt hat. Kommen Sie 1801 noch einmal, und sie liegt laut Zensus schon bei 7339 Einwohnern. Noch einmal drei Jahrzehnte lang wächst sie in diesem Tempo und ist damit die britische Stadt mit dem größten proportionalen Bevölkerungszuwachs in dieser Zeit. 1830 wohnen mehr als 40 000 Menschen dort, zehnmal so viele wie 1789 – eine gewaltige Entwicklung: Jetzt tut die Oberschicht, die das Meer früher nach Möglichkeit mied, alles, um mit Seeblick zu wohnen – was dazu führt, dass nur noch die Reichsten sich das leisten können.
Die Altstadt – das ursprüngliche »Brighthelmstone«, wie es hieß, bevor die Vermögenden kamen – steht noch, umrahmt von North, East und West Street. Hier sind die Häuser ganz anders gebaut als an der »Steine« oder an der Küstenfront und den Plätzen dort. Die neuen Teile der Stadt sind offen, hell und geräumig, die Altstadt aber ist eng, dunkel und vollgestopft. Die Gassen sind meist von kleinen Fachwerkhäusern mit Hinterhöfen gesäumt, die im Erdgeschoss einen Laden beherbergen. Darüber wohnt die Familie. Hier findet man Schneider, Wollhändler, Bootsbauer, Möbelschreiner, Tee- und Kohlenhändler, Apotheker, Metzger, Pastetenbäcker, Krämer und viele andere Gewerbe. Auch einige exquisitere Unternehmen sind hier untergebracht – Banken, Juweliere und Waffenschmiede. Wenn man die alten Fischer, Netzmacher und Arbeiter dazurechnet, lebt in den 1820er-Jahren noch immer etwa ein Drittel der Bevölkerung in der Altstadt.[5]
In dieser Stadt gibt es also, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, alles, was das Herz begehrt. Haben Sie vielleicht Lust auf ein Türkisches Bad? Dann statten Sie doch Mahomed’s Warm, Cold and Vapour Baths an der Seepromenade einen Besuch ab.[6] Frischer Fisch? Unten am Strand wird jeden Morgen der Fang von etwa hundert Booten angeboten, die jetzt auf den Kies gezogen sind. Wie wäre es mit einer kleinen Pferdewette? Oben auf dem Hügel östlich der Stadt finden Sie die Pferderennbahn von Brighton. Und wenn Sie sich austoben wollen, gibt es einen Tennisplatz – für »echtes Tennis« natürlich, die traditionelle Version auf einem ummauerten Platz. Vielleicht steht Ihnen der Sinn eher nach Schwimmen? Es gibt hier mehr als genug Badekarren zu mieten – Holzhütten auf hohen Rädern, die von Pferden ins brusttiefe Wasser gezogen werden. Sie kleiden sich darin um und springen dann im Badeanzug, der bei Frauen einem langen Kleid und bei Männern einer Unterhose ähnelt, in die Fluten. Wenn Sie mehr Spaß am Tanzen haben, besuchen Sie vielleicht einen Ball in den Versammlungsräumen am Ende der Ship Street; dort gibt es auch Tische für Kartenspiele, wenn es Sie danach gelüstet. Wer sexuelle Verlockungen sucht, findet Frauen mit bezahlbarer Tugend in den Straßen rund um Upper Furlong im Norden der Altstadt. Und für die Hochkultur steht ein schönes, neues Theater zwischen North Street und Church Street bereit, mit Logen in zwei Rängen und einer großen Galerie. Dort finden von Ende Juli bis Ende Oktober dienstags, mittwochs, freitags und samstags Aufführungen statt. Die Karten kosten fünf Shilling für einen Logenplatz, drei fürs Parkett und einen für die Galerie.[7]
Nun ist Brighton dank der vielen Adligen und der königlichen Patronage nicht unbedingt eine typische Küstenstadt. Aber es ist Vorbild für viele andere. Neben den ursprünglichen fünf Erholungsorten könnten Sie in den 1820er-Jahren auch Ramsgate in Kent, Worthing in Sussex oder ein anderes »Bad« an der Küste von Devon besuchen: Sidmouth, Teignmouth, Exmouth und Dawlish, um nur die bekanntesten zu nennen. Einige sind seit Jahrzehnten langsam gewachsen. Der Reverend John Swete reist 1795 durch Süddevon und bemerkt, dass »Sidmouth der fröhlichste Erholungsort an der Küste von Devon ist. Jede vornehme Eleganz, jeder Luxus, jedes Amüsement ist hier anzutreffen – Eiscreme, Hutmacherläden, Karten, Billard, Spiele [und] Leihbüchereien«. In Bezug auf Dawlish schreibt er:
Vor etwa zwanzig Jahren lag der Preis für die beste Herberge bei nicht mehr als … einer halben Guinee die Woche, doch heute ist Dawlish so in Mode, dass man in der Hochsaison nicht einmal das geringste Haus für weniger als zwei Guineen die Woche mieten kann, und viele von ihnen kosten vier oder fünf.[8]
Trotz dieser frühen Entwicklungen an der Küste läutet erst die endgültige Niederlage Napoleons in der Schlacht von Waterloo 1815 die Hochzeit der Küstenstädte ein. Sie nehmen den großen Zustrom wohlhabender Londoner auf, die jeden Sommer an die See fahren. Die vierundsiebzig kleinen Rundforts an der Südküste, die das Land im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts vor einem Eindringen der Franzosen schützen sollten – die sogenannten Martello-Türme –, scheinen plötzlich aus grauer Vorzeit zu stammen. Jetzt lieben die Menschen das Meer, die Angst ist verschwunden. Und die Liebe wird immer stärker: 1830 hat sich das Zentrum Brightons allmählich von der »Steine« weg zur Küste, der »New Steine«, verlagert. Wenn die eleganten Bewohner der Stadt einen großen Anlass wie etwa einen königlichen Geburtstag feiern wollen, lassen sie den Himmel mit einem gewaltigen Feuerwerk an der Küste erstrahlen und beleuchten den Royal Chain Pier mit Tausenden Öllampen, die von weit draußen zu sehen sind.
Größere Städte
Als der junge deutsche Philosoph Karl Philipp Moritz in den 1780er-Jahren zum Wandern nach England kommt, schreibt er in sein Tagebuch: »Ich hatte nun nur noch einige Meilen bis Nottingham, das ich gegen Mittag erreichte. Dies schien mir unter allen Städten, die ich außer London gesehen habe, die schönste und netteste zu sein.«[9] Das klingt zunächst vielleicht überraschend und würde einem nicht auf Anhieb einfallen, doch eigentlich könnte man praktisch jede Stadt in Großbritannien für ihre Regency-Architektur rühmen. Schlichtweg jede Stadt wächst. Die 77 größten Orte des Jahres 1801 – diejenigen mit einer Einwohnerzahl von 7000 oder mehr – erleben in den nächsten 30 Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 83 Prozent. 23 verdoppeln ihre Einwohnerzahl, und bis auf zwei wachsen alle um mindestens ein Drittel.
Sie können sich vorstellen, dass dieses Wachstum auch starke Auswirkungen auf die Landschaft hat. Großbritannien war immer eine relativ ländliche Insel, doch vom späten 18. Jahrhundert an führt das massive Bevölkerungswachstum zu einem großen Umschwung. Wenn man alle Kleinstädte mit mindestens 2500 Einwohnern einbezieht, leben 44 Prozent der Menschen 1831 in einer Stadt.[10] Und in diesen Städten wird jetzt ständig gebaut, mit einer Unmenge neuer Straßen und Baustellen, die zwischen den älteren Häusern aus dem Boden schießen. Hunderttausende Hektar Ackerfläche werden diesem Wachstum und der dazu nötigen Infrastruktur geopfert.
Natürlich wollen jetzt all diese wachsenden Gemeinschaften ihre Versammlungsräume, Theater, Postämter, Konzerthallen, Arbeitshäuser, Krankenhäuser und Bibliotheken haben. Wo vorher vielleicht eine große Kirche allen Einwohnern genügt hat, ist das bei mehr als zehntausend Menschen kaum noch praktikabel. 1818 beschließt die Regierung das Kirchenbaugesetz, das einer Kommission eine Million Pfund für neue Kirchen zur Verfügung stellt.
Aufgrund der immer größeren religiösen Toleranz sehen auch viele nicht konformistische Gemeinden die Möglichkeit, eigene Gotteshäuser zu errichten. Bristol hat 1830 zum Beispiel seine Kathedrale und einundzwanzig weitere anglikanische Kirchen und Kapellen, dazu vier baptistische, sieben unabhängige und sechs methodistische Kapellen und fünf Kapellen für kleinere Glaubensgemeinschaften; eine walisische Kapelle, eine römisch-katholische, ein Versammlungshaus der Quäker und eine Synagoge.[11]
Abgesehen von den vielen neuen Häusern, Kirchen und Kapellen verändert sich die urbane Landschaft auch dadurch, dass viele Kleinstädte ein Ausbaugesetz bekommen, das dem Stadtrat erlaubt, lokale Bevollmächtigte zu ernennen, um die Kanalisation, die Pflasterung der Straßen, die Sicherheit und die Beleuchtung der Stadt zu verbessern, und in einigen Fällen sogar, um Häuser abzureißen und die Straßen zu verbreitern. In Birmingham kaufen die Bevollmächtigten die Rechte des Grundherrn auf, um dann den Hauptmarkt zu verlegen. Wenn man gerade ein hübsches neues Haus im Stadtzentrum gekauft hat, will man schließlich nicht unbedingt Hunderte grunzende, muhende und blökende Tiere vor der Haustür, inklusive all der Gerüche, der Mist- und Strohhaufen, die sie so mit sich bringen.
Gleichzeitig können sich aufgrund der wachsenden Bevölkerung mehr spezialisierte Gewerbe wie Hutmacherinnen, Optiker, Buchhändler und Juweliere etablieren, und diese verdrängen die traditionellen Händler allmählich aus den Stadtzentren. Besucher erwarten immer öfter eine High Street, eine breite, gerade Durchgangsstraße für Kutschen, Karren, Reiter und Fußgänger, gesäumt von Läden mit eleganten Fertigwaren im Angebot. Wacklige Marktstände und Tierpferche wollen sie dort nicht sehen.
Städte mit verwinkelten Gassen, engen Straßen und Märkten im Stadtzentrum gelten als alt und schmutzig. Die Stadtväter öffnen sich daher der Moderne, sie reißen Altes ein und bauen aufsehenerregende, prächtige Architektur. Alle sieben mittelalterlichen Stadttore Exeters werden zwischen 1769 und 1825 niedergerissen, um die Hauptstraßen zu erweitern. Bürgermeister und Stadtrat lassen auch den großen Kanal in der Stadtmitte wegreißen, der jahrhundertelang Wasser geliefert hat. Die offenen Abflüsse, die in der Mitte der Straßen liefen, ersetzen sie durch leicht gewölbte Oberflächen, die nach den Seiten hin entwässern. Von der großen Kathedrale einmal abgesehen, wendet Exeter der Vergangenheit den Rücken zu und ist vielmehr sehr stolz auf seine modernen öffentlichen Gebäude: Versammlungsräume, Ballsaal, Kartenspielsaal, Hotel, Bibliotheken, Postamt, Badehaus, Gefängnis, Gerichte, Krankenhaus, öffentliche Arzneiausgabe, Augenklinik, Irrenhaus, Oberschule, Kasernen und Theater.
Im Jahr 1800 haben die meisten Kleinstädte in regelmäßigen Abständen an den Hauptstraßen Öllampen angebracht. An den vornehmsten Straßen in einem eleganten Ort wie Bath stehen Glaskugeln auf Eisensäulen, in denen Rapsöl brennt.[12] Glasgow beginnt seine Straßenbeleuchtung im Jahr 1780 mit neun Öllampen am Trongate; 1815 ist die Gesamtzahl der von städtischen Behörden unterhaltenen Lampen auf 1274 gestiegen.[13] Danach wird vor allem Gas eingesetzt. 1830 hat mehr als die Hälfte der größten Städte Großbritanniens wenigstens ein Gaswerk, um Straßen, öffentliche Gebäude und Geschäftsräume zu beleuchten. Wer keines hat, wie etwa Plymouth und Newcastle-on-Tyne, ist weiter von Öllampen abhängig, die bis in die 1840er-Jahre an Eisengestellen an den Straßenecken hängen.
Wenn Sie sich diese großen Städte einmal näher anschauen, erkennen Sie, wie unterschiedlich sie sind. Nehmen wir zum Beispiel Liverpool. Wie Brighton liegt es am Meer, an der Ostseite der großen Trichtermündung des Mersey. Wie Brighton ist es im letzten Jahrhundert gewaltig gewachsen. 1700 hatte es nur etwa 5000 Einwohner, doch dann verdoppelte sich die Bevölkerung alle fünfundzwanzig Jahre. Grund dafür ist die Ausweitung des Atlantikhandels, vor allem mit Zucker, Baumwolle und Tabak. Das hat zu beträchtlichen Investitionen in die Docks geführt, die jetzt allen, die sie besuchen, Respekt abnötigen.
Das Rathaus in der Dale Street im Zentrum ist ein prächtiges Gebäude, errichtet von John Wood in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Hinter dem Rathaus liegt die Börse: ein großer Hof mit einem Laubengang ringsum, in dem sich Kaufleute treffen und miteinander handeln. Hier befinden sich auch die Versammlungsräume und der Sitzungssaal des Stadtrats. Die Stadt boomt so sehr, dass die Bank von England hier 1827 eine Zweigstelle eröffnet. Zu der Zeit sind die Felder im Südosten des Zentrums schon mit langen Reihen eleganter Stadthäuser und Plätze überbaut. Wenn Sie eine der breiten Avenuen entlangspazieren, werden Sie glauben, dass Liverpool ebenso reich wie Brighton ist. Verlassen Sie allerdings dieses Viertel, werden Sie bald merken, dass die beiden Städte eigentlich wenig gemeinsam haben. Brighton ist ein Ort der Unterhaltung, der Gesundheit und des Luxus, er spiegelt die Vorlieben der Reichen wider; Liverpool dagegen ist ein Ort des Handels und der Arbeit, der die Ambitionen der Geschäftsleute und die alltäglichen Mühen der Armen reflektiert.
Nichts, was Sie je in Großbritannien gesehen haben, kann Sie auf die erbärmlichen Zustände in den ärmsten Vierteln im Liverpool des Regency vorbereiten. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in Kellern, Höfen oder »Hinterhäusern«. Das sind Reihen kleiner Gebäude hinter den Häusern, die zur Straße hin ausgerichtet sind. Ein schmaler Gang führt von der Straße durch das Haus in eine Gasse oder einen »Hof«, der drei bis vier Meter breit ist. Hier stehen sich zwei Reihen von Ziegelhäuschen gegenüber, mit gemeinsamen Latrinen ganz hinten. Wir werden noch sehen, wie es ist, an solchen Orten zu leben – in Kapitel 8, »Wo Sie Unterkunft finden«, obwohl es hier besser heißen sollte »Wo Sie keine Unterkunft suchen sollten« –, doch um das städtische Umfeld zu beschreiben folgt eine kurze Schilderung, was Sie hören, sehen und riechen werden, wenn Sie durch Liverpool gehen und einen dieser Höfe betreten.
Zuallererst wird Ihnen der Lärm auffallen. Die extrem dichte Bebauung ohne jede Privatsphäre führt dazu, dass die Luft ständig von Kreischen und Lachen erfüllt ist. Babys schreien und Kinder weinen, Flüche, Beleidigungen und Drohungen klingen durch die Fenster und quer über die Straßen. Was für ein Gegensatz zur »Steine« in Brighton mit ihren Klavierübungen und Dienern, die die Hunde ihrer Herren ausführen! Viele Straßen sind noch nicht gepflastert, der Schlamm oder Schotter mischt sich mit Pferdeäpfeln. Nur einmal in der Woche kommen die Straßenkehrer, die den Mist und Dreck beseitigen.
Aus der Sicht eines Fußgängers sind die Straßen von Liverpool selbst in den ärmsten Vierteln ziemlich breit. Erst wenn man sie verlässt, landet man im Dunkeln. Die Tunnel zu den Höfen sind so lang, wie die Vorderhäuser tief sind. Wenn Sie wieder ans Tageslicht kommen, haben Sie das Gefühl, durch eine Höhle gekrochen zu sein. Und dann erschlägt Sie der Gestank.
Die Meeresbrisen, die die Wohlhabenden Liverpools mit der gesundheitsfördernden Wirkung der Stadt verbinden, erreichen die stinkende Luft hier nie. Die Höfe sind nicht gepflastert, und sie werden auch nicht von den Straßenkehrern gefegt. Abwasserrinnen sind selten, denn die Bauunternehmer wie auch die städtischen Behörden gehen davon aus, dass der Regen schon alles Stinkende und Eklige den Tunnel hinab auf die Straße schwemmen wird. Doch der medizinische Untersuchungsbeamte Dr. Lyon Playfair muss noch 1845 feststellen:
In zahllosen Fällen sind Höfe und Gassen ohne jede Neigung zur Entsorgung des Oberflächenwassers gebaut worden. Viele sind ohne Abwasserkanäle angelegt, und während der dort weggeworfene feste Abfall an der Oberfläche verrottet, versickern die Flüssigkeiten, und viel davon findet seinen Weg in die bewohnten Keller der Höfe. Der Norden der Stadt ist voller Gruben mit übel riechendem, stehendem Wasser, die Unmengen Fauliges aufnehmen, das ständig dort hineingeworfen wird, wie etwa tote Tiere und die Abwässer der Stärke- und anderer Fabriken; und bei warmem Wetter ist der Gestank, der von diesen Orten ausgeht, oft unerträglich.[14]
Auch der Regen läuft in die Sickergruben, und nach einem schweren Schauer steigen die Wasserspiegel, sodass die Exkremente, verwesende Fleischabfälle und andere unappetitliche Dinge hervorquellen. Normalerweise hat ein Hof mit sechzehn Häusern zwei Toiletten für um die achtzig Menschen, aber es ist durchaus möglich, dass sich auch mal zwanzig Menschen ein solches Haus teilen, sodass zwei- oder dreihundert Menschen mit den beiden Toiletten auskommen müssen. Dann muss die einzige Sickergrube enorme Mengen Unrat schlucken.[15] Außerdem berichtet Dr. Playfair:
Die Toiletten, oft ohne Türen und von beiden Geschlechtern zu benutzen, müssen den Sinn für Schicklichkeit und Anstand empören, wenn sie nicht sogar zu Unzucht führen. Es ist nicht unüblich, dass die Aborte ohne Türen gebaut werden, mit der Entschuldigung, dass, wenn man sie anbrächte, sie als Feuerholz weggerissen würden …
1790 gibt es schon 1608 solche Hinterhofhäuser in Liverpool, in denen vor allem zugewanderte Arbeiter aus Lancashire, Irland und Wales leben.[16] Diese Zahl steigt immer weiter, 1830 sind es achtmal so viele, in denen mehr als 70 000 Menschen in einem armseligen Durcheinander aus elender Düsternis und atemberaubendem Gestank leben. In der Crosbie Street gibt es 1790 insgesamt 61 Vorderhäuser und 84 Hinterhofbehausungen mit weiteren 42 Kellern darunter. In den Vorderhäusern wohnen 360 Menschen, in den Hinterhöfen 434 und noch einmal 181 in den Kellern. Das sind insgesamt 975 Menschen in 145 Häusern – was einer Bevölkerungsdichte von fast 2000 Menschen pro Hektar entspricht und eine der dichtesten Besiedlungen weltweit darstellt. Unglaublicherweise wächst die Einwohnerzahl weiter bis auf über 3200 Menschen pro Hektar.[17]
Im Allgemeinen bieten die schnell wachsenden Industriestädte sehr wenig Infrastruktur. In Liverpool gibt es Büchereien und Versammlungsräume für die Reichen und neu errichtete Kirchen für die Frommen, aber keine öffentlichen Parks. Die großen Gemeinschaftsgärten sind in Privatbesitz, man muss regelmäßig bezahlen, um einen Schlüssel zu bekommen. Die einzigen wirklich öffentlichen Bereiche sind die Straßen mit ihren vielen Pferdewagen. Kein Wunder also, dass viele Menschen der Arbeiterschicht ihre Zeit in den Kneipen verbringen. Man sieht hier auch keine öffentlichen Brunnen, kein öffentliches Badehaus. Wenn Sie baden wollen, müssen Sie dafür auf »die Flussufer am Nord- und Südende der Stadt« zurückgreifen.[18] Der Mersey mag lang sein, aber alle Abwässer werden in ihn eingeleitet, und der gesamte Dreck aus der Industrie landet ebenfalls dort. Und da wir gerade von Kanalisation sprechen: Die Behörden erheben zwar Gebühren für die Kanalisation, doch diese reicht nur so weit wie die Adressen der Reichen. Gleiches gilt für die Wasserversorgung: Kaum ein Hinterhof hat Wasser aus dem Hahn. Es ist einfach entsetzlich – und eine schwer erträgliche Lektion dazu, was passiert, wenn man die Stadtplanung den Geschäftemachern überlässt.
Was denken die Zeitgenossen über Liverpool? Die meisten wohlhabenden Bewohner werden Ihnen wohl erklären, dass es eine nach vorn schauende, fortschrittliche, moderne Stadt ist; sie waren wahrscheinlich noch nie in der Crosbie Street, geschweige denn in ihren Hinterhöfen. Die Besucher sind geteilter Meinung. Für Reverend Nathaniel Wheaton, der 1823 aus Amerika zu Besuch kommt, ist Liverpool eine »Stadt der Docks, der fetten Männer und fetten Frauen, des Kohlenqualms, der dreckigen Straßen, des Gusseisens, des Mammons und des Schlamms«.[19] Auch Robert Southey bemerkt, dass »die Außenbezirke von Liverpool ein unansehnliches Aussehen haben: neue Straßen mit Häusern für die ärmeren Schichten, die weder Sauberkeit noch Komfort erkennen lassen, Felder, aufgerissen für die Fundamente weiterer Bauten, Ziegeleien und Brennöfen, die allerseits rauchen«.[20]
Andere übersehen den Dreck und die Armut völlig. Der Franzose Louis Simond, der 1810 hierherkommt, nachdem er zwanzig Jahre in Amerika verbracht hat, zieht einen positiven Vergleich zu New York.[21] In seinen Augen sind Liverpools öffentliche Gebäude zahlreicher und in ihrer Architektur ansprechender, und er zeigt sich beeindruckt von den Lagerhäusern, von denen manche dreizehn Stockwerke hoch sind. Zu den Lebensbedingungen der Arbeiter sagt er nichts. Auch der Schweizer Industrielle Hans Caspar Escher schreibt 1814 nur Positives über die »ziemlich regelmäßige« Stadt.[22] Das zeigt, dass die Eindrücke der Menschen häufiger von dem geprägt sind, was sie sehen wollen, als von dem, was tatsächlich da ist.
Auch in anderen Industriestädten werden Sie feststellen, dass die Umwelt immer stärker durch Produktionsprozesse in Mitleidenschaft gezogen wird. Dazu gehören vor allem die Industrieabfälle. Aber die Menschen halten in den Hinterhöfen der wuchernden Städte auch Tiere, die sie sogar direkt vor Ort schlachten. In Birmingham, der Stadt mit den größten Fabriken Großbritanniens, gibt es gleichzeitig 1600 Schweineställe.[23] In Bristol kann man die niedrigen Hygienestandards am Kommentar eines Ladeninhabers gegenüber einem medizinischen Untersuchungsbeamten ablesen. Über den Hof hinter seinem Haus, auf dem sein Nachbar aus Irland importierte Schweine schlachtet, gibt er zu Protokoll:
Oft sterben die Tiere beim Transport im Schiff, und ich habe gesehen, wie bis zu dreißig tote Schweine in einem Schwung in den Hof gebracht wurden. Sie werden unter das Schuppendach dort geschmissen, bis man Zeit hat, sie aufzuschneiden, und dann habe ich schon gesehen, dass die Maden richtig aus ihnen herausfallen. Dann werden sie aufgeschnitten und, glaube ich, zu gesalzenem Speck verarbeitet oder für Würste verkauft. Die Eingeweide solcher Schweine sind meist zu verwest, um von Nutzen zu sein, und sie werden auf den Misthaufen geworfen. Wenn der Misthaufen beim Abtransport aufgewühlt wird, oh!, Sir, ist der Geruch furchtbar. Wir müssen alle unsere Fenster und Türen schließen und Stofffetzen in die Schlüssellöcher stopfen, doch auch das hält den Gestank nicht draußen. Die Eingeweide der Schweine, die im Hof getötet werden, werden gekocht und verkauft und geben einen sehr üblen Geruch ab, aber das ist nichts im Vergleich zu den anderen.[24]
Aber auch die industrielle Luftverschmutzung kann überwältigend sein. 1802 schildert Robert Southey den folgenden Blick auf Birmingham:
Eine schwere Rauchwolke hing über der Stadt, über der an vielen Stellen schwarze Rauchsäulen mit ungeheurer Kraft von den Dampfmaschinen aufstiegen … Überall um uns herum war statt der Dorfkirche, deren Turm gewöhnlich so schön die englische Landschaft schmückt, der Turm irgendeiner Fabrik in der Ferne zu sehen, Flammen und Qualm spuckend und alles ringsum mit ihren metallischen Dämpfen zugrunde richtend. Die Gegend war so dicht bevölkert wie London. Statt hübscher Häuschen sahen wir Straßen aus Backsteinhäuschen, ganz schwarz vom Rauch der Kohlefeuer, die in diesen trostlosen Regionen Tag und Nacht brennen. Solche Schwärme von Kindern habe ich an keinem anderen Ort je gesehen, und auch nicht so elende, in Lumpen, die Haut verkrustet mit Ruß und Dreck. Das Angesicht des Landes war, als wir weiterfuhren, scheußlicher, als man es beschreiben kann, ungepflegt, schwarz und qualmend.[25]
Ähnliche Anblicke werden Sie in vielen anderen Industriestädten finden. Das ganze Gebiet rund um Swansea leidet unter dem »Kupferrauch«, den die mit Kohle befeuerten Öfen ausstoßen. Die Leute dort wissen nicht, was das eigentlich ist – und ich würde Ihnen nicht raten, ihnen zu erklären, dass bei der Verhüttung Schwefeldioxid und Wasserstofffluorid freigesetzt werden, die mit der Luftfeuchtigkeit reagieren und Schwefelsäure bilden, den »sauren Regen«, wie wir ihn nennen –, aber sie wissen, dass die Kupferwerke die Ursache sind und dass deshalb in ihren Gärten nichts mehr wächst.[26]
Wer in der Nähe eines Gaswerks wohnt, kann die Wäsche nicht draußen trocknen, weil Ruß herabregnet, und der Schwefelgeruch, wenn es »ablässt«, ist ekliger als der Gestank verwesender Kadaver. Und dann gibt es noch das Kalkwasser, das bei der Gaswäsche entsteht. Wenn die Gasunternehmen es in die Flüsse laufen lassen, tötet es alle Fische.[27]
Und da wir gerade von Rauch sprechen: Eines der auffälligsten Merkmale der Zeit ist der enorm schnelle Übergang zur Dampfkraft. 1789 hat Manchester ein Dutzend Mühlen, die alle von Wasser angetrieben werden. Noch 1801 gibt es nur 42 große Mühlen, und sie sind alle wassergetrieben. Die erste erfolgreiche Baumwollfabrik mit Dampfantrieb wird erst 1806 gebaut. Doch dann schießen in nur zwölf Jahren mehr als 2000 dampfgetriebene Baumwollmühlen aus dem Boden.[28] In den 1830er-Jahren stehen in Manchester und Salford 6000 Baumwollspinn- und Webmühlen, 1200 Bleich- und Färbemühlen, 700 Gießereien und Industriemühlen und fast 2000 andere Mühlen mit verschiedenen Aufgaben – alle dampfgetrieben.
Zu jedem einzelnen dieser 10 000 Betriebe gehört ein hoher Schornstein, und Sie können sich vorstellen, wie der Rauch in einer großen dunklen Wolke darüber hängt. Manche Fabriken entlang des Rochdale-Kanals sind riesige, achtstöckige Ziegelbauten, mehr als dreißig Meter hoch und fast hundert Meter lang und voller Arbeiter. Über tausend Menschen sind allein in den McConnel & Kennedy Mills beschäftigt. Künstliche Beleuchtung – einschließlich der 1500 Gasleuchten, die 1809 allein in einem einzigen Gebäude installiert wurden – führt dazu, dass das dumpfe Geräusch der Dampfmaschine die ganze Nacht zu hören ist.
Jede romantische Vorstellung davon, dass diese Bauten womöglich »die Kathedralen ihres Zeitalters« seien, verschwindet auf der Stelle, wenn Sie den Lärm, die Gerüche und den Schmutz wahrnehmen, die sie begleiten. Die großen Kirchen des Mittelalters wurden zum Ruhm Gottes und zum Wohle der Seelen ihrer Besucher gebaut: Sie versprachen Erlösung und ewigen Frieden. Diese gewaltigen, Ehrfurcht erregenden Bauwerke dagegen wurden um des Profits, nicht des Ruhmes willen gebaut, und obwohl sie vielen Männern, Frauen und Kindern Arbeit geben, bieten sie den Körpern derjenigen, die dort vierzehn Stunden täglich schuften, sicherlich keine Wohltaten, von ihren Seelen ganz zu schweigen.
Kleinstädte und das Land
Wie die großen Städte unterscheiden sich auch die kleinen, was Eleganz und Wohlstand angeht. Manche wachsen massiv und halten alle möglichen Freizeiteinrichtungen vor, etwa ein Theater, Versammlungsräume und eine private Bücherei; andere verändern sich kaum und bewahren sich ihren ländlichen Charakter. Axminster in Devon hat im Jahr 1801 genau 2154 Einwohner und 30 Jahre später auch nur 2719: ein Zuwachs von gerade einmal 26 Prozent. Die Häuser dort sind alt, die Straßen mit Kutschen mühsam zu befahren. Ironischerweise ruft diese Unterentwicklung mehr Kritik auf den Plan, als sie im Allgemeinen die auswuchernden Städte mit ihrem wabernden Qualm trifft. Der Londoner Arzt George Lipscomb, der 1798 auf seinem Weg nach Cornwall durch die Stadt kommt, schreibt später: »Axminster ist eine überaus armselige Stadt. Die Häuser sind sehr schäbig und viele von ihnen mit Reet gedeckt … Alle Straßen sind eng, verwinkelt und im höchsten Grade unangenehm und abstoßend.«[29] Etwas diplomatischer beschreibt der Verfasser des Pigot’s Directory Axminster 1830 als »achtbar, aber unregelmäßig gebaut«.[30] Das Problem ist nicht so sehr der Schmutz, sondern vielmehr die Altertümlichkeit. Gelobt werden nur die Gasthöfe, die Pfarrkirche und die 1755 gegründete Teppichfabrik. Aber lassen Sie sich von diesen Berichten nicht abschrecken: Kleinstädte wie Axminster sind wichtig für die Versorgung der Menschen auf dem Lande. Axminster verfügt zum Beispiel über:
8 Ladenbesitzer
7 Gasthöfe
6 Stiefel- und Schuhmacher
6 Schulmeister
5 Schneider
5 Leinen- und Wollhändler
5 Brandversicherungsbüros
5 Bäcker
4 Zimmerleute und Schreiner
4 Kolonialwaren- und Teehändler
4 Damenschneider
3 Wundärzte
3 Vermesser
3 Steinmetze
3 Sattler
3 Rechtsanwälte
3 Müller
3 Klempner und Glaser
3 Hufschmiede
3 Gärtner und Samenhändler
3 Böttcher
3 Banken
3 Auktionatoren
2 Uhrmacher
2 Strohhutflechter
2 Stellmacher
2 Möbelschreiner
2 Mälzer
2 Eisenwarenhändler
2 Apotheker
1 Weinhändler
1 Talgkerzenzieher
1 Tabakhändler
1 Spirituosenhändler
1 Postamt
1 Marmorsteinmetz
1 Hotel
1 Friseur
1 Eisengroßhändler
1 Butterhändler
1 Buchhändler
Im Stadtzentrum gibt es außerdem dreimal die Woche einen sehr guten Fleischmarkt und drei Viehmärkte im Jahr. Postkutschen fahren täglich nach London, Bath, Bristol und Exeter und dreimal die Woche nach Portsmouth und Southampton. Axminster mag klein sein, und elegant ist es ganz sicher nicht, aber es ist ein unglaublich geschäftiges Zentrum für die gesamte Umgebung.
Ähnliches lässt sich über tausend andere Marktstädte in Großbritannien sagen.[31] Louis Simond beschreibt Falmouth gleich bei seiner Ankunft in England 1809 als »eine kleine, alte, schwarze, übel gebaute Stadt«. Im Grunde tut er fast jede alte Stadt, in die er kommt, als »hässlich« ab. Chester ist »von einer mehr barbarischen als classischen Alterthümlichkeit«, Salisbury »eine alte kleine sehr häßliche Stadt«, Carlisle eine kleine »Stadt, von der weder Gutes noch Böses zu sagen ist«, und Llangollen »wie alle andern kleinen alten Städte Englands und Europas ein ausgezeichnet häßliches Ding«.[32] Auch Nathaniel Wheaton rümpft die Nase über die meisten Kleinstädte. Seiner Ansicht nach ist Wolverhampton »alt, schmutzig, mit schmalen Straßen und schwarz vor Kohlenstaub«; Ware ist »alt und schlecht gebaut mit sehr engen, verwinkelten und schmutzigen Gassen«; und die Straßen von Stamford sind »schmal, unregelmäßig und schmutzig«.[33] Doch all diese Orte erfüllen viele wertvolle Funktionen für ihre Bürger und ihr Umland.
Wenn Sie weiter ins Land hinein reisen, werden Sie feststellen, dass die Industrielle Revolution selbst an den entlegensten Orten ihre Spuren hinterlassen hat. Kanäle in einer Länge von mehreren Tausend Kilometern verbinden die Städte mit den größeren Flüssen. Kohle wird mit lokalen Güterzügen transportiert. In den 1820er-Jahren bringen mehrere Zechen ihre Kohle mithilfe von Dampfmaschinen zur nächstgelegenen Hafenstadt. Und vor allem werden auch auf dem Land Fabriken und Hüttenwerke gebaut, von denen einige fast so groß sind wie die Kolosse in Manchester. Oft entstehen in der Nachbarschaft neue Dörfer, um die Arbeiter unterzubringen, vor allem wenn die Fabriken rund um die Uhr in Betrieb sind.
Das berühmteste Beispiel ist New Lanark, ein großer Komplex von beeindruckenden vierstöckigen Baumwollfabriken im grünen Flusstal des Clyde, fünfundvierzig Kilometer südöstlich von Glasgow. Hier hat der Industrielle Robert Owen nicht nur die wasserbetriebenen Baumwollspinnereien seines Schwiegervaters ausgebaut, sondern auch Wohnhäuser für mehr als zweitausend Menschen errichtet, mit Schule, Werkskantine, Krankenstation und vielen Annehmlichkeiten einer kleinen Stadt. Dutzende Unternehmer tun Ähnliches, allerdings nicht immer mit so hohen Standards wie Owen.
Wie Sie sehen werden, geht es bei der Industriellen Revolution nicht nur einfach um Fabriken mit Dampfkraft und verbesserte Transportverbindungen, sondern viel grundsätzlicher um das Bestreben, richtig viel Geld zu verdienen. Das können Sie überall um sich herum erkennen. Wenn irgendetwas profitabler gemacht werden kann, wird der Besitzer normalerweise versuchen, das auch zu tun. Was macht man mit den fünfhundert Quadratkilometern Ödland, aus denen das Dartmoor besteht? Einige Männer weigern sich, zu akzeptieren, dass man dort keine Landwirtschaft