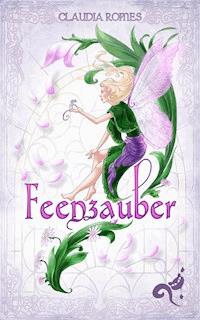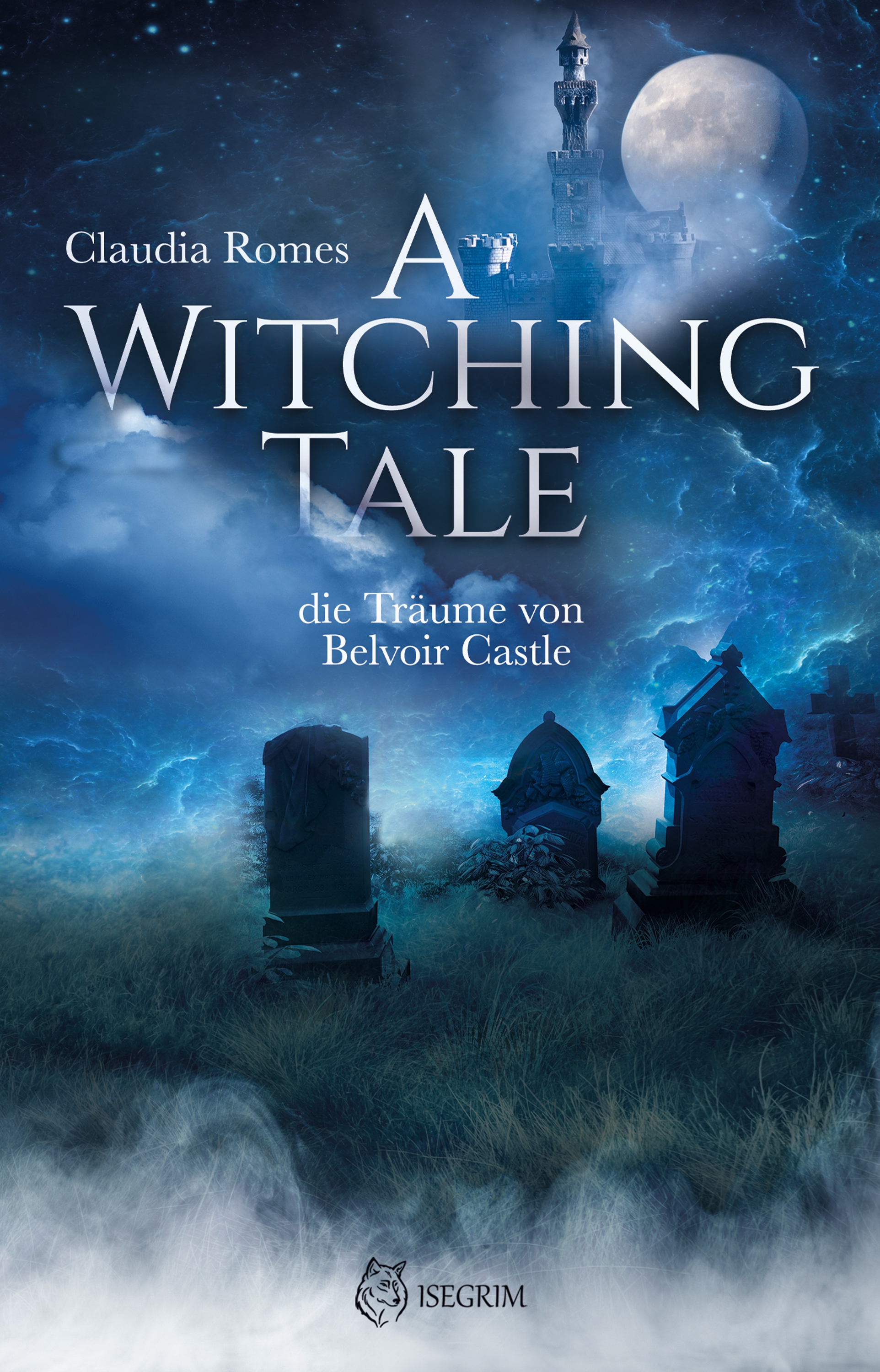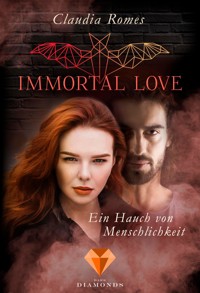
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Wenn Liebe mehr heißt als »für immer«** Als Sarah Heys sich nach einer Party auf den Weg nach Hause macht und dabei in einen schweren Autounfall verwickelt wird, scheint ihr Leben dem Ende nah. Doch dann taucht plötzlich ein Unbekannter auf und rettet sie. Wochen später begegnet sie dem geheimnisvollen Zachary, den Sarah als ihren Lebensretter wiedererkennt. Fasziniert von seiner Unnahbarkeit besucht sie ihn auf seinem Wohnsitz Schloss Glamis. Doch um das uralte Gemäuer rankt sich eine unheimliche Legende und die Tatsache, dass Sarah dem jungen Erben ihr Leben verdankt, lässt sie unabsichtlich zu einem Teil davon werden. Schon bald kann sie sich Zacharys Nähe nicht mehr entziehen und muss eine Entscheidung treffen, die sie für die Ewigkeit bindet. Mit »Immortal Love. Ein Hauch von Menschlichkeit« hat Claudia Romes eine elektrisierende Vampir-Romance geschaffen, die den Leser nicht mehr loslässt. //Dies ist ein Roman aus dem Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.// »Immortal Love. Ein Hauch von Menschlichkeit« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dark Diamonds
Jeder Roman ein Juwel.
Das digitale Imprint »Dark Diamonds« ist ein E-Book-Label des Carlsen Verlags und publiziert New Adult Fantasy.
Wer nach einer hochwertig geschliffenen Geschichte voller dunkler Romantik sucht, ist bei uns genau richtig. Im Mittelpunkt unserer Romane stehen starke weibliche Heldinnen, die ihre Teenagerjahre bereits hinter sich gelassen haben, aber noch nicht ganz in ihrer Zukunft angekommen sind. Mit viel Gefühl, einer Prise Gefahr und einem Hauch von Sinnlichkeit entführen sie uns in die grenzenlosen Weiten fantastischer Welten – genau dorthin, wo man die Realität vollkommen vergisst und sich selbst wiederfindet.
Das Dark-Diamonds-Programm wurde vom Lektorat des erfolgreichen Carlsen-Labels Impress handverlesen und enthält nur wahre Juwelen der romantischen Fantasyliteratur für junge Erwachsene.
Claudia Romes
Immortal Love. Ein Hauch von Menschlichkeit
**Wenn Liebe mehr heißt als »für immer«** Als Sarah Heys sich nach einer Party auf den Weg nach Hause macht und dabei in einen schweren Autounfall verwickelt wird, scheint ihr Leben dem Ende nah. Doch dann taucht plötzlich ein Unbekannter auf und rettet sie. Wochen später begegnet sie dem geheimnisvollen Zachary, den Sarah als ihren Lebensretter wiedererkennt. Fasziniert von seiner Unnahbarkeit besucht sie ihn auf seinem Wohnsitz Schloss Glamis. Doch um das uralte Gemäuer rankt sich eine unheimliche Legende und die Tatsache, dass Sarah dem jungen Erben ihr Leben verdankt, lässt sie unabsichtlich zu einem Teil davon werden. Schon bald kann sie sich Zacharys Nähe nicht mehr entziehen und muss eine Entscheidung treffen, die sie für die Ewigkeit bindet.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© Fotostudio Nieder
Claudia Romes wurde am 02.10.1984 als Kind eines belgischen Malers in Bonn geboren. Sie war schon immer eine begeisterte Leserin und liebte es, in fremde Welten einzutauchen. Mit neun Jahren begann sie, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und fasste den Entschluss, eines Tages Schriftstellerin zu werden. Heute lebt die Autorin mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einem kleinen Dorf in der Vulkaneifel.
Für alle besten Freundinnen und Freunde. Ihr seid unbezahlbar!
Und für meine Kinder. Immer für euch.
PROLOG
Es dämmerte. Über dem hellen Schein der untergehenden Sonne zerstreute sich ein purpurfarbenes Licht und die ersten Sterne zeigten sich schwach am Horizont. Schon bald würde der rote Mond den Himmel über Schloss Glamis beherrschen.
Coraline Strackmore wandte sich vom Fenster ab, senkte den Kopf und seufzte. Ihre Hände umklammerten ein gerahmtes Foto, das einen kleinen Jungen am Strand von Seacliff beim Muschelsuchen zeigte. Sie drückte es an ihre Brust und Tränen der Verzweiflung quollen aus ihren Augen. Als es plötzlich an der Tür klopfte, fuhr die Gräfin erschrocken zusammen.
»Coraline, Liebes?« Ihr Ehemann Henry streckte zaghaft den Kopf durch den Türspalt. Nur langsam schaute sie zu ihm auf. »Es ist so weit.«
Sie nickte, ließ ihren Blick wieder zum Fenster schweifen und wischte sich die Tränen aus den Augen.
»Du weißt, dass wir keine andere Wahl haben?«
Coraline schluckte hörbar, während sie das Bild des kleinen Jungen zurück auf die Anrichte des Salons stellte. »Ich weiß.« Diese Worte kamen ihr nur schwer über die Lippen. Sie klangen eher wie eine einstudierte Antwort – wenig überzeugt, erstickt und rau.
»Er sollte nicht das Gefühl haben, allein zu sein, wenn er in die Krypta gebracht wird. Meinst du nicht auch?« Ihr Mann hielt ihr seine Hand entgegen.
Die Gräfin nahm einen tiefen Atemzug und ließ sich von Henry aus dem Zimmer führen. »Nein, das sollte er nicht.«
Gemeinsam gingen sie in den Ostflügel des Schlosses, wo bereits drei Männer in schwarzen Ledermänteln auf sie warteten.
»Es hat begonnen«, sagte einer von ihnen. »Der Mond ist aufgegangen.«
Die anderen nickten entschlossen.
Graf Strackmore trat vor sie und hob die Hände. »Ich werde ihn selbst in die Krypta bringen«, sagte er, woraufhin die Männer überraschte Blicke tauschten.
»Denkst du wirklich, dass du das kannst?«, fragte einer von ihnen. Er war groß gewachsen, sein schulterlanges schwarzes Haar fiel ihm strähnig ins Gesicht, während er Henry aus forschen Augen musterte.
»Ich muss es tun«, antwortete dieser zögerlich.
»Das ist meine Aufgabe!« Im Blick des Mannes lag etwas Unberechenbares, etwas Erschreckendes.
Unwillkürlich trat der Graf einen Schritt zurück. Er sah zu seiner Frau, atmete hörbar ein und im nächsten Moment kam er seinem Gegenüber näher als zuvor. Diesmal war es sein Blick, der diesen erschreckte. »Aber er ist mein Sohn, Murdoch! Wenn es schon geschehen muss, dann durch meine eigene Hand. Er soll wissen, dass es nicht anders geht.«
Murdoch machte schmale Augen. »Er weiß es. Er hat es bereits in sich gespürt, noch bevor es erste Anzeichen gab. Was jetzt mit ihm geschehen muss, ist Tradition.«
»Es ist ein Fluch!«, wandte die Gräfin mit vor Wut zitternder Unterlippe ein. Ihr Mann legte beruhigend den Arm um sie. »Er kann nichts dafür, was er ist. Es ist allein unsere Schuld. Die Ahnen der Strackmores haben zu verantworten, was mit unseren Kindern geschieht.« Weinend sank sie auf ihre Knie.
»Nun«, sagte Murdoch mit einem hämischen Grinsen im Gesicht, »dann sollte eure Familie vielleicht damit aufhören, Kinder zu zeugen.«
Der Graf schluckte eine Erwiderung hinunter. Er ging vor seiner Frau in die Hocke und drückte ihren Kopf an seine Schulter. »Es ist nicht seine Schuld, trotzdem muss er dafür büßen – das weißt du so gut wie ich, Cora.«
Murdoch wartete nicht länger. Er öffnete die Tür zu seiner Rechten, hinter der ein leises Brummen zu hören war.
»Halt!«, ermahnte Henry ihn und trat rasch an seine Seite. »Ich sagte doch, überlass ihn mir.« Beim Anblick seines Sohnes erstarrte der Graf augenblicklich.
»Sieh genau hin! Das ist seine wahre Natur. Der Blutmond hat sie offenbart. Es wird schlimmer.« Murdoch sah ihn voller Genugtuung an.
Langsam stemmte sich auch die Gräfin wieder auf die Beine und ging auf das Zimmer ihres Sohnes zu. Im Türrahmen stehend, schlug sie fassungslos die Hände vor den Mund. »Zachary?«
Er reagierte nicht. Wie in Trance blickten seine blutunterlaufenen Augen zur Zimmerdecke hinauf, das Brummen war in ein Schnaufen übergegangen, das dem eines wilden Tieres glich. Weißer Schaum umgab die Mundwinkel und seine Haut war so durchscheinend, dass sich darauf die Blutgefäße abzeichneten.
»Mein Junge!« Die Gräfin wollte zu ihm, sich an sein Bett setzen und seine Hand ergreifen, aber ihr Mann hielt sie energisch zurück. »Er ist krank!«, rechtfertigte sie sich.
»Nosferatu – der wandelnde Tod«, zischelte Murdoch. »Es ist nichts, das man heilen könnte. Zachary ist der Fluchträger, daran gibt es keine Zweifel.«
»Nein!«, schrie die Gräfin unter Tränen. Bis zuletzt hatte sie gehofft, dass ihrem Kind diese Bürde erspart blieb – vergeblich.
Henry legte eine Hand an ihr Kinn, um sie dazu zu bringen, ihn anzusehen. »Cora, Liebling. Wir können ihm nicht helfen. Niemand kann das. Er ist verloren.«
»Er ist nicht länger der Junge, den ihr gekannt habt«, sagte Murdoch. »Sein Durst nach Blut macht ihn zu einer Gefahr für die Menschen. Selbst für euch.«
Er gab den beiden Männern hinter ihm ein Zeichen. Sie betraten das Schlafzimmer und zogen den jungen Mann aus seinem Bett. Vorbei an den verzweifelten Eltern, die ihnen durch einen langen Flur und schließlich über die große Freitreppe hinterhereilten. Ihr Weg führte sie hinunter in die ehemalige Kapelle, hinein in die Krypta des alten Schlosses, tief unter der Erde. Zachary wehrte sich nicht. Der Blutmond, der diese Nacht beherrschte, hatte seine Sinne betäubt, ihn in einen Rausch versetzt. Den ersten, den er als Verfluchter, als naturgeborener Vampir erlebte, und es sollte auch sein letzter sein.
In der Krypta warfen Murdochs Männer Zachary in eine steinerne Zelle, in deren Mauern Dutzende Kruzifixe hineingehauen waren. Sie schwächten Zachary, ließen ihn in sich zusammensinken. Direkt auf das silberne Kreuz, das auf dem massiven Boden schimmerte.
Ohne ein Fenster, das das Licht des Blutmonds hineinließ, wurde er wieder klar. Er kam zu sich und das Bild eines Gegeißelten verflog. Plötzlich sah die Gräfin in nichts anderes als die unschuldigen Augen ihres dreiundzwanzigjährigen Sohnes. Der Blutmond hatte ihn berufen und seine Willkür glich einer Folter.
»Was geht hier vor? Was tut ihr da?« Zachary sprang erschrocken auf. Er versuchte, sich aus der Zelle zu befreien, aber die Männer drängten ihn zurück. Ungerührt zogen sie die Mauer vor ihm hoch.
»Seht ihn euch doch an«, sagte die Gräfin. »Er ist keine Gefahr!«
»Er ist ein Vampir, Cora!«, entgegnete ihr Mann. »Schau nur richtig hin.« Er deutete auf das steinerne Gefängnis, aus dem Zachary versuchte, zu entkommen, doch das Kreuz zu seinen Füßen hielt ihn darin fest. Es bildete eine unsichtbare Barriere, die ihn daran hinderte, zu fliehen.
Seine Mutter schüttelte entgeistert den Kopf. »Das ist Wahnsinn!«
»Wir dürfen uns nicht täuschen lassen.« Der Graf hielt seine Frau an den Armen fest, um sie davon abzuhalten, in das Geschehen einzugreifen.
Nur noch wenige Mauersteine, dann war es vollbracht. Hilfe suchend starrte Zachary seinen Eltern aus dem finsteren Verlies entgegen. Er wusste, was mit ihm passierte. Er war an dem Ort, an dem bereits viele Strackmore-Nachkommen ihr Ende gefunden hatten. Der Fluch hatte sie alle gefordert und nun traf er auch ihn. Zachary wagte es nicht, daran zu denken, wie viele Zellen sich hinter der seinen befanden.
Als ihn nur noch ein einziger Stein von seinen Eltern und der Freiheit trennte, schob seine Mutter ihr Gesicht vor das Loch. Sie reichte ihm ihre Hand und er ergriff sie sofort. Tränen rannen seine Wangen hinab und er sah, dass auch die Augen seiner Mutter glitzerten.
»Ich liebe dich, mein Sohn«, hauchte sie mit erstickter Stimme. »Bitte vergiss das nicht.«
Er nickte schluchzend.
»Hör genau zu, was ich dir jetzt sage, Zachary. Ich werde einen Weg finden, diesen Fluch zu beenden. Das verspreche ich dir!« Ein letztes Mal drückte sie seine Hand ganz fest, dann setzte Murdoch wortlos den verbliebenen Stein. »Halte daran fest, mein Junge!« Die Gräfin legte ihre Hand auf die kalten Mauern, hinter denen ihr Sohn gefangen war. »Halte daran fest!«
Die Trauer über den Verlust ihres einzigen Kindes ließ sie innerlich zusammenbrechen. Verstört wandte sie sich zu ihrem Mann um, der reglos hinter ihr stand. In ihrem Blick lag kein Mitgefühl, nur blanker Hass.
»Es ist deine Schuld«, fuhr sie ihn an. »Ganz allein deine! Wie konntest du das nur zulassen?«
KAPITEL EINS
Blutroter Mond
Ein langer Tag lag hinter mir. Ich war müde. Erst die Arbeit im Café, dann die Party. Dank meiner neuen roten High Heels, die im Regal wesentlich bequemer ausgesehen hatten, brannten meine Füße. Eigentlich wäre ich nach der Arbeit lieber auf die Couch gefallen, hätte mir irgendetwas im Fernsehen angesehen, bis ich davor eingeschlafen wäre. Megan war jedoch meine beste Freundin und sie feierte ihre bestandene Zwischenprüfung in Psychologie. Zwei Gründe, weshalb ich mich auf ihrer Party hatte blicken lassen müssen.
»Du willst wirklich schon gehen, Sarah?«
Ich stand auf der Veranda der Blockhütte, aus der Hip-Hop dröhnte, und versuchte, Megans enttäuschte Miene nicht auf mich wirken zu lassen. Gelächter und das Aneinanderklirren von Flaschen waren von drinnen zu hören.
»Ich muss morgen früh raus!«, erklärte ich, während ich mir eine Strähne meines dicken rotblonden Haars hinters Ohr steckte, die zum wiederholten Mal in mein Sichtfeld gefallen war.
»Kann dein Vater nicht die erste Schicht übernehmen?«
»Er hat noch etwas zu erledigen. Ich habe ihm versprochen, das Café aufzuschließen.«
Megan wirkte wenig überzeugt.
Ich wollte ihr nicht sagen, dass meine Eltern einen Banktermin wegen der Hypothek hatten, die auf dem Café und unserem Haus lastete. Auch wenn ich ihr sonst alles anvertraute, die Sorgen wegen unserer miserablen finanziellen Lage wollte ich für mich behalten. Ich schämte mich dafür, und auszusprechen, wie schlecht es in Wahrheit um unser Café stand, wäre für mich einer Niederlage gleichgekommen. Ich wollte meine letzte Hoffnung nicht verlieren, dass sich vielleicht doch noch alles zum Guten wenden würde.
Megan stemmte die Hände in die Hüfte und legte den Kopf schief. »Ich möchte mal wissen, was mit dir los ist. Früher hättest du dir keine Party entgehen lassen.«
Ich lächelte sanft. »Das habe ich auch heute nicht. Ich kann nur nicht so lange bleiben. Tut mir leid! Du bist mir doch nicht böse?«
Megan klimperte mit ihren langen falschen Wimpern, dann kam sie auf mich zu und umarmte mich. »So ein Unsinn. Wieso sollte ich deswegen böse sein? Ich mache mir nur Sorgen um dich. In letzter Zeit siehst du ziemlich erschöpft aus. Meinst du nicht, dass du dich vielleicht etwas zu sehr in die Arbeit im Café reinhängst?«
Ich schüttelte leicht den Kopf.
Megan betrachtete mich eindringlich. »Du solltest deinen Eltern sagen, dass es dir zu viel wird. Es ist schließlich ihr Laden. Sie können nicht von dir verlangen, dass du dafür deine Zukunftspläne hinschmeißt.«
»Tun sie nicht.«
Megan hob die Augenbrauen. Es war offensichtlich, dass sie mir nicht glaubte. »Was ist mit Edinburgh?«
Wieder schüttelte ich den Kopf. »Ich kann jetzt nicht studieren gehen.«
»Weil deine Eltern dich brauchen«, sagte sie in einem leicht abfälligen Ton.
»Sie hindern mich nicht daran. Es ist nicht so, wie du denkst. Ein Studium ist im Moment einfach nicht möglich.«
Megan musterte mich eingehend. Sie presste bedauernd die Lippen aufeinander. »Na gut.« Sie drückte mich noch einmal an sich. »Fahr heim und hol dir eine Mütze Schlaf. Aber pass auf dich auf, ja?«
»Versprochen. Ich schreibe dir, sobald ich zu Hause bin.« Ich zückte die Autoschlüssel und ging zu meinem alten Mini Cooper, dessen hellblaue Farbe von Rostflecken durchwandert war. Die eingedellte Motorhaube stammte noch vom Vorbesitzer. Mit seinen zwölf Jahren war mein Mini sicherlich kein besonders schöner Wagen mehr, aber er erfüllte seinen Zweck, und das war entscheidend.
»Ach du Scheiße!«, rief auf einmal jemand hinter mir. Erschrocken drehte ich mich um. Megans Freund Ethan stand neben ihr und starrte hinauf zum Himmel. Unwillkürlich folgte ich seinem Blick.
»Was ist das denn auf einmal?«, hörte ich meine beste Freundin fragen.
Der Nachthimmel war von einem seltsamen Nebel durchzogen, der um einen kupferroten Mond wallte und den Horizont völlig für sich einnahm. Kein Stern war mehr zu sehen. Als hätte der unheimlich aussehende Mond sie alle verschlungen.
»Das heißt, dass heute Nacht Blut vergossen wird. Muahhh …«, raunte Ethan verschwörerisch.
»Mann, lass den Scheiß!«, brüllte Megan.
Ich wusste, er versuchte nur, uns Angst einzujagen, aber bei seinen Worten und dem Anblick des Spektakels am Himmel lief mir ein eiskalter Schauder über den Rücken.
Ethan lachte. Erst als er merkte, wie sehr uns der rot schimmernde Himmel beunruhigte, wurde er ernst. »Hey, das ist bestimmt nichts weiter als eine Mondfinsternis.«
»Bist du sicher?«, erkundigte sich Megan.
»Na klar! So sieht das am Anfang immer aus.«
Ein plötzlich aufkommender Wind wehte mir meine Haare ins Gesicht. Für einen Moment horchte ich auf, denn er erschien mir merkwürdig stumm. Als hätte jemand die Lautstärke heruntergedreht, drangen die Geräusche der Party für mich in den Hintergrund. Mein Blick suchte die umliegenden Baumkronen, die sich durch die Kraft des Windes zur Seite bogen. Keine raschelnden Blätter, kein einknickendes Geäst.
Ich sah zu Megan, deren Augen sich ein wenig verengten. Ethan nippte ungerührt an einer Bierflasche. Unwillkürlich schüttelte ich mich, bevor ich ins Auto einstieg. Wahrscheinlich war ich einfach nur total übermüdet.
»Und vergiss nicht, dich zu melden, wenn du zu Hause bist«, erinnerte mich Megan.
»Keine Sorge.« Ich winkte ihr und schlug die Autotür zu.
***
Es war kurz nach Mitternacht, als es zu regnen begann. Quietschend schoben sich die Scheibenwischer hin und her. Ich hatte die Wischblätter längst auswechseln wollen, doch ich war noch nicht dazu gekommen. Jetzt bildeten sie hässliche Schlieren, die meine Sicht verschlechterten. Der Mond verlieh dem regennassen Asphalt einen rötlichen Glanz. Unwirkliche Schatten, hervorgerufen von knorrigen Ästen, tanzten auf der einsamen Straße.
Gähnend schaltete ich das Radio ein, während der Wald an mir vorbeirauschte. Auf allen gespeicherten Sendern herrschte nichts als ein dröhnendes Rauschen. Der automatische Suchlauf dauerte eine kleine Ewigkeit.
»Muss kaputt sein«, murrte ich und schlug mit der flachen Hand gegen die Armatur. Gleich darauf war der Suchlauf erfolgreich, wenn auch etwas gewöhnungsbedürftig. Aus den Lautsprechern tönte eine sanfte Swing-Melodie im Stil der dreißiger Jahre. Die Musik klang, als käme sie aus einem Grammophon. Antiquiert, aber dennoch unterhaltsam und leicht. Froh darüber, irgendetwas zu empfangen, drehte ich lauter. Die Frau sang mit rauer Stimme von der Erbarmungslosigkeit der Liebe. Der Text war so einfach zu merken, dass ich den Refrain bereits nach der zweiten Strophe mitträllerte.
»Blue moon. You saw me standing alone …«
Ich hatte das Gefühl, dieses Lied zu kennen. Wahrscheinlich war es einer dieser Klassiker, die jeder schon einmal gehört hatte, wenn auch unbewusst.
Meine Augen brannten vor Müdigkeit. Ich riss sie gewaltsam auf, doch sie fühlten sich so staubtrocken an, dass es das Brennen nur noch schlimmer machte.
»Bleib wach, Sarah«, ermahnte ich mich selbst, in der Hoffnung, der Klang meiner Stimme würde dafür sorgen. »Gleich bist du da. Nur noch ein paar Kilometer.«
Die Straße schien kein Ende zu nehmen. Sie war mir noch nie so lang vorgekommen. Gähnend drehte ich die Lautstärke des Radios nochmals hoch und trommelte mit den Fingern im Takt der Musik auf dem Lenkrad.
Als die Scheinwerfer das Richtungsschild mit der Aufschrift Forfar anstrahlten, fühlte ich mich schon wacher. Hier endete der Wald. Erleichtert darüber, ihn hinter mir gelassen zu haben, stellte ich das Radio leiser und schnaufte durch.
Auf der bisherigen Strecke war mir kein einziges Auto entgegengekommen. Auch das letzte Stück des Weges in Richtung Stadt blieb einsam. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, diese endlos erscheinende Fahrt bald hinter mich gebracht zu haben.
»Es ist nicht mehr weit«, sagte ich mir immer wieder.
Die Nacht wirkte furchteinflößend – dafür sorgten die dichten Nebelbänke, der Wind, der hin und wieder so stark war, dass er meinen Mini ins Wanken brachte, und nicht zuletzt der unheimliche Mond, der ununterbrochen auf mich herabschien. Beinahe sah es so aus, als würde er mich verfolgen.
»Bestimmt irgend so ein seltenes Naturereignis«, sagte ich mir. »Eine Mondfinsternis, wie es Ethan vermutet hat. Von der ich wahrscheinlich wüsste, hätte ich in den letzten Tagen ferngesehen.«
Ich hatte wirklich kaum noch Zeit für mich, geschweige denn für das Alltägliche. Megan hatte recht! Es musste sich etwas ändern. Ich sollte mir endlich eingestehen, dass die Arbeit im Café nicht das war, was mich ausfüllte, und die Existenzsorgen meiner Eltern mich allmählich auffraßen. Vielleicht sollte ich mit ihnen reden. Ja, wahrscheinlich wäre es das Beste.
Die Erschöpfung ließ mich frösteln. Gedanklich war ich bereits in meinem Schlafzimmer und zog mir die Bettdecke über die Schultern. Automatisch sackte ich ein wenig im Sitz zusammen. In meinem Zustand war die Eintönigkeit dieser Straße brandgefährlich. Inzwischen war ich jedoch zu müde, um mich selbst daran zu erinnern. Für den Bruchteil einer Sekunde schlossen sich meine Augen und meine Hände rutschten vom Lenkrad.
Und dann ging alles ganz schnell. Ich kam von der Fahrbahn ab, schlitterte in den Graben und überschlug mich. Im nächsten Augenblick durchzog ein stechender Schmerz meinen Körper. Blut rann meine Schläfen hinunter. Es fühlte sich warm und feucht an, als es die Wangen erreichte und von dort auf das eingedrückte Armaturenbrett tropfte.
Ich versuchte, meinen Arm zu bewegen, der über dem Lenkrad lag, wollte den Gurt lösen und mich aus dem Sitz befreien, aber mein Körper reagierte nicht. Mein Nacken spannte unerträglich. Es war mir nicht möglich, mich aufzurichten. Ich war wie gelähmt. Selbst das Schlucken verursachte höllische Schmerzen.
Ich wollte nach meinem Handy greifen, doch meine Handtasche lag nicht länger im Fußraum vor dem Beifahrersitz und war unerreichbar für mich.
Meiner aufsteigenden Panik folgte die schreckliche Erkenntnis, dass ich allein war. Ungeordnet und hastig rotierten meine Gedanken – ich wollte noch nicht sterben. Ich dachte an meine Eltern und spürte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten.
Mir stieg der beißende Geruch von Benzin in die Nase und ich ahnte Schreckliches.
»Hilfe«, hörte ich mich flüstern. Einmal. Zweimal. Dreimal. Es nützte nichts. Niemand war in meiner Nähe, der mich hätte hören können. Der Mond ließ sein unbarmherziges Licht wie einen Fingerzeig auf mich herabscheinen und mir war, als würde er mich auslachen.
Hoffnungsvoll klammerte sich mein Blick an den kleinen goldhaarigen Schutzengel, den mir meine Mutter zur bestandenen Führerscheinprüfung geschenkt hatte. Die Heftigkeit des Unfalls hatte ihn vom Rückspiegel gerissen. Nun lag er mit dem Gesicht zu mir gegen die Scheibe gelehnt und wurde vom Blutmond angestrahlt. Der bizarre Anblick rief mir Ethans fadenscheinige Warnung ins Gedächtnis.
Die Schmerzen raubten mir fast den Verstand. Ich spürte, wie meine Glieder taub wurden. Sollte das wirklich alles gewesen sein, was das Leben für mich bereithielt? Das Atmen fiel mir zunehmend schwerer. Mein Herzschlag ging stetig langsamer. Immer leiser strömte die Luft aus mir heraus, bis ich überhaupt nicht mehr einatmen konnte. Es wurde still.
Mein Blick glitt zurück auf die einsame Straße. Noch immer schimmerte sie rötlich im Schein des unheimlichen Mondes. Plötzlich sah ich die vagen Umrisse einer Person, die aus den Schatten trat. Wie ein Geist bewegte sie sich auf mich zu. Erst als sie vor der zersprungenen Windschutzscheibe angekommen war, erkannte ich, dass es sich um einen jungen Mann handelte. Ein berstendes Geräusch folgte. Vergeblich versuchte ich, den Kopf zur Seite zu drehen. Ich spürte die eiskalte Nachtluft ins Auto strömen. Kurz darauf schob sich das Gesicht des Mannes vor meins. Sein Erscheinen ließ mein Herz noch einmal kräftiger gegen den Brustkorb hämmern. Das Letzte, was ich sah, bevor mein Blick trüb wurde, waren seine leuchtend blauen Augen.
»Du bleibst«, hauchte der Mann, dann presste er seine Lippen auf meine. Ein süßer Geschmack ging auf mich über und wie ein Stromschlag fuhr ein gewaltiges Ruckeln durch meine Glieder. Als wäre ich von einem langen Tauchgang an die Oberfläche zurückgekehrt, schnappte ich nach Luft. Mein Herz nahm seine Tätigkeit wieder auf. Es pulsierte stark und gleichmäßig.
Vorsichtig löste sich der Fremde aus der intensiven Berührung und legte mir seine Hand in den Nacken.
Es war unglaublich. Meine Schmerzen ließen nach. Wie konnte das sein? Ich fühlte mich nicht länger wie jemand, der gerade fast gestorben wäre. Als hätte mich der Kuss dieses Mannes zurück ins Leben geholt.
»Wer bist du?«, fragte ich zaghaft, denn das Sprechen kostete mich noch viel Kraft. Aber ich musste wissen, wem ich mein Leben zu verdanken hatte.
Der Fremde lächelte sanft. »Hab keine Angst. Alles wird gut. Kannst du den Arm um mich legen?«
Ich wollte antworten, ihm sagen, dass ich nicht fähig war, auch nur den kleinen Finger zu bewegen, aber ich blieb stumm. Der Schock hatte mir die Sprache verschlagen.
Er betrachtete mich aufmerksam. »Ist schon gut.« Seine tiefe Stimme hatte eine beruhigende Wirkung auf mich. »Ich hole dich hier raus.«
Ich spürte, wie er mich aus dem Gurt befreite, dann umfasste er behutsam meine Taille, hob mich aus dem Autowrack und legte mich fernab der Straße ins Gras. Mir gelang es, mich ein wenig aufzurichten, meinen Arm zu bewegen. Als der Fremde sich noch einmal zu mir hinunterbeugte, führte ich die Hand an seine Wange.
»Hilfe ist unterwegs. Du wirst wieder gesund«, versicherte er mir und legte behutsam seine Hand über meine.
»Ich danke dir!«, flüsterte ich.
Der Fremde nickte leicht. Aus der Ferne näherte sich ein Rettungswagen und ich schaute den blinkenden Lichtern entgegen. Nur für einen Moment hatte ich den Blick abgewandt, doch als ich mich umsah, war ich allein. Meine Hand, die unter der meines Retters gelegen hatte, griff ins Leere, als wäre er ein Geist gewesen. Suchend schaute ich mich um. Bei den ruckartigen Bewegungen pochte mein Kopf.
KAPITEL ZWEI
Unvergesslich
Ich erwachte in einem Zimmer mit kahlen weißen Wänden. Der Geruch von Desinfektionsmittel und Latexhandschuhen schwebte im Raum. Es war unschwer zu erraten, wo ich mich befand.
Durch ein Fenster drang das matte Licht eines wolkenverhangenen Tages. Der Regen hämmerte gegen die Scheibe.
Allmählich kam die Erinnerung an das, was mir passiert war, zurück. Bruchstückhaft und verworren, aber sie ließ keine Zweifel darüber aufkommen, dass ich einen schweren Unfall erlitten hatte.
Rasch streckte ich beide Beine durch und wagte einen ängstlichen Blick unter die Bettdecke. Gott sei Dank!, dachte ich erleichtert. Alles noch dran.
Im nächsten Moment ging die Tür auf und meine Eltern kamen herein.
»Sie ist wach!« Meine Mutter, in der Hand einen Strauß bunter Rosen, eilte an mein Bett und drückte mir ihren Kuss auf die Stirn. »Wie geht es dir, Liebes?«
»Ich fühle mich ziemlich durchgeschüttelt«, antwortete ich schwach.
»Solange es nur das ist!«, sagte mein Vater. »Die Ärzte meinen, es grenzt an ein Wunder, dass du den Unfall überlebt hast.«
»Dein Auto war kaum mehr als solches zu erkennen«, ergänzte Mum.
Ich sah zwischen den beiden hin und her. »Ist das wahr?«
Dad nickte bekümmert. »Kannst du dich daran erinnern, was passiert ist?«
Ich dachte angestrengt nach. »Ich muss wohl kurz eingenickt sein.«
Meine Eltern betrachteten einander besorgt.
»Zum Glück konntest du dich aus dem Wagen befreien, bevor er in Flammen aufging!« Mein Vater hatte Tränen in den Augen, was mich sehr mitnahm, denn so aufgelöst hatte ich ihn noch nie gesehen.
Schockiert schluckte ich. Mein Mini war also Geschichte – auch das musste ich erst mal verarbeiten.
»Das war ich nicht«, verbesserte ich Dad kurz darauf, denn die Erinnerung an die vergangene Nacht wurde immer klarer. »Ich hätte mich nie allein befreien können. Ich war eingeklemmt.« Meine Stimme klang nun kraftvoller. »Es war jemand bei mir. Ein Mann. Er hat mich aus dem Auto geholt.« Ich sah, wie meine Eltern ratlose Blicke tauschten. »Ohne ihn wäre ich nicht mehr am Leben.«
Langsam tasteten sich meine Hände unter der Bettdecke hervor. Die linke war bandagiert. Als ich sie auf dem Laken ablegte, bemerkte ich ein Ziehen im Gelenk. Im rechten Handrücken steckte eine Kanüle, über die mir eine Infusion verabreicht wurde.
»Du meinst sicher einen der Sanitäter«, spekulierte meine Mutter.
»Nein«, erwiderte ich kopfschüttelnd. »Er war kein Sanitäter. Der Mann war vor den Rettungskräften bei mir.«
»In dieser gottverlassenen Gegend? Bist du dir da ganz sicher?« Dad musterte mich kritisch.
»Ja!«
Wieder tauschten meine Eltern Blicke. Diesmal wirkten sie überaus besorgt.
»Ich werde mal eine Vase für die Blumen holen. Und nach dem Arzt schicken.« Mum lächelte leicht, dann verschwand sie zur Tür hinaus.
»Stimmt etwas nicht?«, erkundigte ich mich vorsichtig.
Mein Vater nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben mich.
»Sarah.«
Nie zuvor hatte ich ihn derart ernst gesehen.
»Was ist denn?«
»Letzte Nacht, nach dem Unfall … Da war kein Mann, der dich aus dem Auto gezogen hat. Du warst allein, als der Krankenwagen bei dir eintraf. Darüber sind sich alle Rettungskräfte einig.«
»Er verschwand, bevor der Krankenwagen kam. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Außerdem, wer soll die Rettungskräfte sonst alarmiert haben?«
Dad schüttelte leicht den Kopf. »Ich weiß es nicht. Laut den Sanitätern gab es einen anonymen Hinweis.«
»Siehst du? Das bestätigt doch, was ich sage.«
Dad wirkte nicht überzeugt. »Tatsache ist, dass ihn niemand gesehen hat. Sarah, bei dem Aufprall bist du mit dem Kopf hart auf dem Lenkrad aufgeschlagen.«
Ich schnaufte tief durch. »Dann soll ich allein aus dem Auto geklettert sein?«
Mein Vater nickte geduldig.
»Aber ich habe jemanden gesehen. Ich erinnere mich genau. Und er hat …« Ich stockte kurz.
»Was?«
Statt meinem Vater zu antworten, atmete ich ein weiteres Mal tief durch und behielt das, was ich glaubte, erlebt zu haben, für mich. Die Tatsache, dass mich ein Kuss vor dem Tod bewahrt hatte, klang einfach zu verrückt. Womöglich hatte ich mir den Fremden mit den strahlend blauen Augen wirklich eingebildet.
Benommen fasste ich mir an die Stirn. Ein breites Pflaster deckte sie ab. Ich zog die Möglichkeit in Betracht, dass der Mann nur eine Halluzination gewesen war. Etwas, das sich mein Unterbewusstsein in dieser lebensbedrohlichen Situation herbeigesehnt hatte. Aber wer oder was auch immer er gewesen war, nur durch ihn hatte ich dem sicheren Tod entkommen können.
***
Auch Megans Besuch ließ nicht lange auf sich warten. Sie hatte sich bei meiner Mutter gemeldet, nachdem meine versprochene Nachricht ausgeblieben war, und so von meinem Unfall erfahren.
Sie machte sich schwere Vorwürfe, weil sie mich in der Partynacht hatte fahren lassen, obwohl ich so müde gewesen war. Sie schwor, bis auf Weiteres keine Partys mehr zu geben, erst recht nicht auf der Blockhütte in Glamis. Stattdessen überhäufte sie mich mit Pralinen, Blumen und Klatschzeitungen und versicherte mir, dass sie mich nie wieder nachts allein irgendwo hinfahren lassen würde.
Ich erzählte auch ihr von meinem geheimnisvollen Retter. Zu meiner Enttäuschung reagierte sie darauf ähnlich wie meine Eltern.
»Es ging sicher alles unglaublich schnell«, sagte sie nur, tätschelte mir den Arm und erinnerte mich daran, dass eine Kopfverletzung Wahrnehmungsstörungen verursachen konnte.
Ich verstand einfach nicht, warum niemand auch nur in Erwägung ziehen wollte, dass es den Fremden wirklich gegeben hatte. Je mehr ich darüber nachdachte, umso sicherer wurde ich mir, dass er existierte. Dass er irgendwo da draußen war.
***
Zehn Tage hatten mich die Ärzte im Krankenhaus behalten. Mir ging es deutlich besser. Ich merkte nichts mehr von dem Trümmerbruch meines Handgelenks, der ebenso verheilt war wie die Rippenfrakturen – das machten die Röntgenaufnahmen deutlich. Unter den Ärzten löste meine rasche Genesung Stirnrunzeln aus. Ich war erleichtert, denn das hieß, ich konnte nach Hause.
Am Morgen meiner Entlassung zog die Krankenschwester grummelnd die Vorhänge auf. »Schade, dass das Wetter Sie an Ihrem großen Tag nicht netter begrüßt. Die grauen Wolken scheinen sich über unserer Stadt festgesetzt zu haben. Dabei sagten die im Fernsehen für heute Sonnenschein voraus.« Sie drehte sich halb zu mir um, sodass ich ihre enttäuschte Miene sah. »Und Sie haben wirklich keinerlei Schmerzen mehr?« Sie musterte mich skeptisch.
Ich schüttelte den Kopf. »Um ehrlich zu sein, ich fühle mich super!«
»Na dann.« Sie nahm mein Handgelenk und tastete nach meinem Puls. Während sie dem Sekundenzeiger auf ihrer Uhr folgte, verzog sie kritisch das Gesicht.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte ich.
»Hm«, machte sie. »Ihre Herzfrequenz ist leicht erhöht.«
»Das muss die Aufregung sein«, versicherte ich. »In meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so sehr auf mein Zuhause gefreut.«
Sie lachte. »Na, wenn das so ist. Aber lassen Sie den Puls noch mal von Ihrem Hausarzt kontrollieren. Und sollten Sie sich nicht wohlfühlen …«
»Dann gehe ich sofort zum Arzt.«
»Richtig!« Grinsend zog sie eine Mullkompresse aus ihrer Kitteltasche. »Dann mal raus mit der Nadel. Oder wollen Sie die mitnehmen?«
»Ganz bestimmt nicht! Ich bin heilfroh, das Ding loszuwerden.«
Die Krankenschwester lachte. »Das glaube ich Ihnen gern.« Beim Herausziehen der Kanüle ziepte es. »Die Haut ist ein wenig gereizt«, erklärte mir die Schwester mit Blick auf das Hämatom, das die gerötete Einstichstelle umgab. »Es wurde allerhöchste Zeit, dass die Nadel rauskommt.« Sie bedeckte die etwas nachblutende Stelle mit der Kompresse. »Noch kurz drücken, bis es aufgehört hat, zu bluten.«
Ich nickte und tat, was sie sagte.
»Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Miss.«
»Danke!«, antwortete ich.
Die Schwester verließ das Zimmer. Ich setzte mich auf die Bettkante und blickte aus dem Fenster. Der Himmel war so dunkel, als hinge er voll Asche. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, zwischen den Wolken denselben roten Mond durchblitzen zu sehen, der mich bereits in der Unfallnacht erschreckt hatte.
»Das kann doch nicht sein«, murmelte ich und stemmte mich auf die Beine. Auf dem Weg zum Fenster fiel die Kompresse zu Boden. Als ich mich bückte, um sie aufzuheben, bemerkte ich, dass meine Hand völlig unversehrt war. Die Rötung und das Hämatom waren ebenso verschwunden wie die Einstichstelle der Kanüle. Meine Haut fühlte sich glatt und gesund an.
Merkwürdig, dachte ich und rieb mir ratlos über die Hand. Geistesabwesend wandte ich mich wieder dem Fenster zu. Der anhaltende Regen hatte nachgelassen. Angestrengt starrte ich in das durchgängige Grau, das den Horizont mit Dunkelheit erfüllte, doch die leuchtend rote Silhouette des Mondes war nicht mehr zu sehen.
KAPITEL DREI
Mein Geist
Dass ich ohne schwere Verletzungen davongekommen war, grenzte für viele an ein Wunder. Die Sanitäter behaupteten, sie hätten noch nie gesehen, dass jemand einen so schweren Verkehrsunfall überlebte. Für sie hatte ich unglaubliches Glück gehabt. Meine Eltern sagten, dass ich einen riesigen Schutzengel an meiner Seite gehabt hätte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!