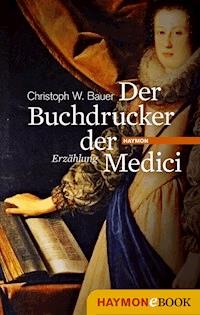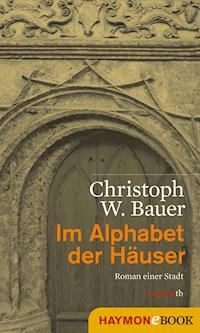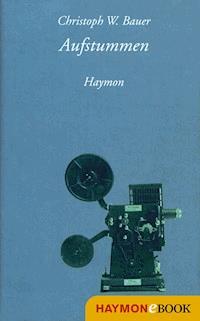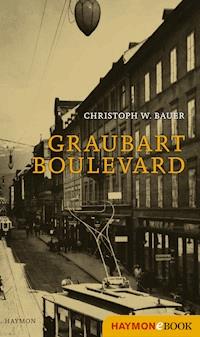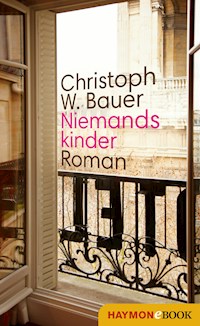Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Dichter mit dem Schlapphut, der Professor mit dem pissgelben Fahrrad, der Künstler in der pikanten Pose, die Schauspielerin und ihr Traum vom Meer - die Figuren in Christoph W. Bauers Erzählungen mögen auf den ersten Blick verschroben wirken. Dabei sind sie vertrauter, als einem lieb ist: Sie trauern verpassten Chancen nach, verrennen sich in Träume, sind unglücklich in ihren Berufen, sprechen von Treue und wandern von einem Bett ins andere, geben sich kühl und erfahren, im nächsten Moment innig und schmachtend. In den unterschiedlichsten Tonarten sprechen sie an, was wir alle kennen: Einsamkeit, Sehnsucht, Liebe und Verlust. Temporeich und direkt sind Bauers Geschichten, manchmal kurz und energisch wie ein Punksong, manchmal eigenbrötlerisch und elegisch wie ein Blick aufs Meer. Dabei oft von einer bestechenden Komik und voll plötzlicher Wendungen, die unversehens den Blick öffnen auf eine Wirklichkeit, die uns alle betrifft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Christoph W. Bauer
In einer Bar unter dem Meer
Erzählungen
Motto
„Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land.“
Ingeborg Bachmann
Zwei plus eins
Der Tag, an dem ich für verrückt erklärt wurde, war der zweitglücklichste Tag meines Lebens. Dabei begann er alles andere als verheißungsvoll. Ich erwachte mit schwerem Schädel, quälte mich aus dem Bett und hinaus auf den Gang, wo ich über ein Fahrrad stolperte. „Schau an“, sagte ich, „schau an, ein Fahrrad, ja, wem mag wohl dieses Fahrrad gehören“, war mittlerweile im Bad und vorm Spiegel, aus dem ein Gesicht mir auf den Kopf zu sagte: „So weit hast du es also gebracht.“ Die mir seit Jugendtagen vertraute Anrede hatte mich nicht schrecken können, dennoch war ich nahe daran, die Kontrolle über meinen Schließmuskel zu verlieren. „Was ist los“, fuhr mein Gegenüber fort, „hat es dir die Rede verschlagen? Wäre es dazu nicht schon viel früher an der Zeit gewesen? Nun beginnt es zu arbeiten hinter deiner Stirn, ich sehe es dir an.“
Zu arbeiten begann es vor allem in meinen Oberschenkeln, sie leiteten ein Zittern ein, das bald den ganzen Körper erfasste. Ich ging etwas in die Knie, Hände am Beckenrand, Kinn zunächst nach unten, dann in Gegenbewegung –
„Gut, ich will dir auf die Sprünge helfen“, hatte mein Vis-à-vis mich wieder unter Kontrolle. „Du hast es gestern Abend erneut verabsäumt, dich zu überraschen, was deinem Dasein vielleicht keinen Halt gegeben, ihm aber zumindest die Haltlosigkeit genommen hätte.“
Mich schwindelte, ich tastete nach dem Kaltwasserhahn, hielt die Hände unter den Strahl. Nur bedingt wurde mir klarer, mutmaßlich jedoch aufgrund der Frage:
„Blond, schwarzhaarig?“
Ich stürmte aus dem Bad, sie war brünett, doch das spielte nun wirklich keine Rolle, ich stieß mich abermals am Fahrrad, wichtiger war, ob sie – fluchend trat ich ins Schlafzimmer, sie schrak auf, sah mich verstört an, was mich kurz aufatmen ließ. Hätte sie mich dann nicht angelächelt, wäre mein Problem zwar nicht gelöst, aber immerhin vereinfacht gewesen, so jedoch hatte ich ein doppeltes, denn nun war ich augenscheinlich zwei. „Du kennst mich also“, keuchte ich, ihr Lächeln fror ein, sie schlug die Bettdecke zurück. Sie stand auf, sammelte ihre auf dem Fußboden verstreuten Kleidungsstücke ein.
„Versteh mich bitte nicht falsch“, stockte ich, „ich kenne dich ja auch, aber –“
„Was du nicht sagst“, unterbrach sie mich, schloss ihren BH. Mir war zum Schreien, sie kapierte einfach nicht, linkes Hosenbein, rechtes, sie zog das T-Shirt verkehrt herum an. „Mona“, sagte ich – „Ach, meinen Namen kennt er auch“ – „Mona, hör auf mit dem Unsinn, schau mich doch an: Das bin nicht ich.“
„Das wünschst du dir nur“, erwiderte sie, maß mich mit spöttischem Blick. Um mich irgendwie zu bedecken, griff ich zum Polster, warf ihn zurück aufs Bett, hatte andere Sorgen. „Jetzt pass mal auf, Johannes Strammer“, fuhr sie fort, „wir wollen kein Drama aus der Sache machen. Warum nicht, das haben wir uns gestern Nacht in der Bar gefragt und sind dann in deinem Bett gelandet. Ein gemeinsames Frühstück hätte ich mir noch erwartet, mehr nicht. Also komm mir nicht mit Sprüchen, es entspräche nicht deiner Art, gleich mit jeder und so weiter, denn eigentlich wärst du ja ganz anders.“
„Dein T-Shirt“, sagte ich und sie, „fick dich selbst“, ich konnte kaum mit ihr Schritt halten, folgte ihr auf den Flur, brüllte: „Dann nimm wenigstens dein beschissenes Fahrrad mit.“ Es gehöre nicht ihr, entgegnete sie, die Wohnungstür fiel ins Schloss.
Ich müsste lügen, wenn ich behauptete, dass ich mich in diesen Momenten besonders wohl gefühlt hätte in meiner Haut. Andererseits spürte ich mit dem Zufallen der Tür eine an Aberwitz grenzende Heiterkeit in mir aufsteigen. Diese fand Untermalung im Ton der Fahrradklingel, die ich nun wie wild betätigte, was ich erst unterließ, als mir der Daumen wehtat. Ich trat wieder ins Bad, „wer sein Gesicht verliert, ohne dass ein anderer es merkt, dem bleibt eben nur noch eine Option“, wurde ich empfangen. Irrtum ausgeschlossen, wer auch immer mir da entgegenblickte, ich war es nicht. Wie also konnte Mona sich so täuschen, fragte ich mich, hörte mein Gegenüber indes sagen: „Tu es ihr lieber gleich. Und ich meine das nicht auf deine Frage bezogen.“
Mag sein, dass die Zurechnungsfähigeren unter Ihnen mich längst der Obhut fachlich ausgebildeter Kräfte anempfohlen hätten. Mir aber reichte die ausweichende Antwort meines Gegenübers nicht aus, mich meines Verstands für verlustig zu erklären. Im Gegenteil, ich fing an, das Gesicht zu erkunden, vorsichtig grimassierend zunächst, bohrte ihm alsdann in der Nase, linkes Ohr, Zunge rechts, furchteinflößendes Fletschen, rechtes Ohr, Zunge links, kraftvolles Zähneblecken, armer schwarzer Kater, wiederholte mein Vis-à-vis dreimal, forderte mich damit heraus zum Blickduell. Ich war ein Trottel, und was ich sah, hat mich zu zwei Trotteln gemacht, erinnerte ich plötzlich einen Vers von Rafael Alberti, konnte es kaum fassen, mein Gegenüber gab auf. Und entließ mich in eine Leere, wie sie nur das Glück auslösen kann, indem es einen für Sekunden von allem befreit. Ohne Mitleid für die Visage, die sichtlich noch unter dem Eindruck Albertis stand, verließ ich also das Bad.
Pissgelb, wie es sonst beschreiben, pissgelb und hässlich war das Fahrrad, es sah nicht aus wie eines, das man abzusperren, geschweige denn in eine Wohnung mitzunehmen hätte. Und auch wenn es absolut nicht zu Mona passte, es musste ihr gehören, so zielstrebig wie sie gestern Nacht darauf zugesteuert war. Da ich ihre Telefonnummer nicht hatte, rief ich ihren Ex an, mit dem mich eine langjährige Freundschaft verband. War froh, dass er erst nach der Auskunft fragte, was ich von der blöden Schnalle wolle, ich verwies auf die schlechte Verbindung, verfiel in alte Denkmuster, legte auf. Mach dich locker, Strammer, dachte ich, mach dich locker, und das war ein Rückfall in ganz alte Zeiten. Zwar blieben mir noch drei Stunden bis zum Vorlesungsbeginn, aber mein soeben an den Tag gelegtes Verhalten riet mir, rasch den geschützten Raum zu verlassen. Auf eine Dusche verzichtete ich aus nachvollziehbaren Gründen, kleidete mich an, und dann nichts wie raus.
Clochard klingt gut, meint aber auch nur Penner, stolz auf diesen Geistesblitz grüßte ich die abgerissene Gestalt, die mir jeden Tag in meiner Straße begegnete, ging die Häuserzeile entlang, vorbei am Supermarkt, dann durch einen kleinen Park. Hier hatte Mona gestern das Rad mitgenommen, ich schrieb ihr ein SMS, verrücktes Weib, dachte ich. Die Euphorie, binnen kurzem gleich zweimal illuminiert worden zu sein, trieb mich ins Stadtzentrum, jetzt wollt ich’s wissen, um es weniger esoterisch zu formulieren. Ich bog in die Fußgängerzone ein, die Straßencafés waren bereits gut besucht, Panflöten-Seufzer stiegen auf, El cóndor pasa im Halb-Playback. Welchen Vogel muss man haben, um an dieser Szenerie Gefallen zu finden, ich sah gut zehn Meter von mir entfernt einen Punk mit hübsch lackierten Spikes. „Johnny Thunders lebt!“, schrie ich in seine Richtung, er sah mich gelangweilt an, „na, Johnny Thunders“, wiederholte ich, intonierte, „Baby, I’m born to lose“, der Irokese tippte sich an die Stirn. Von nun an gab es für mich kein Zurück.
Ich ging zur Universität, die noch verbleibende Zeit bis zur Vorlesung verkürzte ich mir mit Zigaretten, fragte mich, wann ich mit dem Rauchen angefangen hatte und warum, sah mich als Jugendlicher mit gelbgefärbten Haaren einem Freund meine erste Tätowierung erläutern und darüber staunen, dass er meiner Haut zunächst etwas anderes hatte ablesen wollen. Ich spürte ein Jucken und rieb mir immer noch den Oberarm, als ich endlich den Hörsaal betrat, wo man mich bereits erwartete.
„Meine Damen und Herren, ich will mich kurz halten: Ich bin ein Trottel, und was ich vor mir sehe, macht mich zu vielen Trotteln. Welche Lehre ziehen Sie daraus für Ihr Leben? Keine, wie ich befürchte. Denjenigen unter Ihnen, die selbst diese Sätze noch mitschreiben, ist wohl ohnehin nicht mehr zu helfen. Dabei mangelt es auch diesen Fleißigsten unter Ihnen nicht an jenem Häppchen Intelligenz, an dem der Entschluss fett werden könnte, jetzt einfach den Hörsaal zu verlassen. Doch Sie bleiben, sind darauf konditioniert, Ihre Mindmaps zu füllen, so wie ich darauf konditioniert bin, Ihnen das Futter dafür zu liefern, und verzeihen Sie das abgestandene Bild, Pawlow’schen Hunden gleich wedeln wir mit dem Schwanz und verfügen über eine erstaunliche Kondition, um unsere Leistung auf dem Platz zu zeigen. Diese Phraseologie des Sports, an der man sich belustigen kann, wenn ein Fußballspieler beichtet, dass es der Mannschaft nicht gelungen sei, ihr Potential abzurufen, geht einem altbackenen Begriff an der Leine, der Demut. Die ist als frömmelnde Maske des Christentums bekannt geworden, wir unterscheiden zwischen falscher Demut, der es um Effekthascherei geht, und unechter Demut, die der servilen Gesinnung entspringt, dem Kriechertum. Letzteres ist uns ins Gesicht geschnitten, ob hohlwangig oder feist, wir knien ab vor dem Bild, das wir von uns haben und nach dem wir unsere Möglichkeiten ausrichten, wir erwarten von uns dies und das, denn das sind wir uns schuldig – ja was? Und als Antwort darauf erstellen wir Anforderungsprofile, kippen verbrämte Eigenschaften ins Netz, grinsen uns allerorten entgegen und ruinieren jedes innere Aufmucken mit Sprüchen. Arm, fröhlich und Sklave, um es mit Nietzsche zu sagen. Der eine philosophiert mit dem Hammer, der andere mit der Moralkeule, beides ist lächerlich, solange er es nicht weiß. Gut gebrüllt, Strammer, gut, aber was hat das alles mit dem Gegenstand unserer Vorlesung zu tun, mit der Kunstgeschichte, mögen Sie einwenden. Und ursprünglich wollte ich mit Ihnen heute über Il narciso di Caravaggio sprechen, jenes Gemälde, in dem der Künstler – ach, wissen Sie was, schauen Sie es sich doch selbst an! Denn ich wollte mich ja kurz halten, Sie erinnern sich bestimmt noch an meinen ersten Satz. Nehmen Sie ihn persönlich, nehmen Sie ihn so persönlich, wie Sie nur irgendwie können. Aber wahrscheinlich lässt sich auch das missverstehen. Dass ich verrückt bin, wurde mir im Übrigen heute bereits diagnostiziert, geben Sie sich diesbezüglich also keine Mühe.
Ich verließ den Hörsaal, die Uni, betrat mein Stammcafé, setzte mich an einen der Fenstertische, ein Blick zur Seite genügte. „Eine Melange wie immer?“, fragte die Kellnerin, „einen Schnaps“, sagte ich, „und einen für meinen Begleiter.“ Sie zog verwirrt ab, kam aber tatsächlich mit zwei Schnäpsen zurück an meinen Tisch. Ich bestellte eine weitere Runde, bezahlte vier Schnäpse, „alles in Ordnung bei Ihnen?“, zeigte sich die Kellnerin besorgt, „wer von Ihnen will’s wissen?“, fragte ich und ging.
Richtung Stadtzentrum, in die Fußgängerzone, El cóndor pasa, meine Seufzer. Mona hatte sich immer noch nicht gemeldet, ich rief sie an, „lass es gut sein“, so eröffnete sie das Gespräch. Dass ich genau das tue, wollte ich entgegnen, doch sie: „Und wegen dem Fahrrad, es ist wirklich nicht meins. Irgendwer wird es brauchen, stell es einfach wieder dorthin, von wo du es mitgenommen hast. So zielstrebig wie du darauf zugesteuert bist, habe ich gar nicht daran gedacht, dass es nicht dir gehören könnte, wobei die Farbe, naja, aber gedacht habe ich gestern wohl ohnehin nicht viel. Leider. Sei’s drum.“
„Sei’s drum oder leider?“, hakte ich nach, in ihrem Hintergrund erklang Musik, „sag, sind das die Heartbreakers?“, fragte ich. „Komm mir nicht auf diese Tour“, erwiderte sie und legte auf. Mit dem Besetztzeichen im Ohr spürte ich eine an Aberwitz grenzende Heiterkeit in mir aufsteigen, diese Wiederholung, dachte ich, streckte zuerst den Mittelfinger in die Höh, gesellte ihm dann den Zeigefinger hinzu, stand breitbeinig in der Fußgängerzone und grölte: „Victory!“ Der Punk vom Vormittag kam des Wegs, wieder schwer um jene Haltung bemüht, die er von sich erwartete, und als wollte er sich nun solidarisch mit mir erklären, hob er grimmig die linke Faust, es gibt Menschen, die völlig daneben sind, dachte ich. Doch nur kurz durfte ich mich dieser Erkenntnis erfrischen, die so ganz nebenbei meinem bisherigen Leben das ideologische Geläuf entzog, denn eine ältere Dame tippte mir sanft auf die Schulter und meinte: „Ich will mich ja nicht in ihr Privatleben einmischen, junger Mann, aber Sie stehen im Weg.“ Ich bedankte mich höflich, „Ihr Hinweis ist Goldes wert“, sagte ich, er schaffe Freiräume und sollte jeder und jedem nach einem arbeitsreichen Tag auf den Heimweg mitgegeben werden. „Was glauben Sie, wie gut Beziehungen dann funktionieren“, fügte ich hinzu. „Nun ist aber Schluss“, mischte sich ein Herr im Anzug ein, „was machen Sie hier für ein Theater? Moment mal, Sie sind doch, ich kenne Sie“ – „Kann nicht sein“, unterbrach ich ihn, „sonst hätten Sie mir was voraus.“ Er zog schweigend ab, und ich formte die Finger abermals zum Victory-Zeichen.
Wieder in meiner Straße, ich im Supermarkt, in Händen zwei Dosen Bier, klar, warum, mein Plan vordergründig, die Frau an der Kassa machte ihn in gewohnt privatem Ton zunichte: „Holst dir eine Dritte. Zwei plus eins gratis.“ Heute weiß ich, dass in diesen Momenten meine Zukunft auf dem Spiel stand. Und es mag ein Wink des unsterblichen Johnny Thunders gewesen sein, der mich eine dritte Dose mitnehmen ließ.
Auf den letzten Metern zu meiner Wohnung holte mich der Schnaps ein, verlieh mir eine ungeheure Geschmeidigkeit im Knie, ich tanzte dem Penner förmlich in die Arme. „Johnny Thunders lebt“, sagte ich, drückte ihm die Dosen in die Hand, hörte ihn mir nachrufen, „aller guten Dinge sind drei“, ich war nüchtern wie selten zuvor.
In meiner Wohnung griff ich mir das Fahrrad, brachte es zurück in den Park, die Hand noch am Sattel, ließ ich den Tag Revue passieren, Alberti fiel mir ein. Ich dachte an die vergangene Nacht, und da war plötzlich wieder diese Leere, wie ich sie schon einmal gespürt hatte an diesem zweitglücklichsten Tag meines Lebens.
Der Rest ist rasch erzählt, weil schlüssig, sprich völlig normal. Ich ging nachhause, sofort ins Bett, und als ich am nächsten Morgen erwachte, war die Welt um ein paar Monate älter. Da ich zunächst nicht das Gefühl hatte, etwas zu versäumen, verbrachte ich den ganzen Tag daheim. Abends aber rief ich Mona an und fragte sie, ob sie sich mit mir treffen wolle, sie überraschte mich mit einer Zusage. Also zog ich mich an, ging ins Bad, grüßte mein Gegenüber, „ich bin nicht ich“, sagte ich, „aber du bin ich auch nicht.“ Dann verließ ich die Wohnung, schlenderte stadteinwärts, hielt plötzlich inne. Sah schon von weitem, was da auf mich zukam, immer näher rückte, nun vor mir stand: „Herr Doktor Strammer, erkennen Sie mich denn nicht wieder? Ich war vor Ihrer Suspendierung einer Ihrer Studenten“, sagte ein junger Mann und: „Ich war Ohrenzeuge Ihrer abstrusen Rede, die allen im Hörsaal offenbarte, was für ein – mit Verlaub – Narziss Sie doch sind.“ Ich aber hatte nur Augen für das Pissgelb an seiner Seite. „Schönes Fahrrad“, sagte ich.
Die Meidlinger
Die Meidlinger wurde zum Problem. Stets kam sie zu spät, malte sich schrille Farben ins Gesicht und kleidete sich schrecklich, vor allem aber: Sie rauchte. Sich die Lunge zu ruinieren, war ihre Sache, nicht jedoch, dass sie dies während der Arbeitszeit tat. Ihr Schreibtischgegenüber, Raimund Gritschler, hatte mehrmals mitgestoppt: Sieben Minuten verqualmten ungenützt. Und da dies stündlich geschah, läpperte sich einiges zusammen, die Summe der an die Sucht verplemperten Zeit belief sich pro Monat auf eine Stundenanzahl von achtzehnkommasechsperiodisch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!