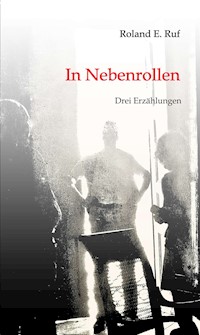7,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Fünf Jahre alt ist Roland, als er in einer kalten Kriegsnacht 1945 mit seiner Familie von Breslau nach Westen fliehen muss. Mangel, Improvisation und Orientierungslosigkeit begleiten fortan seine Kindheit im Karlsruhe der unmittelbaren Nachkriegszeit bis ins frühe Erwachsenenalter hinein. Beharrlich sucht und seinen Weg zwischen verkrusteten Ordnungsvorstellungen und Selbstbestimmung. Das Bild, das er dabei von seiner Familie zeichnet, offenbart den Konflikt zwischen Kriegs- und Nachkriegsgeneration im schlichten bürgerlichen Milieu. Dem "Gespenst Ordnung" begegnet er auf seine Weise: " Vor allem war es das Spielerische und Zufällige, das mich in seinen Bann zog, was es in Gang setzte, welche Welten es erschloss und welche Spielräume sich meiner Neugier und Phantasie öffneten." Präzise, in oft ironisch-kritischen Beobachtungen und Reflexionen beleuchtet der Erzähler, bisweilen mit umwerfender Komik, die Gesellschaft der jungen Bundesrepublik, eng verwoben mit seinen eigenen Lebensentscheidungen. Authentisch und von verblüffender Aktualität!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der Autor
Roland E. Ruf
1939 - 2023
lebte und arbeitete in Freiburg im Breisgau
www.roland-e-ruf.de
Roland E. Ruf
In Ordnung ?
Sequenzen aus einem halben Leben
© 2024 Volker Eck alias Roland.E. Ruf und Inge Reuter-Eck (Hrsg.)
Lektorat, Layout, Cover-Design, Fotografie:
Inge Reuter-Eck
Druck und Distribution im Auftrag des Autors und der Herausgeberin durch tredition GmbH, An der Strusbek 10,
22926 Ahrensburg, Germany
Softcover
ISBN
978-3-384-08148-3
E-Book
ISBN
978-3-384-08149-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Für meine Enkel Jan Philipp und Sanja
« Ordnung ist das halbe Leben - woraus mag die andere Hälfte bestehen?
Heinrich Böll 1959
Sequenzen
Erinnerung zu fassen, erinnerte Wahrnehmung früher und sehr viel später, in gelegentlich sich überschiebenden Gedankengängen, Erinnerungsbildern und Nachbetrachtungen, vom Präsens zum Imperfekt und zurück, vom Ich zum Er, in Aspekten, die sich nach und nach zu einem Lebensbild fügen, - darum geht es in diesen Erzählungen.
Inge Reuter-Eck (Hrsg.)
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
I: 2009
Ankunft 11:58 Uhr
II: Auf dem Weg
Kriegsfolgen
Ein langer Tag
Karlsruhe
Die Ordnung und ich 1
III: Aufbrüche
Na, ich weiß nicht . . .
Oberfeldwebel Winter
Keren
Der Lehrer
Die Ordnung und ich 2
IV: Unterwegs
Rolands Reise
Dresden 1972
Der Zug verkehrt stündlich
Anhang
In Ordnung?
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Ankunft 11:58 Uhr
Anhang
In Ordnung?
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
I
2009
Ankunft 11:58 Uhr
Soeben noch im Dämmerlicht der Bahnhofshalle, blendet die Mittagssonne auf dem Vorplatz. Vor mir, neben mir abgestellte Fahrräder, eilende, bummelnde Passanten, die zu Stadtbahnen oder in Gegenrichtung zu den Zügen streben. Schemenhaft im ersten Moment.
Angekommen in meiner Heimatstadt an einem Mittwoch im Oktober 2009, einem sonnigen und warmen Herbsttag.
Das Auge braucht Zeit, um sich an die Fülle des Lichts zu gewöhnen. Jetzt erst überblicke ich den Vorplatz. Er wirkt wie aufgeräumt. Eine breite Zone vor dem Bahnhofsgebäude ist nun Fußgängerbereich, flankiert von Tischen und Stühlen vor Cafés und Imbissketten unter Sonnenschirmen. - Kein Durchgangsverkehr teilt mehr den Platz wie vor Jahren.
Schon lange war ich nicht mehr in Karlsruhe.
Am Rand dieser Zone entdecke ich einen freien Tisch. Der Kellner, ein ältlicher Typ, eilt herbei, und ich bestelle Milchkaffee. „Sehr wohl, der Herr. Vielleicht auch ein Butterhörnchen dazu?“ - „Gute Idee!“ - „Darf ich im Voraus kassieren? Vierfünfzig der Kaffee, zweiachtzig das Hörnchen, macht siebendreißig.“
In kurzen Schritten tänzelt er um Tische, rückt da und dort Stühle zurecht. Die Körperhaltung und sein altertümlich höflicher Ton passen geradezu zum Ambiente - Gebäude der Gründerzeit in gelblichem Sandstein.
*
Karlsruhe ist eine vergleichsweise junge Großstadt, 1715 gegründet. Es gibt zwar keinen Altstadtkern, aber imposante Straßenzüge und Bauten, vor allem die klassizistisch anmutenden. Der Name Friedrich Weinbrenner hat sich mir eingeprägt, Baumeister der Markgrafen von Baden-Durlach, seit 1803 Großherzöge des Landes Baden. Er hat wesentlichen Anteil am architektonischen Bild der damals neuen Residenzstadt.
Neuere Stadtplanung hat die Parkzonen auf die Südseite hinter dem Bahnhof verlegt und das Schienennetz der Straßenbahn ausgebaut. Bereits seit den Sechzigerjahren auf Normalspur-Gleisen, verkehren die gelben Bahnen problemlos auf den Schienensträngen der Bundesbahn bis weit über die Stadtgrenzen hinaus - Richtung Schwarzwald, ins Murgtal bis Freudenstadt, in die Rheinebene, nach Bruchsal… wie schon vor Zeiten, als ich mit Schülergruppen unterwegs war, um die Geologie des nördlichen Schwarzwalds zu erkunden.
Als ich den Bahnhofsvorplatz Richtung Stadtgarten überquere, umgeben mich die gewohnten Eindrücke: das gleiche Licht, der gleiche Schattenwurf der Gebäude wie stets zu dieser Jahreszeit. Sogar der Geruch, der in der Luft liegt, von einem leichten Südwestwind getragen, kommt mir vertraut vor. Seit jeher haben Gerüche und der Einfall des Lichtes für mich eine besondere Rolle gespielt. Seltsam, wie sie nun die frühen Jahre nachklingen lassen.
Hinter der Arkadenreihe befindet sich noch immer der Einlass zum Stadtgarten. Die Grünanlage mit ansprechenden Gartenbereichen, westlich um zwei kleine Seen, auf der östlichen Seite ergänzt vom Zoogelände um den Lauterberg, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geplant, als die Stadt noch an der Kriegsstraße endete, die sie heute als B10 durchquert.
*
Eher als die Stadtgeschichte bedrängen mich aber im Moment Erinnerungen an Sonntagsspaziergänge hier im Stadtgarten. Die endeten meist bei Darbietungen örtlicher Chöre und Musikvereine. Wir wären lieber bei den Seehunden geblieben. Die jüngeren Geschwister liefen an der Hand der Eltern, wir drei älteren trotteten hinterher. Die Familie bleibt beisammen! befahl der Vater. Der Fotoapparat hing am Riemen vor seiner Brust. Entsprechend ungezwungen fielen die verordneten Aufnahmen von seiner Kinderschar aus.
Älter geworden und nicht mehr zum Sonntagsspaziergang verpflichtet, zog mich das Leben am Hauptbahnhof, von der Wohnung in der Südendstraße in zwanzig Minuten zu erreichen, magisch an. Mit einem ‚Groschen‘ für die Bahnsteigkarte am Automaten begann für mich in der kreuzförmig angelegten Halle der Traum vom Reisen, begleitet vom Sound der Zugansagen und dem Rauschen der Klappanzeigen an der großen Tafel über dem Zugang zur stinkenden Unterführung. Damals, in den Fünfzigerjahren, meine Bahnhofsatmosphäre!
Heute bestimmt in der Unterführung der eilige Klang der Rollkoffer die Geräuschkulisse.
Vorhin überholte mich ein Junge mit Löchern in den Jeans, überlangem Shirt und verschwitzter Kappe, über Stufen springend auf der Treppe zur Unterführung und begann, noch im Laufen, am Handy zu werkeln.
Auch ich eilte im Pulk der Angekommenen um Bestuhlungen und Schauvitrinen, in einer Wolke aus anregenden Kaffee- und Grilldüften, übernutzten Bratfetten und Ölen. Schließlich öffnete sich der Tunnel zur Bahnhofshalle, einer Oase des Konsumangebots unter ihrem denkmalgeschützten Tonnengewölbe.
Die Barriere und die Kabinen für die Fahrkartenkontrolleure gibt es schon lange nicht mehr. Hier hatte man die Fahrkarte oder die Bahnsteigkarte vorzuweisen, sowohl beim Zugang zu den Zügen als auch beim Verlassen des Bahnsteigs. Im Stau vor den Kabinen schauten manche nervös auf die Uhr über der großen Tafel, belauert von Gepäckträgern. Wehrte man denen nicht, nahmen sie die Gepäckstücke der soeben Kontrollierten auf. Zu Gleis 3 bitte! oder - zum Taxistand!
Auch die Gepäckträger fehlen heute. Rollkoffer haben sie aus dem Job gedrängt. Und Rolltreppen! Eigentlich - denn an meinem Bahnsteig gab es keine, nur ein Gepäckband, das stillstand.
Unter dem Tonnengewölbe der Bahnhofshalle kam die Erinnerung. Ich sah mich als jungen Mann mit meiner Bahnsteigkarte in der Reihe zur Fahrtkartenkontrolle anstehen. Mehr als fünfzig Jahre ist es her. Als jungen Mann, der sich vorzustellen versuchte, wohin ihn die Reise von Gleis 3 führen würde. Neue Fernzüge – stromlinienförmige Diesel-Lokomotiven, in Form und Farbe eine Einheit mit den Wagen - verbanden wieder entfernte Ziele. TEE war die Formel des mondänen Reisens.1
Am Bahnsteig stehend, verschmolz mein Spiegelbild im Fenster des Speisewagens mit den Schirmlämpchen auf einladenden Tischen. Beim Anrollen des Zuges zogen die Schirmlämpchen beschleunigt vorbei und ließen mich zurück. Aber in einem war ich sicher: Die Zukunft würde mich in die Ferne tragen - mich, den Schwarzfahrer in Gedanken, neben dem anrollenden Zug Richtung Süden. Ich fühlte die Bahnsteigkarte in der Hosentasche und hätte es gerne versucht, einmal nur - wirklich nur einmal! - bis zur nächsten Station zu gelangen. Und dann im nächsten Personenzug zurück nach Karlsruhe. Was hätte ich auf dem Bahnhof in Rastatt oder Baden-Baden auch getan?
Gestoppte Phantasie eines ängstlichen jungen Menschen. Was ich vom Bahnhof mitbrachte, gerollt unter dem Arm, das war die Wochenendausgabe einer namhaften Zeitung. Ein bisschen Flair der großen Welt demonstrierend, eher mir selbst als der Umgebung.
Bis heute sind mir Bahnhöfe vor allem eins geblieben: Verkehrsknotenpunkte und Sehnsuchtsorte. Die üblich gewordene Ausstattung empfinde ich als sinnlose Fülle. Mit einem Apfel und zwei Mettwurstbroten bin ich für die nächsten Stunden hinreichend ausgestattet. Für den Weg in meine Vergangenheit.
*
Automatisch schlage ich die gewohnte Richtung zum Kolpingplatz ein - dem Revier meiner Kindheit. Erwartet werde ich nicht. Das unterlegt dem Erinnern keine Absicht und beschleunigt nicht den Schritt.
Vom Kolpingplatz über die Leibnizstraße zur Südendstraße: Südende der Stadt? Das war einmal um die Jahrhundertwende! Schon im Näherkommen erkenne ich die Front des Hauses mit der Nummer 14. Es sieht aus wie ehedem. In den Dreißigern des vergangenen Jahrhunderts dem Nachbarhaus angefügt, mutete es in meiner Jugend neben den Häusern aus der Gründerzeit geradezu modern an. Westlich ist der große Garten mittlerweile überbaut, die Häuserzeile geschlossen. Das Haus, in dem ich gewohnt habe, ist jetzt eines unter anderen, eher gesichtslos im Gegensatz zu manchen in der Straße.
Ein paar Häuser weiter hatten Ines‘ Großeltern gewohnt. Sie und ihr jüngerer Bruder verbrachten hier die Nachmittage und gehörten bald zu unserer Kindergruppe.
Ich überquere die Straße und stehe jetzt direkt vor der Nummer 14.
Von Bomben beschädigt, war das Haus nach der Währungsreform wieder aufgebaut worden. Kostengünstig und zeitsparend, denn es war rasch Wohnraum zu schaffen. Balkendecken zwischen den Etagen, unten Strohmatten an Latten als Putzträger, oben rohe Holzdielen mit Linoleum belegt. Dazwischen kaum Isolierung. - Die Tritte der Nachbarn über uns waren in alle Richtungen zu verfolgen, ihre Stimmen deutlich zu unterscheiden.
Meine Familie war froh, 1950 die Wohnung im Erdgeschoss zugewiesen zu bekommen. Der Wohnungsmarkt war noch reguliert und sie erschien uns wie ein Glückslos, diese Dreizimmer-Wohnung mit 90 Quadratmetern für vier Erwachsene, - Oma, Opa, meine Eltern – und uns drei Kinder. Ich war das älteste und gerade mal 10 Jahre alt.
Die Kinderschar wuchs auf fünf, die Quadratmeterzahl blieb. Es ging eng zu.
Das alles liegt nun Jahrzehnte zurück. Wie mag das Haus heute im Inneren ausschauen? Eventuell wird es ein Baulöwe aufgekauft und in dämmende Zwischendecken investiert haben. Die Einfachverglasung der Fenster hat er vielleicht durch Doppelscheiben ersetzt, die Kohleöfen in den einzelnen Räumen durch eine Zentralheizung. Ob man auch die rückseitigen Loggien in den Umbau einbezogen hat? Die Bäder mit WC waren eng, die verglasten Loggien dahinter Abstellräume. Vermutlich wurde nur das Unumgängliche veranlasst. Die günstige Lage zwischen Innenstadt und Bahnhof im Südwesten der Stadt ist attraktiv genug.
Stehen im Hof noch die drei Pappeln vor der hohen Mauer? - Ihr abfallendes Laub und die wattigen Flugfrüchte häufte der Luftzug zu Wällen, aus denen wir Kinder Material für lustige Perücken und fellige Behänge an unserer farblosen Kleidung gewannen. Mutter und Großmutter zeigten kein Verständnis für solchen Spaß.
Ich schleiche über die Garagenzufahrt von Nummer 12 zur Hofseite, um unser Haus von hinten zu betrachten.
Den weißen Angorakater hinter dem Fliegendrahtgitter im Küchenfenster der Witwe Schröder im Erdgeschoss wird es längst nicht mehr geben, die zu uns Kindern unfreundliche Frau auch nicht mehr. Lautstark schimpfte sie, wenn das nervöse Tier, das keinen Freilauf kannte und hinter dem Fliegendraht der Illusion eines Katzenlebens nachhing, uns fauchend verriet, sobald wir unter ihm an der Hauswand vorbeihuschten. Wir zwängten uns dann durch die Gitterstäbe der Begrenzung zwischen beiden Höfen, um das Läuten an der eigenen Türglocke zu vermeiden. Mutter und Großmutter hatten sich zum Mittagsschlaf hingelegt. Von hier aus konnten wir Großvater Zeichen geben, die Wohnungstür zu öffnen. Der schrieb in der Regel an Notenblättern für den Kirchenchor von St. Elisabeth, den er leitete.
Unsere Kinderhorde hatte eigene Vorstellungen vom Umgang mit der Zeit, die spontanen Einfällen und Möglichkeiten Raum gab – und die waren der Grund, uns heimlich zu entfernen und ebenso heimlich zurückzukehren. Dazu gehörte auch das stille Warten auf die anderen in kaum einsehbaren Winkeln. Wir hockten vor Kellerfenstern, saßen auf Treppenstufen zu Waschküchen, tauschten Autobilder und steigerten uns in Superlative kindlichen Schwärmens: der schnellste Sportwagen, die spannendste Abenteuerreise, das dickste gelesene Buch, der blödeste Lehrer. - Die Hausaufgaben konnten warten.
Wir waren Kinder der Nachkriegszeit, entzogen uns dem Zusammenleben in überbelegten Wohnungen. Straßen und Höfe waren unser Raum des Sich-Erlebens. Mit ihren Zufahrten zu Garagen, Remisen und Werkstätten kleiner Betriebe waren vor allem die Höfe mit ihren Begrenzungsmauern und Flachdächern unsere Rückzugsgebiete.
Eine Kinderkultur, für die niemand plante, die keine Sozialhelfer kannte. Dennoch trieben wir uns nicht ideenlos und gelangweilt herum. Das schien nur denen so, die müßig in den Fenstern lehnten. Keine Seltenheit an Nachmittagen und langen Sommerabenden. Im Hintergrund lief das Radio, oft ein Hörspiel, das allerdings kaum einer der Fenstergucker verfolgte, denn deren Aufmerksamkeit galt der Straße. Wenn dort etwas Unerwartetes geschah, lehnten sie sich weit vor, selbst wenn es nur zwei Hunde waren, die sich ankläfften.
Das Wirtschaftswunder glitt an ihren mageren Einkünften vorüber. Fernsehen war noch nicht üblich. Nur wer es sich leisten konnte, dem leuchtete von 18 bis 22 Uhr das zuckende blaue Licht der Mattscheiben das Wohnzimmer aus, beobachtet von neidischen Nachbarn.
Im Viertel gab es Begüterte in großen Wohnungen, denen Bombenkrieg und Flucht nicht alles genommen hatten. Wie konnte es sein, dass sie vom Wohnungsamt übersehen wurden? Das habe ich mich als Kind gefragt, das in einer zugewiesenen Flüchtlingsfamilie die zwangsweise Bewirtschaftung von Wohnraum erfahren hatte, auch den Streit der Erwachsenen um die Nutzung der gemeinschaftlichen Räume wie Küche und Bad. Erst recht, wenn es kein Bad gab, dann war die Küche auch Waschraum. Das traf für eine Vielzahl älterer Häuser zu. Den morgendlichen Andrang mit Kulturbeutel, Waschlappen und Handtuch über der Schulter kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Gewöhnung der Kinder an Hygiene . . . kleingeschrieben! Der nasse Waschlappen genügte uns am Morgen.
Im Eckhaus zur Leibnizstraße hatte man großbürgerliche Wohnungen so aufgeteilt, dass zwei Familien mit Kindern unterkommen konnten. Im gleichen Haus bewohnte ein ehemaliger Rechtsanwalt mit seiner Lebensgefährtin und einer Haushälterin das Sechs-Zimmer-Appartement. In der Etage darüber teilten sich drei Familien die Räumlichkeiten. Allerdings hatte keines der je zwei Zimmer weniger als zwanzig Quadratmeter. Die herrschaftliche Küche, die Nebenräume wie Speise- und Hauswirtschaftskammer, das geräumige Entrée und der lange, gewinkelte Korridor wurden gemeinsam benutzt. Das erzwang Absprachen und Rücksichtnahme.
Kam ich bei schlechtem Wetter zum Spielen mit dort wohnenden Nachbarskindern in das Haus, ermahnte mich die Haushälterin des greisen Anwaltspaares, die Schuhe gründlich abzutreten und leise die Treppe hinaufzugehen. Dabei hatte sie die Etagentür immer weit geöffnet, und ich gewahrte staunend die geschmackvolle Ausstattung im Entrée. Einen Biedermeierschrank, die entsprechende Sitzgarnitur und Orientteppiche auf wachsglänzendem Parkett. Eine andere Welt! Seitdem hege ich eine Vorliebe für antike Möbel und wertvolle Teppiche.
*
Was der Südwesten der Stadt in den Grenzen seiner Bebauung für mich einmal war, ist heute auf dem Stadtplan nur mühsam nachzuvollziehen: Neubaugebiete, Industrie- und Gewerbezonen, Umgehungsstraßen, Autobahnzubringer und neue Straßenbahntrassen haben ältere Industrieanlagen beschnitten, die heute anderen Zwecken dienen2, Kleingartengebiete, Sportplätze, Felder, Brachzonen mit Gebüsch und Tümpeln verdrängt.
Als wir etwas älter geworden waren, fand dort auf stillen Wegen erstes Flirten statt: Hannelore mit Norbert, Uschi mit mir. Sobald sich unsere Blicke trafen, sich gar die Hände berührten, hatten wir ein Geheimnis, das so lange bestand, bis sich Uschi mit Gerald aus der Clique zu solchen Spaziergängen absetzte. Das schmerzte, war aber beim Völkerball-Spiel vergessen, sobald der Ball wiederholt die Richtung zu mir nahm. Dann also Evelyne!
Wo sollten sich heute Nachbarskinder treffen zum Rollschuhlaufen, das Radfahren zu üben, zu Ballspielen? - Die Straßen sind zugeparkt! Wo fänden sie Winkel auf Höfen, Hecken in verbotenen Gärten für das Versteckspiel und erste Flirts? - Die offenen Flächen sind überbaut! Kein Sitzen mehr auf Sandsteineinfassungen vor Schaufenstern. Die alten Geschäfte sind aufgegeben und ihre Räume anderweitig genutzt.
Die Gruppenbildung von Kindern und Jugendlichen ist in der Sprache von Städteplanern auf Funktionsflächen verlagert: Bolzplätze, Half-Pipes und Abenteuerspielplätze mit Klettergeräten und der Phantasie Erwachsener entsprungene ‚Abenteuerbauten‘ geben je nach Altersgruppe die Nutzung vor.
*
Die Spielkameraden und ersten Flirtpartnerinnen sind längst verzogen. Herbststimmung, nicht nur in der Natur! Heute wird mir das klare Licht genügen, das die langen Schatten wirft, die Stadt Kulisse zu meinen inneren Bildern sein lässt. Ich gehe weiter, biege in die lange Hirschstraße ein, die zur Innenstadt führt. Ich hätte die Straßenbahn nehmen können, doch die Füße finden von selbst den Weg.
Und nun auf der Hirschbrücke die hier nicht zu unterdrückende Erinnerung an Ines. In der nächsten Querstraße hat sie gewohnt. Dort ist sie längst nicht mehr anzutreffen, war sie damals schon nicht mehr allzu lange. Dennoch gehe ich auf das Haus zu, zögere und überfliege schließlich die Klingelleiste.
Ergebnislos . . . und beruhigend. - Was hätte ich andernfalls getan? Das Aufspüren verwischter Beziehungen verklärt das Erinnern – eine Art Alterskrankheit. Trotzdem berührt mich hier die Frage, was wäre gewesen, wenn Ines und ich uns über das erlaubte Maß angenähert hätten?
Ausgeschlossen! Für sie war das nie eine Option. Da bin ich mir heute sicher.
Mir musste das Gefühl genügen, neben ihr zu gehen, neben ihr im Kino zu sitzen, auch im kleinen Kellertheater an der Waldstraße, danach ihr gegenüber im Restaurant. Gegenseitiges Berühren war unausgesprochen tabu. Das Milano in der Nähe der Hauptpost3 war unser Stammlokal. Weiß eingedeckte Tische, appetitanregende Gerüche, eine dezente Bedienung und Gäste, die sich ein besseres Ambiente leisten konnten. - Wir eigentlich nicht!
Bald kannte uns der Ober und servierte von sich aus Johannisbeersaft. Ein ewig lächelnder Mensch, dünn wie seine lange Nase. Die war das Erste, was bei seinen angedeuteten Verbeugungen und dezenten Gesten auffiel. Vermutlich tat er so, weil ihn unser Auftreten amüsierte. Ines, in Rock und Bluse oder Kleid, ließ sich von ihm den Mantel abnehmen. Ich stand verlegen schweigend hinter ihr, trug Krawatte und erwartete seinen Hinweis auf einen freien Tisch.
Nach Abschluss der Lehre verfügte ich über ein schmales Gehalt und bestellte an besonderen Tagen Spätburgunder, bevor er mit den Saftfläschchen kam. Das Besondere solcher Tage weiß ich nachträglich nicht zu erklären, es war ein Gefühl.
Vermutlich ist es der Unterschied von Sein und Dasein gewesen, meiner damals aktuellen Sartre-Lektüre entnommen, über den ich im Dunst meiner Gauloises schwadronierte. Hatte ich meinen Monolog abgeschlossen, berichtete Ines über ihr zuletzt gelesenes Buch. Ein Titel ist mir beispielhaft im Gedächtnis geblieben: Die Zitadelle von Cronin. Alles, was mit Literatur zu tun hatte, schien sie zu interessieren – zumindest glaubte ich das.
Sprach ich gelegentlich nicht und hörte ihr zu, beschäftigte mich ihr ruhiger Blick aus graugrünen Augen, dem ich zu entnehmen meinte, was sie für mich empfand. Eine Illusion! Das stellte sich regelmäßig beim Abschied heraus, wenn sie den Schlüsselbund aus dem Handtäschchen zog, die Haustür öffnete und mir dezent zuwinkte.
So bin ich heute in Gedanken dort angelangt, wo ich schon einmal gewesen bin. Was band mich so sehr an Ines? Ihr Äußeres alleine war es nicht, obwohl ihre Figur meine Phantasie beschäftigte und ich ihre eleganten Bewegungen bewunderte, ob sie den Rock glattstrich oder den Stuhl zur Seite schob. Auch ihre Ruhe und Sicherheit in Sprache und Gesten sind nur ein Teil des Bildes. Ines, mit siebzehn damenhaft perfekt und schier jeder Situation gewachsen, war für mich in der Summe ihrer Reize das weibliche Idealbild. Neben ihr kam ich mir vor wie ein zurückgebliebener Knabe. So sah sie das wohl auch.
Die nächste Zigarette im Mundwinkel, nuschelte ich meine Sätze, hüllte Ines in Qualm und bestellte Mineralwasser nach. Nur noch ein Glas bitte, sagte sie hüstelnd und wedelte gegen den Rauch. Danach gingen wir und sprachen kaum während der zwanzig Minuten auf dem Weg durch die Stadt. Sie hängte sich bei mir ein. Das gehörte sich so zu jener Zeit bei Dunkelheit. - Die einzige Berührung, die Ines mir erlaubte.
Ich spürte den Druck ihres Armes, das Schwingen des Beckens, wenn sie oder ich aus dem Gleichtakt der Schritte geriet. Mal empfand ich mich auf dem Trottoir schwebend, mal stolperte ich über das Pflaster unter der Last meiner unausgesprochenen Wünsche. In der Nacht träumte ich, wie wir auf einer Decke im Freibad Rüppurr liegen, sie mich mit der großen Zehe an der Wade kitzelt, über meine Verlegenheit lacht, mir die Hand hinhält und mich hochzieht, um zum Schwimmbecken zu gehen.
Auch das eine Illusion! Schwimmen konnte ich damals gerade einmal fünf Meter weit, brauchte den Beckenrand zur Sicherheit und mied möglichst den gemeinsamen Besuch von Freibädern. - Zu peinlich!
*
An der Kaiserstraße angelangt, erstehe ich aus der Wühlkiste einer Buchhandlung ein Bändchen mit Heine-Gedichten, setze meinen Weg Richtung Schlossplatz fort, stehe in der Hans-Thoma-Galerie vor dem Gastmahl des Platon und habe plötzlich keine Lust mehr auf weitere Bilder.
So schlendere ich durch den Botanischen Garten, finde eine freie schattige Bank gegenüber der Glasfassade des Gewächshauses und beginne in der Sonne dieses warmen Herbsttages im Büchlein zu blättern, bis ich an diesen Versen hängenbleibe:
Geh nicht durch die böse Straße, Wo die schönen Augen wohnen – Ach! Sie wollen allzugütig Dich mit ihrem Blitz verschonen. Grüßen allerliebst herunter Aus dem hohen Fensterbogen Lächeln freundlich (Tod und Teufel!), Sind dir schwesterlich gewogen.
Eine ältere Dame steuert die Bank an, sieht mich lesen und setzt sich zögernd. Mir scheint, als suche sie nach einem Blick auf mein Büchlein das Gespräch. Ich reagiere nicht, lese weiter, blicke zwischendurch in den mild-blauen Oktoberhimmel.
Doch du bist schon auf dem Wege, Und vergeblich ist dein Ringen; Eine ganze Brust voll Elend Wirst du mit nach Hause bringen.
Ja, so habe auch ich empfunden! Mal für Mal.