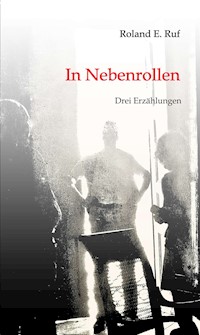4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachgereicht - eine biographische Collage. Im Zentrum ein junges Paar, Rita und Roland, das just während der Unruhejahre 1966 bis 1968 in ein gemeinsames Leben stolpert. In der nordbadischen Provinz abseits der Brennpunkte des Protests sind sie auf der Suche nach beruflicher und familiärer Identität, nach ihrem Platz in der Gesellschaft. Die Handlung entwickelt sich entlang der Widersprüche aus ihren unterschiedlichen sozialen Milieus, zwischen bürgerlicher Anpassung und Aufbruch. Der Zeitrahmen reicht bis in die Gegenwart. Die nächste Generation ist längst erwachsen und konfrontiert ihre Eltern mit neuen Widersprüchen. Der Wandel zu einer vernetzten Welt paust sich bis in den Alltag durch. Das alles verunsichert nun auch Rita und Roland in Beruf und Familie. Wie sollen, können sie darauf reagieren? Der Roman überzeugt durch anschauliche Erzählsequenzen, durchaus mit Humor, und nimmt den Leser mit in Rolands geliebte Landschaft der Rheinebene. Nachgereicht - auch in zeitgeschichtlichen Bezügen ein Beitrag, als Elterngeneration nicht sprachlos zu bleiben, Einblicke zu geben. Nach wie vor aktuell!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Autor
Roland E. Ruf * 1939lebt und arbeitet in Freiburg im Breisgau
www.roland-e-ruf.de
Roland E. Ruf
NACHGEREICHT
Roman
© 2020 Roland E. Ruf
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg Gestaltung und Illustration: Inge Reuter-Eck
ISBN
Paperback:
978-3-347-09744-5
Hardcover:
978-3-347-09745-2
e-Book:
978-3-347-09746-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für Inge, Ulrike…..und die Rheinebene
Voraus
Freitag, 28. Juli 2006
Warum bin ich nicht dort, wo die Anderen sind? Franziska hat mir verständnisvoll zugenickt, als ich mich über einen Nebenweg aus dem Trott der Trauergemeinde davongeschlichen habe. Ich mied jede Begegnung, streifte über Wege und atmete im Duft der Bäume und Sträucher. Für Momente blieben die bedrängenden Bilder hinter mir. In der Stille des Friedhofs fand ich die Ruhe, die mir jetzt gut tat in meiner aus den Fugen geratenen Welt.
Was sollte ich auch sprachlos bei Kaffee und Kuchen im Belvedere? Wie eine Statue säße ich Pfarrer Kunz gegenüber, zwischen unseren Töchtern und deiner Schwester Maria mit Jens. Bedrückende Stille – selbst die Kellnerin flüsterte. Hie und da ein Satz über klappernde Tassen hinweg - mit scheuem Seitenblick zu mir. Einzelne zögen Familienbilder hervor. Leise Gespräche kämen auf. Manch einer sähe verstohlen auf die Uhr. Die Trauerstimmung bröckelte. Und immer wieder die Beteuerung, wie sehr man mit mir und den Töchtern fühlt, dass du uns allen fehlen wirst.
Trauerrituale, weitab von dem, was ich jetzt brauche. Ich hasse Klischees. Ich hasse Fragezeichen. Ich hasse mich. Man müsste mich hier sehen – besser nicht! Die Einzige, die mir begegnen dürfte, gibt es nicht mehr. Oder doch? …Rita, als ich deine Urne auf dem Brett absetzte - ich ließ es mir nicht nehmen, sie selbst zu tragen - und in das ausgehobene Erdloch schaute, war ich bereit, wieder vorauszudenken. Doch dann hallte der Klang jeder geworfenen Schaufel Erde wie ein entfernter Aufprall in mir nach. Mit den Rosen in Händen, die mir Anna gereicht hatte, harrte ich aus. Rosen, die du in allen Farben so sehr liebtest. Als Letzter ließ ich sie auf deine Urne gleiten und wartete, bis sich die Trauergemeinde auf dem Weg zum Belvedere zerstreute.
Zurück auf dem Vorplatz in die Geräusche der Stadt, wusste ich, dass mir einer fehlt: Pater Thomas, ein außergewöhnlicher Mensch und Freund seit meinen ersten Tagen in Bruchsal. Nie ein scheeler Blick, nie ein mahnendes Wort an mich oder Rita, als wir unverheiratet zusammenlebten. Gewiss hätte er mich auch jetzt begleitet, wenn er das könnte. Selbst sein Schweigen wäre mir Trost.
In meiner Klause angelangt, habe ich zur Whiskyflasche gegriffen, statt vor der Ansammlung in Schwarz Gefühle preiszugeben, zu hören, dass du nicht zu ersetzen seist. Das braucht mir keiner zu sagen. … Was ich jetzt brauche, ist Musik! Musik, die meine Stimmung trägt. Bach? – Als das Streichquartett in der Aussegnungshalle die Aria aus den Goldberg-Variationen spielte, hat mich das eher aufgewühlt als getröstet. Ich weiß doch, was dir Bach bedeutet hat! Nein, jetzt lieber Fado zum Whisky! – Dieser melancholische Gesang aus Portugal.
Du bei weichen Fadoklängen? Und ausgerechnet mit Whisky, den du nie angerührt hast?
Ich höre dich geradezu! Dann würdest du lauthals lachen. Dein Lachen täte mir gut!
Weshalb habe ich deine Asche nicht vom Boot in den Fluss, aus der Ballongondel auf Felder gestreut? Das wäre natürlich gewesen. Am Montag, dem ersten Montag im August - an unserem Tag! Aber ich hätte nicht zusehen können, wie sie aus der Urne rieselt und vom Wind mitgenommen in der Luft verwirbelt. Der Rest eines Menschen, den ich geliebt habe – ja, immer lieben werde!
Vom Korridor höre ich deine Schritte, als wärst du soeben zurückgekehrt, im Schrank hängen deine Kleider, dein Bett ist frisch bezogen. Ich glaube nicht an Übersinnliches und spüre doch deine Gegenwart.
Das Telefon läutet. Ich bin nicht da und öffne das Fenster im Schlafzimmer.
Ich werde wieder unter Menschen gehen - ins Theater, ins Kino nach Karlsruhe und zwei Karten kaufen. Der leere Platz neben mir ist nicht frei, entgegne ich dem, der mich fragt.
Sage nicht, das fändest du unnatürlich! Aber was ist schon natürlich? Nicht ein hinter der Kurve liegengebliebener Sattelschlepper und erst recht nicht dein Tod im brennenden Auto.
Als ich dich noch einmal sehen wollte, nahm mich der Bestatter in die Arme, ließ mich nicht zu dir, … nicht zu dem, was es von dir noch gab. So bleibe mir dein Bild erhalten, meinte er, und seine Augen waren feucht.
Wie recht er hatte! Rita, du bist gegangen und doch so nah.
Zu nichts entschlossen stehe ich vor dem Schreibtisch und nippe am Whisky, schalte aus Gewohnheit den Computer ein: Wellen schäumen über felsigen Strand in eintönig wiederholten Sequenzen.
Worauf warte ich?
Vom Bildschirm halb verdeckt, die verblichene, an zwei Klammern aufgestellte Postkarte der Nanna - Feuerbachs Gemälde aus der Karlsruher Kunsthalle.
Und schon ist die Erinnerung wieder da!
Am Samstag unserer ersten Woche sind wir dort gewesen. Nach der Hektik der Ereignisse hatte ich eine Auszeit vorgeschlagen. Eine spontane Idee, um die Angst zu verdrängen, unser ‚Kartenhaus‘ könne einfallen. So hattest du am Morgen deinen Zustand beschrieben. Dann standen wir lange vor der Nanna. Ich kaufte sie mir anschließend als Postkarte. So hätte ich am Schreibtisch immer auch dich vor Augen, sagte ich. Lachend hast du gemeint: Wozu das Bildchen? Du hast mich doch ganz real!
Schaue ich mir die Karte heute an - vierzig Jahren danach, Rita! - und vergleiche die Nanna mit dem Bild, das mir von dir geblieben ist, hat sie wenig bis nichts mit dir gemein: Zu groß die Nase in einem flächenhaften Gesicht, das kaum eine Spur von Leben zeigt. Auch ihre Hand ist nicht feingliedrig wie deine Hände, und abschreckend hell ihr Teint. Zu Feuerbachs Zeiten vielleicht ein Schönheitsideal, für mich nicht mehr vorstellbar, dass ich mich dem Leib eines solch fahlen Weibes hingegeben hätte.
So früh schon eine Gedenkecke für mich in deiner Klause? Ja, du warst es, die das Wort „Klause“ gebraucht hatte, als du zum ersten Mal vom Hof aus am Haus hinaufschautest. Ich war mir nicht sicher, wie du das meintest. War das schmucklose, graue Gebäude dir zu einfach – dir, der Tochter aus gutem Haus? Verunsichert war ich auch, wenn du mich später ironisch „Bürgerschreck“ genannt hast, sobald ich mich den üblichen Auftritten in Anzug und Krawatte entzog, und ließen die sich nicht vermeiden, mich abseits hielt.
Lappalien!
Es gab Wesentlicheres, was uns unterschied. Gewiss erinnerst du dich an unser nervendes Debattieren in jener Zeit des Aufbruchs aus einer verkrusteten Nachkriegsgesellschaft. Ging es um Reformen, bist du wenig aufgeschlossen gewesen. Hinter so manchen meiner Ansichten wittertest du den Einfluss meiner Studienfreunde in Heidelberg. Die waren dir zu links-ideologisch. Du befürchtetest sogar, ich könne dich verlassen, um mich der Protestbewegung anzuschließen.
Blicke ich zurück, meine ich, du hattest keinen Grund, mich in die linke Ecke zu stellen - mich, den ängstlichen Menschen, der nach Sicherheit strebte.
Rita, du doch auch nach deiner gescheiterten Beziehung!
War ich dir mit der Zeit nicht sogar zu angepasst, zu wenig Held? Mit den Jahren habe ich das jedenfalls befürchtet. Oh ja, meine Anpassung war nicht aufzuhalten: die Töchter, der Haushalt, dein zeitfressender Job, als freiberufliche Photographin ständig unterwegs. So entstanden Notwendigkeiten.
Schaben Sie den Teig über den Rand des Brettes in kleinen Strängen in das kochende Wasser. Bei mittlerer Hitze lassen Sie die Spätzle garen, bis sie aufsteigen. Schöpfen Sie diese nach und nach mit einem Schaumlöffel ab und geben sie in eine vorgewärmte Schüssel.
Ich köchelte sozusagen auf mittlerer Flamme, während der Nachklang der Protestjahre im Entsetzen über den RAF-Terror erstickte.
Das hat dich aber nicht davon abgehalten, die Nacht zum Tag zu machen. Ich hatte zunehmend Sorgen um deine Gesundheit.
Ich ahne, worauf du anspielst, auf meine Gewohnheit bis Mitternacht am Schreibtisch auszuharren, bei leiser Radiomusik, womöglich noch mit Kaffee, während du bereits eingeschlafen warst. Ab zehn brauchtest du das Bett. Unsere biologischen Uhren tickten eben unterschiedlich. Zugegeben, zuweilen hattest du es nicht leicht mit mir. Wurde aber nachts eines der Kinder unruhig, war nicht selten ich an ihren Bettchen.
Müßige Gedanken! - Im Moment ist mir die Erde eine Scheibe und dreht sich nach dem zweiten Whisky auf dem Plattenteller der Schöpfung. Irgendwann werde auch ich abspringen.
Vergiss deine Töchter nicht, sie werden dich brauchen.
Meinst du? Ihre Ablösung geschah unentwegt. Sie haben Berufe, Familie, Kinder. Ich bin derjenige, der an der Vergangenheit klebt - ein Klotz an ihren Beinen. Eltern gehen irgendwann - der unumkehrbare Gang des Lebens. Den Partner, dein anderes Ich, verlierst du. So ist das doch!
Und auf dem Bildschirm schäumen immer noch die Wellen.
Computer, mein Leidensgefährte, mein Antreiber aus einem gefüllten Speicher – ich hasse dich, wie mich! Sind wir nicht aufeinander angewiesen? Wer sonst in diesem entseelten Haus, wenn nicht wir beide. Du wirst mich zu ertragen haben, denn trotz aller Zweifel am Sinn meines Tuns werde ich zu meinen Texten zurückkehren, aus erzwungener Ruhe unsere Spuren suchend auf dem Weg bleiben, Rita - dem Weg, den du mir so nachdrücklich gewiesen hast.
Freilich, die Fantasie wird mich verleiten die Grenzen des bloßen Erinnerns zu überschreiten. Und wenn schon, habe ich nur dieses eine Leben? Das eines Witwers, der sein Haus in Ordnung hält, den man ab und zu besucht? Hinter der Fassade täglicher Gewohnheiten bliebe eine andere Realität unentdeckt.
Jetzt spüre ich geradezu deine Hand auf meiner Schulter.
Bei allen Differenzen, wir haben doch stets zusammengefunden – wir beide, die wir aus Erfahrung wussten, dass Liebe über die schönen Stunden hinaus im Alltäglichen gelebt und in kritischen Phasen – auch über den eigenen Trotz hinweg - errungen sein will.
Ach Gott, was rede ich so klug daher?
Du warst einfach die Frau, auf die meine Liebe flog: auf deine tiefblauen, großen Augen, auf deine mädchenhafte Figur, das dunkle Haar zum wippenden Zopf gebunden im Hörsaal vor mir, schließlich dein promptes intelligentes Reagieren auf meine gewöhnungsbedürftig krausen Gedankengänge. Meine Eigenheiten hast du angenommen, als gehörten sie ganz selbstverständlich zu unserer Nähe.
Über vierzig Jahre, Rita – und für mich kein Ende!
Computer, du verbliebener Gefährte, vier Buchstaben werde ich in deine Tastatur hämmern - R I T A - in Großbuchstaben gesperrt oder eng und kursiv, wie um mich danebenzulegen, in allen Schriften, derer deine Programme mächtig sind, die Ausdrucke als endlose Schleife über den Spiegelrahmen im Korridor hängen – deinen Empire-Spiegel, Rita, den ich nach einem unsinnigen Streit bei Paul für dich erworben habe.
Welch kitschverklebter Unsinn geht mir durch den Kopf!
Ja, ich weine und schäme mich nicht. Ich weine wie damals, an dem nasskalten Novemberabend, als ich dir sagen wollte: Zu spät, ich bin der Erniedrigungen leid und werde mir eine Zwei-Zimmer-Wohnungnehmen! … eben nach jenem unnötigen Streit.
Rita, wo bist du?
Ich weiß nicht weiter! Alle Gedanken über Diesseits und Jenseits verschwimmen in einem Brei aus Verzweiflung und Unsicherheit. Sie verdrücken sich in Kirchenwinkeln und lauern hinter Heiligenstatuen – Vorstellungen aus Kindheit und schwachen Momenten … und ich fülle mein Glas auf.
HERR, ich lästere und bleibe bei Whisky, weil mir keine Vorstellung hilfreich sein will. Weshalb lässt Du nicht die kleine Pietà eine einzige Träne weinen? Als ob ich geahnt hätte, was kommen wird, habe ich sie letztes Jahr von einem Flohmarkt mitgebracht.
Gott ist tot! Mit dem Ausrufezeichen ist nichts bewiesen. Nietzsche, hinter dem man sich mit diesem losgelösten Satz versteckt, war meines Wissens ein Suchender, wie auch ich einer bin. Suchende sind zur Freiheit des Fragens verurteilt, Zitierende oftmals Darsteller in zu großen Mänteln.
Doch! Trotz aller Zweifel werde ich nach Paris fahren! In der Kirche Saint-Germain-des-Prés gebe es eine Statue der Heiligen Rita, sagte man mir. Sie wird mich verstehen, wenn ich die Kerze anzünde und eine Rose ablege. Keine rote, vielleicht eine weiße oder eine gelbe - du mochtest sie alle!
Gegenüber im Café de Flore saß Sartre, wartete im angestammten Winkel auf Simone und schrieb, der Gewohnheit folgend, in ein Heft. Wartete er nicht auf Madame de Beauvoir? Angeblich siezten sie sich bis zum Ende. Weshalb haben wir das nicht getan?
Welch ein Nonsens!
Ich werde einen café noir bestellen und darüber nachdenken, in welcher Weise ich an einen Gott glauben kann. Für Sartre existierte er nicht. Wollte er das Zweifelhafte an einem Jenseits außerhalb des Spiels belassen, des zufälligen Spiels, das Leben heißt? Oder hatte er sich aus Enttäuschung über das Sichtbare das Wort HERR verboten?
Was gehen mich heute seine Gründe an? Die Zeit ist längst verstrichen, als ich seinen Zeilen mit dem Bleistift folgte, mich vergeblich bemühte, Das Sein und das Nichts zu verstehen und meinte, mich auf diese Weise aus der Menge der Gestrigen hervorzuheben. Wie auch immer, ich werde alleine vor meinem Kaffee sitzen. Meine Welt ist enger geworden.
Auf die Stelle, Rita, an der sie Erde über deine Urne gehäuft haben, lasse ich eine Sandsteinplatte legen, darauf dein Name - sonst nichts …
♦
I
Montag, 1. August 1966
Halbzwölf - Stau vor der Neckarbrücke. Meter für Meter aufrücken im Gestank der Abgase. Schweißfeucht haften die Hände an den Griffen. Unter der alten Lederjacke klebt das Hemd am Körper. Trotz allem, ich bin in der Zeit.
Nie wieder auf einen Motorroller! Das hatte ich mir vor Jahren geschworen, nach einem Unfall auf der Augusta-Anlage in Mannheim. Ein Pkw, aus einer Nebenstraße kommend, versuchte sich einzufädeln, stoppte plötzlich auf meiner Fahrbahnseite. Trotz Vollbremsung war der Aufprall nicht zu vermeiden. Ich flog über die Motorhaube, schlitterte auf Straßenstaub, bis es mich zur Seite schlug … und hatte unbeschreibliches Glück: nur Prellungen und Schürfwunden! Mein Zündapp-Roller war allerdings Schrott.
Vier Jahre hat der Schwur gehalten, dann erwähnte Paul den Heinkel-Tourist, auf dem ich sitze - nach einem Todesfall abgestellt in einer Scheune. Das sechs Jahre alte Fahrzeug bot man mir zum Schrottpreis an. Schwur hin, Schwur her! Ich bin mit Motorrädern aufgewachsen und konnte nicht widerstehen.
Paul handelt mit alten Möbeln aus Nachlässen. Dabei fällt immer wieder an, was ich brauche. Und ich brauchte praktisch alles für meine neue Wohnung. Versetzt nach Bruchsal, bin ich vergangenes Jahr im April mit Koffer und zwei gefüllten Bananenkartons eingezogen. Frau Bechtle, die Vermieterin, sah den Bedarf und erwähnte einen Altwarenhandel in der Stadt. So lernte ich Paul kennen.
Noch immer scheue ich Fahrten in größere Städte, aber heute blieb mir keine Wahl. Die Chance wäre vertan, zur Fortbildung im Herbst zugelassen zu werden. Vor zwölf muss ich auf dem Sekretariat der Pädagogischen Hochschule sein und meinen Brief abgeben in der Hoffnung, dass er Professor L trotz der Semesterferien noch erreicht.
Auch im konservativen Südwesten der Republik ist seit einiger Zeit die Reform des Bildungswesens im Gang. Die Volksschule, an der ich unterrichte, wird künftig Realschule im Aufbau sein. Für diese neue Schulart fehlen weitgehend ausgebildete Lehrkräfte. Deshalb können sich Volksschullehrer in drei Fächern nachqualifizieren. „Wenn nicht Sie, wer dann? Mit Ihrer Wahlfachprüfung in Geschichte erfüllen Sie doch bereits eine Voraussetzung!“, hat mich die Schulleiterin schon vor Wochen nachdrücklich auf diese Möglichkeit hingewiesen. Und nun verlangt die Schulbehörde eine inhaltliche Präzisierung meines Studiengangs Geschichte zur Anerkennung als drittes Fach.
Als weitere Fächer habe ich Geographie und Chemie angegeben. Chemie habe ich zwar auf meinem gestückelten Bildungsweg nie gehabt, Frau Basler riet mir dennoch zu. „Naturwissenschaftlicher Unterricht liegt Ihnen doch! Keine Sorge, die Grundlagen in Theorie und Praxis vermittelt das Seminar, und bis bei uns Fachunterricht einsetzt, dauert es noch drei Jahre, ausreichend Zeit sich vorzubereiten. Also starten Sie!“
So viel Zuspruch ermutigt, möchte man meinen. Erst am Wochenende habe ich mich entschlossen, die paar Zeilen zu tippen. Heute Morgen war es zu spät für Post und Bahn!
Nach der Neckarbrücke fließt im Stadtteil Neuenheim der Verkehr noch immer zäh. Für mich nur auf einer kurzen Strecke, dann biege ich in die lange Blumenthalstraße ein, bin nach Minuten auf dem Hof der Hochschule.
Zwanzig vor zwölf! Über dem verlassenen Gelände flimmert in Schlieren die Hitze. Im Schatten der Kastanien stelle ich den Roller ab und eile zum Hintereingang des Gebäudes. Menschenleere kühle Flure, nur aus der Aula tönt das Kofferradio der Putzkolonne. Weiter zum Verwaltungsbereich. Die Türen stehen weit offen. Als ich das Kuvert über den Tresen schiebe, komme ich mir vor wie ein ungebetener Besucher. Es ist noch dieselbe wortkarge Sekretärin wie zur Studienzeit. Die verzieht auch heute keine Miene, als ich mein Anliegen erkläre und wirft meinen Brief wortlos in einen Korb. Wann ich denn mit einer Antwort rechnen dürfe, erkundige ich mich vorsichtig. „Sie sind heute nicht der Einzige, aber vermutlich der Letzte!“, sagt sie knapp, grinst nun doch und ergänzt: „Professor L will morgen vorbeischauen. Die Verlagspost, Sie kennen ihn ja!“ Sie greift nochmals nach dem Umschlag, stempelt rot EILT! über eine Ecke - und ich atme auf.
Zurück auf dem Hof! - Nur das Tschilpen der Spatzen durchbricht die Stille. Während ich mich für die Rückfahrt richte, knirschen Autoreifen auf dem lockeren Belag. Ein blauer VW-Käfer parkt direkt neben meinem Roller ein, am Steuer eine junge Frau. Bevor ich das schwere Ding vom Ständer bringe, öffnet sich die Autotür und schlägt prompt an meinen Lenker. Für einen Moment blickt eine üppige Sonnenbrille zu mir herüber. Das dazugehörende weibliche Wesen schwingt die Beine aus dem Auto und zwängt sich - mit dem Rücken zu mir - durch die Enge zwischen unseren Fahrzeugen. Hätte die Lady nicht eine Minute warten können?
Bei jedem ihrer zögerlichen Seitwärtsschritte schwingt zum Zopf gebundenes dunkles Haar, wie damals im Hörsaal in der Reihe vor mir. Unwillkürlich sehe ich genauer hin: Kopfhaltung, Figur und Bewegung, das alles kommt mir bekannt vor…. Kann das Rita sein? - Unsinn! Was sollte sie hier auch zu tun haben, zwei Jahre nach dem Examen? Und dann auch noch in Kostüm und Stöckelschuhen!
Ende Dezember habe ich Verena, eine ehemalige Kommilitonin aus unserer Praxisgruppe, auf dem Bahnhof in Mannheim getroffen. Ungefragt berichtete sie, Rita seit dem Examen nicht mehr gesehen zu haben. Den Gerüchten nach sei sie verlobt und lebe jetzt irgendwo in Hessen. Verena war knapp in der Zeit, wandte sich aber nochmals um. „Am besten, du vergisst sie!“ rief sie mir zu und verschwand in der Unterführung.
Während ich den Motor anlasse, nimmt die junge Frau die Sonnenbrille ab, steckt den Brillenbügel in den Mund, geht ums Auto und angelt nach der Handtasche auf der Rückbank.
Rita!
Ich kann’s nicht fassen, schalte die Zündung aus, zerre den Roller wieder auf den Ständer. Meine Hände zittern, während ich den Kinnriemen am Helm löse. Brille und Helm rutschen mir übers Gesicht - von drüben Lachen. Dann ein Aufschrei: „Roland, du?“ Mit ausgebreiteten Armen eilt Rita auf mich zu.
„Was für ein Zufall! Mit dir hätte ich am wenigsten gerechnet!“ Verschwitzt wie ich bin, traue ich mich kaum in ihre Umarmung; so nahe sind wir uns auch noch nie gewesen. „Kurz vor zwölf! Gleich schließt das Sekretariat“, sagt sie und fasst mich am Arm. „Komm bitte mit! Ja? Wir haben uns doch so lange nicht gesehen.“
Während wir über den Hof hasten, drängen sich Szenen aus der Studienzeit vor mein inneres Auge:
Ende Sommersemester 63 - in ihrer Clique wartet Rita vor dem Hörsaal, entdeckt mich im Pausengetümmel, kommt auf mich zu und fragt nach einem Unterrichtsentwurf aus der Praktikumszeit. Ein Vorwand? Das weiß ich bis heute nicht.
Wintersemester - Rita fehlt in der Vorlesung. Von Verena erfahre ich, sie liege im Krankenhaus, am Blinddarm operiert. Während der Dozent am streikenden Overhead-Projektor hantiert, schiebt sie mir einen Zettel zu: Anschrift und Zimmernummer.
Mit Blumenstrauß stehe ich am nächsten Nachmittag an Ritas Bett, fasele von einem Zufall, der mir den Weg gewiesen habe. Sie schmunzelt: „Hat der Zufall einen Mädchennamen?“ Dann verschwindet der schelmische Zug um ihren Mund, und ihre Augen ziehen Wasser. „Roland, der Blinddarm war mit einem Eierstock verwachsen, beides musste entfernt werden! Ich kann wohl nicht mehr Mutter werden!“, schluchzt sie. Der verbliebene würde die Aufgabe gewiss übernehmen, behaupte ich kühn. Das habe auch der Arzt angedeutet, sagt sie und faltet penibel das Blumenpapier.
In der Woche darauf reichte Verena ein Kuvert mit Blumenmuster im Hörsaal nach hinten. Für Roland! Rita teilte mit, dass sie nun wieder zu Hause sei. Ob ich nach Schwetzingen kommen könne, um mit ihr zu lernen? Die Prüfung stehe doch an.
So saß ich an den folgenden Samstagnachmittagen an einem Tischchen in der Ecke des Wohnzimmers eines großzügigen Einfamilienhauses und arbeitete mit ihr meine Mitschriebe auf. Ein einziges Mal sah ich den Vater. Mit energischem Schritt querte er von der Terrassentür aus den Raum, nickte uns zu - ein großer, hagerer Mann mit Bürstenhaarschnitt und angegrauten Schläfen – und verschwand durch die aufstehende Tür im Flur. Die Mutter, eine freundliche Frau, bot Kaffee an. Ich blieb bei Mineralwasser.
Danach traf ich Rita nur noch flüchtig auf Fluren. Ich empfand mich benutzt.
Zwei Minuten vor zwölf. - Als Rita nach der zugesagten Zweitschrift ihres Abschlusszeugnisses fragt, schaut die Sekretärin demonstrativ auf die Uhr, zieht eine Postmappe unter dem Tresen hervor und entnimmt ihr das Dokument. Rita rollt es, steckt es in die Handtasche und kramt nach der Geldbörse, murmelt vor sich hin: „Am besten gleich zum Schulamt damit!“ - „Sofern Sie dort noch jemanden antreffen!“, meint die Sekretärin trocken und quittiert.
Zurück über den Hof. - Wir haben fast die Kastanien erreicht, da hält Rita unvermittelt an. „Begleitest du mich eventuell auch zum Schulamt?“, fragt sie unsicher. „Dann wäre ich nicht so alleine, falls es mit einer Stelle nichts wird. Du hast hoffentlich Zeit, sind ja Ferien.“
Zeit wozu? Zum Plaudern? Für einen Kaffee? Für einen Abschied mit der Beteuerung, sich bald einmal wiederzusehen? Ich bin noch in Gedanken, ob ich mir das antue, da hat sie bereits entschieden: „Also, dann komm! Wir nehmen die Tram, wie damals, als wir zur gleichen Zeit diese Sandsteinburg verlassen haben. Erinnerst du dich?“
Na klar weiß ich das noch! Zum Bahnhof mussten wir beide. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich oft eine spätere Bahn nehmen musste, weil ich vergeblich auf sie gewartet hatte. Am besten du vergisst sie! schießt mir durch den Kopf. Ich schiele nach Ritas linker Hand. Trägt sie einen Verlobungsring? Ein schmaler, hellschimmernder, mit kleinem, blauem Stein fällt mir auf. Saphir in Weißgold? Den Diamanten in Rotgold gibt’s zur Hochzeit! Und nun braucht sie eine Stelle, weil der Auserwählte in Heidelberg promoviert - und ich bin mal wieder der nützliche Idiot. Zu spät, um mit einer Ausrede abzuspringen! So trotte ich neben ihr her, meinen diffusen Gedanken ausgeliefert.
„Wohin hat es dich verschlagen?“, durchbricht sie mein Schweigen im Plauderton.
„Verschlagen? Zwar bin ich nicht im hinteren Odenwald gelandet, doch Dorf bleibt Dorf“, antworte ich in gespielter Leichtigkeit. „Der Herr Rektor sitzt im Gemeinderat, ortsansässige Kollegen singen im Kirchenchor. Einer spielt die Orgel, ein anderer trainiert die Fußballjugend. So ist das in einer dörflichen Gemeinde, auch wenn sie bei Bruchsal an der Autobahn liegt.“
Rita lacht. „Deine Dorfschule ist offenbar nur mit trockenem Humor zu ertragen.“
„Manchmal ja! Als ich zum Beispiel am ersten Tag ins Klassenzimmer kam, sprangen die Kinder auf – eine dritte Klasse - und empfingen mich mit einem im Chor geleierten Guten Morgen, Herr Lehrer! Dann bedrückende Stille, bis ein Mädchen schüchtern fragte: Beten wir heute nicht?“
„Und? Hast du mit ihnen gebetet?“
Was betet ihr? habe ich gefragt und bekam zur Antwort: Das hat unsere Lehrerin aus einem Buch gemacht, und wir haben dann nur ‚Amen’ gesagt. Also habe ich mir kurzentschlossen ein Morgengebet ausgedacht, die Hände gefaltet und wohl in überzeugender Weise vorgetragen: Lieber Gott, bleib uns auch heute nah. Der Tag ist lang, und wir nicht nur zum Lernen da! Die Kinder klatschten in die Hände und riefen fröhlich durcheinander ‚Amen, Amen’. Ich war angenommen.
„Und wie hat das Kollegium reagiert?“
Bei Ihnen ging’s hoch her, Kollege Ruf! empfing man mich im Lehrerzimmer. Das dürfen Sie nicht dulden! Lassen Sie die Kleinen aufstehen und Kopfrechnen üben. Das hilft allemal! Der Rektor, im Kollegium ein Despot, gegenüber dem Rathaus ein Abnicker, der außer Kreide nur mittlerweile verschlissene Schulbücher ersetzen ließ, schüttelte missbilligend den Kopf. Ab diesem Moment wusste ich - sagtest du nicht verschlagen? -, wo ich gelandet bin.“
Rita kichert und rempelt mich mit der Schulter an: „Du, das ist pädagogische Wirklichkeit im 20. Jahrhundert! Hattest du in einer Dorfschule anderes erwartet?“
„Mir war nicht zum Lachen! Hatte auch bald den unangekündigten Besuch des Schulrats zu überstehen. Gott sei Dank stand fest, dass die Kollegin, die ich zu vertreten hatte, nach der Geburt ihrer Tochter planmäßig zurückkehren wird. Ich beantragte die Versetzung; dem Rektor war’s nur recht.“
„Und wohin hat man dich versetzt?“
„Nach Bruchsal an eine größere Schule, eine künftige Realschule. Vielleicht sogar vom Schulrat lanciert! Der hatte mich nicht abgebügelt. Im Gegenteil! Er war - von Kleinigkeiten abgesehen - einverstanden mit meinem Unterricht.“
„Scheint ja eine rühmliche Ausnahme zu sein, dieser Schulrat!“ Oh je, ich würde ihr nicht wünschen, ihn kennenzulernen, diesen ehemaligen Offizier mit grauem Dienstkäfer.
„Jedenfalls habe ich in Bruchsal eine vernünftige Chefin angetroffen“, übergehe ich ihre Bemerkung, „und der Ton im Kollegium ist grundsätzlich auch ein anderer. Ich würde ja gerne bleiben, das ist aber von einer Weiterbildung abhängig. Deshalb bin ich heute nach Heidelberg gekommen, Rita. Ich brauche eine Bestätigung meines Wahlfachstudiums, um zur Fortbildung zugelassen zu werden. Als Volksschullehrer droht mir sonst die nächste Versetzung!“
„Ob Volks- oder Realschullehrer, die Bezeichnung hängt doch nur von der Schulart ab, an der man unterrichtet.“
„In Hessen vielleicht“, rutscht mir heraus. „Bei uns brauchst du eine zusätzliche Ausbildung in drei Fächern mit Prüfung … und eine habe ich ja bereits.“
„Und du wohnst auch in Bruchsal?“
Rita lässt sich nicht auf Hessen ein. Dagegen habe ich nichts zu verbergen und beschreibe meine Wohnsituation: zwei ineinander übergehende Zimmer in einer großen Etagenwohnung, Küche, Bad mit WC, sowie einen mit der Drogerie im Haus geteilten dritten Raum – mein ‚Schrankzimmer’.
„Als Mitbenutzer von Küche und Bad?“
„Eine Wohngemeinschaft wie in Berlin oder München?“ Nein, das habe sie nicht gemeint. „Rita, die zweieinhalb übrigen Räume auf der Etage nutzt die Drogerie zu Lagerzwecken.“
„Also im Ganzen eine recht große Wohnung!“
Das mag sie so sehen, ihren Ansprüchen dürfte sie nicht genügen, allenfalls von der Größe her. „Und du, Rita?“ wechsle ich das Thema „Du bist doch offenbar dabei, dich in der Region beruflich zu orientieren.“ Mich nerven ihre Fragerei und mein förmliches Geschwätz!
Ruckartig bleibt sie stehen. Ihr Arm schwenkt durch die Luft, als werfe sie voller Wut eine Tür zu. „Du, ich habe aufgegeben! Bin ausgebrochen, wo ich in der Zwischenzeit war!“ stößt sie heraus. „Fand mich total vereinnahmt, war nicht mehr ich selbst. Verstehst du?“
Wie sollte ich? Doch derart aufgebracht kenne ich die ‚sanfte Rita’ nicht. Eine ironische Bezeichnung von Verena, die ihrer Zurückhaltung nicht zu trauen schien, wenn es in der Praktikumsgruppe – außer mir alle weiblich - um Beziehungen ging.
Ruhiger geworden, berichtet Rita, dass sie nun wieder bei den Eltern lebe, in der Vorschulgruppe eines Kindergartens ausgeholfen habe und jetzt Boden unter den Füßen brauche. „Wo auch immer, Roland! Abhängigkeit habe ich bis zum Erbrechen genossen. Auf meine vor Monaten beim Kultusministerium eingereichte Bewerbung um eine Stelle, kam letzte Woche endlich vom hiesigen Schulamt die Aufforderung, möglichst bald das Abschlusszeugnis nachzureichen. Deshalb bin ich heute nach Heidelberg gefahren.“ Nach wenigen Schritten bleibt sie abermals stehen und sieht mich nachdenklich an: „Roland, ist das nicht seltsam, dass wir uns hier aus schier ähnlichen Gründen wiedersehen? Man könnte fast an Fügung glauben.“
Ich hebe die Schultern und lächle dünn. Den von mir vermuteten Doktoranden gibt es wohl nicht, und die Verbindung in Hessen scheint gelöst zu sein. Ich überlege noch, wie ich möglichst gefühlsneutral nachfrage, da entdeckt sie auf der anderen Straßenseite eine Bäckerei mit Stehtischen. „Kaffee und Butterbrezeln, Roland? Im Schulamt ist entweder jemand da oder es ist geschlossen. Wir werden ja sehen! Auf die halbe Stunde kommt es jetzt auch nicht an.“
Die Kaffeemaschine beginnt zu zischen, Geschirr klappert. Ein Tablett wird mir über den Ladentisch zugeschoben. Vorsorglich nehme ich eine Flasche Wasser mit. Rita hat sich an einem der beiden Stehtische auf die Ellenbogen gestützt. Ich setze das Tablett ab und gieße Wasser in die Gläser.
Geradezu gierig trinkt sie, starrt dann, das Kinn auf den Fäusten, an mir vorbei zum Schaufenster hinaus. „Als sei die Zeit stehengeblieben, so kommt es mir heute vor … vielleicht auch, als hätte ich gerade das Kino verlassen“, Rita zieht den Kaffeebecher zu sich und rührt mechanisch, schüttelt den Kopf, … „nach einem miserablen Film“. Das Zuckertütchen liegt ungeöffnet auf dem Tablett. „Und dann stehst du mir hier gegenüber.“ Sie tastet mit den Fingerspitzen die Salzkörner an der Brezel ab. „Wir haben uns schon einmal gut verstanden, Roland“, … sie bricht ein Stück ab, dreht es in der Hand … „und dann war ich nicht mehr da.“ Ohne abgebissen zu haben, legt sie es zurück und blickt wieder auf die Straße. „So wird das für dich gewesen sein.“
Orakelhaftes Gerede! Schließlich weiß sie am besten, weshalb es so gekommen ist.
Eine Großmutter mit Enkelin betritt den Laden. Die Kleine beschwatzt die Oma, die größere Tüte Gummibärchen zu wählen. Wir schauen amüsiert zu, wohl beide dankbar für die Unterbrechung.
„Ja, so war das für mich“, setze ich schließlich an und starre meinerseits auf die grüne Kunststoffbeschichtung des Tisches. „In Räumen und auf Fluren habe ich mich nach dir umgesehen. Eine Stimme sagte mir, dir hier zu begegnen, Rita – damals in unserem letzten Jahr in Heidelberg.“
Sie blickt nicht auf, lächelt nicht. Kennt sie den Film nicht? 1 Das Suchen eines Mannes nach einer Frau, Gegenwart mit Vergangenem verschränkt, auf langen Wegen über Flure und durch barocke Räume.
„Verständlich!“, kommt leise von ihr, über den Kaffeebecher gebeugt. Wieder greift sie nach dem Brezelstück, kaut versonnen. Ich bin wie gelähmt. Damit etwas gesagt ist, wechsle ich das Thema: „Du, Ende April war ich überraschend im Krankenhaus.“ Sie sieht aus ihrer Grübelei auf. „Was war?“ - „Der Blinddarm musste raus. Das zu lange Teil lag unter der Leber. Fast Gleichstand zwischen uns! Nur habe ich keine Eierstöcke.“
Ich lache zwanghaft über meinen dümmlichen Scherz und breche ein Stück von der Brezel ab. Ihre Hand kommt über den Tisch, streicht über meine. „Oh Gott! Dein Blinddarm war vermutlich voller Eiter und hat die Leber angehoben! Das hätte schlimm enden können!“
Wieder Schweigen. Wir kauen an unseren Brezelstücken.
Unversehens schiebt Rita den Kaffeebecher zur Mitte, bückt sich nach der Handtasche unter dem Tisch. „Komm, machen wir uns auf den Weg, wir zwei von Blinddärmen und sonstigen Anhängen Befreite! Wir sind nun doch knapp in der Zeit. Es ist spät, aber hoffentlich nicht zu spät, das Schicksal hat demnächst Feierabend!“
Die angebrochenen Brezeln lassen wir zurück. Auf der Ladenschwelle stolpert Rita. Ich bin einen Schritt voraus und reiche ihr die Hand, eher ein Anlass als notwendige Hilfe. Diese Hand halte ich fest, fühle, wie sie sich in meiner einrichtet. So geht sie neben mir, und mein Schritt ist mit einem Mal leicht.
Wir erreichen das Schulamt - ein hohes Treppenhaus, wohltuend kühl – und folgen dem Hinweis Sekretariat. Entschieden geht Rita auf die Tür zu, klopft und öffnet, gibt mir Zeichen zu folgen. Vom einzigen Schreibtisch im Raum erhebt sich eine Dame. „Statt anzurufen, bin ich lieber gleich gekommen“, beginnt Rita und entnimmt der Handtasche ein Schreiben sowie die Zeugniszweitschrift, reicht beides der Sekretärin. Ein prüfender Blick, ein gedehntes Ahaa! und die Bemerkung: „Da haben Sie aber Glück - an einem Ferientag! Die zuständige Schulrätin ist noch im Haus.“ Daraufhin verschwindet sie im Nebenraum. Man hört gedämpfte Stimmen, das Rücken eines Stuhls - Vorzimmeratmosphäre.
Eine hagere Frau im hellgrauen Hosenanzug tritt durch die Verbindungstür, grüßt freundlich. Auf deren auffordernde Geste hin geht Rita voraus. Ich bin auf Warten eingestellt und sehe mich um. Bevor ich in dem sparsam möblierten Raum eine Sitzgelegenheit ausmache, schaut die Schulrätin zu mir. Ich nenne meinen Namen, füge an, dass ich Studienkollege sei und nun Lehrer in Bruchsal. Sie stutzt. „Ich meine Sie zu kennen, Herr Ruf. Aber bitte, treten Sie ein. Als junger Kollege wissen Sie ja, was ansteht.“
Fragend sehe ich Rita an. „Bleib!“, flüstert sie.
Frau Sieber – so hat sich die Dame vorgestellt – lächelt, bietet Plätze an. Eine Frau um die Fünfzig, dunkelblonder Bubikopf, Fältchen unter den Augen, die gemeinsam mit ihrer unaufgeregten Mimik Vertrauen ausstrahlen. Die etwas linkischen Gesten dieser schlaksigen Dame tun ein Übriges; sie wirkt echt und spielt nicht die Vorgesetzte. „Einen Moment bitte, bin gleich soweit!“ Dann zieht sie gelassen eine dünne, rote Mappe aus dem Aktenstapel auf dem Schreibtisch und eröffnet Rita, dass sie nach den Ferien den Lehrauftrag einer erkrankten Kollegin in Leimen übernehmen könne. „Eine dritte Klasse, Fräulein Pradel, außerdem acht Stunden katholische Religion von Stufe eins bis vier. Die Kollegin war die einzige mit kirchlicher Lehrbefugnis. Ihre Rückkehr ist leider ungewiss. Eine andere Stelle in der Nähe kann ich derzeit nicht anbieten.“ Sie lehnt sich zurück.
Eine dritte Klasse, kein schlechter Einstieg! - Kinder, die Schule kennen, bereit sind zu vertrauen, sobald sie merken, dass es um sie geht.
Rita schaut auf ihre Hände, wirft einen Blick auf mich, richtet sich auf und sagt zu. Frau Sieber entnimmt der Schublade am Schreibtisch ein Formular – den Personalbogen. Rita beginnt ihn auszufüllen. Frau Sieber schaut ihr kurz zu, zeigt auf eine Stelle, widmet sich erneut ihrem Aktenstapel, macht den einen oder anderen Vermerk. Beide Frauen sind beschäftigt.
Ich sehe mich diskret im Raum um: Zwei nach Osten ausgerichtete Fenster, grüne Vorhänge und dunkle Büromöbel, an der Wand hinter dem Schreibtisch ein mächtiges Ölgemälde: Das Heidelberger Schloss im winterlich kalten Morgenlicht und darunter die Altstadt mit Neckarbrücke. Schneepolster auf Dächern, Mauervorsprüngen und kahlen Bäumen. Zum Frösteln dieses Winterbild im Sommer, vermittelten nicht die blassroten Partien der Morgensonne auf Schnee und Mauern einen Schimmer von Wärme.
Rita reicht der Schulrätin den ausgefüllten Personalbogen. Die überfliegt ihn, erklärt das Einstellungsprozedere, nennt den Termin der Vereidigung - Stühle rücken. Im Grunde alles unkompliziert, ohne moralisches Geschwafel über die Bedeutung des Amtes eines Lehrers, wie ich es in gleicher Situation hinzunehmen hatte.
Bevor ich nach Rita den Raum verlasse, berührt mich Frau Sieber am Arm: „Soeben ist mir eingefallen, woher ich Sie kenne, Herr Ruf. Nicht wahr, Sie waren einer der Studentenvertreter an unserer PH.“ Sie erinnert an eine Veranstaltung des AStA mit Lehrerverbänden zum Thema Schulreform und Lehrermangel in der Aula. Mit Dozenten und Vertretern der organisierten Lehrer saß ich auf dem Podium. „Und nun? Sind Sie weiterhin standespolitisch engagiert?“ Ich erwähne mein Vorhaben. „Na schön, dann machen Sie mal den nächsten Schritt“ – nun lächelt sie verschmitzt - „und Fräulein Pradel mit Ihrer Unterstützung den ersten in die pädagogische Wirklichkeit.“
Vor der Treppe wartet Rita. „Über dich weiß die Frau ja jetzt Bescheid“, empfängt sie mich kühl. „Aber was uns beide hierhergebracht hat, die Frage hat sie nicht gestellt. Wie hätte ich ihr das auch erklären sollen, etwa als nachhaltigen Service eines ehemaligen Studentenvertreters?“
Energisch wirft sie den Kopf zurück, wendet sich der Treppe zu und nimmt die ersten Stufen. Ich taumle eher, als ich gehe, an ihr vorbei und bleibe eine tiefer stehen. „Du, aber ich weiß es jetzt!“, würge ich hervor. „Was, Roland?“, fragt sie leise. „Ich bin hier, weil ich … ja, weil ich dich nie mehr irgendwohin verschwinden sehen möchte.“ Zögernd kommt sie die Stufe herab. „Ist das wahr?“ Meine Hände gleiten an ihren Armen hinauf zu den Schultern. „Ja, Rita, das ist so!“ Ich hole Luft. „In dem Moment, als du auf der Ladenstufe gestolpert bist, wurde mir mit einem Mal klar, dass ich … , ja, dass ich dich noch immer liebe.“ Es ist heraus!
„Roland“, sagt sie fast unhörbar, umfasst mich, flüstert an meiner Halsgrube: „Und ich … ich liebe dich auch … noch immer!“ An Hals und Wange spüre ich ihren Atem, ihr warmes Gesicht. Sie fühlt sich so leicht, so zart an, wie ich mir das in meinen Träumen vorgestellt habe. So stehen wir auf der Treppe, ohne etwas zu sagen. Ihre Finger gleiten an meinem Nacken hinauf, drücken meinen Kopf an ihren. Ich fühle Feuchtes an der Wange. Sie hebt den Kopf, ihre Lippen suchen meine, und mir schwinden Ort und Zeit.
„Endlich!“ Rita nimmt mein Gesicht in beide Hände. „Auf diesen Augenblick habe ich heute gewartet, seit du plötzlich wie aus dem Nichts vor mir gestanden bist. Mit einem Mal war alles wieder da, was ich in den vergangenen beiden Jahren verdrängt habe.“ Sie presst erneut ihr Gesicht an meine Halsgrube und schluchzt, es schüttelt sie regelrecht. Ihre Rührung macht mich völlig hilflos. Ich halte sie fest - sehr fest! -, streichle über ihren Rücken. „Damals im Krankenhaus … wollte ich dir sagen … dass ich …“ stammle ich. „Ach Rita, du warst so unerreichbar für mich!“, bringe ich schließlich heraus.
„Hast du ein Taschentuch?“ Ich greife in die Hosentasche. „Hier, gebügelt und ungebraucht.“ Sie tupft sich die Tränen aus dem Gesicht. „Das ist vorbei, ich will dich auch nicht mehr fortlassen.“ Das geknüllte Taschentuch drückt sie mir in die Hand.
Über uns fällt eine Tür ins Schloss. Ein älterer Herr mit weißem Bart kommt die Treppe herab, nimmt mit Bedacht Stufe um Stufe. Auf unserer Höhe angelangt, schmunzelt er und geht vorüber. Wir sehen uns an: Für mich ein Déjà-vu, auch aus irgendeinem Film. Nur aus welchem? – Wohl Kinotag heute! schießt mir erbarmungslos unromantisch durch den Kopf. Unten angelangt, hält der Herr die Tür auf, als habe er auf uns gewartet. Sommerhitze schlägt uns entgegen. „Ungewöhnlich heiß heute!“, sagt er und mahnt: „Trinken Sie viel, öfters als üblich! Bei solchen Temperaturen trocknen leicht Herz und Hirn aus.“ Er lächelt verständnisinnig, nickt und geht seiner Wege.
Unsere Arme um die Hüften gelegt, habe ich Mühe, mich Ritas Rhythmus anzupassen. In Gedanken versunken übersehen wir die Haltestelle der Straßenbahn. In welche Gedanken? – Für Rita kann ich das nicht sagen. Es sind Bilder, die über meine innere Leinwand huschen, wie vorhin auf dem Hof, zufällig in der Abfolge – oder doch nicht? Rita vor meinem Motorroller, Rita in der Bäckerei, Rita im Schulamt - Ich kann Ihnen keine andere Stelle anbieten - und vorhin auf der Treppe. Auch der ältere Herr kommt darin vor, und plötzlich ahne ich, an wen er mich erinnert: An den Professor im Treppenhaus in einer Schlussszene.2
Bei jedem Schritt berühren sich unsere Körper. Ich muss mich nicht kneifen. Ich spüre sie – und das ist kein Film!
Nach Minuten kommt verhalten von der Seite: „Roland, erinnerst du dich noch an deine Deutsch-Stunde am letzten Praktikumstag? Aus meiner Tagträumerei geholt, bleibe nun ich überrascht stehen. "Wie kommst Du jetzt darauf?"
„Na ja, ich habe gestaunt, wie du es geschafft hast, die quirlige Klasse mit deiner Einführung so zu faszinieren, dass sich die Kinder anschließend auf die Geschichte im Lesebuch geradezu gestürzt haben. Ich kannte ja deinen Entwurf, hätte aber in der realen Situation Probleme gehabt, ihm auch zu folgen.“
„Rita, es war eine Lehrprobe! Das spüren auch die Schüler und erwarten mehr, als den gewöhnlichen Stundenverlauf. Darauf war ich vorbereitet. Außerdem sind zwei Dinge zusammengekommen: eine für Kinder dieses Alters spannende Erzählung vom Kampf um eine Burg und ein Poster von der Wehranlage auf dem Dilsberg - zufällig entdeckt im Aushang des Verkehrsvereins.“
„Ach geh! Deine Art zu unterrichten ist doch nicht planbar. Du bist ein Naturtalent. Daran habe ich mich erinnert, als ich das Abschlusszeugnis in Händen hielt und mich fragte, ob ich es jemals schaffen würde, mit Kindern Stunde um Stunde zurechtzukommen. In Träumen stand ich immer wieder vor dem Portal eines düsteren Dorfschulhauses. Irgendwo lärmte eine Klasse – meine Klasse. Albträume! Was sollte ich tun? Auf Drängen meiner Eltern entschied ich mich schließlich, ein Germanistikstudium anzuschließen.“ Sie verlangt erneut nach dem Taschentuch, schnäuzt sich umständlich. „Das Studium habe ich im dritten Semester gesteckt, um es gleich zu sagen.“
„Und weshalb?“ Sie stopft das Tüchlein in die Tiefen ihrer Handtasche. „Roland, es ist so“, sagt sie und schmiegt sich an, „dass ich eben - zugegeben etwas plump - nach einem Übergang gesucht habe, um dir meine Geschichte des letzten Jahres zu erzählen. Du liebst mich, da kann ich dich doch nicht im Ungewissen lassen und peu à peu die Wahrheit hervorholen. Auch wenn ich dir viel zumute, hör mir bitte zu!“
Weshalb dieser konstruierte Einstieg? Mich beschleicht ein mulmiges Gefühl…. und sie lockert den Halt.
„Alles nahm seinen Anfang auf dem Stiftungsfest der Verbindung meines Vaters letztes Jahr im Sommersemester“, beginnt sie monoton, als lese sie den Text ab und fährt in gleicher Weise fort: „Dort lernte ich einen jungen Mann kennen, hochgewachsen, selbstsicher, charmant und weltläufig gebildet. Wo war der nicht schon überall in Europa und Amerika! Und er konnte mitreißend erzählen, eine absolute Ausnahme in der stupiden Atmosphäre dieser alkoholseligen Männergesellschaft. Als die Bücher mit den Kommersliedern rumgereicht wurden, meinte er, Ännchen von Tharau wird Ihnen nicht fehlen! und forderte mich zu einem Spaziergang auf.“
Sie unterbricht und sieht mich an, als hoffe sie auf …? Ich weiß es nicht! Nur widerwillig habe ich bis jetzt zugehört und schaue auf das Pflaster. Das scheint sich nun unter meinen Schritten zu bewegen.
„Roland!“, verlangt sie meine Aufmerksamkeit. „Ich empfand mich herausgehoben aus der Selbstgefälligkeit des akademischen Klüngels … und war fasziniert von ihm, von einem Verbündeten, dem – wie mir – nichts an den Riten dieser überholten Institution lag“, rechtfertigt sie sich. „Gegen Ende des Abends bot er mir das Du an und lud mich in sein Elternhaus ein.“
Den letzten Teil des Satzes verschluckt sie fast. Sie beschreibt ein großes Haus mit Park am Taunusrand zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Man nimmt sie ganz selbstverständlich auf, geht mit ihr ins Theater und zu Konzerten. Sie sieht mit ihm alte Filme in Szenekinos und geht auf Partys.
Warum erspare ich mir das nicht? Schon bereue ich mein Geständnis vorhin auf der Treppe. Allein das kulturbeflissene Programm empfinde ich als Provokation. Ging es den beiden ‚Hauptdarstellern‘ nicht ganz handfest um etwas anderes?
Irgendwo im Hintergrund nervt eine Kreissäge - die melodische Entsprechung zu meinen Gefühlen. Zynisch höre ich mich sagen: „Familiensaga à la Hollywood!“ Rita schluckt einen Satz hinunter, und ich befördere eine Glasscherbe über den Bordstein in den Gully.
„Georg fragte mich eines Tages, ob ich seine Frau werden wolle.“ Welch großzügiges Angebot! liegt mir auf der Zunge, und sie sieht an sich hinunter, als läge der nächste Satz auf dem Pflaster.
„Offen gesagt“, beginnt sie beschwichtigend, „ich wollte in diesem Moment nicht wahrhaben, was doch zu ahnen gewesen wäre, wenn ich meinen Verstand gebraucht hätte.“ Sie löst die Haarspange, fächert umständlich das Haar auf. „Alles von den Vätern eingefädelt!“, nuschelt sie mit der Spange zwischen den Zähnen. Dann schüttelt sie energisch den Kopf. „Nein, nein, ich will mich jetzt nicht als unbeteiligt darstellen! Glaub’s mir, ich war wie in einem Nebel aus Selbstüberschätzung und Stolz. Ich, das junges Ding aus der Kleinstadt, mit einem Volksschullehrer-Examen in der Tasche, aufgenommen wie eine Prinzessin im Milieu der Besitzenden und Einflussreichen.“ Dumpf fügt sie an … „und ich blieb!“
Mit dem Handrücken wische ich mir den Schweiß von der Stirn. Rita sieht mich besorgt von der Seite an. „Roland, nimm es mir bitte ab: Ich war naiv, zu naiv! Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der liebenswürdig bemühte, korrekte Georg sich jemals anders verhalten würde.“ Sie stockt. „Und ehrlich gesagt, in dieser Wunderwelt – das ist sie doch gewesen! - hatte ich dich vergessen, den schüchternen ‚Bub’, wie dich meine Mutter genannt hat…. Weißt du noch, wie wir am kleinen Tischchen in der Ecke des Wohnzimmers saßen und gelernt haben?“
Was soll jetzt diese Anspielung? Die Fakten sind doch klar, und mein Hals ist trocken.
Um uns die Geräusche der Straße, der Geruch des Stadtsommers nach weichem Teer, nach Abgasen und Staub. Wir sind gelaufen und gelaufen, und nun hat mich der Zweifel geradezu überrollt. Bin ich erneut zu einem Zeitpunkt aufgekreuzt, an dem sie nach Sicherheit verlangt, der Zuverlässigkeit eines Menschen vertraut, der sie bewundert und begehrt? … Und was habe ich ihrer Wunderwelt entgegenzusetzen? Auch nur das Leben in einer Kleinstadt, eine Wohnungshälfte, dürftig ausgestattet mit alten Möbeln, einen gebrauchten Motorroller, das Gehalt eines Volksschullehrers … und die Unsicherheit eines Menschen, der sich nach ihrer Nähe sehnt – im Augenblick eher sehnte. Ich finde ihren Bericht zum Kotzen! Am liebsten würde ich mich auflösen, um nicht länger zuhören zu müssen.
„Georg war zu einem Praktikum bei der Partner-Bank in Boston“ – Rita lacht hysterisch - „und ich trank Tee mit Damen der Gesellschaft, streichelte Hunde, blätterte in Frauenzeitschriften mit Edelklamotten und Klatschgeschichten, lernte sogar Canasta – totgeschlagene Zeit!“
Rita, der es nun wirklich nicht an Sinn für Selbstdarstellung mangelt, geht einige Schritte vor, posiert … und wo? … neben einem Mülleimer! „Schau dir diese schnieke Klamotte aus Italia an! Heute wollte ich darin in Amtsstuben Eindruck machen – bin ja geübt. Und dann stehst plötzlich du mit deinem Motorroller vor mir!“ - „Und du neben einem vergessenen Müllgefäß!“
Sie stutzt, tritt ziemlich heftig gegen die graue Tonne.
Au!- Das scheint geschmerzt zu haben! - Zischend zieht sie Luft ein, bückt sich und drückt auf die lädierte Schuhspitze. „Meine Güte!“, stellt sie im Aufrichten fest. „Wir sind ja schon an der Neckarbrücke!“
„Erzähl weiter!“ sage ich emotionslos.
„Ach ja, so manches änderte sich im vergoldeten Käfig, nachdem Georg von seinem Praktikum aus Boston zurück war“, berichtet sie und humpelt zum Brückenaufgang. „Einige Tage nach Weihnachten stand er ohne anzuklopfen im Zimmer, und so blieb das. In Großraumbüros gewöhnt man sich das Anklopfen wahrscheinlich ab.“
„Hi Rita, there is a little problem. You have three, four, five minutes for … ?“ Mein Englisch reicht allenfalls, um verkrampft den Lässigen zu geben.
„So ähnlich lief das!“, stimmt sie nüchtern zu. „Man hatte mir ein Fernsehgerät im Zimmer installiert. War er nicht zu einem seiner zahlreichen Termine unterwegs - der Einsteiger in die väterliche Kanzlei - und bot das Fernsehen nicht, was ihn interessierte, stand bald ich auf dem Programm. Was ich in diesem Moment wollte oder nicht und schließlich gar nicht mehr, hat ihn wenig bewegt.“
Mir steigt das Blut in den Kopf! Das alles ekelt mich an wie das Aufschlürfen von zerflossener Eiscreme, dem ich zuzusehen gezwungen bin! Ich blicke einem Hund hinterher, einer Frau mit Kinderwagen, um nicht Vorstellungen ausgeliefert zu sein, die mich bedrängen. Peinlich quälende Minuten.
Auf der Brücke angelangt, setzt sie wie von der Klatschpresse interviewt fort: „Er behandelte mich wie sein Eigentum, nach Belieben verfügbar. Ich hatte nur noch Angst und versuchte mich mit allen möglichen Ausreden aus der Situation zu winden. Ich solle mich nicht so zickig anstellen, war sein Kommentar.“ Sie macht eine wegwerfende Handbewegung und schlüpft aus den Pumps. Mit den Schuhen in der Hand geht sie barfuß über die Brücke, schwingt sie wie eine Trophäe über dem Geländer. „Und ich darf froh sein, dass ich nicht schwanger wurde.“
Eingetaucht in ihre Empörung, stoppt sie auch kein erschrockener Seitenblick meinerseits. Ich habe meine Reaktionen kaum noch unter Kontrolle, und sie steigt wieder in die Pumps. „Denk dir, das Muttersöhnchen hatte sich bei Mama beschwert. Die wollte mich zum Gynäkologen schicken und hatte bereits ungefragt einen Termin vereinbart. Da stand mein Entschluss fest! Heimlich habe ich meine beiden Koffer gepackt und auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Die ergab sich im Februar an einem Dienstagabend nach zehn. Er und Vater waren mit Klienten essen, die Mutter nach der Kirchenchorprobe schon im Bett. Vom Telefon im Foyer aus habe ich ein Taxi in die Nebenstraße bestellt und bin verschwunden, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Den Verlobungsring habe ich neben das Telefon gelegt, den Schlüssel zur Gartentür in ein Beet geworfen. Zum wartenden Taxi bin ich gerannt, trotz meiner schweren Koffer…. Kannst du dir das vorstellen?“
„Auch nur schwer!“ sage ich gequält.
Erst jetzt scheint Rita meine Stimmung wahrzunehmen. Wie zum Trost setzt sie fort: „Während der Taxifahrer mein Gepäck im Kofferraum verstaute, ging im Obergeschoss Licht an. Ich bin ins Auto gesprungen und habe die Tür zugeschlagen! … Zu Hause musste ich feststellen, dass der Ordner mit meinen persönlichen Unterlagen fehlte. Soll ihn doch mein Vater bei seinem Bundesbruder anfordern, von mir hören die nichts mehr! … So, nun weißt du Bescheid!“
*
Ritas Käfer steht inzwischen in der prallen Sonne, sie öffnet weit die Autotüren. Ich versuche verbissen, den Roller zentimeterweise rückwärts aus dem Kies zu rücken. Eine ungeschickte Lenkbewegung - und er kippt! Die Anstrengung brauche ich jetzt, um mein Gefühlschaos zu überspielen. Auf dem letzten Stück unseres Weges war mir, als würde mir die Brust eingeschnürt, sich der Magen wenden.
Bevor sie an mein Zeug gelangt, auf der Rückbank deponiert, springt sie aus dem Auto und fasst am Gepäckträger an. Zu zweit bringen wir das schwere Ding auf festen Boden. Erleichtert richte ich mich auf. Ihre Augen tasten mein Gesicht ab. Ruhig und gefasst, wie man einen Menschen unter Schock anspricht, fragt sie: „Roland, willst du mich jetzt noch, eine gebrauchte Frau?“
Irritiert sehe ich sie an, kann nicht antworten, muss etwas tun und hole meine Sachen selbst aus dem Käfer. Als ich zurück bin, steht sie noch an derselben Stelle. „Fahr mir einfach hinterher!“, sage ich ohne weiteres zu erklären und ziehe die Lederjacke über. Der Trotz würgt in meiner Kehle. Ihre blauen Augen, die ich so sehr mag, ziehen Wasser. Abrupt wendet sie sich um, schlüpft hinters Steuer. Ich setze den Helm auf und lasse den Motor an. Über die Schulter sehe ich, dass sie zurückstößt, sich dann nähert. Vor dem Einbiegen in die Blumenthalstraße setze ich den Blinker, und sie tut dasselbe.
An Kreuzungen wende ich mich nach ihr um, auf der Strecke vergewissere ich mich im Rückspiegel, dass sie hinter mir ist. Beim Schalten stammle ich gebrauchte Frau, gebrauchte Frau. Gebrauchte Frau passt zu gebrauchten Möbeln, und ich sitze im Fahrtwind auf einem gebrauchten Motorroller. Was ändert eine gebrauchte Frau an meinen Gefühlen? Nichts, wenn ich mich nicht hinter falschem Stolz und verstaubten Vorstellungen verkrieche. Sie war schließlich aufrichtig, hat mir nichts vorenthalten … und der blaue Käfer ist noch immer hinter mir!
*
Rita parkt vor der Drogerie. Ich fahre den Roller auf den Abstellplatz hinter dem Haus. Auf der Hofzufahrt kommt sie mir entgegen. „Da bin ich!“, ruft sie.
Ich renne zu ihr, nehme sie in die Arme. „Endlich!“ Erst bleibt sie steif, dann erdrückt sie mich fast. Mir kommen die Tränen, schließlich heulen wir beide. Verschämt versuche ich, an die Hosentasche zu gelangen. Rita lacht unter Tränen und zieht aus der Handtasche mein Taschentuch hervor. „Da nimm!“ Wir sehen uns an, lachen, heulen, lachen - und Rita schwenkt das Taschentuch: „Roland, unser erster gemeinsamer Besitz!“
Vom Hof aus schaut sie an dem unscheinbaren Haus hinauf, das sich kaum von seiner Umgebung abhebt, sieht man von der recht hübschen, aber vernachlässigten Ladenfront im Stilgemisch der Gründerzeit ab. Ein zweistöckiges Gebäude, grau gestrichen, beim Bombenangriff auf Bruchsal im März 1945 beschädigt und danach auf der Hofseite um einen schmalen Anbau erweitert. Sie zeigt auf die Fenster im Obergeschoss: „Dort oben residierst du also in deiner Klause?“ - „Nur in der linken Hälfte, die andere wird von der Drogerie als Lager genutzt.“ – „Eigentlich schade! Vergeudeter Wohnraum.“
Während ich noch überlege, weshalb ausgerechnet Rita hier Wohnraum vergeudet sieht, steht sie schon vor der Haustür. Ich krame nach dem Schlüssel, öffne. Kellergeruch kommt uns entgegen. Die Holztreppe glänzt, von mir gewachst und mit dem Blocker bearbeitet. Mit jedem Schritt aufwärts setzt sich der Bohnerwachsgeruch gegen den Kellermief durch. Die Treppe knarrt, und mit diesem Knarren beginnt mein Zuhause-Gefühl. Als ich die Tür zur Wohnung aufschließe, bleibt sie zurück, betrachtet den Glasabschluss. „Echt schön diese Pflanzenornamente an, auf oder in den Milchglasscheiben?“ - „In, Rita! Sind wahrscheinlich Ätzungen“, antworte ich vom Korridor.
Die Besichtigung beginnt in Bad und Küche. Kein Kommentar zu der in die Jahre gekommene Nachkriegsausstattung, von der Vormieterin übernommen. Dann das helle, große Zimmer, ein Doppelraum über die ganze Hausbreite. Rita geht umher, streicht über die Politur der alten Möbel - einem ovalen Esstisch mit vier Stühlen, der Kirschkommode neben der Tür und einer Glasvitrine in der Ecke - alles bei Paul nach und nach erstanden. Sie deutet auf den Teppich. „Ist der etwa echt?“
„Ein Shiraz, meine letzte Erwerbung, stammt aus einer aufgegebenen Kanzlei. Leider über eine Ecke abgetreten, deshalb konnte ich ihn mir leisten.“ Rita geht am Teppich entlang, bückt sich. „Wo? … Ach hier! Sieht man nicht sofort. Ja, der ist total schön in seinen beige-roten Tönen mit den blauen Rauten. Zusammen mit den alten Möbeln gibt er dem Raum Gediegenheit. Kompliment! Du hast Stil!“
Sie richtet sich auf, sieht sich um. „Und die als Couch getarnten Liegen in der Ecke mit den melierten Überwürfen? … Na ja, die sind eben nützlich! Ich meine, du könntest ein weiteres Zimmer gut gebrauchen. Dein Schrankzimmer ist doch ein Provisorium. Was meint denn deine Vermieterin dazu?“
„Frau Bechtle hat schon mal angedeutet, dass sie nicht verstehen könne, weshalb die Drogistin ihr altes Zeug hier oben deponiert. Eventuell würde sie mal einen Karton brauchen, aber die alten Farben und Dekorationen bestimmt nicht. Aus meiner Sicht aber immer noch besser, als einen weiteren Mieter auf der Etage, mit dem ich auch noch Küche und Bad teilen müsste! Ein Schrank wäre allerdings notwendig - mein nächstes Projekt.“
Rita schnippt mit den Fingern. „Apropos Küche! Seit dem Frühstück haben wir lediglich eine halbe Brezel im Magen. Fällt dir dazu etwas ein?“
„Ach Gott ja, meine Mangelwirtschaft! Zum Einkaufen ist’s zu spät. Dann halt nachher zum Italiener!“
„Hm, lass uns doch erst mal deine Vorräte inspizieren. Wir werden schon etwas finden.“
Die Inspektion beginnt am Küchenbuffet. Eine Packung Spaghetti, die Dose mit geschälten Tomaten und ein schlaffer Salatkopf aus dem Kühlschrank landen auf dem Küchentisch. Außer einer Dose Büchsenmilch habe sie in den Winkeln meines Küchenschranks nicht einmal Mehl entdeckt. Ich hole die alte Sarotti-Dose vom Schüsselregal: „Hier!“- „Gut, dann bleibt es heute bei Spaghetti an Tomatensoße, dazu Blattsalat aus verwertbarer Substanz.“ Ein angebrochener Becher Sahne für die Soße – „ohne Schimmel!“ grinst sie - sei ja noch im Kühlschrank, und mit etwas Glück könne man in einer Schublade auf Gewürze, Knoblauch und Zwiebeln stoßen. Ich ziehe unter der Spüle eine Plastikschüssel hervor: „Darin ist wahrscheinlich alles, was wir noch brauchen – auch Essig und Öl.“ Sie lacht und küsst mich flüchtig auf die Wange. „Dann mal an die Arbeit!“
*
Rita legt die Gabel zur Seite. „Bereits halb acht!“ - „Schon so spät?“, frage ich überrascht.
„Schauspieler! Du bist doch erleichtert, dass ich nicht weiter nach deiner Familie frage, so ausweichend wie du geantwortet hast. Ja, und jetzt weiß ich mit meiner nicht weiter. Ich sollte mich auf jeden Fall in Schwetzingen melden.“
Dass dieser Moment kommen musste, war mir klar - nur nicht wann! In einer guten halben Stunde wäre sie zu Hause. Ich schiebe die abgegessenen Teller zur Seite, breite wie in Zeitlupe die Arme über den Tisch und setze Wort an Wort: „Rita, ich möchte, dass du bleibst - heute, morgen, überhaupt.“ Sie umschließt ihr Glas mit beiden Händen. „Und du bist dir ganz sicher?“ Ohne zu zögern antworte ich: „Ja!“ Sie zieht Kreis um Kreis am Sockelrand des Glases. „Das klingt entschieden!“, sagt sie dabei ruhig, so verdammt ruhig. „Ja!“, sage ich zum zweiten Mal, diesmal wirklich entschieden. „Wie? Immer?“, fragt sie in dieser scheußlich abgeklärt wirkenden Gelassenheit. Fast verzweifelt antworte ich: „Von heute an immer!“ Sie legt den Kopf auf die Arme, hebt einen Finger, lässt ihn sinken, hebt den nächsten. Ich bleibe, ich bleibe nicht?… Das wird sie hoffentlich nicht an den Fingern abzählen! Nach einer gefühlten Ewigkeit flüstert sie: „Roland, ich bleibe!“
Ein Band scheint zu reißen, das mich an den Stuhl gefesselt hält. Ich springe auf und umarme sie samt der Stuhllehne. „Ich hoffe, junger Mann“, presst sie unter dem Druck meiner Arme heraus, „Sie besitzen eine zweite Steppdecke in ihrem bescheidenen Heim, das ich von jetzt an mit Ihnen teile werde.“
Glasklar steht mir vor Augen, dass eine Entscheidung gefallen ist, weit über den Abend hinaus. Aber es fehlt ein Satz, der Satz, der zur Wirklichkeit führt, zu der Wirklichkeit, die sich im Wechsel der Stimmungen in meine Vorstellung eingegraben hat. Stockend bringe ich hervor: „Rita, sag mal … könntest du dir vorstellen, vorausgesetzt … , na ja, dass wir eines Tages sogar heiraten?“