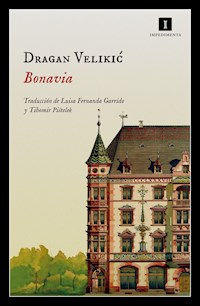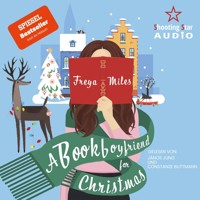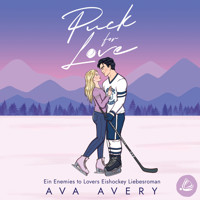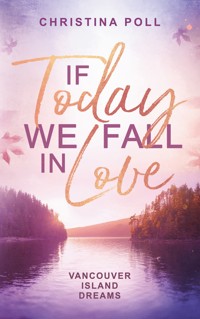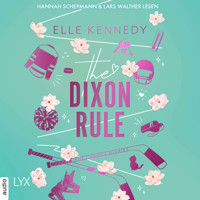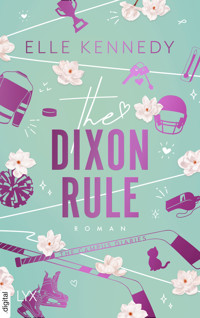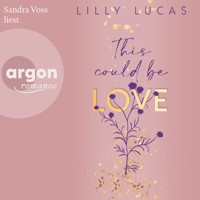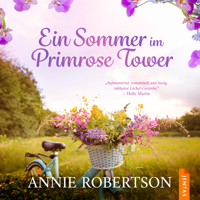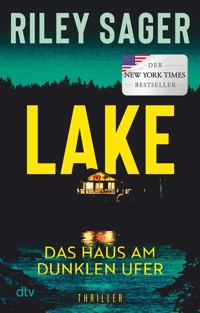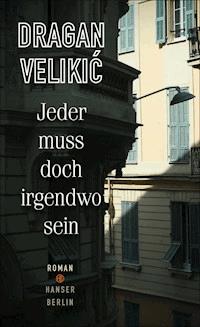
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niemand hat sein Leben akribischer memoriert als seine Mutter. Als sie stirbt, tritt der Sohn ihre Erbschaft als Archivar der Erinnerung an, folgt der Flut der Bilder, die in ihm aufsteigt. Erinnern, das ist bei Dragan Veliki? immer an Orte geknüpft, die die Landkarte eines Lebens ergeben. Er ist wieder der Junge, frisch von Belgrad nach Pula gezogen, erkundet die duftenden Innenhöfe, trifft den alten Uhrmacher Maleša, der einst Titos Uhren repariert hat und alle Geschichten kennt – immer begleitet von der rigiden Weltdeutung der Mutter, von der er sich mit jedem Schritt mehr befreit. Dragan Veliki?s neuer Roman ist eine berührende Hommage an seine Mutter, an ein Land, eine Zeit und Menschen, die es nicht mehr gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Niemand hat das eigene Leben akribischer memoriert als die Mutter, doch gezeichnet von Demenz, hat sie zum Schluss fast alles vergessen. Als sie stirbt, tritt der Sohn ihre Erbschaft als Archivar der Erinnerung an, folgt der Flut der Bilder, die in ihm aufsteigt. Erinnern, das ist bei Dragan Velikić immer an Orte geknüpft, die die Landkarte eines Lebens ergeben. Jeder muss doch irgendwo sein. Er ist wieder der Junge, frisch von Belgrad nach Pula gezogen, erkundet die duftenden Innenhöfe, trifft den alten Uhrmacher Maleša, der einst Titos Uhren repariert hat und alle Geschichten kennt – immer begleitet von der rigiden Weltdeutung der Mutter, von der er sich mit jedem Schritt mehr befreit. Velikić schlägt mühelos den Bogen über Jahrzehnte und erzeugt dabei im Detail intensive Bilder. Rastlos erzählend lässt er uns ein Land und seine Geschichte begreifen, schenkt er seiner Mutter ihr Gedächtnis zurück.
Hanser Berlin E-Book
Dragan Velikić
Jeder muss doch irgendwo sein
Roman
Aus dem Serbischen von Mascha Dabić
Hanser Berlin
Für Sanja
Nach der Beichte fühlt sich der Mensch keineswegs gereinigt. Ganz im Gegenteil. Er fühlt sich wie ein Mülleimer. Nachdem er sich seiner sämtlichen besseren Versionen entledigt hat, bleibt er mit der allerschlechtesten zurück, mit derjenigen, die man niemals und niemandem beichtet.
Borislav Pekić
I
1
»Du bist immer locker und entspannt auf Kosten anderer. Und andere müssen die Zeche dann zahlen.«
Das sagte meine Mutter gern.
»Wenn ich eine Heilige wäre«, seufzte sie wehmütig, »dann wäre ich die Schutzpatronin der Köchinnen, Zimmermädchen und Dienstmägde. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute, ich aber würde die Dienstboten beschützen. Nur die Dienstboten wissen, wie jemand wirklich ist, in seinen eigenen vier Wänden.«
Danach folgte eine von Hunderten Geschichten, mit denen ihr Gedächtnis vollgestopft war. Ein gewisser Professor Lolić hatte einen Sohn, einen Medizinstudenten, der gerne im Bett aß. Das Essen verschmutzte die Bettwäsche. An dieser Stelle hielt Mama stets kurz inne, angeekelt allein von der Vorstellung des Anblicks befleckter Bettlaken.
»Sag mal, würde jemand, der halbwegs bei Verstand ist, im Bett essen? Dieser junge Mann ist zwar später in London gelandet und hat Karriere gemacht, aber das nützt alles nichts, er ist und bleibt ein Grobian.«
Oder das Beispiel des berühmten Literaten, in dessen ehemaliger Wohnung sie eine Zeitlang gelebt hatte. »Du hättest diesen Herd sehen müssen, den verwahrlosten Backofen. Verkohlt und stinkend, vor lauter Fett. Ein solcher Schriftsteller hat für mich seine Glaubwürdigkeit verspielt. Schluss aus.«
Alle ihre Geschichten stammten aus dem Boudoir, den Dienstbotenzimmern, den Mädchenkammern. Von dort, wo man mit gedämpfter Stimme sprach. Wo die Schatten niemals stillstanden. Wo sich Lachen, Schluchzen und Seufzen unaufhörlich abwechselten. In diesem natürlichen Standquartier der Sünde fingen die Geschichten niemals an, sie hörten auch niemals auf, sondern es war ein einziges endloses medias in res. Ein Zwischenraum und eine Zwischenzeit. Und die Reste fremder Leben. Ein Blick aus dem Souterrain. Leben, gelebt durch das Schlüsselloch.
Mama führte ihre Unterhaltung mit der Welt von der Küche aus. Von dort sandte sie ihre Botschaften an die Umgebung. In ihrer Küche stand alles an seinem Platz. Die Küche war ihr Altar, ihre Kommandobrücke, der Ort, wo sie nach ihrer Heirat die Rolle der göttlichen Vollstreckerin angenommen hatte. Sie zweifelte nicht daran, dass ihr hingebungsvoller Kampf für Gerechtigkeit und Wahrheit eines Tages belohnt, dass sie nach ihrem Tod heiliggesprochen würde. Sie sprach ihren Namen italienisch aus, als könnte die Erwähnung ihres echten Namens die Illusion zerstören.
»Violetta. Santa Violetta, die Schutzheilige der Dienstboten.«
Da war sie schon im Altersheim. Sie war an dem Ort gelandet, den sie für sich zeitlebens kategorisch abgelehnt hatte.
»Lieber würde ich mich umbringen, als in einem Heim zu leben«, hatte sie unzählige Male gesagt.
Als sie ins Heim kam, hinterließ sie in ihren Schränken zahlreiche Geschenke, bestimmt für künftige Hochzeiten, Einweihungsfeste und Geburtstage. Denn Geschenke kaufte man immer dann, wenn sich eine günstige Gelegenheit bot. Mama würde etwa vor einem Schaufenster stehen bleiben, wo ein Geschirrset zum halben Preis angepriesen wurde. Eine Zeitlang würde sie überlegen und dann etwa eine Verwandte nennen, die bald eingeschult wurde. Für diese wäre das Geschirrset also bestimmt. Das kleine Mädchen würde nicht einmal ahnen, dass sie die Besitzerin des Porzellanservice in unserem Schrank war.
Ein kleines Vermögen steckte in diesen im Voraus gekauften Geschenken. Akkurat beschriebene Zettel mit den Namen der zukünftigen Besitzer, von denen einige schon längst tot waren.
Man kaufte im Voraus. Man lebte im Voraus. Man konnte alles erreichen, weil nichts dem Zufall überlassen war. Der fürsorgliche Blick meiner Mutter schwebte über dem gesamten Territorium des Alltags. Nichts entging ihrer Kontrolle. Nichts geschah von selbst. Selbst die Spinne oben in der Ecke im Bad hatte ihr Leben dem Aberglauben meiner Mutter zu verdanken. Das gesamte Universum unserer Wohnung bebte im Rhythmus ihres Atems.
»Die Küchengeräte lieben mich, weil ich mich um sie kümmere.«
Die Dinge und Gegenstände hatten, so glaubte sie, ihr geheimes Leben, und nur empfindsame und verantwortungsbewusste Menschen waren in der Lage, es zu spüren.
Mama verachtete Verschwendungssucht. Sie war eine globale Ökonomin.
In den letzten Jahren im Altersheim las sie den ganzen Tag Zeitungen und Frauenzeitschriften. Sie war süchtig nach Texten, die Vulgarität und Geschmacklosigkeit verbreiteten. Mindestens zwei Stunden, in denen ihr alles auf die Nerven ging, das war ihre tägliche Dosis. Sie geriet außer sich, wenn sie las, dass irgendjemand eine Villa als Hochzeitsgeschenk erhalten hatte. Luxus und Verschwendungssucht widerten sie an. In ihren Augen war es eine unverzeihliche Sünde, ein Vermögen für Vorhänge und Lüster auszugeben. Ganz zu schweigen von Yachten. Wie viel Geld ging das ganze Jahr über für die Erhaltung einer Yacht drauf, nur damit man einige wenige Wochen eine Kreuzfahrt in südlichen Gewässern unternehmen konnte? Vor lauter Vulgarität wird die ganze Welt noch explodieren, wiederholte sie unermüdlich.
Besonders irritiert war sie, wenn sich jemand den Annehmlichkeiten des Lebens hingab. Sie war der Meinung, wenn der Genuss zum wichtigsten Sinn der menschlichen Existenz erhoben würde, komme es unweigerlich zur Verblödung. Die Tendenz, alles zu vereinfachen, führe zu einer Degeneration der Menschheit und schließlich zum Verschwinden der menschlichen Rasse. Die Welt war schließlich nicht zu unserem Vergnügen erschaffen worden.
Im Kino verlieh sie ihrem Unmut über das Rascheln, Knabbern und Schmatzen der anderen Kinobesucher lautstark Ausdruck. Ich erinnere mich an Aufsichtspersonen, die im Kinosaal aus der Dunkelheit auf uns zukamen und meiner Mutter mit dem Rauswurf drohten. Immer wieder schickte sie Briefe an die Leitung des Kinos, in dem wir uns samstags die Premieren anschauten. Darin schlug sie vor, das Mitnehmen von Essen und Getränken in den Kinosaal zu verbieten.
Entspanntheit versetzte meine Mutter in Unruhe. Vor Ameisen hatte sie großen Respekt.
Santa Violetta. Wie sehr hatte sie sich vor dem Wasser gefürchtet! Immer auf das Schlimmste gefasst sein, das war ihre Devise. Sie glaubte, Gefahren könnte man ausweichen, indem man sie ständig herbeirief. Mit großem Vergnügen erzählte sie immer wieder, wie sie als Kind mehrmals fast ertrunken wäre. Diese Angst übertrug sich auf meine Schwester und mich. Aus uns wurden niemals gute Schwimmer. Dabei gingen wir regelmäßig mit Mama zum Strand: Valkane, die Bucht von Gortan, die Fischerhütte, die Goldenen Felsen … Mama mochte am liebsten Stoja. Das war ein richtiger städtischer Badestrand: betonierte Meereszugänge, Rutschen, Kabinen, Duschen, ein Restaurant. Voller Neid beobachtete ich die Badenden. Ungehemmte Körper auf den Sprungbrettern. Luftpirouetten. Die Schwimmer verschwanden in den Wellen, um wenige Sekunden später wieder aufzutauchen. Überall Geschrei und Gelächter.
Vergeblich fuchtelte ich mit den Armen und versuchte, meinen Körper länger als zwei Minuten an der Oberfläche zu halten. Ich übte in einer menschenleeren Bucht, neben dem Zaun des Campingplatzes, wo es nicht allzu viele Augenzeugen gab. Ich hatte das Gefühl, die ganze Welt würde mir dabei zuschauen. Auch mir war Stoja der liebste Strand. Meine Schulfreunde kamen selten dort vorbei. Sie bevorzugten die offenen Strände, wo man keinen Eintritt bezahlen musste. Sie verabredeten sich dort, ohne Eltern. Wenn dann doch jemand zufällig bei Stoja vorbeikam, versteckte ich mich geschickt in der Menge, zwischen den entblößten Körpern, oder ich verzog mich in den kleinen Wald und wartete so lange, bis die Gefahr vorüber war.
Mama verachtete alles Provisorische, ganz gleich, ob es sich um einen Badestrand handelte oder um eine Fernsehantenne. Sie ertrug keine Reparaturen oder Umbauten. In unserer Wohnung hatte nichts Platz, das beschädigt oder zerkratzt war. Teller, Gläser und Tassen warf sie sofort weg, sobald sie einen Riss darin entdeckte.
Am Strand bedachte sie alle Kinder, die schrien, umherliefen oder mit Obstresten um sich warfen, mit drohenden Blicken. Wer über unsere Handtücher lief, wurde laut zurechtgewiesen. Die Eltern der gescholtenen Kinder lächelten milde. Meine Schwester und ich wären am liebsten im Erdboden versunken, wenn unsere Mutter ihnen die Leviten las. Es ärgerte sie, wenn die Eltern Zigarettenstummel in die Wandritzen schoben. Sie spielte sich als Bademeisterin auf. Einmal hörte ich auf der Straße, wie eine Frau zu ihrem Mann sagte: »Schau mal, ist das nicht der Sohn dieser Verrückten vom Strand?«
Sie haben gewonnen, Mama. Die Leute vom Strand haben die Weltherrschaft erlangt. Gleichgültig und abgestumpft, tingeln sie von einem exotischen Urlaubsort zum nächsten. Der Wert der Dinge ist ihnen fremd. Unter dem Deckmantel der Freiheit verstecken sie ihre jämmerlichen Seelen. Horden von Tölpeln in Markenkleidung und Markenschuhen ziehen Markenkoffer und Taschen in Hotellobbys hinter sich her. Sie überfluten Flughäfen und Bahnhöfe. Sie unternehmen Kreuzfahrten. Touristen schwärmen in alle Richtungen aus und verdrecken den gesamten Planeten.
Es ist unmoralisch, auf den griechischen Inseln Urlaub zu machen, ohne auch nur ein einziges antikes Drama zu kennen. Wie kann man in Spanien unterwegs sein, ohne das Wissen darum, dass einst der Ritter von der traurigen Gestalt und sein Diener Sancho Pansa Andalusien bereist hatten? Du willst nach London? Dann sag erst einen Vers von Shakespeare auf. Oder meinetwegen von John Donne.
Mama mochte reine Wahrheiten. Die Dinge genau so wiedergeben, wie sie sich zugetragen hatten. Sie erzählte jedes Gespräch genau nach, mit der präzisen Intonation, mit dem richtigen Gesichtsausdruck, den passenden Gesten und gemurmelten Kommentaren. Ohne doppelten Boden. Der Welt die Wahrheit ins Gesicht schreien. Und dabei das verdreckte Bett nicht vergessen und ja nicht den verkohlten Herd. Im Detail steckte die Aufzeichnung des Ganzen. Begabung ist nichts anderes als der angeborene Instinkt, im Nebensächlichen das Wesentliche zu erkennen. Regelmäßig erwähnte sie einen Minister, von dem sie aus erster Hand wusste, dass seine Sekretärin ihm im Flugzeug regelmäßig die Socken wechseln musste, während er sich wie ein Pascha im Sessel räkelte.
»Das sagt viel über einen Menschen aus. Wer bereit ist hinzuschauen, wird alles verstehen. Später wundern sich alle, wie es kommt, dass Primitivlinge und Dummköpfe an die Macht kommen. So etwas kündigt sich aber immer an.«
»Es ist leichter, sich etwas vorzustellen, als zu leben«, sagte sie nach längerem Nachdenken. »Was ein Mensch im Eifer des Gefechts alles falsch machen kann, das weiß nur Gott allein.«
Und dann fügte sie, eher für sich, noch hinzu: »Es ist leichter, anständig zu sein, als fleißig.«
Nach der Rückkehr von einer Reise liebte es Mama, die Wäsche auf der Terrasse aufzuhängen. Jede Rückkehr bedeutete eine Erneuerung unseres Zuhauses, denn wir alle erneuern uns, wenn wir von irgendwoher zurückkehren, sagte sie, während sie die Koffer und die Taschen auspackte. Sie legte jeden Gegenstand an seinen Platz zurück und wies neuen Gegenständen sofort ihre jeweiligen Plätze in der Wohnung zu. Sie ließ ihre Hand über eine Figur oder den Fernsehbildschirm gleiten, als würde sie ein Haustier streicheln. Das leise Surren der Waschmaschine versetzte sie in Erregung. Der Schleudergang kündigte das Ende des Waschzyklus an. Alles würde wieder an seinem Platz stehen.
»Kinder, den Tag der Rückkehr von einer Reise würde ich gegen nichts eintauschen wollen. Dieser Tag ist der allerschönste. Obwohl, auch der Tag der Abreise ist schön. Und die Reise selbst. Hauptsache, man unternimmt eine Reise. Und sei es nur von der Küche bis zur Terrasse.«
2
Ich bin ein Jahr alt. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin zum ersten Mal in einem Hotel. Auf dem Foto ist im Hintergrund eine Steinmauer zu sehen und dunkle Pflanzenumrisse im Garten. Ein einjähriger Junge steht vor der sperrangelweit offenen Terrassentür. Der Schrecken steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er ist soeben auf dem polierten Parkettboden ausgerutscht. Er hat geweint. Das Auftauchen des Fotografen mit seiner Lampe und seiner Kamera hat jedoch augenblicklich seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Schon damals besitzt der Junge die Fähigkeit, eine Unannehmlichkeit sofort zu vergessen. Ein Lichtblitz und die Ankündigung der nächsten Aufnahme. Die Initiation im Kinosaal. Die dichte Vegetation im Hintergrund steht in einem scharfen Kontrast zum Gesicht des Jungen. Tageszeit: Abenddämmerung. Auf der Rückseite der Fotografie die Notiz in schwarzer Tinte: Hotel Palas, Ohrid, 22. Juni 1954.
Exakt zwei Jahrzehnte später war ich wieder in diesem Hotel. Ich holte Mamas postlagernden Brief im Postamt von Ohrid ab. Sie erinnerte mich an meine erste Reise. In ihrer schnörkeligen Schrift erkannte ich die Bemühung, bloß nichts zu verpassen. Die Fürsorglichkeit einer Lehrerin. Die fotografische Erinnerung an einen gewöhnlichen Tag. Eine gesteigerte Aufnahmebereitschaft auf Reisen. Oder hatte sie sich damals schon in großem Stil ausgemalt, was alles passieren könnte? Woher tauchte im richtigen Moment direkt vor Ort ein professioneller Fotograf auf, um den Jungen zu fotografieren, der kurz davor war, in Tränen auszubrechen? Des Rätsels Lösung steckte in einer Nebenbemerkung in Mamas Brief: Ein Filmteam, das einen Dokumentarfilm über den Ohridsee drehte, war zeitgleich im Hotel Palas untergebracht. Mama war eine Meisterin darin, mögliche Fragen zu antizipieren. Genauer gesagt verwandte sie die meiste Energie darauf, Antworten auf Fragen zu finden, die sie sich im Namen anderer selbst stellte.
Warum hatte sie sich jenen Tag gemerkt? Und war wirklich alles ganz genau so, von dem Moment an, als sie, Papa und ich nach Ohrid kamen? Wie konnte sie sich überhaupt so viel merken? In ihrem Gedächtnis waren Hunderte von Biographien archiviert. Manche der Menschen hatte sie nur flüchtig gekannt. Begegnungen im Zug, ein oder zwei Tage auf einer Reise, aber das genügte schon, um ein ganzes Leben zu erzählen. Alles war für sie lehrreich. Nichts war überflüssig. Sie lebte das, was sie erzählte. Was sie erzählte, das war sie.
Die geborene Enzyklopädistin. Ihr Gedächtnis beherbergte Unmengen banaler Details. Sie zelebrierte den Alltag. Es gab keine Prioritäten, alles war gleichermaßen bedeutsam. Der einsame Fußgänger, der an der Ampel auf grünes Licht wartet, die Ameisenkolonne im Gras, der lächelnde Glaser nach einem Sommergewitter, die Anordnung der Betten im Internat der Pädagogischen Lehranstalt in Šabac, die erste Autofahrt in einem Citroën von Ruma bis Bogatić.
Jahrelang führte sie in einem eigenen Heft ordentlich Buch über alle Hotels, in denen sie abgestiegen war. Dieses Heft lag zuunterst in einer Dose aus Kautschuk, zusammen mit Bündeln von Briefen. Als bei unserem Umzug aus Belgrad nach Pula am Bahnhof von Vinkovci der Zugwaggon ausgeraubt wurde, befand sich auch die Kautschukdose unter den gestohlenen Gegenständen. Es wird für immer ein Rätsel bleiben, warum sie das kostbare Heft nicht bei sich hatte. Die einzige Erklärung für Mamas Unachtsamkeit, die mir plausibel erscheint, ist ihre Angewohnheit, Gegenstände stets am selben Platz aufzubewahren. Das Heft musste also in der Dose mit den Briefen bleiben.
Als Mama viele Jahre später im Altersheim allmählich erlosch, sagte sie oft im Flüsterton ihr Lieblingsmantra auf – die Namen der Hotels, in denen sie gewesen war. Vielleicht versuchte sie auf diese Weise den Inhalt des verlorengegangenen Hefts zu rekonstruieren? Zuweilen war ihr gar nicht bewusst, dass ich bei ihr war. In solchen Augenblicken holte ich sie mit meinen Fragen aus ihrer Abwesenheit heraus.
»Terapija. Wie meinst du das, wo das war?«, wunderte sie sich über mein Nichtwissen. »Das schönste Hotel in Crikvenica. Im Foyer wurde nur Tschechisch gesprochen, man fühlte sich wie am Hradschin. Die Tschechen liebten Crikvenica über alles.«
Dann schwieg sie eine Zeitlang und nickte mit dem Kopf. Sie wechselte jeweils ihren Gesichtsausdruck, als würde sie alle diese Tschechen im Hotelfoyer einzeln begrüßen.
»Und dann sind sie nach Pula gezogen.«
»Wer ist umgezogen?«
»Na, die Tschechen, wer denn wohl sonst? Hast du etwa vergessen, dass nur die Tschechen an der Ribarska koliba Urlaub machten? In der Dependance, auf der anderen Seite der Straße, am Rande des Kiefernwaldes. Dort war es immer sauber. Die Tschechen sind ordentlich. Deshalb sind sie bei vielen unbeliebt – vollkommen unbegreiflich.«
Das Zauberwort »Dependance«, ausgesprochen mit Mamas Stimme. In dieses Wort phantasierte ich alles hinein, was mir einfiel, bevor ich seine wahre Bedeutung erfuhr. Ich glaubte, eine Dependance, das seien besondere Hotelräumlichkeiten, die privilegierten Gästen exklusiv zur Verfügung gestellt würden. Erst lange Zeit später fand ich mich mit der Tatsache ab, dass es sich bei einer Dependance im Grunde genommen um zweitklassige Hotelräumlichkeiten handelte, die ausschließlich zum Schlafen bestimmt waren. Selbst wenn die Zimmer komfortabler waren als im Haupthaus – davon konnte ich mich in einigen luxuriösen Dependancen selbst überzeugen –, empfand ich diesen Komfort als eine Art Kompensation für den untergeordneten Status, den eine Dependance im Bezug zum Hauptgebäude des Hotels genoss.
Ich saß in der Wohnung am Erzsébet körút, im Zentrum von Budapest, an jenem Tag im Juni, als Mama starb. Ich sagte laut: Hotel Lipa. Unsere erste Adresse in Pula. Die Glühbirne in der Metallfassung hing hoch oben von der Zimmerdecke. Die schwache Spannung des Wechselstroms verstärkte das Gefühl von stumpfer Verzweiflung und Verlassenheit. Es war ein kalter Novembermorgen. Auf der Straße flatterten Fahnen. Es war ein Staatsfeiertag. Ich stand am Fenster. Mit meinem Blick nach draußen versuchte ich mich physisch vom Hotelzimmer zu entfernen. Seit früh am Morgen die Nachricht gekommen war, dass unser Waggon in Vinkovci aufgebrochen und geplündert worden war, warf Mama dem Vater heftig vor, dass er, anstatt die Waggontür mit einem Hängeschloss zu sichern, den zuständigen Arbeitern am Belgrader Bahnhof vertraut hatte, die behauptet hatten, eine Plombe würde vollkommen ausreichen.
»Wo lebst du denn, du Naivling?«, wiederholte sie unablässig. »Man hat dich über den Tisch gezogen. Die stecken doch alle unter einer Decke. So ist das eben in einem Land der Gauner.«
Vater ermahnte sie, leiser zu sprechen. Nervös knabberte er an seinem Zigaretten-Mundstück und ging in seiner blauen Matrosenuniform im Zimmer auf und ab. Die Truhe mit seiner Garderobe war in Vinkovci ebenfalls gestohlen worden.
Die leere Kandlerova ulica. Die nackten Äste der Platanen vor dem Fenster des Hotels Lipa. Fahnen und Parolen an den Fassaden. Der eine oder andere Passant ging vorüber an diesem feierlichen Morgen. Dieses Bild sah ich vier Jahrzehnte später ganz deutlich vor mir, am Fenster der Wohnung am Erzsébet körút, an einem sonnigen Tag im Juni, als mich die Nachricht von Mamas Tod erreichte.
Der geplünderte Waggon in Vinkovci – das war die erste Reaktion auf Mamas Tod. Ich sprach diese Worte in meinem Inneren, mit ihrer Stimme. Ich ging zum Fenster und beobachtete die Autos und die gelben Straßenbahnen, die den Boulevard entlangrasten. Mit der bewährten Technik versuchte ich meinen Schmerz zu lindern. Das Prinzip blieb immer gleich, unabhängig davon, ob ich beim Zahnarzt war oder von Liebeskummer geplagt wurde. Ausweichen in einen anderen Raum, in eine längst vergangene Zeit. Der Blitz des Fotoapparats im Hotel Palas am Ohrid hatte vor Jahrzehnten die Tränen versiegen lassen, damals übte ich mich zum ersten Mal in der Kunst, dem Schmerz davonzulaufen.
Ich setzte Mamas Mantra fort. Hotelfoyers tauchten auf, namenlose Menschen, Plätze und Straßen, Fassaden, Bruchstücke von Dialogen, Koffer und Taschen auf Metallgittern über den Sitzen in Zugabteilen. In diesem Augenblick hatte ich das Foto vom Ohrid nicht dabei. Erst ein Jahr später, als ich nach Belgrad zurückkehrte, entdeckte ich auf der Rückseite das Datum, 22. Juni, der Tag, an dem meine Mutter sechsundvierzig Jahre später starb.
Wie lange bleiben die Stimmen nahestehender Menschen mit klarer Intonation im Kopf erhalten?
Es gibt Wörter, die nur ihnen gehören.
»Himmelherrgott.« Mamas Lieblingsausdruck. Sie sprach ihn stets mit schriller Stimme. Außerdem schürzte sie dabei verächtlich die Lippen und blickte streng, um dann heftigen Einspruch gegen die Äußerung des jeweiligen Gesprächspartners zu erheben, und schon stand man kurz vor dem Ausbruch eines Streits.
An jenem Morgen hatte sie es im Hotel Lipa abgelehnt, mit Vater zum Bahnhof zu gehen. »Himmelherrgott«, hatte sie mehrmals hintereinander gesagt. »Geh doch alleine. Du hast eine Liste der Gegenstände, also wird die Kommission problemlos feststellen können, was alles gestohlen wurde. Und bring mir meine Dose mit den Briefen aus der roten Truhe mit. Die werden sie ja wohl nicht gestohlen haben.«
Ich vermute, sie sah sich nicht in der Lage, mit der Unordnung konfrontiert zu werden, die die Diebe im geplünderten Waggon zurückgelassen hatten. In ihrem Kopf war alles durchnummeriert, eingesäumt, eingefasst, eingerahmt, symmetrisch. Nichts war einfach so da. Alles auf dieser Welt musste aus etwas anderem resultieren. Der beste Schutz vor unangenehmen Fragen waren im Voraus durchdachte Antworten. Mama unterhielt sich eigentlich nie wirklich mit jemandem, sondern lieferte bloß Antworten auf Fragen, die sie sich selbst zuvor gestellt hatte. Aus diesem pathologischen Bedürfnis nach Ordnung entstand die größtmögliche Unordnung und diese Unordnung nahm ich in mich auf.
Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, den Mantel des Realismus abzulegen, den Mama mir übergestreift hatte. Es gelingt mir nicht, zu begreifen, dass immer irgendwo jemand oder etwas sein muss. Und dass ich niemandem eine Erklärung schuldig bin. Sagen wir so: Es genügt, dass der Vogel fliegt. Es ist nicht meine Aufgabe, einen Ast zu finden, auf dem der Vogel landen könnte. Und zu jedem Zeitpunkt habe ich das Recht, die Tür hinter einem Kapitel zuzuschlagen.
In der Fiktion bin ich verloren. Seit jeher rufen Märchen in mir Unbehagen hervor. Eine Handlung, die ohne eine rationale Erklärung auskommt, treibt mich in den Wahnsinn.
Anfangs, als ich noch nicht selbst lesen konnte, las Mama mir vor dem Einschlafen Geschichten vor. Das war, als wir noch in Novi Beograd wohnten. Ich erinnere mich an die Fabel über die Liebe zwischen der Ameise und der Biene. Vergeblich suchte ich sie später bei La Fontaine, dann auch bei Andersen und den Gebrüdern Grimm. Die meisten Geschichten, die Mama vorlas, handelten von Dingen und Gegenständen. Ich erinnere mich an die Beichte der Türschwelle. Da die alte, knarrende Türschwelle jedem Hausbesucher Misstrauen entgegenbrachte, spielte sie manchmal Streiche, indem sie sich ein wenig von der Stelle bewegte und böswillige Besucher straucheln ließ. Mir sind Personen, die beim Hereinkommen an der Schwelle ausrutschen oder stolpern, noch heute suspekt.
Als Vater vom Bahnhof zurückkehrte und Mama eröffnete, dass auch ihre Kautschukdose gestohlen worden war, brach sie in Tränen aus. Meine Schwester und ich schwiegen. Schluchzend sagte Mama, sie werde niemals über den Verlust der Briefe und des Heftes, in dem alle ihre Reisen notiert waren, hinwegkommen – die Städte und die Namen der Hotels, in denen sie abgestiegen war. Und die vielen Geschichten.
Zwei Jahre später waren wir im Hotel Slon in Ljubljana. Mama führte nicht mehr Buch über ihre Reisen. Aber ich beschloss, mir heimlich die Hotelnamen zu merken und zu notieren. Wir fuhren mit dem Topolino nach Slowenien. Papa hatte erst unlängst den Führerschein gemacht. Die Straßen waren fast leer. Auf jedem Dorfplatz sahen wir ein Kreuz. Im Schaufenster eines Buchladens in Ljubljana entdeckte ich die Romane von Karl May. Während sich die Eltern am Abend in der Hotelbar amüsierten, lag ich ausgestreckt auf dem Doppelbett und las Winnetou.
Die Sirene eines Rettungswagens am Erzsébet körút holte mich zurück in jenen Tag im Juni. Eine Reise war zu Ende.
»Jeder muss doch irgendwo sein«, wiederholte Mama, während wir den Gang des Altersheims entlangflanierten. Sie erwähnte die Tschechen, die so sauber und ordentlich waren, dass sie sich ein eigenes Meer verdient hätten. Zumindest eine kleine Bucht, wie sie die Slowenen hatten. »Wir hatten es so schön in Ljubljana, Papa und ich hörten zwei Abende hintereinander Lado Leskovar im Hotel Belvi.«
»Das Belvi war in Split. Lado habt ihr im Slon gehört. Das war unser Hotel in Ljubljana.«
»Himmelherrgott, im Slon gab es einen Nachtclub. Marijana Deržaj hat gesungen. Nur Ausländer hatten dort Zutritt. Ausländer und Nutten. Lado hat bei den Tanzveranstaltungen im Belvi gesungen. Ich kann mich gut erinnern. Ivo Robić in Rijeka im Plavi Jadran und Dobri Stavrevski im Palas am Ohrid. Jeder musste irgendwo sein.«
Mit ihrer Intonation sprach ich mir selbst das Mantra vor: Palas am Ohrid, Lipa in Pula, Slon in Ljubljana, Neboder in Sušak, Slavija in Opatija, Terapija in Crikvenica, Bonavia in Rijeka, Belvi in Split, Grand in Skopje, Evropa in Sarajevo, Union in Belgrad, Esplanada in Zagreb, Vojvodina in Novi Sad, Admiral in Vinkovci …
Herberge Raša.
Vor meinen Augen erschien die Aufschrift über dem Eingang zu einem zweistöckigen Gebäude an der Ecke. Der Bus aus Pula bremste hier ruckartig, drehte und fuhr zu dem Hauptplatz des Bergbaustädtchens. Dort machte er für eine Viertelstunde Pause.
Ich spazierte über die Bühne des Theaters von Raša. Dieser Platz war von Kulissen umgeben: Bahnhofsgebäude, Kirche, eine breite Treppe, eine langgezogene Fassade, ein Torbogen mit Parolen verziert am Anfang von etwas, das wie eine Straße aussah, sich aber zehn Schritte weiter als Illusion entpuppte, hier war die Bühne zu Ende. Die Stadt war gespenstisch leer. Die Reisenden waren Statisten in einer Vorstellung, die für einen Augenblick angehalten wurde.
Jahrelang legte ich, wenn ich nach Rijeka oder nach Zagreb unterwegs war, einen Zwischenstopp in Raša an. Eine Viertelstunde für Kaffee, Zigarette, Toilette. Ich lief zur Mitte des Platzes. Kreisrunde Fenster am Kinogebäude. Sie erinnerten an ein verlassenes Schiff. Und stets das Gefühl, im Nirgendwo gelandet zu sein. Allein in einem Film ohne Ton.
Gegen Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts verschwand die Herberge Raša aus meinem Blickfeld. Aber das Wort »Herberge« selbst behielt einen Sonderstatus in meinem Gedächtnis bei. Entblößt und geheimnisvoll gemahnte dieses Wort an eine Zeit der Armut, an billige Seifen und verrauchte Wartezimmer an Bahnhöfen, an trübe Schaufenster mit Konfektionsware und Milchläden. An Koffer ohne Räder.
Wenn auch der letzte Stern erlischt, verliert ein Hotel seine Kategorie. Es wird zu einer Herberge. Bett, Schrank, Waschbecken. Toilette auf dem Gang. Und Schlaf.
Im Hotel lebe ich in der dritten Person. Mit einem anderen Kopf.
Ich hinterlasse Spuren. Das Bett lasse ich ungemacht. Ich genieße den Luxus der Unordnung. Die Freiheit. Denn Ordnung ist nichts anderes als die Abwesenheit des Lebens. Ein Triumph des Grabes.
Denk ein bisschen nach, hörte ich meine Mutter.
Das konnte nur eines bedeuten: so denken, wie sie dachte. Lange Zeit hatte ich den Kontakt zu mir selbst verloren. Dann nahmen die Verstrickungen ihren Lauf. Die Angst setzte ein, sobald Ende Mai die Badesaison begann. Dann galt es ein gutes Szenario für den Strand zu erfinden. Sich unter die anderen mischen, ohne sich anmerken zu lassen, dass man nicht gut schwimmen konnte.
Meine erste Liebeserfahrung erlebte ich an einem verregneten Nachmittag im August. Tagelang hatte der Jugo geblasen. Es war plötzlich kälter geworden. Die Strände waren leer. Ich war entspannt und glücklich.
3
Es kommt häufig vor, dass wir einen Raum betreten und vergessen, warum wir überhaupt hineingegangen sind. Am leichtesten fällt es uns wieder ein, wenn wir den Raum durch dieselbe Tür verlassen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Probanden eine vorgegebene Aufgabe drei Mal häufiger vergessen, wenn sie zuvor durch eine Tür gegangen sind, als wenn sie dies nicht getan haben. Unser Gehirn erlebt die Tür alsGrenze des Geschehens,und daher verbucht es eine Entscheidung, die in einem bestimmten Raum getroffen wurde, als abgeschlossen, wenn wir den Raum verlassen. Deshalb können wir uns wieder daran erinnern, wenn wir in den Raum zurückkehren.
4
Der Keller in der Villa Maria war eine Grenze des Geschehens, eine Bühne, auf der sich ein ausgedachtes Leben abspielte. Jede erdenkliche Flucht war möglich. Ein langer Gang führte vorbei an einer Tür mit Vorhängeschloss bis zu einem geräumigen Waschraum. Weit oben an beiden Außenwänden waren längliche vergitterte Fenster. Ein tiefes, trogartiges Waschbecken aus Beton zog sich fast über die gesamte Wandbreite. In der Ecke, neben dem Kessel, stand ein Stuhl mit einer gepolsterten Lehne.
Der Junge im Waschraum war ich. Ein Unzufriedener, ein Rebell, ein Kellerwesen, dessen Handlungen von jenem »Anderen« gelenkt werden, vom Doppelgänger aus dem ersten Stock, von demjenigen, der, unter der gestrengen Obhut der mütterlichen Erziehung, alles bestimmt. Ein Gefangener im Imperativ der Verantwortung, stets eifrig darum bemüht, alles, was passieren könnte, zu antizipieren. Deshalb war noch Jahre später stets alles parat im Rucksack, Regenschirm, Taschenlampe, ein trockenes Oberteil, Aspirin. Requisiten, um den Rebell auf dem Thron zwischen Kessel und Waschbecken zu besänftigen. Bis zum Schluss gelang es ihm nicht, die dreiundvierzig Stufen zurückzulegen, die den Waschraum des ehemaligen Hotels Central von der Wohnung im ersten Stock trennten. Die Kellertür blieb geschlossen.
Zwei Jahre lang wurde in der Villa Maria ein Militärhotel mit dem Namen Central betrieben, in dem englische Offiziere lebten. Man munkelte, in den Kriegsjahren hätte es dort ein Bordell für geschlossene Gesellschaften gegeben, das nach der Kapitulation über Nacht zu einem Hotel für hohe Offiziere umfunktioniert worden war. Im September 1947 kam es zur Übergabe an die Stadt. Mein Vater, ein junger Leutnant der jugoslawischen Kriegsmarine, steht am Deck des Panzerträgers am Eingang zum Hafen von Pula. Die angloamerikanischen Truppen verlassen die Stadt. Die Tage danach sind ein einziges Volksfest. Aus den Lautsprechern, die auf Balkonen und Masten für die Straßenbeleuchtung angebracht sind, dröhnen Ansprachen, Partisanenlieder und Märsche. Überall flatternde Fahnen. Parolen auf den Wänden. Plakate mit den Gesichtern der Volkshelden. Eine Euphorie, verewigt in Filmzeitschriften und auf Kinoleinwänden überall im ganzen Land, einem Land, das nun endlich sein Territorium abgesteckt hatte.
Das, was auf den Kinoleinwänden und dem Repertoire der Filmnachrichten nicht zu sehen war, waren die einzelnen Schicksale. Eine leergefegte Stadt, verlassene Wohnungen, künftige Kinder, gezeugt in Beziehungen zwischen den Frauen aus Pula und ausländischen Soldaten. Die eine Armee ging, die andere kam. Tage, an denen es in den Lagern bei Triest und Udine vor italienischen Flüchtlingen aus Istrien wimmelte. In den Waschkesseln des Hotels Central wurde die Vergangenheit ausgekocht. Die Wäsche war wieder rein. Spurenlos.
Stundenlang saß ich in meinem Unterschlupf. Ich ahnte, hier war das Herz der Villa Maria. Der Kessel und das Waschbecken aus Beton hatten seit Anbeginn Bestand, sie waren unverrückbar. Im Halbdunkel des Kellers wartete ich darauf, dass die Bewohner des Hotels Central auftauchten. Ich stellte mir kräftige englische Offiziere in hellen Uniformen vor. Und verruchte Frauen, die in der Erinnerung an italienische und deutsche Uniformen schwelgten. Noch immer konnte man sie von Zeit zu Zeit sehen, nunmehr betagte Damen, die in den engen Passagen und Treppenhäusern der Altstadt unter der Festung Kaštel umherliefen. Wenn sie in den Treppenhäusern der Gupčeva und Kandlerova ulica verschwanden, hallte ihnen bösartiges Getuschel nach. Sowohl die Damen selbst als auch ihre bissigen Biographen waren Figuren aus Geschichten, die niemals vollständig erzählt sein werden.
Eine Zeitlang, etwa ein oder zwei Jahre, diente die Villa Maria als Heim für Kriegswaisen. Und dann kamen Mitte der fünfziger Jahre die neuen Mieter – verdiente Kämpfer aus dem Volksbefreiungskrieg. Wir mischten uns ebenfalls unter die kommunistische Elite, nachdem mein Vater versetzt worden war und an einem Novembertag im Jahr 1958 die Donau gegen die Adria eintauschte. Anstatt jeden Tag zur Anlegestelle in Belgrad zu gehen, wo der Monitor Sava vor Anker lag, ging Vater nun in die Musil-Kaserne, die den Hafen von Pula vom Meer aus schützte. Durch diesen Umzug handelte ich mir unter Gleichaltrigen bald die folgende Kurzbeschreibung ein: der Junge aus der Villa.
Ich spreizte die Finger und zählte bis zehn. Ich versuchte, die Zeit zu überblicken. Jeder Finger ein Jahr. Lautlos zählte ich lange Minuten ab. Was alles hatte Platz in einem Jahr? Wie viele Menschen und Ereignisse? Ich reiste durch die Zeit, auch wenn ich nicht im Keller war. Treppenstufen. Dreiundvierzig bis zu unserer Wohnung. Mein Vater war dreiundvierzig. Wenn ich auf meinem Schulweg zur Straße des Ersten Mai die Treppe hinunterstieg, blieb ich an jeder fünfzehnten Stufe kurz stehen, dort, wo sich jeweils ein Podest von einigen Metern Länge befand. Ich ließ den zurückgelegten Weg Revue passieren. Was alles hatte ich durch die Fenster in den Häusern gesehen? Mein eigenes Leben, diese etwa zehn Jahre, verbrauchte ich, noch bevor ich das erste Treppenpodest erreichte. Der Rest des Wegs war die Zukunft. Die Jahre, die mir noch bevorstanden. Jeden Tag durchlief ich auf meinem Schulweg dieses ungelebte Leben. Eines Tages würde auch mein eigenes Leben drei Treppenkaskaden bemessen. Ich würde älter sein als mein Vater jetzt. Und wenn ich schließlich auch die letzte Kaskade hinter mich gebracht hatte, kam ich als ein alter Mann von siebzig Jahren in der Straße des Ersten Mai an.
Der Weg nach Hause war noch länger. Er führte mich durch die Straße des Ersten Mai bis zum Goldenen Tor, dann die Steigung hinauf, ohne Treppen. Eine ganze Stunde nahm diese Reise in Anspruch. Immer wieder blieb ich stehen, warf einen Blick in die Innenhöfe mit den kleinen Gärten, Weinreben, Feigenbäumen und Ligustern. Mauern, ganz in Lorbeergrün getaucht. Ich las die Namen der Bewohner auf den Metallschildern neben den Eingangstüren. Daraus entwickelte sich später meine Leidenschaft für Telefonbücher. Für eine Geschichte genügte ein Name, die Kombination aus einigen Silben, die einen sonoren Klang ergaben, oder der knirschende Ton verdoppelter Konsonanten. Eine besondere Schwäche hatte ich für Nachnamen ohne die übliche Endung »ić«, mit langen Vokalen, die ich genüsslich noch weiter in die Länge zog und das Versprechen der Geheimnisse auskostete, die in diesen melodischen Chiffren stecken mochten. Einige Eingangstüren hatten keine elektrische Glocke, sondern einen Eisenring, der an einer Metalloberfläche befestigt war. Oder aber eine Kette in der Rille des Türpfostens, die einen Glockenmechanismus im Hof in Gang setzte.
Der alte Stadtteil, wo sich vor Ankunft der Römer die Burgruine Histria befunden hatte, ist durchzogen von schmalen Durchgängen, welche die Straßen Prvomajska und Kandlerova ulica mit dem engeren Ring verbinden, der Gupčeva ulica. Ganz oben, im Mittelpunkt des Spinnennetzes, befindet sich das Kaštel, eine venezianische Festung aus dem 17. Jahrhundert. Es konnte gar nicht genug Finger und Stufen geben, um die Zeit abzumessen zwischen einem römischen Legionär auf seiner Galeere und meinem Vater, einem jungen Leutnant der jugoslawischen Kriegsmarine, der vom Deck seines Panzerträgers auf die Riva von Pula herabblickte. Die Blicke der beiden kreuzten sich im Dunkel des Waschkellers. Dort, auf dem Thron zwischen Kessel und Betonbecken, lebte die Vergangenheit in der Gegenwart auf. Die ganze Welt pulsierte im Kopf des wagemutigen Jungen. Die Vorsehung hat dafür gesorgt, dass alle an die Reihe kommen: der römische Legionär genauso wie mein Vater. Und ich.
Und auch der englische Offizier. Denn nichts konnte einfach so verschwinden. Alles, was gewesen war, existierte für immer. Damals wusste ich noch nichts über die ersten Besitzer der Villa Maria. Aber auch sie steckten bereits irgendwo in den Hosentaschen der Zeit. Jeden Tag kam ich an ihnen vorbei. Ich schlief im selben Zimmer, in dem sie geatmet hatten. Ich hatte eine Ahnung von ihrer unzerstörbaren Existenz. All die Worte, die sie ausgesprochen hatten. Die Bilder, die sie in ihrem Inneren trugen. Die Welt war eine endlose Verschmelzung.
Eines Morgens stand Lisetta, Mamas Freundin aus dem Haus gegenüber, gemeinsam mit einer Italienerin, der Tochter des ehemaligen Besitzers der Villa Maria, vor unserer neuen Wohnungstür. Lisetta dolmetschte. Mama bat die beiden herein. Mich und meine Schwester schickte sie in den Garten zum Spielen. Bald verließen auch Lisetta und Mama die Wohnung.
»Das hättest du sehen sollen«, sagte Mama am Abend zum Vater. »Sie wollte die Zimmer besichtigen. Unsere Wohnung war früher ihr Teil der Villa gewesen. Dann stand sie lange auf der Terrasse und schaute sich um.«
»Das ist ein richtiger Verlust, ein solches Haus. Verglichen damit ist unser geplünderter Waggon rein gar nichts«, kommentierte mein Vater.
Es gefiel mir, wie die Italienerin am Terrassengeländer stand. Edel und stolz wie eine Sphinx. Ich hatte mich in einer Baumkrone versteckt und sie von dort aus beobachtet. Die ganze Zeit über hatte sie ihren Blick zur Schiffswerft und zur Veruda schweifen lassen. In den folgenden Tagen stand ich ebenfalls in Gedanken versunken auf der Terrasse und blickte zu den Kasernen am Musil, zu der Zementfabrik und der Marinekirche. Ich ahnte, dass nur ein großer Verlust ein Gesicht so zu veredeln vermochte, wie es bei der Italienerin der Fall war. Es genügte nicht, dass der Waggon mit deinen Habseligkeiten ausgeraubt wurde. Der Verlust musste viel größer sein. Ich wünschte mir, dass mir eines Tages auch etwas Derartiges widerfahren möge, damit auch mein Blick so bitter und hart würde.
Ich stand mit dem Abstand eines halben Jahrhunderts am Kaštel und betrachtete den Hof der Villa Maria. Durch die Baumkronen erkannte ich das gegenüberliegende Haus, die Fenster von Lisettas Wohnung im zweiten Stock. Ich sah, dass die zwei Fenster am Rand inzwischen zugemauert waren. Wie die leeren Augen eines Blinden. Dabei hatte gerade an dieser Stelle zwischen den Fenstern früher der Fernseher gestanden. Eines der ersten Fernsehgeräte in der Gupčeva ulica. Die Nachbarskinder kamen zu Lisetta, um Zeichentrickfilme zu schauen. Die Älteren kamen für Serien und Festivals. Bei Lisetta liefen immer italienische Programme. San Remo. Mina, Claudio Villa, Modugno, Rita Pavone, Bobby Solo. Und Sergio Endrigo aus Pula. Quizsendungen auf RAI. Sette voci. Pippo Baudo.
Als meine damals neunjährige Schwester am Festival Kinder singen – Zagreb 1964 teilnahm, verbrachte ich einige Tage in Lisettas Wohnung. Mama war mit meiner Schwester nach Zagreb gefahren. Ich hatte nachmittags Schulunterricht. Sobald Lisetta morgens zum Markt ging, verließ ich das Bett und machte mich daran, die Wohnung zu erkunden. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, das Bewusstsein zu verlieren angesichts der Erkenntnis, dass ich gerade dabei war, etwas Verbotenes zu tun. Die voyeuristische Neigung, die sich im Keller der Villa Maria gezeigt hatte, wo durch die Fenster für wenige Sekunden die nackten Beine der Nachbarinnen zu sehen waren, während sie im Hof ihre Wäsche aufhängten, fand erst bei meinem Aufenthalt in Lisettas Wohnung ihre vollständige Erfüllung. Ich betrat jenes andere Zimmer, das Lisetta mir nicht gezeigt hatte, das Zimmer, in dem sie schlief. An den Wänden hingen ein Dutzend kleiner eingerahmter Fotografien. Doch diese nahm ich erst später in Augenschein, nachdem ich die Schränke und Kommoden erforscht hatte. Der schwere Geruch von Wintermänteln, Pelzüberwürfen und Umhängen. Frauenhüte mit Federschmuck. In den Schubladen Halstücher, Seidenstrümpfe, Schals, Handschuhe. In einer Schachtel stieß ich auf eine Taschenuhr für Herren und eine goldene Halskette. Ich kann mich nicht erinnern, dass Lisetta diese eleganten Sachen getragen hätte. Sie war immer bescheiden gekleidet. Diese Dinge schienen einer anderen Person gehört zu haben, die früher einmal dort gelebt hatte. Und irgendwann fortgegangen war.
Dann kamen die Fotografien an die Reihe. Ein ganzes Leben war hier an die Wand gebannt. Über dem Bett hingen an einer Korkpinnwand vergilbte kleinformatige Bilder und Postkarten mit abgewetzten Rändern. Bei einigen hatten Zeit und Feuchtigkeit dafür gesorgt, dass die Oberfläche sich stellenweise bereits abgelöst hatte und die Ecken eingerollt waren. Grobe Gesichter, knotige gebogene Nasen, dunkle Augen, starre Blicke. Gesichtszüge wie von einem anderen Planeten. Fese und Mützen auf den Köpfen der Männer. Dichtgedrängte, übervolle Marktstände. Tabaktrafiken. Fischgeschäfte. Straßenszenen. Firmennamen in schnörkelhaften, unbekannten Buchstaben. Über dem breiten Eingang zu einem Palais eine Tafel mit lateinischen Buchstaben: Kinematografos Odeon. Ein Mädchen in einem weißen Kleid mit langen Zöpfen auf einem Trampelpfad im Park. Ich fand das Mädchen noch auf einigen anderen Fotografien. Auf einer saß sie auf dem Schoß eines eleganten Mannes mit Halsschleife und Strohhut. Derselbe Mann stand in einem dunklen Anzug und mit Bowler-Hut vor einem zweistöckigen Gebäude mit einem schmiedeeisernen Balkon und breiten französischen Fenstern. An der Fassade war eine längs beschriebene Tafel angebracht: Ksedohion Egnatia. Außerdem einige schwarz-weiße Postkarten aus einer Stadt am Meer. Ein dichtes Spalier von Segelmasten im Hafen. Am unteren Rand einer sepiafarbenen Postkarte lateinische Buchstaben: Thessaloniki.
Schritte in der Küche. Geschickt entfernte ich mich von der Bilderwand. Lisetta tauchte an der Zimmertür auf. Sie lächelte und sprach mich in einer unbekannten Sprache an. Raschelnde Wörter, als würde ihre Stimme durch Blätter dringen. Sie sagte, das sei Griechisch, die Sprache, die sie in ihrer Kindheit gesprochen habe. In Thessaloniki.
Ich war überrascht von ihrer Reaktion. Ich hatte Tadel erwartet oder zumindest die Frage, was ich hier denn mache. So erging es mir immer, wenn Mama mich dabei erwischte, dass ich fremde Sachen durchwühlte. Wenn wir bei jemandem zu Besuch waren, wartete ich auf den richtigen Moment, um mich in ein menschenleeres Zimmer davonzustehlen und alles zu erforschen. Das war meine Leidenschaft. Ich sagte, ich würde, wenn ich einmal groß bin, ein Forscher werden. In aller Heimlichkeit die Schubladen in einer fremden Wohnung herauszuziehen, den Duft aus dem Kleiderschrank in der Nase spüren, Gegenstände berühren, sich in Fotografien auf Kommoden vertiefen, all das ließ mich in höchste Verzückung geraten. Die leicht geöffnete Tür einer Abstellkammer, der Lagerraum eines Supermarktes, das Gitter eines Kellerabteils rauben mir noch heute den Atem.
Als Lisetta Thessaloniki erwähnte, erzählte ich ihr, dass mein Großvater dort im Krieg gekämpft hatte. Alle Kämpfer, die dort gewesen waren, hießen Solunci. Zuvor war mein Großvater auf Korfu stationiert, später in Tunesien, wo er in einem Krankenhaus in Bizerta behandelt wurde, nachdem er bei der Durchquerung Albaniens Verletzungen davongetragen hatte. Lisetta wunderte sich, dass ich mir alle diese Städte gemerkt hatte.
»Ich merke mir nicht nur Städte«, sagte ich. Ohne ihre Reaktion abzuwarten, sagte ich die Nachnamen von den Metallschildern neben den Eingangstüren auf, und zwar in jener Reihenfolge, in der ich sie jeden Tag auf meinem Weg sah, eine Reihe von Tasten, die jeweils einen eigenen Ton von sich gaben.
In den darauffolgenden Tagen, bevor Mama und meine Schwester aus Zagreb zurückkehrten, unternahm ich mit Lisetta viele Spaziergänge durch Thessaloniki. Wir setzten uns auf ihr Bett, mit dem Gesicht zu der Pinnwand mit den Fotografien. Es war so wie im Waschraum, wo ich mir die englischen Offiziere vorgestellt hatte. Nicht nur die Menschen von den Fotos waren bei uns, sondern auch diejenigen, die Lisetta mit geschlossenen Augen herbeirief. In solchen Momenten war sie so vertieft, dass sie meine Anwesenheit gar nicht mehr bemerkte. Wie in Trance sprach sie Worte auf Griechisch. Dann wechselte sie ins Italienische, was ich teilweise verstand. Sie war also nicht mehr in Thessaloniki, sondern in Ancona, und sie sprach von ihren Vorfahren, der Familie Benedetti. Auf einem knittrigen Foto zeigte sie mir einen bärtigen alten Mann. Ambrogio Benedetti, Lisettas Urgroßvater, hatte in Thessaloniki das erste europäische Hotel eröffnet: Albergo Benedetti. Anschließend wiederholte sie: Ksenodohion Benedetti.
Die Gärten von Beschinar, sagte Lisetta. Dort hatte sie gespielt. Die Straßenbahn fuhr am Park vorbei. Es war ihr verboten, weiter wegzugehen, nach Bara, ins Rotlichtviertel mit den Stundenhotels Aphrodite und Bacchus. Die Grenze ihrer Welt verlief hinter dem alten Markt, wo es eine Reihe von Gemischtwarenläden gab: Kapon, Perachia, Modiano, Benmayor, Moreno. Sie spielte mit den Kindern jüdischer Händler, von denen sie auch Ladino lernte. Sie ging nicht in die Synagoge und trug nicht zwei Namen wie diese Kinder – einen für zu Hause, einen für die Straße –, so wie ihr bester Freund Francesco, der zu Hause Abraham hieß.
Dann schwieg sie eine Zeitlang. Das Mädcheninternat der Frau Haslinger in Wien, sagte sie. Dort hatte sie fünf sorglose Jahre verbracht. Sie studierte Gesang am Konservatorium. Als der Krieg begann, schickten die Eltern sie zu Verwandten nach Triest. Dort, im Windschatten, in der Stadt an der Adriaküste, sollte sie das Ende des Krieges abwarten. Und dann gab es den großen Brand in Thessaloniki. Das gesamte Stadtviertel, in dem ihre Eltern lebten, brannte bis auf die Grundfesten nieder. Sie sah ihre Eltern nie wieder. Und ihre Stadt gab es nicht mehr. Jetzt steht dort eine andere Stadt, die denselben Namen trägt. Aber die Straßen und die Plätze, in denen sie aufgewachsen war, die gibt es nicht mehr, nicht die Häuser, nicht die Parks; nichts ist mehr da von dem, was hier an der Wand existierte – und in ihrer Erinnerung. Die Eltern haben kein Grab, denn ihre Körper wurden niemals gefunden.