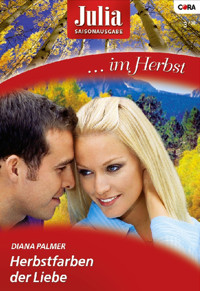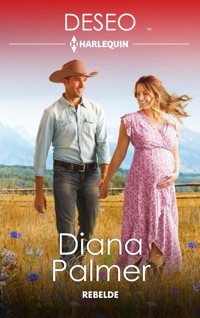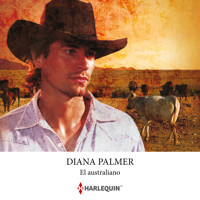5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia Best of
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
ZÄRTLICHE KÜSSE AUF ST. MARTIN Mit jedem Tag auf der zauberhaften Karibikinsel St. Martin verliebt sich Stephanie Summers mehr in den attraktiven Fabrikanten Philippe Cambridge. Doch auch die Angst wächst, dass ihr Traummann erfährt, wer ihn so schwer verletzte. Stephanie überfuhr ihn mit ihrem Boot ... PARIS – UND SEHR VIEL LIEBE Ganz Paris träumt von der Liebe – auch die hübsche Ivy! Sie sehnt sich nach Küssen und Nächten voller Leidenschaft mit dem attraktiven Ryder, der sie in die romantische Stadt an der Seine begleitet hat. Soll sie es wagen und ihm ihre heimlichen Wünsche gestehen? VOM VERLANGEN BESIEGT Ein heißer Begrüßungskuss von Alexander – und sekundenlang schwelgt Jodie in erregenden Fantasien. Bis ihr einfällt: Alles nur Show! Sie spielt ja bloß die Geliebte für den attraktiven Agenten. Doch ihr Verlangen muss sie nicht vortäuschen – das ist nämlich echt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Ähnliche
Diana Palmer
JULIA BEST OF BAND 263
IMPRESSUM
JULIA BEST OF erscheint in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Neuauflage in der Reihe JULIA BEST OF, Band 263 03/2023
© 1990 by Diana Palmer Originaltitel: „Bound by a Promise“ erschienen bei: Silhouette Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Robyn Peters Deutsche Erstausgabe 1990 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe JULIA EXTRA, Band 51
© 2014 by Diana Palmer Originaltitel: „The Best Is Yet To Come“ erschienen bei: Silhouette Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Constanze Suhr Deutsche Erstausgabe 1993 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe COLLECTION BACCARA, Band 74
© 2003 by Diana Palmer Originaltitel: „Man in Control“ erschienen bei: Silhouette Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Gabriele Braun Deutsche Erstausgabe 2004 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe BACCARA, Band 1296
Abbildungen: Harlequin Books S. A., Getty Images / lucky-photographer, alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 03/2023 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783751519243
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
Zärtliche Küsse auf St. Martin
1. KAPITEL
Allein stand er am Ufer des Sees – eine hochgewachsene, einsame Gestalt inmitten der feinen Nebelschleier; die an diesem frühen Morgen noch immer das silbern schimmernde Wasser verhüllten.
Stephanie hatte diesen Mann schon einige Male gesehen, seit sie und Miriam in das Haus am See gezogen waren. Dort wollten sie den Sommer verbringen. Aber sehr oft hatte Stephanie nicht hierher kommen können – und wenn, dann nur für eine kurze Zeit. Sie musste nämlich viel und hart arbeiten, um die Abgabetermine für die Manuskripte der berühmten Schriftstellerin einzuhalten. Und eine dieser seltenen Gelegenheiten war von dem Mann, der nun am Ufer stand, mit seiner Überheblichkeit gestört worden.
Obwohl Stephanie Summers all das ablehnte und verachtete, was Philippe Cambridge verkörperte, kam sie doch gegen ihr Interesse für ihn nicht an. Cambridge besaß eine der größten Flugzeugfabriken des Landes, und seine geniale Begabung, neue Flugzeugtypen zu entwerfen, hatte ihm zu weltweiter Berühmtheit verholten. Aber für Stephanie bedeutete dies nur, dass sich ein solcher Mann einfach alles kaufen konnte – sogar Menschen.
Auf diesem Gebiet kannte sie sich bestens aus. Sie war nämlich gerade erst von einem reichen Mann, den sie sehr geliebt hatte, verlassen worden. Das ereignete sich, als er feststellte, dass sie den gesellschaftlichen Ansprüchen seiner Familie angeblich nicht genügte.
Die Tochter eines kleinen Farmers aus Texas, deren Eltern außerdem auch noch geschieden waren, kam für die sogenannte feine Gesellschaft natürlich nicht in Frage. Und wenn Stephanie den Job bei der berühmt-berüchtigten Miriam Niccole nicht bekommen hätte, durch den sie ihrem Vater helfen konnte, wäre dessen kleine Rinderfarm sogar noch versteigert worden. Zu allem Unglück ging es nicht nur mit der Farm allmählich bergab, sondern auch noch mit der Gesundheit ihres Vaters.
All diese bedrückenden Gedanken zogen Stephanie durch der Kopf, als sie am Strand des riesigen Laniersees saß. Sie war zu diesem Platz gekommen, weil sie Ruhe und Frieden finden wollte. Und jetzt wünschte sie sich sehnlichst, dieser einsame Mann hätte sich entschlossen, die Sommermonate in Europa oder Miami zu – verbringen, statt ausgerechnet hier. Vielleicht glaubte er, dass die vielen Reporter, die ihn ständig verfolgten, ihn an diesem See in North Georgia nicht suchen würden. Anscheinend hatte er recht, denn er war allein – eine gespenstisch anmutende Gestalt in braunen Sporthosen und einem cremefarbenen Hemd mit offenem Kragen. Die leichte Brise spielte mit dem dunklen Haar des Mannes in den Nebelschleiern.
Als ob er den durchdringenden Blick von Stephanies hellbraunen Augen gespürt hätte, drehte sich Cambridge unvermittelt um und entdeckte Stephanie auf dem Baumstamm sitzend. Das silberblonde Haar fiel ihr wie weiche Seide um die schmalen Schultern.
Die Hände in den Hosentaschen vergraben, kam er auf Stephanie zu, bis er dicht vor ihr stand und sie mit seiner hochgewachsenen Gestalt bedrohlich überragte. Zornig schauten die grünen Augen in dem so dunklen Gesicht wie dem eines Indianers auf die hinunter.
„Sie dürfen sich hier nicht aufhalten“, sagte er barsch. Die Mühe, wenigstens einigermaßen höflich zu sein, machte er sich nicht. „Unbefugten ist der Zutritt verboten.“
Mit schiefgelegtem Kopf blickte Stephanie zu ihm hoch. „Entschuldigen Sie. Mir ist nicht bewusst gewesen, dass Ihnen außer dem See auch noch der ganze Uferstreifen gehört.“ Mit dieser Bemerkung spielte Stephanie auf einen Zwischenfall an, als der Mann ihr praktisch befohlen hatte, vom See zu verschwinden. In ihrer Stimme klang bitterer Spott.
Der entging Cambridge offenbar nicht, denn er zog eine Augenbraue hoch, erwiderte jedoch beherrscht: „Ich besitze zweitausend Ar des Ufergebietes. Die Stelle, auf der Sie sich befinden, ist ein Teil davon. Und ich kam hierher, um für mich zu sein. Aber nicht, um von neugierigen Menschen gestört und verfolgt zu werden.“
In diesem Augenblick hätte Stephanie alles dafür gegeben, viel Geld und viel Macht zu haben. Dann könnte sie diesem überheblichen Kerl gehörig die Meinung sagen und ihn zum Teufel schicken. Doch sie hatte nichts, und er wäre durchaus berechtigt, sie ohne weiteres davonzujagen.
Ohne den Mann noch eines weiteren Wortes zu würdigen, stand Stephanie auf und klopfte den Staub von ihren blauen Denim-Jeans ab. Dann begab sie sich mit einem tiefen Seufzer auf den Weg zu Miriams luxuriösem Strandhaus.
„Wer sind Sie eigentlich?“, rief ihr der Mann hinterher.
„Joan Collins, das Denver-Biest“, antwortete sie schnippisch. „Halten Sie bitte Ausschau nach meinem Privatflugzeug. Ich scheine es offenbar falsch abgestellt zu haben.“
Hinter sich glaubte sie das tiefe Lachen des Mannes zu vernehmen. Zornig lief sie weiter. Miriam wartete bereits ungeduldig im weiträumigen Wohnzimmer auf Stephanie. Das schmale Gesicht Miriams war nervös, und sie hatte ihre Koffer schon gepackt.
„Gott sei Dank, dass Sie endlich zurück sind“, sagte Miriam sichtlich erleichtert. „Ich dachte, Sie würden überhaupt nicht mehr heimkommen. Steffi, ich habe soeben ein Telegramm erhalten. Mein Vater liegt im Krankenhaus. Ich muss so schnell wie möglich nach Paris fliegen.“
„Das tut mir leid“, erwiderte Stephanie, die ehrlich besorgt war.
„Mir auch“, bemerkte Miriam traurig. „Ich mag diesen alten Knaben wirklich sehr gern, auch wenn er mich enterbt hat. Das geschah, als ich ihm meinen Entschluss verkündete, Romanautorin zu werden. Schätzchen, glauben Sie, die Stellung halten zu können, bis ich zurückkomme? Leider habe ich nicht die geringste Ahnung, wie lange es dauern wird.“
Stephanie nickte ihrer Arbeitgeberin mit einem aufmunternden Lächeln zu. Das verspannte, hagere Gesicht und die traurigen blauen Augen der älteren Frau mit dem grau melierten lockigen Haar machten Stephanie schwer zu schaffen. „Während Ihrer Abwesenheit tippe ich das Manuskript zu Ende ab.“
„In Ordnung.“ Miriam schaute sich um, ob sie vielleicht noch etwas vergessen hätte. „Übersehen Sie bitte das Blatt mit den Änderungen nicht, die ich gestern Abend vorgenommen habe. Es müsste in der obersten Schublade meines Schreibtisches liegen. Und vergessen Sie um Himmels willen nicht, nachts immer die Türen abzuschließen.“
„Das werde ich bestimmt nicht vergessen. Machen Sie sich um mich keine Sorgen.“
„Dagegen komme ich nicht an“, entgegnete Miriam mit einem winzigen Lächeln. „In letzter Zeit sind Sie ziemlich zerstreut gewesen, Stephanie. Ist es der Job? Möchten Sie aufhören, für mich zu arbeiten?“
„Nein, das ist es nicht“, lautete die hastige Antwort. „Ich … oh, ich weiß nicht so recht. Vielleicht liegt es am Wetter. Es ist so schrecklich heiß und bedrückend.“
„Das Wetter oder die Erinnerung?“, bohrte Miriam nach. „Jesse Drewe war ein dreifacher Schurke, mein Liebes. Sie haben wahrlich etwas Besseres als diesen Kerl verdient.“
Unbehaglich trat Stephanie von einem Fuß auf den anderen. „Wissen Sie, es wäre mir leichter zumute, wenn man mich aus persönlichen Gründen verscheucht hätte und nicht wegen des Mangels an Geld und der fehlenden gesellschaftlichen Stellung. Darum abgewiesen zu werden, tut weh.“
„Ich weiß. Aber wir können uns die Liebe nun einmal nicht nach dem Katalog bestellen. Wenn es ginge, wäre es zu schön, um wahr zu sein. Aber Sie kommen über diese ganze unglückliche Geschichte schon hinweg. Auch wenn Sie mir das jetzt nicht glauben, wird es geschehen.“
„Natürlich komme ich darüber hinweg“, behauptete Stephanie, obwohl sie sehr daran zweifelte. „Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Und bitte, geben Sie mir gleich Bescheid, ob Sie Ihr Ziel heil und gesund erreicht haben.“
„Ich schicke Ihnen ein Telegramm. Das verspreche ich Ihnen.“ Miriam hob einen Koffer vom Fußboden, den zweiten sollte Stephanie ihr nachbringen. Auf dem Weg zum Mietwagen erkundigte sich Miriam beiläufig: „Wo sind Sie eigentlich so lange gewesen?“
„Am Strand. Ich war zumindest solange dort, bis Mr. Cambridge-Vereinigte-Flugzeugwerke mir befahl, seinen Grund und Boden zu verlassen.“
Abrupt blieb Miriam stehen und schaute Stephanie eindringlich an. „Schon wieder Philippe.“ Miriam seufzte tief auf. „Ach, Stephanie, können Sie denn nicht ein bisschen freundlicher zu diesem Mann sein? Sie hatten bereits eine Auseinandersetzung mit ihm, weil Sie so schnell mit dem Boot über den See gefahren sind und …“
Stephanie fiel ihr ins Wort. „Der See gehört ihm nicht!“, rief sie trotzig, weil sie sich nur zu gut an den Zwischenfall und Cambridges eisige Stimme erinnerte. Er hatte Stephanie barsch mitgeteilt, dass er ihr die Wasserpolizei auf den Hals schicken würde, wenn sie nicht aufhörte, wie eine Wahnsinnige auf dem See herumzurasen. Stephanie hatte ihn gleich nach den Fotos in den Zeitungen und Illustrierten erkannt und zornig erwidert, er soll sich zum Teufel scheren. Dann war sie in Miriams kleinem Boot davongeschossen.
Seit jenem Tag hatte sie diesen Mann öfter gesehen, wie er am Strand entlangschlenderte. Sie war aber nie mein: von ihm angesprochen worden. Nun, sie achtete ja auch sorgfältig darauf, dass er ihr nie mehr so nahekam, um sie anzureden.
„Irrtum, Stephanie. Ihm gehört ein beträchtlicher Teil des Sees.“ Miriam fasste Stephanie an den Schultern und lächelte über deren bockiges Gesicht. „Stephanie, bitte legen Sie sich nicht mit ihm an“, warnte Miriam eindringlich. „Er kann Ihnen gewaltig schaden. Versuchen Sie nicht, ihn für Jesses gemeines Verhalten büßen zu lassen. Jesse war ja nur ein Junge. Aber Philippe …“ Miriam hielt inne und suchte nach den richtigen Worten. „Philippe ist ein knochenharter Mann, der nach seinen eigenen Gesetzen lebt. Seien Sie vorsichtig, dass Sie ja nicht eines seiner Gesetze brechen. Er kann nämlich zu einem gnadenlosen Feind werden.“
„Woher wissen Sie das alles?“
„Bevor ich mich entschloss, Bücher zu schreiben, bin ich Reporterin gewesen“, erklärte Miriam nachdenklich. „Als ich eine Reportage über ihn machte, habe ich einen seiner obersten Berater falsch zitiert. Philippe sorgte dafür, dass ich entlassen wurde. Und jedes Mal, wenn ich mich um eine andere Stellung bewarb, schien der Job für mich nicht der richtige zu sein. In meiner Verzweiflung schickte ich Philippe einen langen, tränenreichen Entschuldigungsbrief. Und wissen Sie, was daraufhin geschah? Alle möglichen Redakteure und Verleger setzten sich mit mir in Verbindung und baten mich zu einem Gespräch.“ Miriam schmunzelte. „Es war eine verflixt harte Art zu lernen, wie notwendig absolute Genauigkeit ist. Diese Lektion habe ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen.“
Trotz der Hitze spürte Stephanie eisige Schauer über ihren Rücken rieseln. „Der Mann hört sich wie eine Planierraupe an, die alles niederwalzt.“
„Genauso ist er. Ein Mann, der sich ein so gewaltiges Unternehmen aufbaut und es erhalten will, muss rücksichtslos sein.“
„Mir tut seine Frau leid.“
„Er hat keine.“
„Das überrascht mich nicht.“
„Dafür hat er viele Frauen.“ Miriam lachte. „Sozusagen seinen persönlichen Harem, und die Frauen schwelgen in Juwelen und Nerzen.“
„Anscheinend kann man mit Geld alles kaufen“, bemerkte Stephanie verbittert und spürte den Schmerz wieder mit voller Wucht.
„Nein, Schätzchen. Nicht alles. Liebe zum Beispiel nicht. Kommen Sie.“ Sie gingen zum Mietwagen, und Miriam stieg ein. „Ich weiß nicht, wann es mir möglich ist zurückzukommen, Stephanie. Wenn Sie das Manuskript zu Ende getippt haben, schicken Sie es Benny zu. Und dann fangen Sie bitte gleich mit dem nächsten an. Ich habe es auf Band gesprochen. Okay?“ Miriam machte die Wagentür zu und kurbelte das Seitenfenster herunter.
„Okay.“ Stephanie griff durch das Fenster und drückte Miriams schmale Hand. „Danke.“
„Wofür?“
„Dass Sie mir diesen Job gegeben haben. Dass Sie sich um mich kümmern. Dass Sie sich all die Mühe mit mir machen und mich ertragen.“ Stephanies Stimme klang bewegt.
Lächelnd erwiderte Miriam. „Die Frage müsste lauten, wer erträgt wen? Mein Kleines, ich mag Sie sehr gern. Wenn ich in meiner Jugend so vernünftig gewesen wäre zu heiraten, hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Tochter in Ihrem Alter. Irgendwie scheinen sich einsame Menschen zu finden.“
„Ich bin gar nicht einsam“, versicherte Stephanie. „Jedenfalls jetzt nicht mehr.“
„O doch, das sind Sie, Liebes.“ Miriam, die langsam nickte, schaute forschend in Stephanies schimmernde Augen. „Ja, einsam und zutiefst verletzt. Ich weiß, dass Sie leiden. Aber wir müssen erst die Stürme durchstehen, bevor wir den Sonnenschein genießen können. Grübeln Sie nicht über die Vergangenheit nach, dann wird die Sonne viel schneller durch die Wolken dringen.“
„Passen Sie gut auf sich auf“, bat Stephanie leise und eindringlich.
Doch Miriam lachte nur unbekümmert. „Mir wird schon nichts zustoßen, Stephanie. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich bin unzerstörbar“, scherzte Miriam. „Sie brauchen wirklich keine Angst um mich zu haben.“
„Ich hoffe, mit Ihrem Vater geht alles gut aus.“
„Nun, er ist immerhin schon achtzig Jahre alt, und er hat ein langes und erfülltes Leben hinter sich“, erwiderte Miriam bedrückt. „Kleines, ich will Ihnen nichts vormachen. Der Verlust meines Vaters würde mich hart treffen und nicht ohne Tränen sein. Aber ich mag jetzt noch nicht daran denken. Damit setze ich mich auseinander, wenn es so weit ist. Zunächst einmal muss ich nach Paris, und dann sehe ich weiter.“
Miriam machte eine kleine Pause und fügte eindringlich hinzu: „Also, Stephanie, beherzigen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Und rasen Sie nicht wieder mit dem Boot über den See.“ Den letzten Satz betonte Miriam ganz besonders.
„Spielverderberin.“ Stephanie lachte. „Okay, wenn ich das nicht darf, gehe ich stattdessen auf Bärenjagd oder so.“
In komischer Verzweiflung blickte Miriam himmelwärts. „Es heißt, dass der liebe Gott Kinder und Narren ganz besonders beschützt. Ich kann nur hoffen, dass das stimmt. Auf Wiedersehen, Schätzchen.“
Miriam gab Gas und fuhr in einer riesigen Staubwolke davon. Stephanie blieb stehen und schaute dem Wagen so lange hinterher, bis er nur noch ein kleiner Punkt in der Ferne war. Dann drehte sie sich um und ging zum Strandhaus.
Es kam ihr ohne Miriam mit ihrem lebhaften Temperament und der fröhlichen Art entsetzlich leer vor. Niedergeschlagen wanderte Stephanie durch die Räume und brühte sich einen Kaffee auf. Dann stellte sie sich ans Fenster und starrte hinaus auf den baumbestandenen See, der im gleißenden Sonnenschein wie Silber glitzerte.
Miriam hat recht, dachte Stephanie. Ich muss versuchen, die Vergangenheit loszuwerden. Aber wie kann ich das, wo die Erinnerung an Jesse noch so übermächtig ist? Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich sein lächelndes Gesicht und die strahlend blauen Augen vor mir. Augen, die lachten und mir seine Liebe verkündeten.
Auf einmal stand wieder alles ganz deutlich vor ihr …
Stephanie lernte Jesse Drewe in Austin kennen, wohin sie mit ihrem Vater zu einer Rinderversteigerung gefahren war. Noch bevor der Tag zu Ende ging, hatten sich Stephanie und Jesse sehr miteinander befreundet. Jesse war ein welterfahrener Mann und besaß einen derart umwerfenden Charme, dass Stephanie kaum noch richtig atmen konnte. So ein Mann war ihr in dem ländlichen Gebiet, in dem sie lebte, noch nie begegnet.
Als Jesse sie später zu ihrem Hotel begleitete, stand ihr Herz bereits lichterloh in Flammen. Und nach dem Gute-Nacht-Kuss, den Jesse ihr gab, glaubte sie, dass ihre Gefühle erwidert wurden.
Die Versteigerung dauerte insgesamt drei Tage. Und während dieser drei Tage waren Stephanie, die Kleinfarmerstochter vom Lande und Jesse, der Sohn eines Fleischwarenfabrikanten aus Chicago, praktisch unzertrennlich. In ihrer Freizeit benahmen sie sich wie Touristen und besichtigten fast jeden interessanten Punkt inner- und außerhalb der Stadt. Allmählich stellten sie fest, wie viel sie beide gemeinsam hatten. Ihre Beziehung vertiefte sich. Sie klammerten sich so wild aneinander, dass Stephanie voller Hoffnung der Zukunft entgegensah und sehnsüchtig darauf wartete, was noch geschehen würde.
Am Ende des dritten Tages machte Jesse Stephanie einen Heiratsantrag. Ohne auch nur einen Moment zu zögern, gab sie ihm ihr Jawort. Obwohl erst so kurze Zeit vergangen war, gab es für Stephanie keinen Zweifel an ihren Gefühlen. Nur mit einem hatte sie nicht gerechnet: Dass sie nun mit einer ganz anderen Gesellschaftsschicht Zusammenkommen müsste.
Jesse wollte sie mit nach Chicago nehmen, um sie seiner Familie vorzustellen. Anfangs scheute sie davor zurück, aber dann sah sie ein, dass sie dem Zusammentreffen nicht ausweichen konnte.
Ihr Vater hatte nichts dagegen, dass sie nach Chicago flog. Im Gegenteil, er wünschte ihr von ganzem Herzen Glück und ließ sie bereitwillig weg, auch wenn die Reise sämtliche Ersparnisse Stephanies verschlingen würde.
Der stattliche Besitz von Jesses Familie lag etwas außerhalb der Stadt. Kaum war Stephanie dort angekommen, da wachte sie aus ihren romantischen Träumen auf. Das riesige Haus war sehr elegant. Überall hingen schwere Kristalllüster, und die herrlichen Möbel aus dem viktorianischen Zeitalter waren echt. Als ob das noch nicht genug wäre, Stephanie die Lage klarzumachen, schritt auch noch eine geradezu königliche Gestalt die breiten Treppenstufen hinunter – Jesses Mutter. Sie trug ein Pariser Modellkleid und war vom Duft erlesenen Parfüms umgeben.
Dass sie für die Freundin ihres Sohnes keine Begeisterung empfand, merkte man ihr deutlich an. Sie reichte Stephanie die Hand, als ob sie eine tote Maus anfassen müsste, und ließ sie sofort wieder los. Dann rief Mrs. Drewe ihren Mann zu, er möge hinunterkommen. Das Entsetzen in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
Stephanie, die sich todunglücklich und elend fühlte, kämpfte gegen die Tränen an. Jesse versuchte halbherzig, sie ein wenig aufzumuntern, was ihr jedoch nicht viel half.
Alles wurde noch viel schlimmer, als sie zum Abendessen im riesigen Speisesaal saßen. Jesses Vater fragte Stephanie nach allen Regeln der Kunst aus und wollte genau wissen, wie groß die Rinderfarm ihres Vaters sei.
„Etwa viertausend Ar“, antwortete sie wahrheitsgetreu.
Jesse zuckte zusammen und sah völlig entgeistert aus. Da begriff sie, dass er einen falschen Eindruck von der Größe der Farm gehabt hatte. Offenbar war er der Ansicht, dass Stephanie zu seinen Kreisen gehöre. Und nun, da er festgestellt hatte, wie winzig nach amerikanischen Gesichtspunkten diese Farm war, schien er einer Ohnmacht nahe zu sein.
Am nächsten Tag rief seine Mutter Stephanie zu sich ins Arbeitszimmer hinunter. Dort verkündete Mrs. Drewe mit einem eisigen Lächeln, dass Jesse in einer dringenden geschäftlichen Angelegenheit habe verreisen müssen, und fügte hinzu:
„Ich hoffe sehr, dass Sie meinen Sohn nicht zu ernstgenommen haben. Jesse ist noch zu jung und außerdem ein bisschen flatterhaft. Er fällt immer wieder auf ein hübsches Gesicht herein. Nun, Sie, meine Liebe, werden diese unbedeutende Sache bald vergessen haben. Und es hat Ihnen doch bestimmt gefallen, einmal zu sehen, wie wohlhabende Menschen leben und dass man Ihnen das Frühstück im Bett servierte, nicht wahr?“
Zutiefst verletzt war es Stephanie doch irgendwie gelungen, unbekümmert zu tun und die passenden Antworten zu geben. Dann packte sie ihre Sachen und kaufte sich mit ihrem letzten Geld einen Busfahrschein nach Texas. Es fiel ihr nicht leicht, die Dollars dafür auszugeben, weil sie damit einen Teil der Hypothekenschuld bezahlen wollte, die auf der Farm lastete.
Daheim angekommen, zerbrach sich Stephanie den Kopf, wie es weitergehen sollte. Buchstäblich im letzten Moment gelang es ihr, die Farm vor der Versteigerung zu retten. Miriam hatte in der Austiner Zeitung per Inserat eine Sekretärin gesucht. Stephanie bewarb sich, bekam den Job und einen großen Vorschuss, mit dem sie ihrem Vater aushalf.
All das hatte sich vor einigen Monaten abgespielt. Doch die Wunden waren noch immer nicht verheilt und schmerzten jedes Mal aufs neue, wenn Stephanie an Jesse, seine Familie oder an reiche und mächtige Menschen dachte.
Ihnen gehörte die ganze Welt mit all den kleinen Leuten, die darin lebten. Die Reichen und Mächtigen konnten sich alles kaufen und mit ihren Opfern umgehen, wie sie wollten. Ja, sie kamen sogar mit einem Verbrechen davon, weil sie gefährliche Zeugen bestachen oder sich einfach die besten Anwälte nahmen. Oh, wie sehr wünschte sich Stephanie, ebenfalls reich und mächtig zu sein. Dann würde sie es den Drewes, die sie so erniedrigt hatten, heimzahlen …
Stephanie riss sich aus den düsteren Gedanken. Die Erinnerungen taten wahnsinnig weh, und sie hielt es keinen Moment länger im Strandhaus aus, das ihr auf einmal wie ein Gefängnis vorkam. Trotz Miriams Warnungen stürmte sie zum Bootshaus, in dem der kleine Kabinenkreuzer lag, und startete den Motor. Vorsichtig lenkte sie das Boot hinaus auf den See und gab dann erst Vollgas. Da es noch ziemlich früh am Morgen war, befanden sich nur wenige Boote im Wasser. Stephanie hatte den weiten blauen See fast ganz allein für sich. Sie stand am Steuer und genoss das Gefühl, wie der Kabinenkreuzer durch die Wellen schoss. Auf ihrem Gesicht spürte sie die kalten Gischttropfen und den Wind, die den Schmerz und die Qualen linderten. Tief atmete Stephanie die kühle Luft ein, die zart nach Blüten duftete.
Ein Lächeln flog um Stephanies Lippen, und ihre Augen funkelten erregt wegen der hohen Geschwindigkeit, mit der das Motorboot über den See raste. Wie herrlich, die Erinnerungen vom Wind und den Gischttropfen vertreiben zu lassen. Es war wie ein Rausch. Für einige Zeit schloss Stephanie die Augen und kostete das aufregende Gefühl aus.
Als sie sie wieder öffnete, setzte ihr Herz einen Schlag aus. Nicht weit von ihr wurde ein dunkler Punkt sichtbar, der sich unheimlich schnell vergrößerte.
„Mr. Cambridge! Passen Sie auf!“, schrie Stephanie entsetzt, als sie seinen nassen Kopf und die braunen Schultern entdeckte, die dicht vor dem Boot aus dem Wasser ragten. Sie versuchte noch, irgendwie auszuweichen. Doch es glückte nicht.
Cambridge drehte sich um, die Augen für den Bruchteil einer Sekunde auf Stephanie gerichtet, die verzweifelt die Geschwindigkeit drosseln wollte. Sie sah noch, wie er unter die Oberfläche tauchte, bevor sie den dumpfen Schlag hörte. Der Schiffsbug hatte Cambridge getroffen.
In ihrer Panik gelang es Stephanie nicht gleich, das Boot unter Kontrolle zu bringen. Es raste im Kreis herum, bis sie es endlich anhalten konnte. Ihr Herz hämmerte wie ein Maschinengewehr, als sie sich weit über den Rand beugte und den See nach Cambridge absuchte. Habe ich ihn getötet? fragte sie sich in lähmender, grauenhafter Angst.
2. KAPITEL
Es waren die längsten zehn Sekunden in Stephanies Leben, bis Cambridges dunkler Kopf endlich über dem Wasserspiegel erschien. Blut strömte aus einer klaffenden Wunde. Philippe Cambridge befand sich nicht weit vom Anlegesteg vor seinem großen Strandhaus. Entsetzt beobachtete sie, wie er nach den Pfählen tastete, auf denen der Steg lag, und sich dann mühsam auf die verwitterten Bretter hochzog.
Ein wenig erleichtert und beruhigt atmete sie auf und dankte Gott, dass sie diesen Mann nicht umgebracht hatte. Der Schock setzte bei ihr ein, und zitternd vor Schreck, Angst und Schuldbewusstsein startete sie wieder den Motor und fuhr zurück. Diesmal jedoch sehr langsam. Als sie noch einmal nach hinten blickte, sah sie, dass Cambridge auf dem Steg saß und tief ein- und ausatmete.
Fast wäre es eine Tragödie gewesen, dachte Stephanie. Und nur, weil ich so rücksichtslos über den See gerast bin. Ich wollte meine Schmerzen und meine Verbitterung abreagieren und habe dadurch beinahe einen Menschen ums Leben gebracht. Dass sie Cambridge nicht leiden konnte, war noch lange kein Grund, ihn zu überfahren. Aber sie hatte es ja nicht absichtlich getan.
Was wird er machen? fragte sie sich. Wird er mich anzeigen und ein Strafverfahren gegen mich einleiten? Habe ich mir nur eingebildet, dass er mich noch erkannte, bevor ihn das Boot am Kopf traf?
Sie ließ das Boot treiben und beobachtete Philippe Cambridge. Er stand nach einer Weile mühsam auf und stolperte merkwürdig unsicher über den Steg und weiter zu seinem Haus. Sie weinte so sehr, dass sie kaum richtig sehen konnte. Die Worte, die sie Cambridge zurufen wollte, brachte sie nicht heraus. Was war mit ihm passiert?
Sie dachte daran, dass Boot festzumachen und Cambridge zu folgen und ihm zu helfen. Doch dann trieb sie näher heran und stellte fest, dass mehrere Leute Cambridge vor dem Haus in Empfang nahmen. Alle waren sichtlich aufgeregt und sehr um ihn besorgt. Das konnte Stephanie noch hören, bevor man ihn hineinführte. Wahrscheinlich hatte in der Aufregung niemand ihr Motorboot bemerkt, das in einiger Entfernung vom Landesteg auf dem See trieb.
Von Gewissensbissen gepeinigt, überlegte Stephanie, ob sie sich Cambridge und seinen Freunden stellen sollte. Aber sie brachte den Mut nicht auf. Zumindest wusste sie jetzt, dass man sich gut um den Verletzten kümmerte, und das tröstete sie ein bisschen. Vorsichtig fuhr sie zurück und in das Bootshaus hinein, das sie sorgfältig hinter sich abschloss. Im Strandhaus warf sie sich auf das Sofa, schlug die Hände vor das Gesicht und ließ den Tränen freien Lauf. Wenn doch nur Miriam hier wäre, dachte sie verzweifelt.
Als die Tränen endlich versiegt waren, setzte sie sich auf, trocknete die Augen und fing angestrengt zu überlegen an. Was sollte sie tun? Cambridge anrufen, sich nach seinem Befinden erkundigen und ihm alles erklären? Ihn um Entschuldigung bitten? Den Unfall der Wasserpolizei melden? Oder sollte sie einen Arzt zu Cambridge schicken? Was, wenn er schwerer verletzt wäre, als sie glaubte? Er hatte ja einen furchtbaren Schlag am Kopf bekommen und eine Menge Blut verloren. O Gott, wenn Cambridge nicht überlebte, was dann?
Panik schnürte ihr die Kehle zu. Wenn Cambridge stirbt, habe ich ein Menschenleben auf meinem Gewissen, dachte Stephanie erschüttert.
Angenommen, sie gestand alles ein und Cambridge war gar nicht schwer verletzt? Bestimmt würde er sie ohne zu zögern verhaften lassen. Sie war ja schon einmal wie eine Wilde über den See gerast. Und wenn sie im Gefängnis säße, könnte sie ihrem Vater überhaupt nicht mehr helfen, die Schulden zu bezahlen.
Ihre Gedanken rasten. Kein Mensch war Zeuge des Unglücks gewesen, und man kannte sie hier in der Gegend nicht. Nur Cambridge hatte sie damals lange genug gesehen, um sie wiederzuerkennen. Aber er wusste ja nicht, wie sie hieß. Und das Motorboot, über das er sich so geärgert hatte, war gut versteckt.
Nervös befeuchtete Stephanie mit der Zunge die trockenen Lippen. Wenn er nun doch schwerer verletzt wäre? Sie musste unbedingt herausbekommen, wie es ihm ging, weil sie sonst keine ruhige Minute mehr hätte.
Schweren Herzens griff Stephanie nach dem Telefonbuch. Überrascht stellte sie fest, dass Cambridges Nummer tatsächlich eingetragen, also keine Geheimnummer war. Mit zittrigen Fingern wählte Stephanie die Nummer.
Eine Frau meldete sich: „Hallo.“
Stephanie schluckte aufgeregt, bevor sie mit verstellter Stimme und so sachlich wie irgend möglich fragte: „Ist Mr. Cambridge zu sprechen?“
„Nein, man brachte ihn ins Krankenhaus“, antwortete die Frau am anderen Ende der Leitung. „Er hatte einen Unfall. Wir vermuten, dass er gestürzt sein muss und sich dabei den Kopf angeschlagen hat. Er blutete fürchterlich aus einer klaffenden Wunde, hat aber genauso fürchterlich geflucht. Deshalb nehmen Bob und ich an, dass es nicht allzu schlimm um ihn steht. Pattie, sind Sie es?“ Die Frau klang eigentlich nicht sehr besorgt.
Mit geschlossenen Augen und einem leisen Seufzer legte Stephanie den Hörer auf. Cambridge lebte und schien zum Glück nicht allzu schwer verletzt zu sein. Sie hatte ihn nicht umgebracht, Gott sei Dank.
Doch dann entsann sie sich, was Miriam über den mächtigen Industriekapitän erzählt hatte. Cambridge konnte ein erbarmungsloser Feind sein, der es jedem heimzahlte, was ihm angetan worden war. Wusste Cambridge, dass sie das Motorboot gelenkt hatte, und würde er sie so lange suchen lassen, bis man sie fand?
Ein schrecklicher Gedanke, der Stephanie von da an ständig verfolgte. Sie wagte nicht mehr, aus dem Haus zu gehen. In der Speisekammer befanden sich genügend Lebensmittel, mit denen sie ewig auskommen konnte, wenn es sein musste. Sie traute sich auch nicht, die wenigen Schritte zum Strand zu gehen. Vielleicht war Cambridge dort und würde sie erkennen.
Also versteckte sie sichern Haus und zitterte davor, dass es an der Tür klopfte oder dass das Telefon klingelte. Sie fühlte sich wie eine verurteilte Verbrecherin im Gefängnis. Dabei bestrafte sie ihr eigenes schlechtes Gewissen bereits viel härter, als es je ein Richter tun könnte.
Als einige Tage später das Telefon tatsächlich klingelte, fuhr Stephanie wie ein ertappter Dieb zusammen. Sie ließ es mehrere Male klingeln, bis sie sich soweit beruhigt hatte, dass sie den Hörer abnehmen konnte.
„Ha… hallo“, flüsterte sie voller Angst.
„Miss Summers? Spreche ich mit Miss Stephanie Summers?“, erkundigte sich eine Frau.
„Ja“, brachte Stephanie heraus und schloss fast erleichtert die Augen. Endlich hatte sich das von ihr so Befürchtete ereignet. Die unerträgliche Spannung und die Ängste waren vorbei.
„Ich habe hier ein Telegramm aus Paris von Miss Niccole“, sagte die Unbekannte fröhlich. „Ich lese es Ihnen vor. Also: Vater geht es besser. Stop. Muss noch einige Wochen bleiben. Stop. Schließen Sie Haus ab und fahren Sie bis auf Weiteres heim. Stop. Brief folgt. Stop. Herzlichst Miriam.“
Stephanie bedankte sich und hängte ab. Auf einmal fühlte sie sich verloren und einsam. Und sie fürchtete sich. Was sollte sie tun? Heimreisen und dadurch womöglich ihren Vater all den Folgen aussetzen, die ihr wegen des Unfalls durch Cambridge drohten? Ihr Vater hatte ein schwaches Herz, und ein Schock könnte ihn umbringen.
Was würde geschehen, wenn Cambridge sie in Texas aufspürte und vor Gericht stellte? Und wie würde ihr armer Vater reagieren, wenn er hörte, was seine Tochter angerichtet hatte? Vielleicht setzte sein Herz aus, und was dann? Er hatte sie dazu erzogen, stets rücksichtsvoll gegenüber allen Menschen zu sein und für das, was sie tat, voll und ganz die Verantwortung zu übernehmen.
Stephanie seufzte tief auf. Bis jetzt hatte sie sich vor der Verantwortung gedrückt und sich wie ein Feigling benommen. Damit musste ab sofort Schluss sein. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, dachte Stephanie bedrückt, als zu Cambridge zu gehen. Ich muss ihm die ganze schreckliche Geschichte beichten und mich seiner Gnade ausliefern – falls er so etwas überhaupt kennt, was ich stark bezweifle.
Als Stephanie in ihren weißen Shorts und einem kurzen Oberteil zu Cambridges Haus eilte, kam sie sich wie ein Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank vor. Mit gesenktem Blick lief sie am Strand entlang und zählte nervös jeden Stein, um sich von dem Schrecklichen ein wenig abzulenken, das ihr unweigerlich bevorstand.
Sie war so sehr in Gedanken versunken, dass sie den Mann erst dann wahrnahm, als sie um ein Haar mit ihm zusammengestoßen wäre. Abrupt blieb sie stehen. Er war nur einen kleinen Schritt von ihr entfernt. Sie schnappte nach Luft, als sie in das harte Gesicht mit den grünen Augen blickte. Der Mann war Philippe Cambridge!
Ihr Herz erstarrte. „Entschul… entschuldigen Sie bitte“, stammelte sie wie vom Schlag gerührt, „ich …“
„Es ist meine Schuld“, erwiderte Cambridge mit eisiger Ruhe und hob eine Zigarette an den Mund. „Ich konnte Sie nicht sehen.“
Er machte einen langen Zug und blies den Rauch aus.
Um sie herum brach die Welt in tausend Stücke. „Ihre … Ihre Augen“, brachte sie gequält heraus und starrte in die blinden Augen, die kein einziges Mal zwinkerten.
„Ja. Ein Unfall. Man sagte mir, ich sei gestürzt. Verdammt noch mal, ich erinnere mich an nichts anderes als einen stechenden Schmerz. Ist es schon dunkel?“
Benommen schüttelte sie den Kopf. Doch dann wurde ihr klar, dass Cambridge nicht sehen konnte, und sie erwiderte: „Nein, noch nicht.“
Scharfe Falten zerfurchten sein Gesicht, als hätte er in den vergangenen Tagen sehr viel leiden müssen. Er seufzte leise. Erst in diesem Moment erfasste Stephanie, welchen Schaden sie mit ihrem kindischen Verhalten angerichtet hatte. Es traf sie wie ein Peitschenhieb, und sie musste gegen das Schluchzen ankämpfen, an dem sie fast erstickt wäre. Durch ihre Schuld hatte Philippe Cambridge das Augenlicht verloren!
Aber sie durfte nicht so stumm dastehen, und darum fragte sie: „Wohnen Sie hier?“ Hoffentlich erkannte er ihre Stimme nicht wieder. Nein, wahrscheinlich nicht, dachte Stephanie. Ich habe damals ja nicht viel gesprochen. Er wird sich nicht daran erinnern.
Ein spöttisches Lächeln umspielte seine Lippen. „Ich lebe mehr oder weniger in der Großstadt. Und Sie?“
„Ich bin auf einer Farm aufgewachsen“, murmelte sie.
„Ein Cowgirl?“
Unwillkürlich musste Stephanie lachen. Und sie wunderte sich. Sie hatte diesen Mann aufgrund seines Rufes und aus eigener bitterer Erfahrung verachtet. Doch jetzt zeigte er sich von einer anderen, direkt menschlichen Seite. Das war überraschend. „Nein, kein Kuhmädchen, sondern eher ein Milchmädchen. Ich brauchte noch keine Rinder mit dem Lasso einzufangen.“
„Nun, Milchmädchen, was machen Sie am See?“
Für alle Sünden bezahlen, die ich jemals begangen habe, dachte sie unglücklich. „Ich verbringe hier mit jemandem die Ferien“, erwiderte sie ausweichend.
„Mit wem? Männlich oder weiblich?“
„Selbstverständlich mit einem weiblichen Geschöpf“, sagte sie empört.
Cambridges Lächeln wurde breiter. „Heutzutage ist so etwas durchaus nicht selbstverständlich. Sind Sie so behütet aufgewachsen?“
Stephanie nickte nachdenklich. „Ja, eigentlich schon. Ich glaube, wir Landleute sind im Gegensatz zu Großstädtern nicht sehr welterfahren und freizügig.“
„Aus welcher Gegend stammen Sie?“
„Aus Texas.“
„Das ist sehr groß. Von welchem Teil?“
„Nicht weit von Austin entfernt“, antwortete sie unüberlegt und hätte sich gleich die Zunge wegen dieser unvorsichtigen Antwort abbeißen können.
„Ihre Familie hat sicherlich mit Rindern zu tun. Richtig?“, fragte Cambridge beiläufig.
Sie wollte nicht wieder einen falschen Eindruck entstehen lassen, und darum erklärte sie sofort: „Mein Vater hatte nur fünfhundert Kühe, was in Texas wirklich nicht sehr viel ist. Und die meisten musste er wegen der großen Trockenheit verkaufen.“ Nach einer kurzen Pause fügte sie betont hinzu: „Ich bin also durchaus nicht etwa wohlhabend. Als ich klein war, konnte mir Dad gerade noch das Allernotwendigste wie Schuhe und einfache Kleidung kaufen.“ Es hörte sich irgendwie verletzt an.
„Sie scheinen ja recht empfindlich zu sein, nicht wahr?“
„Ja“, gestand sie ohne Umschweife ein. „Und womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt?“, erkundigte sie sich scheinbar unbefangen.
Cambridges Gesicht verdüsterte sich, und seine blinden Augen zogen sich zusammen. Er sog erst an der Zigarette, bevor er sagte: „Ich … ich war Pilot.“
Verdutzt starrte sie ihn an. Warum hatte er sie angelogen?
„Was für Flugzeuge haben Sie geflogen?“, hakte sie vorsichtig nach.
„Solche, die noch nicht ausprobiert waren.“
„Sie sind also Testpilot gewesen.“ Auf einmal dämmerte es ihr. Natürlich! Er hatte die von ihm selbst entworfenen und gebauten Flugzeuge ausprobiert, und das verstand sie nicht. Es war nicht nur gefährlich, sondern für einen derart reichen Mann auch höchst überflüssig. Warum ließ er seine Flugzeuge nicht von beruflichen Testpiloten ausprobieren?
„So ist es“, bestätigte er und holte tief Luft. „Ich brauche wohl nicht zu erklären, dass ich so etwas nun nicht mehr tun kann. Jetzt bin ich frei für einen neuen Beruf.“
Eine seltsame Erklärung. „Gibt es … ich meine, können Sie auch noch etwas anderes als fliegen?“ Stephanie setzte sich auf einen Baumstumpf und beobachtete Cambridge bei ihrer Frage sehr genau.
„Nun, ich dachte, dass ich vielleicht ein Buch über Flugzeuge schreiben sollte.“ Cambridge lachte auf. „Ich habe, weiß Gott, auf diesem Gebiet genügend Erfahrung, um einige interessante Geschichten zu erzählen.“
„Vom Testpiloten zum Schriftsteller? Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich? Können Sie denn schreiben?“
Er drehte das Gesicht zum Klang ihrer Stimme und blickte in Stephanies Richtung. „Ich kann fast alles tun, was mir gefallt, Miss“, entgegnete er kühl. „Sie sind eine ziemlich neugierige kleine Göre, wie mir scheint.“
„Woher wollen Sie wissen, dass ich eine Göre bin?“, konterte sie.
„Das verrät mir Ihre junge Stimme. Die hört sich an, als wären Sie noch ein Teenager.“
„Das bin ich durchaus nicht mehr.“ Mit einer schnellen Kopfbewegung schüttelte sie sich das Haar aus dem Gesicht. „Ich bin bereits zweiundzwanzig und werde bald dreiundzwanzig.“
Wieder hob er die Zigarette an den Mund. „Zweiundzwanzig“, wiederholte er weich. „Was ist das für ein zauberhaftes Alter gewesen. Die ganze Welt stand einem offen. Man konnte aus vielen Dingen seine Wahl treffen. Nichts stand einem im Weg.“
„Ganz so leicht ist es nicht.“
„Warten Sie, bis Sie mein Alter erreicht haben, Kleines. Dann sprechen wir uns noch einmal.“
Sie schaute sich seinen Kopf mit dem grau melierten Haar an, das im Licht der untergehenden Sonne wie Silber schimmerte. „Mir ist gar nicht bewusst geworden, dass Sie schön so uralt sind“, scherzte sie. „Du lieber Himmel, ich hätte nie gedacht, dass Sie langsam auf die Sechzig zugehen.“
„Wie bitte?“, fragte Cambridge scharf.
„Nun, Sie sagten doch …“
„Verdammt noch mal, ich bin vierzig“, knurrte er gereizt. „Und ich kann noch immer eine Menge Männer überholen, die halb so alt sind wie ich.“
Daran bestand für Stephanie keinerlei Zweifel. Dieser sehnige, muskulöse Philippe Cambridge hatte kein Gramm überflüssiges Fett an sich. Er war durchtrainiert und wirkte fit in jeder Beziehung.
„Zu Fuß oder auf einem Motorrad“, erkundigte sie sich lächelnd.
„Sie unverschämtes kleines Ding.“ Er lachte. Und sein, tiefes, wohlklingendes Lachen war außer dem sanften Rauschen der Wellen der einzige Laut in der Stille.
„Gutes Benehmen scheint nicht gerade eine Ihrer starken Seiten zu sein“, bemerkte Stephanie schmunzelnd.
„Vorsicht, meine Liebe. Frauen sind schon für harmlosere Bemerkungen ertränkt worden.“
„Von Ihnen?“
„Bis jetzt bin ich noch nie so in Versuchung geführt worden. Ich warne Sie.“
„Vielleicht sollte ich lieber verschwinden, bevor Sie gewalttätig werden.“
„Das könnte eine ganz gute Idee sein. Ist es schon dunkel?“
Stephanie schaute in den Himmel. Die Sonne versank in einem farbenprächtigen Spiel im silbrigen, von hohen Tannen umstandenen See. „Das wird es gleich sein.“
„Es wäre nicht sehr klug von einer jungen Frau allein in der Dunkelheit herumzuwandern“, entgegnete Philippe.
„Und was ist mit Ihnen?“ Stephanie stand vom Baumstamm auf. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Räuber oder Vergewaltiger mich für eine Frau halten würde.“
Das konnte sie sich beim besten Willen auch nicht vorstellen. Es war ein so komischer Gedanke, dass sie unwillkürlich lachen musste.
„Worüber lachen Sie?“
„Dass jemand ausgerechnet Sie mit einer Frau verwechseln könnte.“
Da lachte auch Cambridge leise. „Jetzt verstehe ich. Also, gehen Sie heim, Kleines.“
„Aber werden Sie denn den Weg zu Ihrem Haus finden?“
„Warum nicht? Haben Sie Angst, dass ich über meine Füße stolpern und in den See fallen würde?“
„Es heißt, dass der See nur anfangs ziemlich flach ist und dann steil abfällt“, erwiderte sie ein wenig besorgt.
„Ich bin erst seit etwas über einer Woche ohne mein Augenlicht“, sagte er bemerkenswert ruhig. „Und das bedeutet noch lange nicht, dass ich ein hilfloser Krüppel bin. Auch wenn ich ein paar Löcher in den Sessel brenne, in offenstehende Türen hineinlaufe und dem Hund auf den Schwanz trete, kann ich trotzdem … Verdammt noch mal, was ist denn jetzt schon wieder so komisch?“ Sie zwang sich, mit dem Kichern aufzuhören. „Die Art, wie Sie diese Dinge beschreiben, ist … zumindest ungewöhnlich. Ich lache wirklich nicht über Sie. Aber … oh … das arme Tier.“
„Von wegen armes Tier. Es handelt sich um einen 130 Pfund schweren Schäferhund. Und er hat ungefähr das Gemüt einer Klapperschlange, der man eine Büchse an den Schwanz band.“ Wieder kämpfte Stephanie gegen das Lachen an. Solchen Humor hätte sie Cambridge gar nicht zugetraut. „Nun, wie auch immer, da ist niemand, der Sie zum Haus bringt. Und Sie haben keinen Stock …“
„Ich habe einen hervorragenden japanischen Diener namens Yama“, warf Cambridge ein. „Der kommt mit einer Taschenlampe hierher und sucht auf Knien die ganze Gegend und den See ab, wenn ich bei Anbruch der Dunkelheit noch nicht zurück bin. Ein guter, zuverlässiger Mann, dieser Yama. Ganz und gar nicht wie meine treuen Freunde.“ Verachtung klang in Cambridges Stimme auf. „Die klemmten den Schwanz zwischen die Beine und rannten davon, als sie erfuhren, dass ich blind geworden war.“
„Das sind dann offenbar keine sehr treuen Freunde gewesen“, bemerkte Stephanie und fragte dann nervös: „Wissen Sie, ob Sie Ihr Augenlicht zurückbekommen werden?“
Er atmete tief ein und aus, und sie verkrampfte sich. „Ja, es besteht eine Chance, dass ich eines Tages wieder sehen kann, ohne einen chirurgischen Eingriff. Aber wann, das weiß niemand. Es kann sich um Tage, Wochen oder Monate handeln. Und vielleicht geschieht es nie. Ich habe, auf welche Weise auch immer, einen harten Schlag abbekommen. Das ist ein gewaltiger Schock auf den Sehnerv gewesen.“
Stephanie schluckte, denn ihr steckte ein dicker Kloß in der Kehle. „Können Sie überhaupt nichts sehen?“
„Nur dunkle Flecken und schattenähnliche Umrisse.“
Sie drängte die aufsteigenden Tränen zurück, denn sie durfte keinesfalls weinen. Damit würde sie sich vielleicht verraten. „Nun, ich sollte jetzt am besten heimgehen.“
„Wie weit ist es?“, fragte er unvermittelt.
„Nur ein kleines Stück am Strand entlang“, erwiderte sie vorsichtig.
„Wie heißen Sie?“
„Stephanie … Stephanie Jordan“, schwindelte sie hastig, um ihn von ihrer Spur abzulenken. „Also, guten Abend.“ Sie ging einige Schritte weiter.
„Stephanie?“
„Ja?“
„Kommen Sie morgen wieder.“
Dieser Wunsch schockte sie – falls es ein Wunsch gewesen war. Es hatte sich eher nach einem Befehl angehört. Wie sollte sie reagieren? Es wäre höchst gefährlich, sich näher mit Cambridge einzulassen. Doch als sie in seinem sonst so maskenhaften Gesicht für einen Moment so etwas wie ängstliche Erwartung aufblitzen sah, brachte Stephanie es nicht über sich, Nein zu sagen.
„Hierher?“, fragte sie mit schwankender Stimme.
„Nein, zu meinem Haus. Gegen neun Uhr morgen früh. Ich werde Yama veranlassen, den Frühstückstisch für zwei Personen zu decken.“ Cambridge machte eine Pause und fuhr dann brummig fort: „Was halten Sie von meiner Idee?“ Es schien ihm schwerzufallen, um etwas zu bitten.
„Kann ich gebratenen Speck zum Frühstück haben?“
„Natürlich.“
„Und Kaffee?“
„Genehmigt.“
„Vielleicht noch ein Brötchen mit dunklem Honig und dazu handgeschnittene Mangoscheiben?“, scherzte Stephanie.
„Machen Sie so weiter, und dann wird es für Sie nichts anderes als eine Tasse Kaffee geben.“
„Kaffee ist immerhin besser als gar nichts. Gute Nacht.“
Sie marschierte los, und es blieb eine Weile still. „Gute Nacht, Stephanie“, sagte er dann. Die Worte wehten ihr hinterher.
In dieser Nacht schlief Stephanie zum ersten Mal seit langer Zeit richtig gut. Die Schuldgefühle quälten sie nicht mehr ganz so gnadenlos, weil sie nun wusste, dass es eine Chance für Philippe Cambridge gab, das Augenlicht wiederzubekommen.
Was für ein merkwürdiger, rätselhafter Mann, dachte sie. So völlig anders, als ich erwartet habe. Aber warum erzählte er mir nicht die Wahrheit über sich? Warum verschwieg er, dass ihm ein riesiger Konzern gehört und dass er sich mit seinem Reichtum fast alles kaufen kann?
Irgendwie kam es ihr vor, als ob er ein seltsames Spielchen mit ihr triebe. Wusste er womöglich doch, wer sie war? Bei diesem Gedanken schüttelte sie gleich energisch den Kopf. Nein, das konnte nicht sein. Cambridge wäre sonst nicht so freundlich zu ihr gewesen und hätte sie bestimmt nicht zum Frühstück in sein Haus eingeladen. Keinesfalls, wenn er wüsste, dass sie die rücksichtslose Frau war, die ihm das Augenlicht geraubt und all die Schmerzen verursacht hatte.
Trotz dieser einleuchtenden Gegenargumente machte sich Stephanie dauernd Sorgen. Auch noch am nächsten Tag, als sie zu dem eleganten und geräumigen Strandhaus ging.
Auf ihr Klopfen öffnete ein kleiner, schlanker Asiate die Tür und verbeugte sich vor ihr. Lächelnd bat er sie herein.
„Bitte, treten Sie näher“, sagte er fast akzentfrei. „Mr. Cambridge läuft schon seit sieben Uhr ungeduldig hin und her. Er wartet auf der Veranda auf Sie. Würden Sie schon vorausgehen? Ich bringe gleich das Frühstück.“
Stephanie bedankte sich und lief zur Veranda, auf die Yama gezeigt hatte. Von dort hatte man einen herrlichen Ausblick auf den See.
Cambridge war da, die Hände auf dem Rücken ineinander verschränkt. Er trug weiße Bermudashorts und ein blütenweißes, gestärktes Hemd mit kurzen Ärmeln. Er schien auf den See zu schauen. Aber Stephanie wusste leider nur zu gut, dass Cambridge nichts sehen konnte.
„Guten Morgen“, grüßte sie zögernd.
Cambridge drehte sich sofort um, die blinden Augen auf sie gerichtet.
„Guten Morgen. Wollen Sie sich nicht setzen?“ Sie nahm auf einem Stuhl Platz, der gegenüber einem anderen stand und offensichtlich Cambridges Stuhl war. „Mir gefällt Ihre Veranda.“
„Mir auch. Die Fliegengitter halten die Moskitos ab.“ Cambridge lachte leise.
„Wie feierlich es hier ist.“ Stephanie schloss die Augen, um das Wispern des Windes in den hohen Tannen und das sanfte Plätschern der Wellen, die über den Strand rauschten, deutlicher zu hören.
„Ja. Genau deshalb bin ich so gern hier“, erwiderte Cambridge versonnen, um dann loszubrüllen: „Yama, ich verhungere allmählich!“
Im nächsten Moment erschien Yama. Er trug ein Tablett mit allen möglichen Speisen und einer mächtigen Kaffeekanne in den Händen. „Sie brauchen gar nicht so zu brüllen, Boss“, sagte er empört und stellte alles ordentlich auf dem Tisch ab. „Ich komme so schnell wie ich kann. Immer müssen Sie an mir herumnörgeln. Und wenn ich Ihnen alles gebracht habe, schimpfen Sie, weil angeblich die Eier zu weich sind, der Speck nicht knusprig genug gebraten und …“
„Was hältst du von einer tüchtigen Gehaltserhöhung, Yama?“, erkundigte sich Cambridge verdächtig sanft.
Yamas dunkles Gesicht strahlte auf. „Das wäre sehr nett, Sir.“
„Gut. Wenn du gelernt hast, nicht so viel zu jammern, werde ich sie dir irgendwann geben.“
Yama schnitt eine Grimasse. „Man muss direkt ein Heiliger sein, um es mit Ihnen auszuhalten. Statt einer Gehaltserhöhung sollte ich einen Orden bekommen.“ Mit dieser Schlussbemerkung entfernte sich Yama.
Stephanie konnte sich das Lachen nicht verkneifen. „Ihr Diener ist ein einmaliges Juwel.“
„Damit haben Sie recht. Er lässt nicht zu, dass ich mich zu ernst nehme, und das scheint mir einer seiner vielen Vorzüge zu sein.“ Cambridge fuhr sich durch das dichte Haar. „Yama ist schon so lange bei mir, dass ich ihn nicht mehr missen möchte. Wenn er mich verließe, hätte ich das Gefühl, einen Arm verloren zu haben.“
„Begleitet er Sie immer und überallhin?“
Ein verschmitztes Lächeln huschte über Cambridges Gesicht. „Nicht überall und nicht immer“, erwiderte er vielsagend.
Stephanie schluckte verlegen. „Das habe ich nicht gemeint.“
„Sind Sie rot geworden?“, erkundigte sich Cambridge.
„Natürlich nicht“, schwindelte sie.
„Komisch, irgendwie glaube ich Ihnen das nicht.“ Er lachte in sich hinein.
Hastig lenkte sie ab. „Kommen Sie oft an den See?“, fragte sie und trank einen Schluck von dem heißen schwarzen Kaffee, den Yama ihr eingegossen hatte.
„Jetzt nicht mehr.“ Cambridge tastete nach seiner Kaffeetasse und warf sie um. Der heiße Kaffee verbrühte seine Hand, worauf eine Reihe wilder Flüche ertönte.
Stephanie, die aufgesprungen war, tupfte mit ihrer Serviette behutsam die braunen Tropfen von Cambridges kräftigen Fingern. Er hat eine schöne, sehr männliche Hand, schoss es Stephanie unwillkürlich durch den Kopf. Sie betrachtete die tadellos gepflegten Fingernägel und das dunkle, kurze Haar, das sich auf dem Handrücken zeigte. Es war eine warme, ein wenig schwielige Hand, die Stephanie hielt. Ein eigenartiges, unbekanntes Gefühl stieg in ihr auf.
„Ich bin schon okay“, sagte Cambridge brummig, zog jedoch seine Hand nicht weg.
„Es hat sehr wehgetan, nicht wahr?“ Stephanie lächelte.
„Verdammt noch mal, und wie. Ich sagte Ihnen ja, dass ich dauernd etwas umwerfe.“
„Das hätte ich Ihnen auch ohne diese Vorführung geglaubt“, wagte Stephanie zu scherzen. Sie ließ die Hand los, um die braunen Flecken abzuwischen, die auf dem schneeweißen Tischtuch immer größer wurden.
Wieder lachte Cambridge leise. „Sie sind gut für mich, kleine Göre. So etwas wie Mitleid scheinen Sie nicht zu kennen.“
„Wollen Sie, dass ich bedauernd mit der Zunge schnalze und ein Riesentheater um Sie mache?“
„Ja nicht!“, rief er und ging auf ihren Versuch zu scherzen nicht ein. „Was haben Sie für einen Beruf?“
„Ich bin Sekretärin. Warum fragen Sie?“
„Sind Sie für den Rest des Sommers fest gebunden?“
„Nein, für mehrere Wochen nicht“, antwortete sie verdutzt. Was sollten diese seltsamen Fragen?
„Warum ziehen Sie dann nicht zu mir?“
Stephanie stockte der Atem. Sie saß wie versteinert da, unfähig zu sprechen. Geschockt starrte sie Cambridge an.
Ein verstehendes Lächeln breitete sich in seinem Gesicht aus. „Damit habe ich nicht gemeint, dass Sie mein Bett teilen sollen, falls es das ist, was Sie so stumm gemacht hat. Der Gedanke, mit einer Frau zu schlafen, die ich nicht sehen kann, reizt mich zur Zeit nicht besonders.“
Stephanie wurde feuerrot. Hastig wandte sie den Kopf ab, ehe ihr klar wurde, dass Cambridge ja blind war. Was will er von mir? fragte sie sich verstört. Was auch immer, sie durfte keinesfalls unter einem Dach mit ihm leben. Das wäre viel zu gefährlich. Sie könnte sich ungewollt verraten. Dann wüsste er, dass sie die Verrückte in dem Motorboot gewesen war.
Miriam hatte ihr erzählt, wie erbarmungslos er sein konnte. Sie befürchtete, dass er nicht nur ihr, sondern auch ihrem Vater etwas antun würde. Aber zum anderen brachte sie es auch nicht über sich, Cambridge im Stich zu lassen, weil ihn bereits so viele Menschen verlassen hatten. Außerdem sollte sie ja auf Miriams Anordnung das Strandhaus abschließen und sich ein paar Wochen freinehmen … Stephanies Gedanken rasten. Es kam ihr vor, als stünde sie vor einer wichtigen Entscheidung in ihrem Leben.
3. KAPITEL
Lange blieb es still, während Stephanie krampfhaft überlegte. Dann unterbrach Cambridge ihre Gedanken.
„Hören Sie. Ich würde Ihnen nicht nur Ihr bisheriges Gehalt zahlen, sondern noch eine Summe drauflegen. Allerdings kann ich Ihnen keine geregelte Arbeitszeit versprechen, Stephanie. Manchmal bekomme ich mitten in der Nacht irrsinnige Kopfschmerzen, und wenn ich dann einige Seiten für das Buch diktiere, hilft es mir vielleicht ein wenig.“
„Ich … soll an Ihrem Buch mitarbeiten?“
„Ja. Dazu brauche ich Sie. Yama kann zwar ausgezeichnet kochen, aber nicht tippen.“ Cambridge schwieg und presste einige Sekunden die Zähne zusammen. „Oder schrecken Sie davor zurück, für einen blinden Mann zu arbeiten, Stephanie?“
„Warum sollte mich das abschrecken?“, antwortete sie mit einer unbedachten Gegenfrage.
Er schien sich ein bisschen zu entspannen. „Natürlich hätten Sie genügend Freizeit. Sie mögen doch den See, nicht wahr? Falls Ihre Freundin nichts einzuwenden hat …“
„Oh, die hätte absolut nichts dagegen. Doch darum geht es nicht.“ Angestrengt suchte Stephanie nach einer Ausrede, die ihn nicht verletzen würde. „Ich meine … wir… wir kennen uns doch kaum.“
„Nun, ich habe Ihnen ja auch keine Heirat vorgeschlagen.“ Cambridge schmunzelte. „Um meine Sekretärin zu sein, brauchen wir wirklich nicht intim zu werden.“
„Das freut mich“, erwiderte sie unbehaglich und flüsterte: „Ich wüsste gar nicht, wie.“
Wieder entstand eine lange Pause, bis Cambridge schließlich das Schweigen unterbrach. „Ich wünschte mir, dass ich Sie sehen könnte. Sie scheinen auf diesem Gebiet nicht sehr erfahren zu sein … und offenbar sind Sie auch überhaupt nicht geldgierig.“
„Das möchte ich nie und nimmer sein. Ich mache mir nichts aus materiellen Dingen. Die sind mir nicht wichtig.“
„Was ist Ihnen wichtig?“, erkundigte er sich ernst.
„Gärten“, entgegnete sie mit einem versonnenen Lächeln. „Kühe, die am späten Nachmittag auf einer saftigen Wiese weiden. Kinder in sauberen Schlafanzügen nach einem Bad. All solche Dinge.“
Er lehnte sich zurück. „So etwas habe ich nie gekannt“, stellte er mit sachlicher Stimme fest. „Ich lebe mein Leben wie auf einer Achterbahn, die niemals anhält. Wenn ich nicht am Telefon hänge, bin ich in einer Konferenz. Wenn ich nicht schlafe, bin ich auf einer Reise irgendwohin.“
„Ich schätze, dass ein Pilot ein ziemlich hektisches Leben führt.“ Sie erinnerte sich an die Halbwahrheiten, die Cambridge ihr erzählt hatte, und machte sein Spielchen mit.
Cambridge griff in die Tasche nach einer Zigarette, die er zerstreut in seinen kräftigen Fingern drehte. „Stephanie, das mit dem Piloten ist nicht ganz wahr gewesen. Ich habe Flugzeuge entworfen und sie meistens selbst getestet. Ich … ich brauchte irgendwie das Gefahrenmoment, Milchmädchen.“ Er seufzte, und auf einmal flackerte etwas Schmerzliches in seinen Augen auf. „Haben Sie jemals auch solche Gefühle gehabt?“
„Ja“, gestand sie bedrückt. Es war furchtbar, was sie diesem Mann mit ihrer Rücksichtslosigkeit angetan hatte, dem seine Augen alles bedeuteten.
„Wie ist es dazu gekommen?“
Unruhig rutschte sie auf ihrem Stuhl herum. „Ich verliebte mich in einen Mann, der annahm, dass ich reich sei. Als er herausfand, dass das nicht stimmte, ließ er mich wie eine heiße Kartoffel fallen.“ Es hörte sich so einfach und unkompliziert an, dabei hatte sie sich monatelang damit abgequält und letztlich diesen schrecklichen Unfall dadurch verursacht.
„Waren Sie ihm nicht gut genug, Stephanie?“ Cambridge steckte die Zigarette zwischen die Lippen und fummelte mit dem Feuerzeug herum, bis sie brannte. „Was besitzt er oder seine Familie?“
„Eine Fleischwarenfabrik.“
„Nur eine?“ Cambridge grinste. „Mein Gott, das ist ja ganz unten auf der gesellschaftlichen Leiter.“
„Ich verstehe nicht.“
„Irgendwann werde ich Ihnen einiges über Aktien und Geldanlagen beibringen, und dann werden Sie es verstehen. Kleines, eine Fleischfabrik zu besitzen ist nicht mehr, als ein kleines Geschäft in einer Stadt zu besitzen, in der einem anderen Mann ein ganzer Häuserblock gehört. Ist das nun ein bisschen klarer für Sie?“
„Ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, reich zu sein, denn das bin ich nie gewesen. Ich glaube, es würde mir auch gar nicht besonders gut gefallen. In Jeans und einem T-Shirt fühle ich mich viel wohler als in einem Abendkleid.“
„Reichtum hat seine Vorzüge und seine Nachteile“, bemerkte Cambridge und fügte unvermittelt hinzu: „Also, Stephanie, werden Sie zu mir ziehen oder nicht?“
„Eigentlich sollte ich meinen Kopf untersuchen lassen …“
„Das sollten wir beide“, unterbrach er sie. „Ja oder nein?“
„Ja.“
„Braves Mädchen. Essen Sie Ihr Frühstück auf, und dann mache ich Sie mit dem behaarten Mitglied meiner Familie bekannt.“
„Behaarter als Sie?“, fragte sie frech und blickte auf das dichte schwarze Haar, das sich unter dem Hemdausschnitt auf dem Brustkorb zeigte.
„Ich kann nur hoffen, dass Sie Ihren Sinn für Humor nicht verlieren, Stephanie. Ich habe nämlich eine sehr jähzornige Veranlagung, die sich bestimmt nicht legt. Ich bin außerdem ungeduldig und starrsinnig. Und ich scheue nicht davor zurück, Sie wie einen nassen Lappen auszuwringen, wenn ich es für nötig halte. Falls Sie zu Tränen neigen, stehen Sie es hier keine zwei Tage durch.“
„Möchten Sie darauf wetten, wie lange ich es bei Ihnen durchstehe?“
„Nun, warten wir ab.“
„Was immer Sie sagen, Boss“, erwiderte sie scheinbar fügsam. Und sie freute sich, als er daraufhin lächelte.
Stephanie war überzeugt gewesen, dass sie schon große Hunde gesehen hatte. Aber der graue Riesenschatten, der sich von seinem Lager im Hobbyraum erhob, ließ ihr Herz ängstlich hämmern. Und noch ängstlicher, als sie ein tiefes, bedrohliches Knurren hörte.
„Hunter, gib nicht so schrecklich an!“, befahl Cambridge. „Komm her, Junge, und versuche, einen Schoßhund zu spielen.“
„Er ist fürchterlich groß“, flüsterte Stephanie nervös. Doch sie kniete sich hin und streckte Hunter die Hand entgegen, an der er schnüffeln sollte. Hoffentlich fasst er das nicht als Einladung zu einer Kostprobe auf, dachte Stephanie ängstlich.
„Mögen Sie Hunde?“
„Mir sind eigentlich Katzen lieber. Ich … ich fürchte mich vor Hunden.“ Hunter roch gründlich an ihrer Hand und fing dann heftig zu wedeln an. Erleichtert atmete Stephanie auf.
„Sie werden sich an ihn gewöhnen. Komm her, Hunter“, lockte Cambridge. Gehorsam ging das Riesentier zu ihm und legte den Kopf an Cambridges Füße. „Bis zu meinem Unfall war Hunter nur mein Haustier. Doch jetzt ersetzt er mir sehr oft meine Augen.“
„Gestern hatten Sie ihn aber nicht bei sich.“
„Nein, weil ich etwas Neues ausprobieren wollte.“ Cambridge lachte. „Mich ohne Hilfe zurechtzufinden. Leider ist der Versuch nicht sehr erfolgreich gewesen. Yama eilte herbei und hat wie üblich an mir herumgenörgelt.“
„Das ist wahrscheinlich besser, als wenn eine Ehefrau an einem herumnörgelt“, platzte Stephanie heraus. Dann fiel ihr ein, dass sie ja offiziell nichts über Cambridges Familienstand wusste, und sie fügte schleunigst hinzu: „Oder sind Sie verheiratet?“
Ein Schatten flog über sein Gesicht, und seine Augen funkelten für einen Moment wie grünes Feuer. „Nein, ich bin nicht verheiratet.“ Seine Stimme klang grimmig.
„Es tut mir leid“, entschuldigte sich Stephanie. „Ich wollte Sie nicht ausfragen.“ Sie legte begütigend die Hand auf seinen Arm.
Cambridge verspannte sich bei der Berührung, worauf Stephanie sofort die Hand zurückzog. Offenbar ließ er sich nicht gern berühren. Stephanie nahm sich fest vor, in Zukunft daran zu denken.
„Wann soll ich mit der Arbeit beginnen?“, fragte sie ruhig. „Morgen.“
„Schon so bald? Ich muss doch erst noch packen und mich mit meinem Vater in Verbindung setzen, und …“
„Sie können ihn von hier anrufen.“
„Aber er wohnt in Austin, Texas“, wandte sie ein. „Eigentlich nicht direkt in Austin, sondern ganz in der Nähe. Das Gespräch wird doch viel zu teuer.“
„Stephanie, ich bin kein armer Mann“, bemerkte Cambridge und sog an der Zigarette. „Sie werden das zwangsläufig früher oder später herausfinden. Und ich neige dazu, plötzliche Entschlüsse zu fassen. Vielleicht wachen Sie eines Morgens auf und stellen fest, dass Sie sich auf einem Flug zu den Bahamas befinden. Ich bin ein unruhiger Mann und reise viel. Und ich besitze genügend Geld, um mir das leisten zu können. Ein Ferngespräch wird mich kaum ruinieren.“ Er drehte sich in Stephanies Richtung um und fragte: „Haben Sie Angst vor dem Fliegen?“
„Nein.“
„Reisen Sie gern?“
„Ich bin noch nicht oft verreist.“
„Ist Ihr Pass in Ordnung?“
„Ich habe keinen, weil ich noch nie …“
„Macht nichts. Ich werde Pattie beauftragen, sich darum zu kümmern.“ Cambridge wartete und runzelte die Stirn, weil Stephanie schwieg. „Pattie ist meine Bürosekretärin“, betonte er. „Sie ist jung, sehr tüchtig und von ihrem Job begeistert.“
„Und sehr wahrscheinlich in ihren Chef verliebt.“
„Mein Gott, hoffentlich nicht, denn sie ist mit einem meiner Vizepräsidenten verheiratet.“
„Oh.“
Cambridge schmunzelte. „Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Aber es ist nicht meine Art, mich mit meinen weiblichen Angestellten einzulassen.“
Stephanie wurde glühend rot. „Ich gehe jetzt wohl besser nach Hause und fange mit dem Packen an.“
Cambridge schwieg einige Sekunden, und sie beobachtete ihn, wie er das weiche Fell des Hundes streichelte.
„Okay. Aber beeilen Sie sich, Stephanie. Ich bin lange genug untätig gewesen und möchte endlich wieder etwas Vernünftiges machen.“
Bedrückt von ihrem schlechten Gewissen, versicherte sie hastig: „Es wird nicht lange dauern.“ Sie eilte hinaus.
Während Stephanie ihre Habseligkeiten zusammenpackte, überlegte sie angestrengt hin und her. Sie hoffte inbrünstig, den richtigen Entschluss getroffen zu haben. Es gab wesentlich schlimmere Möglichkeiten. Vielleicht kehrte Cambridges Gedächtnis zurück oder jemand beschrieb ihm, wie sie aussah? Würde er sich an die Frau im Motorboot erinnern? Was wäre, wenn …?
Energisch zwang sie sich, an etwas anderes zu denken. Es hatte keinen Sinn, sich um die Zukunft Sorgen zu machen, weil man damit nichts änderte. Außerdem ist es an der Zeit, dass ich mich zur Abwechslung nicht immer nur mit mir befasse, ermahnte sie sich. Sie war in den vergangenen Monaten viel zu sehr mit ihrer Verbitterung und ihrem Selbstmitleid beschäftigt gewesen, um sich um andere Menschen zu kümmern. Vielleicht täte es ihr gut, für einen Mann wie Philippe Cambridge zu arbeiten. Er duldete kein Selbstmitleid, nicht einmal, wenn es sich um ihn selbst handelte. Das hatte Stephanie inzwischen gemerkt.
Er war ihr ein Rätsel. Sie kannte keinen Menschen, der ihm ähnelte. Und sie fühlte sich ihm seltsamerweise sehr verbunden, obwohl er reich war und sie so arm. Er gab ihr das Gefühl, sicher und geborgen zu sein, sie aber auch zu benötigen.
Vielleicht braucht er zur Zeit die Nähe eines Menschen. Jemanden, der ihm das Leben ein wenig leichter macht, sinnierte sie. Durch meine Unbesonnenheit habe ich ihm überhaupt das Leben erst schwer gemacht. Oh, wie sehr wünsche ich mir, ich hätte es nicht getan…
Bevor Stephanie das Haus verließ, schickte sie noch Miriam ein Telegramm. Und am Abend rief Stephanie von ihrem neuen Zimmer bei Philippe Cambridge ihren Vater an.
„Ich dachte, du würdest zwischen zwei Jobs zu Besuch heimkommen“, erwiderte er lachend, nachdem sie ihm alles erklärt hatte. „Aber das scheint ja wohl hoffnungslos zu sein, nicht wahr?“
„Ich komme nächsten Monat. Das verspreche ich dir. O Dad, ich bin so rücksichtslos gewesen, und das tut mir so schrecklich leid. Aber ich mache alles wieder gut. Auch das verspreche ich dir.“
„Stephanie“, erwiderte er liebevoll, „du bist mein wunderbares Mädchen, und ich habe dich von ganzen Herzen lieb. Du darfst niemals glauben, dass du mir etwas schuldest.“