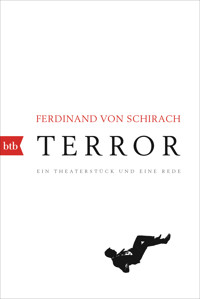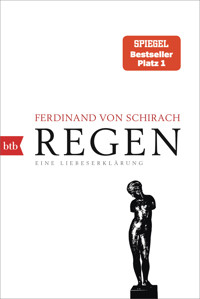10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Kaffee und Zigaretten« verwebt autobiographische Erzählungen, Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem sich Privates und Allgemeines berühren, verzahnen und wechselseitig spiegeln. Es geht um prägende Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, um flüchtige Momente des Glücks, um Einsamkeit und Melancholie, um Entwurzelung und die Sehnsucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft ebenso wie um die großen Lebensthemen Ferdinand von Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle und Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die Würde des Menschen, um die Errungenschaften und das Erbe der Aufklärung, das es zu bewahren gilt, und um das, was den Menschen erst eigentlich zum Menschen macht. In dieser Vielschichtigkeit und Bandbreite der erzählerischen Annäherungen und Themen ist »Kaffee und Zigaretten« das persönlichste Buch Ferdinand von Schirachs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Ferdinand von Schirachs neues Buch »Kaffee und Zigaretten« verwebt autobiographische Erzählungen, Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem sich Privates und Allgemeines berühren, verzahnen und wechselseitig spiegeln. Es geht um prägende Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, um flüchtige Momente des Glücks, um Einsamkeit und Melancholie, um Entwurzelung und die Sehnsucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft ebenso wie um die großen Lebensthemen Ferdinand von Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle und Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die Würde des Menschen, um die Errungenschaften und das Erbe der Aufklärung, das es zu bewahren gilt, und um das, was den Menschen erst eigentlich zum Menschen macht. In dieser Vielschichtigkeit und Bandbreite der erzählerischen Annäherungen und Themen ist »Kaffee und Zigaretten« das persönlichste Buch Ferdinand von Schirachs.
»Ferdinand von Schirach ist ein großartiger Erzähler!«Der Spiegel
»Ein Glücksfall für die deutsche Literatur.«Focus
Zum Autor
Der Spiegel nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Die Erzählungsbände »Verbrechen« und »Schuld« und die Romane »Der Fall Collini« und »Tabu« wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Sein Theaterstück »Terror« zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm »Die Herzlichkeit der Vernunft«, ein Band mit Gesprächen mit Alexander Kluge, sowie die Erzählungen »Strafe«.
Ferdinand von Schirach
KAFFEE UND ZIGARETTEN
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2019 Ferdinand von Schirach
Umschlaggestaltung buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock # 2429389
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-24549-8V004www.schirach.de
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
The woods are lovely, dark, and deep,But I have promises to keep,And miles to go before I sleep,And miles to go before I sleep.
Robert Frost
Eins
Im Sommer ist er jeden Tag unten am Teich. Er sitzt auf der chinesischen Brücke, die zu der kleinen Insel führt, unter ihm Seerosen und Sumpflilien, manchmal sieht er Karpfen, Brassen und Schleien. Libellen mit riesigen Facettenaugen stehen vor ihm in der Luft. Die Jagdhunde schnappen nach ihnen, aber sie verfehlen sie immer. Libellen können zaubern, sagt sein Vater, aber es sind so winzige Wunder, dass sie für die Augen der Menschen unsichtbar bleiben. Erst hinter den alten Kastanien und den Steinmauern des Parks beginnt die andere Welt. Es gibt keine glückliche Kindheit, die Dinge sind zu kompliziert, aber später wird er sich immer an die Langsamkeit damals erinnern.
Die Familie fährt nie in Ferien. Die Höhepunkte im Jahr sind die Weihnachtstage mit der langen Adventszeit, die Fuchsjagden im Sommer mit Pferden und Hunden und die großen Treibjagden im Herbst, bei denen die Treiber im Innenhof des Jagdhauses Eintopf essen und Bier und Kräuterschnaps trinken.
Manchmal kommen Verwandte zu Besuch. Eine Tante riecht nach Maiglöckchen, eine andere nach Schweiß und Lavendel. Sie streichen mit ihren alten Händen über seine Haare, er muss sich verbeugen und ihnen einen Handkuss geben. Er mag es nicht, wenn sie ihn anfassen, und er will nicht dabei sein, wenn sie sich unterhalten.
Kurz vor seinem zehnten Geburtstag kommt er in ein Jesuiteninternat. Der Ort liegt in einem dunklen, engen Schwarzwaldtal, sechs Monate Winter, die nächste größere Stadt ist weit entfernt. Der Fahrer bringt ihn weg von seinem Zuhause, weg von den Chinoiserien, den bemalten Seidentapeten und den Vorhängen mit den bunten Papageien. Sie fahren durch Dörfer und leere Landschaften, an Seen vorbei und dann hinunter und immer tiefer hinein in den Schwarzwald. Als sie ankommen, ist er eingeschüchtert von der riesigen Kuppel des Doms, den barocken Gebäuden und den schwarzen Soutanen der Patres. Sein Bett steht in einem Schlafsaal mit dreißig anderen Betten, im Waschraum hängen die Becken nebeneinander an der Wand, es gibt nur kaltes Wasser. In der ersten Nacht denkt er, bald wird das Licht wieder eingeschaltet und jemand wird sagen: »Du warst tapfer, jetzt ist es vorbei, du darfst wieder nach Hause.«
Er gewöhnt sich an das Internat, so wie sich Kinder an fast alles gewöhnen. Aber er glaubt, er gehöre nicht dazu, etwas fehle, was er nicht benennen kann. Das Grün und das Dunkelgrün seiner früheren Welt verschwinden allmählich, die Farben in seinem Kopf verändern sich. Er weiß noch nicht, dass sein Gehirn Wahrnehmungen »falsch« miteinander koppelt. Buchstaben, Gerüche und Menschen »sieht« er als Farben. Er glaubt, die anderen Kinder würden das Gleiche sehen, das Wort Synästhesie lernt er erst viel später. Einmal zeigt er dem Pater, der Deutsch unterrichtet, die Gedichte, die er über diese Farben schreibt. Der alte Mann ruft bei seiner Mutter an, der Junge sei »gefährdet«, sagt er. Es hat keine Konsequenzen. Als er die Gedichte zurückbekommt, sind nur die Rechtschreibfehler rot markiert.
Sein Vater stirbt, als er 15 Jahre alt ist. Er hatte ihn schon viele Jahre nicht mehr gesehen, die Eltern trennten sich früh. Sein Vater schickte Postkarten ins Internat, Straßenansichten aus Lugano, Paris und Lissabon. Einmal kam eine Karte aus Manila, vor dem weißen Malacañang-Palast stand ein Mann in hellem Leinenanzug. Er stellt sich vor, dass sein Vater aussah wie dieser Mann.
Der Direktor des Internats gibt ihm Geld für die Zugfahrkarte nach Hause. Er nimmt keinen Koffer mit, weil ihm nichts einfällt, was er einpacken könnte. Nur ein Buch hat er dabei, das Lesezeichen zwischen den Seiten ist die Postkarte aus Manila. Auf der Reise versucht er sich jede Bahnstation einzuprägen, jeden Baum vor dem Fenster, jeden Menschen in seinem Abteil. Er ist sich sicher, dass sich alles auflösen wird, wenn er sich nicht mehr daran erinnert.
Auf die Beerdigung geht er alleine, ein Fahrer der Familie setzt ihn vor der Aussegnungshalle in München ab. Er hört Reden über einen merkwürdigen Fremden, über seine Alkoholexzesse, seinen Charme und sein Scheitern. Er kennt die neue Frau in der ersten Reihe nicht. Sie trägt lange schwarze Handschuhe aus Spitze, unter dem Schleier sieht er nur ihren roten Lippenstift. Ein großes Foto steht neben dem Sarg, aber der Mann darauf sieht nicht aus wie sein Vater. Ein Onkel, den er nur zweimal gesehen hat, nimmt ihn in den Arm, küsst ihn auf die Stirn und sagt, er sei »gesegnet«. Es ist ihm unangenehm, aber er lächelt und gibt höfliche Antworten. Später, auf dem Friedhofsweg, spiegelt sich die Sonne auf dem polierten Holz des Sargs. Die Erde, die er in das Grab wirft, ist nass vom Regen der letzten Nacht, sie klebt an seiner Hand, und er hat kein Taschentuch, um sie abzuwischen.
Ein paar Wochen später beginnen die Herbstferien. Er sitzt in der Eingangshalle des Hauses am Kamin, vor ihm liegen die beiden Hunde, die Shakespeare und Whisky heißen. Plötzlich hört er alle Geräusche gleich laut, die weit entfernte Stimme seiner Großmutter und die ihrer Hausdame, die Reifen des Wagens, den der Fahrer vor dem Haus wendet, das Schreien eines Eichelhähers, das Ticken der Standuhr. Überdeutlich sieht er jetzt jedes Detail, den öligen Schimmer in seiner Teetasse, die Fasern des hellgrünen Sofas, den Staub in der Sonne. Er bekommt Angst, minutenlang kann er sich nicht bewegen.
Als er wieder ruhig atmet, geht er hoch in die Bibliothek. Er sucht einen Text, den er einmal gelesen hat. Am 20. November 1811 fuhr Heinrich von Kleist mit einer krebskranken Freundin an den kleinen Wannsee, beide wollten sterben. Sie übernachteten in einem einfachen Gasthaus und schrieben bis in den frühen Morgen Abschiedsbriefe. Ein Brief Kleists an seine Halbschwester endet mit der Datumszeile: »Stimmings bei Potsdam, am Morgen meines Todes«. Am Nachmittag des nächsten Tages bestellten sie Kaffee und ließen sich Stühle nach draußen bringen. Kleist schoss der Freundin in die Brust und sich selbst in den Mund, er wusste, dass die Schläfe zu unsicher ist. Er sei »zufrieden und heiter«, hatte er kurz zuvor geschrieben.
Er wartet, bis alle im Bett sind, dann geht er zur Bar, setzt sich in einen Sessel und trinkt systematisch in kleinen Schlucken anderthalb Flaschen Whiskey. Als er aufstehen will, stolpert er, reißt einen kleinen Tisch um, die Kristallflaschen fallen zu Boden. Er sieht starr zu, wie sich der dunkle Fleck ausbreitet. Im Keller öffnet er den Waffenschrank, entnimmt eine der Schrotflinten und verlässt das Haus, die Tür lässt er offen stehen. Er geht bis zu der Ulme, die sein Vater zu seiner Geburt gepflanzt hat, setzt sich auf den Boden und lehnt sich mit dem Rücken an den glatten Stamm. Von hier sieht er im Morgenlicht das alte Haus mit der Freitreppe und den weißen Säulen, der Rasen im Rondell ist frisch gemäht, es riecht nach Gras und nach Regen. Sein Vater hatte gesagt, er habe damals ein afrikanisches Goldstück unter die Ulme gelegt, sie werde ihm Glück bringen. Er nimmt den schwarzen Lauf des Gewehrs in den Mund, er ist eigenartig kalt auf der Zunge. Dann drückt er ab.
Am nächsten Morgen finden ihn die Gärtner in seinem Erbrochenen, die Schrotflinte liegt in seinem Arm. Er war so betrunken, dass er keine Patrone eingelegt hatte. Er spricht mit niemandem über diese Nacht, in der er sich selbst gesehen hat.
Mit 18 Jahren fährt er das erste Mal mit seiner Freundin in Ferien. Er hat vier Wochen in einer Fabrik am Band gearbeitet, das Geld reicht für die Reise. Sie fliegen nach Kreta und fahren drei Stunden mit einem alten Bus über die Berge, immer engere Serpentinenstraßen, dann weiter bis zur südlichsten Spitze der Insel. In einer Pension mieten sie ein Zimmer, gekalkte Holzböden, weiße Bettlaken. Unter dem Fenster liegt das Libysche Meer. Es gibt nur ein paar Häuser in dem Dorf und einen winzigen Supermarkt mit Obst, Käse, Gemüse und Brot. Die Besitzerin backt jeden Tag im Wechsel Zuckerkekse und salzige Teigtaschen, davon leben sie. Sie verbringen die Tage am Strand, es ist still.
Irgendwann will sie wissen, warum er ist, wie er ist. Wie soll ein heller Mensch das Dunkle begreifen, denkt er. Er versucht es mit den Worten der Ärzte, sie hört zu und nickt. Depressionen seien keine Traurigkeit, sagt er, sie sind etwas ganz anderes. Er weiß, dass sie es nicht verstehen wird.
Im Zimmer hängt sie ihr Kleid über die Lehne des Stuhls. Sie steht im Bad, ihr schmaler Körper vor dem beschlagenen Spiegel. Er liegt auf dem Bett und sieht ihr zu. Die Luft ist feucht und warm. Die Welt um ihn vergeht ohne Widerstand, sie ist nicht mehr scharfkantig, die Farben verblassen, der Lärm verschwindet. Die Tür zum Badezimmer schließt sich, er ist allein. Von der Decke beginnt Öl auf seine Stirn zu tropfen, es rinnt in Schlieren die Kalkwände herunter, überzieht den Holzboden, das Bett, die Laken, alles wird glatt und verliert seine Struktur. Das Zimmer läuft voll, das Öl schwappt in sein Gesicht, in seine Ohren und in seinen Mund, es verklebt seine Augen. Er atmet es ein, wird taub, und dann ist er selbst das blauschwarze Öl.
Später liegen sie verschwitzt und erschöpft auf dem Bett. Als sie eingeschlafen ist, sieht er sie an. Er küsst ihre Brüste, legt das Laken über ihren Körper und setzt sich auf den Balkon. Das Meer ist schwarz und fremd. Er erinnert sich nicht, ob er ihr das alles wirklich erzählt hat. Und dann begreift er, dass noch sechzig solcher Jahre vor ihm liegen.
Zwei
Vor 54 Jahren, am Tag meiner Geburt, verhängte die Liga der Arabischen Staaten einen Import-Boykott über einen englischen Hersteller von Regenmänteln, die Firma Burberry. Zur Begründung hieß es, die Firma mache Geschäfte mit Israel. Die Liga boykottierte damals mehrere Firmen, in denen Lord Mancroft im Vorstand saß. Er war jüdischen Glaubens.
In London blieb man gelassen. Ein Sprecher der Firma teilte mit, in arabischen Ländern regne es ohnehin selten und bisher seien »lächerlich wenige« Regenmäntel dorthin exportiert worden.
Drei
Die Sommerferien des Jahres 1981 verbrachte ich in England. Ich war 17 Jahre alt und sollte die Sprache besser lernen. Der Mann, bei dem ich in Yorkshire wohnte, war ein verarmter Landadliger, der über die Queen nur sagte, sie sei »very middle class«. Er fuhr einen dreißig Jahre alten Rolls Royce und wohnte in einem baufälligen Haus aus dem 14. Jahrhundert. Auf einem Flügel fehlte das Dach, der einzige beheizte Raum war die Küche, und sein wertvollster Besitz waren zwei schmale Holland-&-Holland-Flinten. Die Bettdecke in meinem Zimmer roch, als hätte schon Oliver Cromwell darin geschlafen, was auch nicht ganz unwahrscheinlich war. Aber ich mochte das steinerne Haus und den Garten, die fast schwarzen Bilder der Ahnen und das Moos auf den Fensterbänken. Die Badewanne war aus Kupfer und so riesig, dass es eine halbe Stunde dauerte, bis genügend Wasser darin war. Sie hatte einen dunklen Mahagonirahmen, und ich erinnere mich, wie angenehm es war, in ihr zu liegen und zu lesen.
Der Hausherr hatte eigenwillige pädagogische Vorstellungen. Sein Unterrichtsprogramm bestand darin, alte David-Niven-Filme abzuspielen, Kipling-Gedichte aufzusagen und mich ansonsten in Ruhe zu lassen. Da er seine Köchin längst entlassen hatte, gab es jeden Tag das gleiche Gericht: Lamm in Pfefferminzsoße und Chips aus einer Tüte, die er in einem Wasserbad zu Matsch verkochte.
An den Wochenenden fuhr ich mit dem Zug nach London, mein Lehrer kam nie mit, weil er die Stadt verachtete. Hier regierte Margaret Thatcher seit zwei Jahren mit eiserner Hand, »Fast Eddie« Davenport war noch nicht aufgetaucht, um die wilden, etwas klebrigen Parties in Kensington and Chelsea zu organisieren, und das enorme Wachstum der Stadt hatte gerade erst begonnen. In Brixton, dem traurigsten Bezirk Londons, hatte die Festnahme eines schwarzen Jugendlichen eine Straßenschlacht zwischen der Polizei und Demonstranten ausgelöst, und Mick Jagger sang »Emotional Rescue«. Alles war voller Glanz und voller Elend, alles war profan und heilig, und ich glaube, ich war damals glücklich.
An einem Abend ging ich mit einer Freundin ins Kino. Wir wollten »Jäger des verlorenen Schatzes« sehen, es war der schnellste Film damals, eine neu erzählte Abenteuergeschichte, Harrison Ford als Professor Henry Jones war großartig. Damals durfte man in den Kinos noch rauchen, HD war noch nicht erfunden, und nach der Hälfte des Filmes sah man durch den Rauch kaum noch etwas. Es war die letzte Vorstellung an diesem Tag. Nach dem Abspann blieben wir einfach sitzen. Ein anderes Paar saß vorne in der ersten Reihe unmittelbar vor der Leinwand, Plätze, auf denen man nur noch Farben wahrnehmen konnte. Plötzlich stand der Mann auf, er wankte, zog ein Bündel Geldscheine aus der Tasche, fuchtelte damit in der Luft herum und brüllte durch den leeren Saal: »Again! Again!« Es war Mick Jagger. Der Filmvorführer ging zu ihm, nahm das Geld, schüttelte den Kopf und legte den Film noch einmal ein. Wir durften bleiben, es war herrlich.
Ein paar Jahre später sah ich zum ersten Mal den Film »Der Swimmingpool« von Jacques Deray. Er wurde schon 1968 gedreht. Romy Schneider und Alain Delon verbringen die Ferien in der Nähe von Saint-Tropez in einem abgeschiedenen Landhaus. Die ersten Minuten passiert nichts. Langsamkeit, Trägheit, die weite, trockene Landschaft vor dem Haus, die Sonne des Mittelmeers. Sie küssen sich am Pool, das blaugrüne Wasser, der Halbschatten auf den warmen Steinplatten. Dann ein Anruf. Er sagt, sie solle es klingeln lassen, und wirft sie nackt in das Wasser. Er sei ein Idiot, schreit sie lachend, geht ans Telefon, und kurz danach kommt in einem rotbraunen Maserati Ghibli ein anderes Paar zu Besuch. Die Dinge werden kompliziert und enden schließlich mit einem Mord.
Fast immer scheitern Remakes, die Dinge, die wir lieben, lassen sich nicht wiederholen. Aber es gibt Ausnahmen. 2016 kam »A Bigger Splash« von Luca Guadagnino in die Kinos, Tilda Swinton hat die Rolle von Romy Schneider. Swinton, die einmal in dem Film als die »Frau des Jahrhunderts« bezeichnet wird, ist ein Rockstar, sie erholt sich von einer Stimmbandoperation mit ihrem Freund auf einer Insel bei Sizilien. Ihr Freund ist ein wenig ermüdend. Dann taucht Ralph Fiennes auf, Swintons ehemaliger Liebhaber, er will sie zurück. Und er ist voller Leben, charmant, mitreißend und unglaublich komisch. Mitten im Film tanzt er. Der Song: Mick Jaggers »Emotional Rescue«. Alleine für diese Szene hätte Fiennes einen Oscar verdient. Ich vermute, nicht alles davon stand im Drehbuch, Fiennes sieht direkt in die Kamera, sein Hemd steht offen, er trägt Shorts – und er macht glücklich. »Emotional Rescue« – manchmal rettet uns die Musik.
Romy Schneider und Alain Delon, Tilda Swinton und Ralph Fiennes, Mick Jagger singt, Harrison Ford trägt seinen Hut, es ist immer ein langer, heißer Sommer am Pool.
Vier
Im Kino läuft ein Dokumentarfilm über das Leben dreier Anwälte: Otto Schily, Hans-Christian Ströbele und Horst Mahler. Drei ganz unterschiedliche Biographien: Schily wurde Bundesinnenminister, Ströbele Abgeordneter der Grünen, und Mahler endete als Rechtsradikaler im Gefängnis. Aber in den 1970er Jahren waren alle drei Anwälte, sie haben Terroristen des »deutschen Herbstes«, die Mitglieder der RAF, in den Strafverfahren verteidigt.
Alles beginnt 1967. Während einer Demonstration vor der Deutschen Oper in Berlin schießt ein Polizist aus nächster Nähe von hinten auf einen jungen Mann. Das Projektil zertrümmert die Schädeldecke des Studenten, er fällt zu Boden, Blut rinnt auf den Bürgersteig. Eine junge Frau kniet neben ihm, sie legt ihre Handtasche unter seinen Kopf und schreit um Hilfe. Zwei Männer tragen den Angeschossenen auf einer Bahre zu einem Rettungswagen. Was nun kommt, ist völlig unverständlich: Der Wagen fährt nicht ins nahegelegene Albrecht-Achilles-Krankenhaus oder in die Neurochirurgie des Virchow-Klinikums, sondern zur viel weiter entfernten Rettungsstelle Moabit. Für den Weg braucht er ungewöhnlich lange. Als ein Assistent den Studenten endlich in den Operationssaal schiebt, kann der Anästhesist nur noch den Tod feststellen.
Die alten Fernsehaufnahmen haben bis heute nichts von ihrem Schrecken verloren, der Zuschauer sieht sie noch immer fassungslos. Ströbele sagt im Film, es sei der Tag seiner »Politisierung« gewesen. Damit war er nicht alleine, dieser Tag prägte fast eine ganze Generation. Nach dem Tod des Studenten weiteten sich die Demonstrationen aus, der Polizeipräsident musste zurücktreten, dann der Innensenator und schließlich der Regierende Bürgermeister von Berlin. Aber das war nicht das Ende. Das war der Anfang.
Das Strafverfahren gegen den schießenden Polizisten war Schilys erster »politischer Prozess«. Er vertrat den Vater des Studenten als Nebenkläger, das Mandat hatte ihm Mahler vermittelt. Der Polizist wurde freigesprochen. In dem Film spricht Schily von etwas Düsterem, das den Prozess umgab, von Beweismitteln, die verschwanden. Mahler sagt, für ihn sei das Verfahren »die Bestätigung der marxistischen Theorie über die Rolle des Staates als Instrument der Herrschenden zur Unterdrückung der ausgebeuteten Mehrheit«. So redet er wirklich.