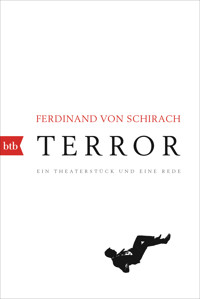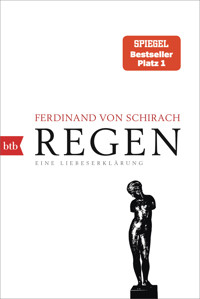9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind?
Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch "Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Bänden "Verbrechen" und "Schuld" zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht zu werden und wie voreilig unsere Begriffe von "gut" und "böse" oft sind.
Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und dem Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind?
Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch »Strafe« zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Bänden »Verbrechen« und »Schuld« zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht zu werden, und wie voreilig unsere Begriffe von »gut« und »böse« oft sind.
Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und dem Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns selbst.
»Immer wieder bin ich verwundert von Ferdinand von Schirachs Gabe, auf knappstem Raum das Widersprüchliche zu fassen, mit ein paar Worten den großen emotionalen Raum zu entwerfen. Immer wieder bin ich bis zu Tränen bewegt von dieser Kombination von unsentimentaler Genauigkeit und wunderbarer, menschenfreundlichster Empathie, die seine Texte so unvergleichlich machen.« (Michael Haneke)
»Warum berühren uns diese Erzählungen so? Weil wir alle einsam sind. Und weil Ferdinand von Schirach immer wieder neu davon erzählt, wohin das führen kann. Er verführt uns so ruhig, so klar, so unwiderstehlich, dass man zur Strafe süchtig danach wird.« (Florian Illies)
Autor
Der Spiegel nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Die Erzählungsbände »Verbrechen« und »Schuld« und die Romane »Der Fall Collini« und »Tabu« wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Sein Theaterstück »Terror« zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin. Zuletzt erschien von ihm im Herbst 2017 unter dem Titel »Die Herzlichkeit der Vernunft« ein Band mit Gesprächen mit Alexander Kluge.
Ferdinand von Schirach
STRAFE
Stories
Luchterhand
Wenn alles still ist, geschieht am meisten.
Søren Kierkegaard
Die Schöffin
Katharina wuchs im Hochschwarzwald auf. Elf Bauernhöfe auf 1100 Meter Höhe, eine Kapelle, ein Lebensmittelgeschäft, das nur montags geöffnet hatte. Sie wohnten im letzten Gebäude, einem dreistöckigen Hof mit heruntergezogenem Dach. Es war das Elternhaus ihrer Mutter. Hinter dem Hof war der Wald und dahinter waren die Felsen und dahinter war wieder der Wald. Sie war das einzige Kind im Dorf.
Der Vater war Prokurist einer Papierfabrik, die Mutter Lehrerin. Beide arbeiteten unten in der Stadt. Katharina ging nach der Schule oft zur Firma des Vaters, sie war damals elf Jahre alt. Sie saß im Büro, wenn er über Preise, Rabatte und Liefertermine verhandelte, sie hörte bei seinen Telefonaten zu, er erklärte ihr alles so lange, bis sie es verstand. In den Ferien nahm er sie mit auf Geschäftsreisen, sie packte seine Koffer, legte seine Anzüge raus und wartete im Hotel, bis er von den Terminen zurückkam. Mit dreizehn war sie einen halben Kopf größer als er, sie war sehr schmal, ihre Haut hell, ihre Haare fast schwarz. Ihr Vater nannte sie Schneewittchen, er lachte, wenn jemand sagte, er habe eine sehr junge Frau geheiratet.
Zwei Wochen nach Katharinas vierzehntem Geburtstag schneite es das erste Mal in diesem Jahr. Es war sehr hell und sehr kalt. Vor dem Haus lagen die neuen Holzschindeln, der Vater wollte das Dach noch vor dem Winter ausbessern. Wie jeden Morgen fuhr sie mit der Mutter zur Schule. Vor ihnen war ein Lastwagen. Die Mutter hatte den ganzen Morgen nicht gesprochen.
»Dein Vater hat sich in eine andere Frau verliebt«, sagte sie jetzt. Auf den Bäumen lag Schnee und auf den Felsen lag Schnee. Sie überholten den Lastwagen, auf der Seite stand »Südfrüchte«, jeder Buchstabe in einer anderen Farbe. »In seine Sekretärin«, sagte die Mutter. Sie fuhr zu schnell. Katharina kannte die Sekretärin, sie war immer freundlich gewesen. Der Vater hatte ihr nichts gesagt, nur daran konnte sie noch denken. Sie drückte ihre Fingernägel in die Schultasche, bis es weh tat.
Der Vater zog in ein Haus in der Stadt. Katharina sah ihn nicht mehr.
Ein halbes Jahr später wurden Bretter vor die Fenster des Hofs genagelt, das Wasser wurde aus den Rohren gelassen und der Strom abgestellt. Die Mutter und Katharina zogen nach Bonn, dort lebten Verwandte.
Katharina brauchte ein Jahr, um sich den Dialekt abzugewöhnen. Für die Schülerzeitung schrieb sie politische Aufsätze. Als sie sechzehn war, druckte eine lokale Tageszeitung ihren ersten Text. Sie beobachtete sich bei allem, was sie tat.
Weil sie das beste Abitur gemacht hatte, musste sie in der Aula der Schule die Abschlussrede halten. Es war ihr unangenehm. Später, auf der Party, trank sie zu viel. Sie tanzte mit einem Jungen aus ihrer Klasse. Sie küsste ihn, sie spürte seine Erektion durch die Jeans. Er trug eine Brille aus Hornimitat und hatte nasse Hände. Manchmal hatte sie an andere Männer gedacht, selbstbewusste, erwachsene Männer, die sich nach ihr umgedreht und gesagt hatten, sie sei hübsch. Aber sie waren ihr fremd geblieben, zu weit weg von dem, was sie kannte.
Der junge Mann fuhr sie nach Hause. Sie befriedigte ihn im Wagen vor ihrer Wohnung, während sie an die Fehler in ihrer Rede dachte. Dann ging sie nach oben. Im Badezimmer schnitt sie wieder mit der Nagelschere in ihr Handgelenk. Es blutete stärker als sonst. Sie suchte einen Verband, Fläschchen und Tuben fielen in das Waschbecken. »Ich bin beschädigte Ware«, dachte sie.
Nach dem Abitur zog sie mit einer Schulfreundin in eine Zweizimmerwohnung und begann Politikwissenschaften zu studieren. Nach dem zweiten Semester bekam sie eine Stelle als studentische Hilfskraft, am Wochenende jobbte sie als Unterwäschemodell für Kaufhauskataloge.
Im vierten Semester machte sie ein Praktikum bei einem Landtagsabgeordneten. Er stammte aus der Eifel, seine Eltern hatten dort ein Modegeschäft. Es war seine erste Wahlperiode. Er sah aus wie eine ältere Version ihrer bisherigen Freunde, noch ganz mit sich selbst beschäftigt, mehr Junge als Mann, er war klein und stämmig, ein rundes, freundliches Gesicht. Sie glaubte nicht an seine politische Karriere, aber sie sagte es nicht. Auf der Fahrt durch seinen Wahlbezirk stellte er sie seinen Freunden vor. Er ist stolz auf mich, dachte sie. Beim Abendessen besprachen sie seinen Auftritt für den nächsten Tag, er beugte sich über den Tisch und küsste sie. Sie gingen in sein Hotelzimmer. Er war so erregt, dass er sofort kam. Es war ihm peinlich, sie versuchte ihn zu beruhigen.
Sie behielt ihre Wohnung, aber übernachtete jetzt fast immer bei ihm. Manchmal verreisten sie, immer nur kurz, er hatte viel zu tun. Sie korrigierte vorsichtig seine Reden, sie wollte ihn nicht verletzen. Wenn sie miteinander schliefen, verlor er die Kontrolle über seinen Körper. Es rührte sie.
Ihr Examen feierte sie nicht, sie sagte ihren Bekannten und ihrer Familie, sie sei zu müde. Ihr Freund kam spät von einer Veranstaltung, sie lag schon im Bett. Er trug die Krawatte, die sie ihm geschenkt hatte. Er hatte eine Flasche Champagner mitgebracht, öffnete sie und fragte, ob sie ihn heiraten wolle. Er stand an der Kante des Bettes. Sie müsse ja nicht gleich antworten, sagte er mit dem Glas in der Hand.
In dieser Nacht ging sie ins Badezimmer, setzte sich in der Dusche auf den Boden und ließ das heiße Wasser so lange laufen, bis ihre Haut fast verbrannte. Es wird immer da sein, dachte sie. In der Schule hatte sie es schon gekannt, damals hatte sie es Hintergrundstrahlung genannt, wie die Mikrowellen, die überall im Universum sind. Sie weinte stumm, dann wurde es besser und sie schämte sich.
»Wir sollten in der nächsten Woche zu meinen Eltern fahren«, sagte er beim Frühstück.
»Ich werde nicht mitkommen«, sagte sie.
Dann sprach sie über seine Freiheit und über ihre Freiheit und über das, was sie noch erleben wollten. Sie redete sehr lange über diese anderen Dinge, die nicht stimmten und die nichts mit ihnen zu tun hatten. Die Hitze des Hochsommertages kam durch die offenen Fenster, sie wusste nicht mehr, was richtig war und was falsch war und irgendwann gab es nichts mehr zu sagen. Sie stand auf und räumte den Tisch ab, den er gedeckt hatte. Sie war verwundet und leer und sehr müde.
Sie legte sich wieder ins Bett. Als sie hörte, dass er im anderen Zimmer weinte, stand sie auf und ging zu ihm. Sie schliefen noch einmal miteinander, so, als würde es etwas bedeuten, aber es bedeutete nichts mehr und war kein Versprechen.
Am Nachmittag packte sie ihre Sachen in zwei Plastiktüten. Sie legte seinen Wohnungsschlüssel auf den Tisch.
»Ich bin nicht der Mensch, der ich sein will«, sagte sie. Er sah sie nicht an.
Sie ging an der Universität vorbei, weiter über den verbrannten Rasen im Hofgarten und die Allee hoch bis zum Schloss. Sie setzte sich auf eine Bank und zog die Beine an, ihre Schuhe waren voller Staub. Die Kugel auf dem Dach des Schlosses glänzte oxydgrün. Der Wind drehte nach Ost, er wurde stärker und der Regen begann.
In ihrer Wohnung war es stickig. Sie zog sich aus, legte sich aufs Bett und schlief sofort ein. Als sie aufwachte, hörte sie den Regen und den Wind und die Glocken der nahen Kirche. Dann schlief sie wieder ein, und als sie erneut aufwachte, war es sehr still.
Sie begann für eine politische Stiftung zu arbeiten. Sie betreute die Gäste während der Konferenzen – Politiker, Unternehmer, Lobbyisten. In den Hotels roch es nach Flüssigseife, beim Frühstück legten die Männer ihre Krawatten über die Schulter, damit sie nicht schmutzig wurden. Später konnte sie sich nur undeutlich an diese Zeit erinnern.
Allmählich wurde es besser. Der Vorsitzende der Stiftung erkannte ihre Begabung: Die Menschen mochten sie und weil sie sich selbst ganz zurücknahm, sagten sie mehr, als sie wollten. Der Vorsitzende machte sie zu seiner Referentin, sie begleitete ihn, schrieb Pressemitteilungen, beriet ihn, schlug Taktiken vor. Der Vorsitzende sagte, sie sei sehr gut, aber sie glaubte, sie sei wertlos, eine Art Hochstaplerin, ihre Arbeit sei unbedeutend. Auf den Reisen schliefen sie manchmal miteinander, es schien dazuzugehören.
Nach drei Jahren in diesem Leben begann ihr Körper zu schmerzen. Sie verlor immer weiter Gewicht. Wenn sie frei hatte, war sie zu erschöpft, um jemanden zu treffen, jede Verabredung, jeder Anruf, jede E-Mail strengte sie an. Ihr Telefon lag nachts neben dem Bett.
Zwischen zwei Konferenzen musste sie sich einen Weisheitszahn ziehen lassen. Sie bekam einen Nervenzusammenbruch. Weil sie nicht mehr aufhören konnte zu weinen, spritzte der Zahnarzt ihr ein Beruhigungsmittel. Es wirkte zu stark, sie verlor das Bewusstsein und erwachte erst wieder im Krankenhaus.
Sie setzte sich auf, sie trug nur den Krankenhauskittel, der am Rücken offen war. Ein gelber Vorhang hing vor dem Fenster. Später kam ein Psychologe, er war ruhig und sanft. Sie sprach lange mit ihm. Er sagte, sie reagiere zu stark auf andere, sie müsse vorsichtig mit sich sein und verstehen, dass sie ein eigener Mensch sei. Es werde schiefgehen, wenn sie so weitermache.
Eine Woche später kündigte sie in der Stiftung.
Vier Monate nach ihrem Zusammenbruch rief der Vorsitzende sie an. Ob es ihr besser gehe, fragte er. Ein Unternehmen aus Berlin suche eine Pressesprecherin, er habe sie empfohlen. Es seien junge Leute, eine Softwarefirma. Vielleicht interessiere sie das ja, er wünsche ihr jedenfalls Glück.
Sie wusste, dass sie wieder arbeiten musste, die Tage hatten längst ihren Rhythmus verloren. Sie meldete sich bei der Firma, eine Woche später flog sie nach Berlin. Sie war schon oft in der Stadt gewesen, aber sie kannte nur das Regierungsviertel, die Konferenzräume, die klimatisierten Bars.
Der Geschäftsführer der Firma war jünger als sie, er hatte sehr weiße Zähne und hellblaue Augen. Er zeigte ihr, wie die App funktionierte, die seine Firma entwickelt hatte. Er führte sie durch die Räume, auch die Mitarbeiter waren sehr jung, die meisten starrten auf ihre Bildschirme.
Abends in der Pension schob sie den Sessel an das offene Fenster, zog die Schuhe aus und legte die Füße auf die Fensterbank. Die Bäume vor dem Haus leuchteten im Licht der Ampeln abwechselnd rot und grün. In einer Wohnung auf der anderen Straßenseite ging das Licht an, sie sah Bücherregale und Bilder, und auf der Fensterbank stand zwischen den Vorhängen eine blau-weiße Vase. Das Zimmer roch nach den Linden und den Kastanien vor dem Fenster und nach dem Diesel der Taxis unten vor dem Eingang.
Am nächsten Morgen flog sie zurück. Sie dachte an ihren ersten Freund und an ihre Reise damals in die Provence, dann an der Küste entlang und weiter über die Pyrenäen bis nach Spanien. Es war ihre erste große Fahrt gewesen. Der Zug war langsam gefahren, ein Halt jede halbe Stunde, Bahnhöfe, an denen niemand aus- oder einstieg. Die Rosen- und Lavendelfelder neben den Gleisen, das Land, hell und freundlich. Sie hatte ihren Kopf in den Schoß ihres Freundes gelegt, sie hatte das Meer nicht sehen können, aber immer gewusst, wo es war.
Als das Flugzeug landete, blieb sie zu lange sitzen. Jemand sagte, sie müsse die Maschine jetzt verlassen, sie nickte. Sie fror auf dem Weg durch die Flughafenhalle. Sie stieg in ein Taxi, auf dem Armaturenbrett klebten Fotos, eine Frau mit Kopftuch, ein Junge im Fußballtrikot. Der Wagen fuhr über eine Brücke, der Rhein floss breit in der Sonne.
Katharina begann in der Softwarefirma in Berlin. Die Arbeit war einfach, Pressemitteilungen, Interviews, manchmal ein Essen mit Kunden. Sie war die einzige Frau im Büro. Einmal sah sie auf einem der Bildschirme ein Foto von sich, jemand hatte ihren Kopf auf einen nackten Frauenkörper gesetzt. Manchmal versuchte ein Programmierer mit ihr zu flirten. Sie ging nicht aus, sie blieb lieber allein.
Das Schreiben des Landgerichts war auf Umweltpapier gedruckt. Sie sei für fünf Jahre zur Schöffin berufen worden, stand dort. Sie wählte die Telefonnummer auf dem Briefkopf und sagte, es sei ein Missverständnis, sie habe dafür keine Zeit. Der Mann am Telefon war gelangweilt. Sie könne versuchen, sich entbinden zu lassen, sagte er, es klang, als habe er das schon sehr oft gesagt. Sie könne das Amt ablehnen, wenn sie ein Mitglied des Landtages, Bundestages, Bundesrates oder des Europäischen Parlaments sei. Oder wenn sie Ärztin sei oder Krankenschwester. Das alles stehe im Gerichtsverfassungsgesetz, sie solle dort nachsehen. Wenn sie dann immer noch glaube, es läge ein Grund vor, könne sie einen Brief schreiben, über ihren Antrag entscheide das Gericht nach Anhörung der Staatsanwaltschaft.
Katharina fragte den Anwalt der Softwarefirma. Er sagte, sie habe keine Chance.
Am Morgen der ersten Verhandlung war sie zu früh im Gericht. Ihr Ausweis wurde kontrolliert. Sie fand den Saal nicht sofort. Ein Wachtmeister las ihre Ladung, er nickte, schloss das Beratungszimmer neben dem Verhandlungssaal auf, sie solle hier warten. Sie setzte sich an den Tisch. Später kam der Richter. Sie sprachen über das Wetter und über ihre Arbeit. Der Richter sagte, sie würden heute über eine Körperverletzung verhandeln. Der zweite Schöffe kam erst kurz vor Prozessbeginn, er war Lehrer an einer Berufsschule. Das sei schon sein fünftes Verfahren, sagte er.
Ein paar Minuten nach 9 Uhr betraten sie durch eine Seitentür den Gerichtssaal. Alle standen auf. Der Richter sagte, die Sitzung sei eröffnet, zuerst werde aber eine Schöffin vereidigt. Dann las er Satz für Satz die Eidesformel vor, Katharina musste sie nachsprechen und dabei die rechte Hand heben, vor ihr lag ein Papier mit den Sätzen in großen Buchstaben. Danach setzten sich alle. Der Angeklagte saß neben seinem Verteidiger, ein Wachtmeister las Zeitung. Es gab keine Zuschauer.
Der Richter begrüßte den Verteidiger und den Staatsanwalt. Er fragte den Angeklagten, wann er geboren sei und wo er wohne. Der Mann war seit vier Monaten in Untersuchungshaft. Die Protokollführerin schrieb alles auf, sie saß neben Katharina. Ihre Handschrift war undeutlich.
Die Staatsanwältin stand auf und las die Anklage vor. Der Mann habe vorsätzlich seine Ehefrau am Körper verletzt. Der Verteidiger des Angeklagten sagte, sein Mandant werde sich »vorerst nicht einlassen«. Der Richter bat den Wachtmeister, die Zeugin aufzurufen.
Die Zeugin setzte sich, ihre Handtasche stellte sie auf den Boden. Sie müsse sich nicht äußern, weil sie die Ehefrau des Angeklagten sei, sagte der Richter, aber wenn sie es doch tue, müsse es die Wahrheit sein.
Es sei um die gelben Zettel gegangen, sagte die Frau. Ihr Mann habe ihr Zettel geschrieben, seit Jahren mache er das. Er habe immer einen Block in der Tasche, diese gelben Zettel, die von selbst kleben. Er habe auf die Zettel geschrieben, was sie tun sollte, während er arbeiten ging. Auf das Geschirr habe er einen Zettel geklebt, Abspülen, auf seine Wäsche Reinigung, auf den Kühlschrank Käse oder was sie sonst einkaufen sollte. Überall habe er diese Zettel hingeklebt. Das habe sie nicht mehr ausgehalten. Sie habe ihm gesagt, sie könne die gelben Zettel nicht mehr ertragen, sie wisse doch selbst, was sie tun müsse. Er habe nicht aufgehört und weiter Zettel geklebt. Er, der den ganzen Tag arbeite, müsse sich auch noch um den Haushalt kümmern, habe er gesagt. »Dumm wie Bohnenstroh«, das sei sein Lieblingsausdruck für sie gewesen. Sie tauge nichts, jeden Tag habe er das gesagt, sie tauge nichts.
Sie habe keine Kinder bekommen können, das habe er ihr früher vorgeworfen. Es habe viele Jahre wehgetan. Aber sie habe sich daran gewöhnt und jetzt sage er das auch nicht mehr.
Im Sommer seien sie fast immer draußen gewesen, das heißt in der Kleingartensiedlung zwischen der Autobahn und dem Flughafen. Sie hätten dort ein Häuschen. Sogar um den Garten müsse er sich kümmern, habe er gesagt. Nur einmal habe sie »von selbst« im Baumarkt blaue Blumen gekauft und im Garten eingepflanzt. Er habe sie wieder ausgegraben. Sie würden nicht passen, habe er gesagt.
Der Richter blätterte in der Akte. Ihr Mann sei schon vier Mal verurteilt worden, weil er sie angegriffen habe, das Krankenhaus habe jedes Mal die Polizei gerufen. Zuletzt habe er sie mit dem Paddel eines Schlauchbootes geschlagen. Die Strafe sei zur Bewährung ausgesetzt worden. Deshalb sei er indieser Sache in Haft, wenn er verurteilt werde, könne die Bewährung widerrufen werden.
»Wissen Sie, wenn er trinkt, dann ist er nicht mehr er selbst«, sagte die Frau. Er sei ein guter Mann, aber das Trinken, das habe ihn verdorben.
An dem Tag, um den es gehe, hätten sie im Garten gegrillt. Die Nachbarn seien auch da gewesen. Sie habe die Würstchen auf den Grill gelegt. Ihr Mann sei mit den Nachbarn am Tisch draußen gesessen. Sie hätten geredet und Bier getrunken. Sie sei in die Küche gegangen, um Brot zu holen. Dann habe sie sich wieder an den Grill gestellt. Es sei »ganz komisch« gewesen. Sie habe ihren Mann reden hören und plötzlich seien ihr die Würstchen egal gewesen. Sie habe zugesehen, wie sie aufplatzten, wie das Fett auf die Kohle tropfte und das Fleisch verbrannte. Ihr Mann sei gekommen und habe sie angeschrien, sie sei selbst zum Grillen zu blöd, und habe ihr mit der Hand auf den Hinterkopf geschlagen. Es sei ihr egal gewesen, sie habe es kaum mitbekommen, es sei ihr einfach alles egal gewesen. Dann habe er gegen den Grill getreten. Die Kohle sei rausgerutscht und habe ihr Bein und ihren Fuß verbrannt. Die Nachbarn hätten sie ins Krankenhaus gefahren, ihr Mann sei nicht mitgekommen. Es seien nur kleine Narben geblieben. »Nichts Schlimmes«, sagte sie.
Der Richter las den Erste-Hilfe-Bericht des Krankenhauses vor. Ja, es sei alles richtig, sagte die Frau. Der Richter fragte den anderen Schöffen und Katharina, ob sie noch Fragen an die Frau hätten. Der andere Schöffe schüttelte den Kopf. Katharina war bleich, sie hatte Angst, ihre Stimme könne versagen.
»Woran haben Sie gedacht, als Ihnen alles gleichgültig wurde?«, fragte Katharina.
Die Frau hob den Kopf und sah sie an. Sie brauchte einen Moment.
»An unseren Wagen«, sagte sie. Es sei ihr erster Wagen gewesen, damals seien sie noch sehr jung gewesen, erst seit sechs Monaten verheiratet. Sie hätten den Wagen gebraucht von einem Händler gekauft, er sei viel zu teuer für sie gewesen, sie hätten einen Kredit aufgenommen. Ein hellblauer VW-Käfer mit Schiebedach und Stoßstangen aus Chrom. Am ersten Tag hätten sie ihn an der Tankstelle zusammen gewaschen und ausgesaugt und den Lack poliert. Dann seien sie schlafen gegangen und am nächsten Morgen hätten sie nebeneinander am Fenster in der Wohnung gestanden und den Wagen angesehen, der unten auf der Straße in der Sonne glänzte. Er habe seinen Arm um ihre Schultern gelegt. Daran habe sie denken müssen. Sie habe es ihm schön machen wollen, sagte sie, ein schönes Leben, sie habe für ihn da sein wollen.