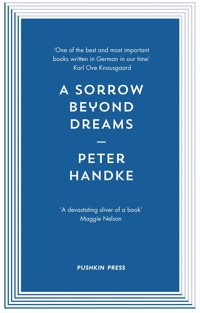6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im neuen Buch, der geheimnisvollen und überraschungsreichen "Vorwintergeschichte" Kali, bricht eine Sängerin nach Abschluß ihrer Tournee in ihre Kindergegend auf – nach Handke-Land: "In die Gegend gleich nebenan, hinter dem Kindheitsfluß. ... Dort ist der Winter noch Winter. Oder: Es ist eine Auswanderer-Gegend ... Das Einzige, was ich noch weiß: Der Untergrund dort besteht bis in die tiefsten Tiefen aus Salz – Kali. ... Auch im Sommer ein schneeweißer Bergrücken mitten in der Ebene." An jenem Ort leben die unterschiedlichsten Weltenbewohner, "Überlebende des Dritten Weltkriegs, der rund um uns schon seit langem wütet, unerklärt, wenig sichtbar, aber um so böser". Deren Leben, so wird der Sängerin bei ihrer Ankunft in der Siedlung auf dem Kali-Berg deutlich, ist völlig aus den Fugen, seit ein Kind verschwunden ist. Und wie geht es mit dem Kind weiter? Und warum heißt es am Ende: "Ah, wenn einmal ein Kind ins Erzählen kommt..."? In Kali hat Peter Handke die Geschichte, die Stationen, das ernste Spiel des Verlorengehens, des Findens und Suchens in unserer Zeit erzählt. Wen sucht die Sängerin? Warum reist sie zunächst zu ihrer Mutter? Wieso flößt sie dem Mann und dessen Sohn in der Bergwohnsiedlung Angst ein? Und warum reist sie zum tiefsten Punkt des Salzstocks?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Handke
Kali
Eine Vorwintergeschichte
Suhrkamp Verlag
Auch mir hat sie Angst gemacht, macht sie Angst. Aber ich möchte mich ihr stellen.
Allmählich setzt das Gedächtnis ein, und ich höre sie, noch ohne sie zu sehen. Und was höre ich von ihr? Ist das ihre Stimme? Oder ein Instrument? Der Ton, eher der Klang, hat etwas von beidem. Es ist eine Art von Zusammenklang, von Instrument und Stimme. Oder nichts als ein Instrument, das sich darüber hinaus als Stimme anhört? Gesang? Nein, Stimme, wie nur je eine, ein Rufen wie manchmal im Traum, ein Ruf, der bei mir ankommt als ein Gerufenwerden wie keines sonst, und so ankommt nicht nur bei mir. Denn nach ein paar Augenblicken der Stille höre ich eine mehrtausendfache Antwort, unisono, einen allgemeinen Aufschrei, der ein Versprechen ist. An sie, die Ruferin? Nein: eines jeden so Aufschreienden an sich selber; ein geschrieener Schwur an mich selber. Dabei habe ich den Klang auch als einen Drohruf im Ohr, zugleich als einen Zornausbruch, zugleich als einen Schmerzenslaut.
Es war ein Schlußklang, den ich gehört habe, der Schlußklang eines Konzerts, des letzten während ihrer Tournee vor dem Winter. Soll ich sie Sängerin nennen? Oder Ruferin? Am ehesten hat sie bei ihren Bühnenauftritten auf mich als eine Musikantin gewirkt, wenn spielend, so nicht für uns, sondern rein um des Spiels willen, und so auch ohne je den Anschein oder das Gehabe eines Spiels. Ab dem Schlußklang jetzt, mit dem diese Geschichte anhebt, soll sie freilich keine Musikantin mehr sein, nur noch, bis zum Ende der Geschichte, die und die.
Und nun sehe ich sie auch. (Es wurde Zeit.) Nicht auf der Bühne ist sie mir in den Blick geraten ‒ als sei solch ein Bild für das Gedächtnis tabu ‒, vielmehr hier auf der Hinterbühne. Fast zugleich mit dem allgemeinen Aufschrei ist sie hereingekommen; hat sich gezeigt. Von den vereinzelten Leuten da sind die, welche saßen, schon vorher aufgestanden, stumm, und lassen sie nun ebenso stumm an sich vorbeigehen, wie durch ein Spalier. Der immer noch nicht verklungene Klang oder Zusammenklang von vorhin hätte auch das Werk eines Mannes sein können. Aber das hier ist eine Frau wie nur je eine. So schnell war sie vorbei auf ihrem Weg in die Garderobe, daß von ihrem Aufzug kaum etwas zu erkennen war. Sie erschien auch ohne Schweiß, oder nasse Haare, wanderte herein auf die Hinterbühne gleichsam aus dem Nachtwind, und ist auch schon da durch und weitergewandert, dabei spürbar alles im Blick; denn wie sonst hätte sie, die anscheinend nur geradeaus schaute, etwas einem der Techniker Entfallenes, einen Knopf? eine Münze?, auf dem Boden wahrgenommen, es aufgehoben und ihm, dem »Richtigen«, im Vorbeiwandern zugeworfen?
Dann steht sie in der Garderobe, auch diese ausgeleuchtet fast wie eine Bühne. Wie aus großer Ferne wird hörbar das anhaltende Schreien des Publikums. Sie steht an der Tür, gerade hereingekommen und schon wieder dabei, zu gehen; umgezogen und aufbruchsbereit. Oder hat sie sich erst gar nicht umziehen müssen, setzt sich jetzt bloß eine Mütze auf und legt sich einen Mantel um? Ist mit ihrem Straßenzeug auf der Bühne erschienen und macht sich in diesem wieder davon? Ein Ansatz zu einem Rhythmus geht auf sie über, ein völlig anderer als der des Schreiens und Klatschens aus der Ferne, ein eher gegenläufiger, wie widerwilliger; bricht gleich ab. Ziemlich dunkel: so ahne ich im Moment ihre Augen, fast finster. Es ist, als halte sie sich dann die Ohren zu, nimmt die Hände dabei aber immer wieder weg, trommelt sich nun auf den Kopf. Die ganze Garderobe, mit ihrem Gesicht im Spiegel, links und rechts und im Rücken weitergespiegelt, erscheint unräumlich, und das nicht bloß wegen der Spiegel, eine vielfach verschachtelte Fläche, sich selbst reflektierend, und hier im kleinen, dort im großen, oder im schiefen Winkel, verzerrt, auf den Kopf gestellt sich wiederholend.
Und wieder sehe ich sie stehen, draußen auf einer Straße, allein. Sie wartet, ohne zu warten. Es ist spät in der Nacht, und wiederum, wenn nicht tag- so fast bühnenhell. Eine recht große Stadt muß das sein. Das Lichterdurcheinander der Fahrzeuge und der Reklamen, zusammen mit den stark vermischten Geräuschen ‒ die nahen jetzt wie fern, die fernen jetzt wie in der Ohrmuschel selber, insgesamt ein Krach ‒, gibt von neuem den Eindruck von Flächigkeit anstelle des Raums. Was ist unten? Was ist oben? Der Vollmond geht auf unterhalb einer ebenso runden, nur kleineren Verkehrsampel. In den Regenlachen des Asphalts in einem fort das Blinken der Nachtflugzeuge und der Satelliten. Sie hält sich abwechselnd die Augen und die Ohren zu, scheint zugleich auch damit zu spielen, für ein Hör- wie Schauspiel in einem. Ein großes Auto ist dann auf sie zugerollt, mit abgeblendeten Scheinwerfern, jetzt kurz aufblendend. Eine hintere Tür wurde ihr aufgehalten. Sie ging um den Wagen herum und stieg vorne ein. Die Limousine fädelte sich ein in den nächtlichen Verkehr, und mit ihrer Langsamkeit schienen auch alle die anderen Fahrzeuge sich zu verlangsamen.
In der Limousine. Nacht. (Freilich: wenn es in der Geschichte hier Nacht ist, spielt in diese immer wieder auch etwas von einem hellichten Tag mit hinein, so wie umgekehrt, wenn es Tag ist, noch und noch Nachtwinkel und Nachtschatten mittun.) Sie und der Fahrer. Allgegenwärtig ein leichter Wind, auch im Inneren des Gefährts. Draußen die Straßen sind belebt von Passanten wie zur Stunde eines südlichen Korso, obwohl die Stadt eher eine heutige Allerwelt darstellt, ohne ein Zeichen von Südlichkeit, etwa Palmen oder venezianische Löwen. Ab und zu hat sich ein Gesicht aus der Menge von außen den Scheiben genähert, anfänglich mit einem neugierigen Starren, das sich angesichts der Passagierin drinnen jeweils in ein Staunen verwandelte, wozu ein sofortiges Zurückweichen gehörte. Der Fahrer ist ein noch junger Mann, als eine Art Uniform weiße Handschuhe, und eine Kappe, die sie ihm gleich abnahm, so wie sie auch auf der Stelle das Radio abschaltete, was beides zu einem gemeinsamen Ritual zu gehören schien.
Und etwa so läßt sich der Fahrer dann hören: »Zu Ihrem Abschied von unserem Land möchte ich Ihnen etwas sagen. Ich war in allen Ihren Konzerten hier. Ihr letztes Konzert heute war etwas ganz Besonderes. Aber auch die anderen Abende waren etwas Besonderes und, ich weiß das, nicht bloß für mich. Sie wollen einem mit Ihrem Musizieren etwas geben. Auch wenn Sie zeitweise stumm sind und ich Sie nur noch in der Einbildung höre, geben Sie, entäußern Sie sich, teilen Sie sich auf für unsereinen ‒ oft gerade dann. Ohne sich zu verausgaben, geben Sie, und wie. Oder nein: Sie verausgaben sich doch, wie nur je ein Musiker, aber so anders als die Musiker, die ich kenne, und ich kenne sie alle, alle. Auch die möchten geben, sich selber. Sie aber geben nichts, rein gar nichts von sich selber, sondern ich weiß nicht was. Es geht bei Ihnen keinen Ton oder Takt lang um Ehrlichkeit, oder gar Wahrheit, sondern um ‒ ich weiß nicht was. Ich habe mir abgewöhnt, Wir zu sagen. Ich habe mir jedes Wir sogar verboten. Aber Ihre Musik hat mein Wir neubelebt. Wir, ja, wir sind von Ihren Konzerten gemeinsam weggegangen, ein jeder in seine Richtung, oder, umso besser, in gar keine Richtung, bloß keine Richtung, und bloß nicht nachhause.«
Der Fahrer hat mittendrin eine Platte oder Kassette eingelegt, wieder wie im Ritual, die von ihr nach dem ersten Ton gestoppt wird. Und er spricht dann weiter: »Vielen Sängern, und mehr noch Sängerinnen, wird eine warme Stimme nachgesagt. Bloß ist das oft die falsche Wärme. Eine angetrimmte Wärme. Eine Wärme mit Botschaft. Ihre Stimme ist anders warm. Längst zähle ich sie nicht mehr, die Stars, die ich gefahren habe, durch mein Land. Sie hier sind die erste, die für mein Land Augen gehabt hat, auf den Seitenstraßen und auf den Zwischenstrecken, da besonders. Ihre Stimme, die kommt aus Ihrem Schauen. Und wie Sie geschaut haben all die Zeit lang. Dabei war das kein warmer Blick. Ihre Art Schauen war finster, und es hat mir Angst gemacht, eine seltsame Angst. Erst mit Ihrer Musik übertrug sich dieses Drohen als Wärme, und blieb doch im Unterton Drohung. Wir sollten laut ihm alle verschwinden von hier, abhauen von hier. Und dabei hat Ihr Drohen, anders seltsam, mir Lust gemacht, aufs Abhauen, aufs Weggehen, und überhaupt auf das Gehen. Und stattdessen fahre ich, und fahre, und fahre.« ‒ Sie: »Und wen werden Sie als nächsten durch Ihr Land fahren?« ‒ Der Fahrer: »Fürs erste niemanden mehr. Es kommt der Winter, und die Sänger bleiben im Süden. Und hier ist alles andere als der Süden.«
Sein Reden ist übergegangen in eine Art Singen: »Sie waren unsere Vorwintersängerin. Nach Ihnen bleibt uns nur noch der Heimweg. Verdammter Heimweg. Auch lang nach Mitternacht. Auch auf mein Bootshaus am Fluß. Meine Eltern waren Indianer. Ah, wär ich ein Indianer. Wär ich ein Indianer, ich wüßte wohin, am Morgen wie am Abend, am Tag wie in der Nacht. Nur sind meine Eltern tot. Und die Indianer sind in einem anderen Land. Und alle Indianer sind tot.« Sein Lied ist zuende: »Sie steigen aus wie üblich?« Sie hat genickt, und er hat gehalten: »Und morgen früh zum Flughafen?« Darauf sie: »Schlafen Sie sich aus.« Darauf der Fahrer: »Winterschlaf. Mein Winterschlaf. Unser Winterschlaf bis zum nächsten Konzert. Schön wär's. Durch die Musik dem Haus entkommen! Den Häusern!« Und unversehens läßt er sie jetzt aussteigen, drängt sie fast aus dem Auto, schlägt hinter ihr die Tür zu und prescht auch schon, mit einem Reifen einen Bordstein schrammend, davon, ins Zentrum? auf der Flucht? auf einer Verfolgungsjagd, ins Leere?
Sie hat dann allein den Kassenraum eines Kinokomplexes betreten, wo nachtlang die Filme laufen. Nicht nur durch die vielfachen Spiegelungen, die Plakate, die einsam blinkenden Spielautomaten entsteht wieder das Bild eines unfaßbaren Raums. Sie hat eine Karte gelöst und ist in einem der Dutzend Säle verschwunden.
Im Kino sitzt sie in einer der vorderen Reihen, dem Anschein nach die einzige Zuschauerin. Die Reihen vor ihr sind allesamt leer. Die Leinwand, wie früher die Bühne, gerät mir nicht in den Blick. Dafür sehe ich, was darüber, darunter, daneben ist, EXIT, TOILETTE; ein Trompe-l'œil-Gemälde von einer Loge mit einem da hineingemalten stillen Zuschauer. Geräusche jetzt, wie von einer heftigen Liebesszene. Sie wendet sich um: fast nur alte und uralte Zuschauer sitzen da dichtauf in den letzten Reihen, ein jeder vollkommen reglos, hier und dort einer oder eine ‒ es gibt auch greise Paare ‒ mit Mänteln und Hüten. Mumienhaft wirken sie in der Starre der Gesichter, samt den tief darin eingesunkenen, keinmal blinzelnden, glasigen Augen, während von der Leinwand ein sich verstärkendes zweifaches Atmen und in der Folge ein einzelnes sanftes Lachen kommt. Die Alten, hier und dort einer oder eine auf einen Stock gestützt, bleiben unberührt, bis auf einen, der mitlächelt, von Herzen. Könnte auch ich dieser eine sein? Und sie? Sie geht aus dem Saal, jedoch nicht aus dem Kino, sondern in einen benachbarten Saal.
Auch dort ist die Leinwand unsichtbar. Umso vordringlicher der Ton: Knall und Fall, Schreien, Toben, Bersten, Röcheln, Explosionen, noch und noch, Knattern, Rattern, Todesgurgeln, Weiterknattern, -explodieren, und so fort. Ins Bild kommt mir dazu allein das sprunghaft wechselnde Licht auf den wieder leeren Stuhllehnen vor ihr, die Lichtsprünge auch an den Seitenwänden des Kinos, dazu die stillen Bodenlichter an den Stufen, für jede Reihe eine Stufe, diese Lichter wie die einer Landebahn. Und auch hier wird sie sich dann umwenden: Im Saal da sind noch mehr Zuschauer als im vorigen, und allesamt sind sie sehr jung, mit ein, zwei wie dazuverirrten Älteren darunter. Junge wie Ältere haben gleich große, weitaufgerissene Augen, und den meisten steht der Mund offen. So ähneln sie sich nicht bloß, sondern gleichen einander zum Verwechseln, und auch die Bejahrteren erscheinen alterslos. Einer der Zuschauer ist fast noch ein Kind, und allein es bemerkt ihren Blick über die Schulter, und schaut groß zurück, anders groß als die von den Filmaktionen Gebannten, ohne die aufgerissenen Augen. Dann folgt das Kind ihrem Blick und beäugt, zur Rechten und zur Linken und hinter sich, seine Nachbarn, wendet sich danach wieder ihr zu. Könnte auch ich so ihrem Blick folgen? Ist das jetzt ein beiderseitiger Komplizenblick? Wenn, dann kein verstohlener ‒ ein ernster, klarer, vielleicht auch belustigter. Dazu ihre Stimme, wie im Vorklang zu einem Lied: »Wenn ein Kind einmal zu reden anfängt … ah, wenn ein Kind einmal ins Reden kommt … ah …«
Diese Nacht, nach dem letzten Konzert vor dem Winter, wird eine besonders lange gewesen sein. Noch einmal jetzt die Allerweltstraßen mit dem Nachtwind, der sichtbar wird an den meist schon kahlen Bäumen und den Kleidern und Haaren der vereinzelt noch Gehenden, mehr noch den still Stehenden, die inzwischen fast in der Mehrzahl scheinen. Und wieder die Tageselemente da und dort, vor allem in den meist bei greller Sonne spielenden Nachtfilmen in den Fernsehergeschäften und an den Meeres- und Wüstenreklamen, sich endlos wiederholend auf den riesigen Projektionsflächen oben auf den Hochhäusern. Schneisen wieder derart von Tageslicht quer durch die Nacht. Tagnacht all die Zeit. Dabei ist kaum mehr Verkehr; fast nur noch eher leere Busse, in den Glasfassaden gespiegelt, so daß mir in meiner Vorstellung die Richtungen durcheinandergeraten.