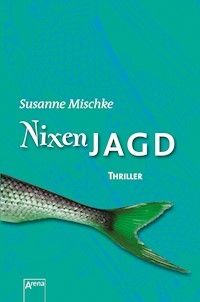8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Steffen Plate gefunden wird, ist er kaum mehr zu identifizieren. Ratten haben ihn bei lebendigem Leibe zernagt! Kommissarin Francesca Dante, eine impulsive Neapolitanerin, und ihr Vorgesetzter Jessen, der reservierte Hanseat mit einer Schwäche für Maßanzüge und alte Geschichte, stoßen schnell auf eine kalte Fährte. Vor 18 Jahren war Plate in ein Verbrechen verstrickt: Eine Familie wurde in Geiselhaft genommen, ein Banküberfall scheiterte. Eine der Töchter starb, so auch Plates Komplize. Dante und Jessen decken viele Ungereimtheiten auf und machen eine grausige Entdeckung: Hier befindet sich jemand auf einem minutiös geplanten, mit erschreckender Geduld ausgeführten Rachefeldzug. Und die drängendste Frage ist: Wer hat sich noch schuldig gemacht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Berlin Verlag erschienenen Buchausgabe1. Auflage 2015
ISBN 978-3-8270-7799-8Deutschsprachige Ausgabe:© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2015Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenCovermotive: © Tony Watson / Arcangel ImagesDatenkonvertierung: psb, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Heute war Judith an der Reihe, das Tischgebet zu sprechen. Sie machte es kurz: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast, amen.
»Amen«, wiederholten die Eltern. Hannah dagegen bewegte nur die Lippen. Ihr eisiger Blick traf ihre Schwester Judith, die trotzig das Kinn reckte. Unter dem leeren Blick des Erlösers in Eiche griff der Vater nach der Suppenkelle.
Jeden Abend um Punkt sieben Uhr versammelte sich die Familie im Esszimmer, jemand sprach das Tischgebet, danach wurde die Mahlzeit eingenommen, schweigend. Peter Lamprecht war der Meinung, die Nahrung sei ein Geschenk Gottes, das es verdiene, mit Andacht gegessen zu werden, ohne Geschwätz und Plauderei. Also hörte man nur das nervtötende Ticken der Standuhr und die Essgeräusche der vier Personen.
Judith senkte den Blick auf ihren Teller. Sie fand es abstoßend, wie ihr Vater jeden Bissen zwischen seinen Kiefern zermalmte, als wäre er ein wiederkäuendes Rind. Wenn er ihn dann endlich hinunterschluckte, bewegte sich sein Adamsapfel und ein leises, gurgelndes Geräusch entstand. Am liebsten hätte sie sich während des Essens die Kopfhörer ihres tragbaren CD-Players übergestülpt, den man ihr gekauft hatte, damit sie Klavierkonzerte anhören konnte, um sie später umso perfekter nachzuspielen. Manchmal borgte Judith ihrer Schwester den CD-Player heimlich aus. Als Gegenleistung erhielt sie von Hannah selbst gebrannte CDs mit Musik, die nichts mit Schubert oder Mozart gemein hatte und über deren Herkunft sich Hannah ausschwieg.
Judith wusste, dass ihre Eltern stolz auf sie waren, auch wenn sie das nicht zeigten. Denn es wäre verwerflich, stolz zu sein auf eine Gabe, die allein Gott der Herr ihr geschenkt hatte. Zuweilen wurde sie aber doch gelobt: wenn sie fleißig übte oder wenn ihr ein Auftritt besonders gut gelungen war. Einzig für sie war der schwarz glänzende Flügel angeschafft worden, der beinahe die Hälfte des Esszimmers einnahm und dem ansonsten schlicht eingerichteten Raum Eleganz verlieh.
An diesem Abend bestand Gottes Geschenk aus Kartoffelsuppe mit Speck und Hackbraten mit Rosenkohl, ein Gericht, das zum Wetter und zur Jahreszeit passte. Es war der 31. Januar 1998, draußen fiel Schnee.
Judith aß mit gutem Appetit, Hannah dagegen rührte ihr Essen kaum an. Kurz vorher hatte es eine Auseinandersetzung gegeben. Den Eltern war zu Ohren gekommen, dass Hannah in der Theaterwerkstatt der Schule mitmachte, und das bereits seit Beginn des Schuljahrs. Dies allein war schon schlimm genug, aber nachdem sie gehört hatten, was für ein Stück aufgeführt werden sollte, war ihr Vater fast ausgerastet. Clockwork Orange! Das kenne er, es sei die schiere Verherrlichung von Gewalt.
»Sie spielt die Mrs Alexander und wird auf der Bühne mit einer Schere ausgezogen und vergewaltigt«, hatte Judith Öl ins Feuer gegossen. Ja, es war sündhaft, neidisch zu sein. Aber manchmal konnte sie sich nicht dagegen wehren. Denn der Herr hatte auch Hannah eine Gabe mitgegeben, genaugenommen gleich mehrere: blonde Locken, vergissmeinnichtblaue Augen, harmonische Gesichtszüge und einen gut entwickelten Busen.
Immer wieder wurde Hannah gesagt, dass sie sich auf ihr Aussehen nichts einzubilden brauche und dass Eitelkeit etwas Verwerfliches, Verderbtes sei. »Schönheit vergeht.« Mag sein, dachte Judith dann, aber bis es so weit ist, fährt man damit nicht schlecht.
Hannah war siebzehn, und die Jungs in der Schule verrenkten sich die Hälse nach ihr. Judith dagegen wurde wenig beachtet. Klavierspielen war keine Tugend, mit der man beim heranwachsenden männlichen Geschlecht punkten konnte. Judith war nicht hässlich, aber im Vergleich zu Hannah nur Durchschnitt. Ihre Brüste waren kaum der Rede wert, sie hatte das mausbraune, dünne Haar ihrer Mutter geerbt und man erlaubte ihr nicht, es zu färben oder sich Locken zu drehen. Auch Hannah musste ihr prächtiges Haar zu einem Zopf geflochten tragen.
Hannah. Seit einigen Monaten schien sie es geradezu darauf anzulegen, die Eltern zu verärgern. Neulich war sie dabei erwischt worden, wie sie mit geschminkten Lippen und blau verspachtelten Augenlidern zur Schule gehen wollte. Ein paar saftige Ohrfeigen und vier Wochen Hausarrest waren die Strafe gewesen, die Schminksachen waren im Müll gelandet und ihr Vater hatte sie zwar nicht direkt eine Hure genannt, aber gebrüllt, er dulde kein hurenhaftes Benehmen in seinem Haus.
Und jetzt diese Theatersache. War es etwa Hannahs heimlicher Traum, Schauspielerin zu werden? Wie lächerlich! Nur weil sie, Judith, öffentlich auftrat, glaubte Hannah nun ebenfalls, auf einer Bühne stehen zu müssen? Vor ein paar Jahren, fiel Judith ein, hatte Hannah beim Krippenspiel der Kirchengemeinde die Heilige Jungfrau gespielt. Die Rolle hatte sie mit Bravour gemeistert, und viele Zuschauer hatten Tränen der Rührung in den Augen gehabt, auch ihre Mutter. Ihr Vater war nicht gekommen, er fand das Krippenspiel »unangebracht«. Man könne sich auch ohne dieses Spektakel an der Geburt des Heilands erfreuen. Ja, ihr Vater fiel nicht so leicht auf Hannah herein. Auch vorhin war er hart geblieben. Wie Hannah ein gutes Abitur schaffen wolle, wenn sie sich nebenbei mit solchem Dreck beschäftige, hatte er sie gefragt.
Hannah hatte trotzig ihre Unterlippe vorgeschoben. Die Schule käme schon nicht zu kurz.
»Nein, das wird sie auch nicht. Denn du wirst ab sofort nicht mehr an diesen Theaterproben teilnehmen.«
»Das ist ein Wahlfach. Ich kann nicht mittendrin aufhören, das wird benotet.«
»Oh doch, das wirst du. Ich lasse nicht zu, dass eine meiner Töchter auf offener Bühne Unzucht treibt.«
Es sei doch nur gespielt, hatte sich Hannah verzweifelt gewehrt.
»Ich habe Nein gesagt.«
Dummes Geschöpf, hatte Judith gedacht. Kapierte sie denn nicht, dass es zwecklos war, gegen ihren Vater zu rebellieren? Konnte sie nicht einfach abwarten, so wie Judith auch?
Vor zwei Monaten war sie achtzehn geworden, im Mai würde sie ihr Abitur machen und dann, ab dem Herbst, an der Musikhochschule in Hannover studieren. Sie würde in einer richtigen Stadt leben, ohne Eltern, ohne Verbote. Das Paradies war greifbar nah, sie zählte die Tage.
Das Abendessen war beendet. Ihre Mutter stand auf und trug die Reste des Hackbratens hinaus, Judith räumte die Teller ab. Auf dem von Hannah lag noch eine halbe Scheibe Braten, was normalerweise nicht akzeptiert wurde. Um den Vater aber nicht schon wieder zu reizen, stellte Judith rasch einen anderen Teller darauf.
»Gut, Papa, meinetwegen. Ich werde aus der Theater-AG wieder austreten.«
Judith, auf halbem Weg in die Küche, blieb stehen und wandte sich um. Wie war das? Hannah gab freiwillig nach, ohne Gezeter, ohne tagelanges Schmollen? Das war so ganz und gar nicht ihre Art. Im Gegenteil, das stank zum Himmel. Ihr Vater fiel doch nicht etwa auf dieses Theater herein? Anscheinend schon. Er nickte ihr wohlwollend zu und sagte, sie könne aufstehen und in ihrem Zimmer noch einmal über ihren Fehler nachdenken. »Geh morgen nach der Andacht zur Beichte und bereue, dass du deine Eltern belogen hast und aufsässig warst.«
Wie? Noch nicht einmal beim Abwasch sollte sie mithelfen? Hatte dieses raffinierte Biest es tatsächlich geschafft, ihn um den Finger zu wickeln? Vielleicht sollte man ihren Vater mal darüber aufklären, was Hannah neben den heimlichen Theaterproben sonst noch alles trieb. Judith hatte schon eine entsprechende Bemerkung auf den Lippen, als alle drei zusammenschreckten. Vom Flur her hörte man ein Geräusch, das wie splitterndes Glas klang, und in der nächsten Sekunde drangen zwei dunkle, maskierte Gestalten ins Zimmer.
Andrej wusste, dass sie ihn beobachteten. Bemüht, nicht auf die Ritzen der Gehwegplatten zu treten, trottete er die Straße hinunter, vorbei an Garagentoren und Vorgärten, in denen weiß blühende Sträucher einen giftig-süßen Duft verströmten. Er hoffte, sein Trödeln würde sie veranlassen, nach Hause zu gehen und ihn in Ruhe zu lassen. Doch eigentlich war ihm klar, dass das nicht passieren würde.
Am Montag hatten sie sein Pausenbrot verlangt, am Dienstag hatte er ihnen drei Euro von seinem Ersparten gegeben, und gestern noch einmal fünf, die er aus dem Portemonnaie seiner Mutter genommen hatte. »Damit dir unterwegs nichts passiert, du kleiner Scheißer«, hatte Johannes gesagt. Im Grunde, das ahnte Andrej, ging es ihnen gar nicht nur ums Geld. Sie würden ihn verprügeln, das war so unausweichlich wie die Tatsache, dass ein wackeliger Zahn früher oder später herausfällt. Also konnte es ebenso gut heute passieren.
Seine Bummelei kam ihm plötzlich erbärmlich vor, zeigte sie den anderen doch nur, dass er Angst hatte. Also ging er schneller weiter, obwohl ihm dabei ganz grummelig im Magen wurde. Das alles konnte nur geschehen, weil Ivo krank war. Seit Samstag schon hatte er Fieber und war deshalb nicht in der Schule gewesen.
Sie waren in der Einfahrt zu einem Garagenhof stehen geblieben und traten von einem Fuß auf den anderen, wie Fußballspieler, die auf den Anpfiff warteten. Als Andrej schon fast an ihnen vorbeigegangen war, setzte ihm Johannes mit ein paar langen Schritten nach und überholte ihn. »Wohin denn so eilig, kleiner Scheißer?«
Andrej blieb stehen.
»He, ich rede mit dir!«
»Nach Hause«, flüsterte Andrej.
»In deine verfickte Kanakensiedlung?«
Andrej schwieg.
»Was ist mit dem Wegzoll?«
»Hab ich nicht dabei«, nuschelte Andrej.
»Er hat nichts dabei!«, wiederholte Johannes gespielt fassungslos und drehte sich mit ratlos ausgebreiteten Armen zu seinen Freunden um. Torsten und Lukas grinsten. Sie waren Brüder, hatten dieselben breiten Nasen, prallen Wangen und aufgeworfenen Oberlippen und taten immer, was Johannes sagte. Alle drei waren fast einen Kopf größer als Andrej. Wenn Ivo nur hier wäre!
»Hast du Schiss?«, fragte Johannes.
»Ja, klar, guck doch mal, wie der zittert«, sagte Lukas.
Sie umringten ihn und begannen, Andrej zwischen sich hin und her zu schubsen wie einen Ball, bis er über ein ausgestrecktes Bein stolperte und lang hinfiel. Johannes riss ihn am Arm in die Höhe. Andrejs Handballen waren aufgeschürft und brannten. Er kam gar nicht auf den Gedanken, sich zu wehren, was Johannes noch gereizter zu machen schien. Dicht vor Andrejs Gesicht zerhackte er mit ein paar Karateschlägen die Luft.
»Gleich pisst er sich in die Hosen«, kicherte Torsten.
Blitzschnell und ohne Vorwarnung fuhr Johannes’ Faust Andrej in den Magen. Der krümmte sich.
»Wie höflich er ist, er verbeugt sich«, lachte Lukas.
Andrej rang nach Luft, kämpfte mit einem Brechreiz und den aufsteigenden Tränen.
Ein silberner Smart näherte sich, wurde langsamer und hielt neben ihnen an. Silke Fosshage, die Kunstlehrerin. Sie war neu an der Schule und jung, jedenfalls jünger als die anderen Lehrerinnen. Der Unterricht entglitt ihr stets nach wenigen Minuten und endete im Chaos, aber Andrej mochte ihre sanfte Stimme und ihre großen hellbraunen Kuhaugen.
Jetzt stieg sie aus. Kam näher in ihrem bunten Flatterrock und den langen Haaren, die so rot waren wie ein Feuerwehrauto. »Was ist da los?« Sie hatte die Hände in die Seiten gestützt und musterte die kleine Gruppe argwöhnisch.
Die vier Jungs blickten die Lehrerin finster an, am finstersten Andrej. Warum fuhr sie nicht einfach weiter? Noch ein paar Minuten, dann hätte er die Sache überstanden gehabt. Wenn sie sich jetzt einmischte, würde bei der nächsten Gelegenheit alles nur noch schlimmer werden.
»Nichts«, antwortete Johannes und grinste sie unter seiner umgedrehten Baseballkappe unverschämt an.
»Andrej, steig ein, ich fahr dich nach Hause.«
Andrej schluckte. Kapierte sie denn nicht, wie lächerlich sie ihn damit machte? Und was würde seine Mutter sagen, oder gar sein Vater, wenn er von einer Lehrerin im Auto nach Hause gebracht wurde? Nie im Leben würden sie ihm glauben, dass er nichts angestellt hatte, und selbst wenn … Seine Mutter war eifrig darum bemüht, dass ihre Kinder »so wie die anderen« waren. Damit meinte sie nicht die Nachbarskinder, sondern die aus den Häusern an der Hauptstraße. Häuser, in denen nur eine Familie wohnte und vor denen kein Müll lag und kein Gerümpel. Häuser wie die von Johannes und Torsten und Lukas. Andrej und sein Bruder Ivo wurden dazu angehalten, in der Schule brav zu sein, keine Schimpfwörter zu benutzen und außerhalb der Wohnung nur deutsch zu sprechen. Auf gar keinen Fall jedoch sollten sie auffallen, weder unangenehm noch sonst irgendwie. Von einer Lehrerin nach Hause gefahren zu werden, das war Andrej klar, ohne dass er darüber nachdenken musste, war das Gegenteil von »so wie die anderen« sein.
Es gab jetzt nur noch eine Möglichkeit. Er bewegte sich ein paar Schritte auf die Lehrerin zu, tat so, als wollte er ihrer Aufforderung nachkommen, schlug dann aber einen Haken und rannte davon. Seine kurzen Beine flogen nur so über das Pflaster, der Schulranzen klopfte ihm auf den Rücken und er fragte sich, ob seine Peiniger es wagen würden, ihn vor den Augen der Lehrerin zu verfolgen. Gut möglich. Gegen Typen wie die kam die Fosshage doch eh nicht an. Wäre doch bloß der Sportlehrer vorbeigekommen! Aber Andrej hörte nur das Aufklatschen seiner eigenen Sohlen und die Dose mit den Stiften, die wild im Ranzen herumklapperte. Jetzt erst fiel ihm ein, dass es sinnvoller gewesen wäre, in die andere Richtung zu laufen, nach Hause, anstatt zurück in Richtung Schule. Aber das war nun nicht mehr zu ändern. Er rannte, bis seine Lungen brannten. Die Grundschule und die Wohnhäuser hatte er längst hinter sich gelassen, jetzt kam nur noch ein graues Bauernhaus, das ein Stück vom Weg entfernt stand. Vor dem Haus qualmte ein Feuer. Eine Frau stand daneben, sie hielt eine Axt in der Hand und blickte ihm böse nach, als er vorbeirannte. Bestimmt eine Hexe!
Allmählich ließen seine Kräfte nach, er wurde langsamer und bog in einen Feldweg ein, der sich eine Anhöhe hinaufschlängelte. Zwischen den Treckerfurchen wuchs hohes Gras. Erst als er den Waldrand erreichte, blieb er stehen. Stiche fuhren durch seinen Oberkörper, er rang hektisch nach Atem, aber die Luft erreichte seine Lungen kaum. Er stützte die Hände auf die Knie, Speichel lief aus seinem Mund. Ein paar Minuten lang verharrte er so, bis er allmählich wieder Luft bekam und das Stechen nachließ. Dann richtete er sich auf und schaute sich um. Den Weg säumten Farne, zwischen denen sich ein Stapel dicker, geschälter Baumstämme auftürmte. Andrej streifte seinen Ranzen ab und kletterte hinauf. Eine Duftwolke umfing ihn, ähnlich wie das Schaumbad, das seine Mutter hin und wieder benutzte. Oben setzte er sich hin und kniff die Augen zusammen. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, und langsam wich die Spannung aus seinem Körper. Die Sonne schien, aber von Westen drückte eine Wolkenwand herein. Hinter dem Dorf leuchteten zwei weiße Rechtecke aus dem Dunst, wie hingestreute Würfel. Im Dorf, wo auch die Schule war, lebten die Einheimischen und in den zwei Würfeln die Fremden. Andrej und Ivo waren im Krankenhaus in Göttingen geboren worden, so wie die meisten seiner Schulkameraden, aber dennoch gehörten sie zu den Fremden. Über den Grund dafür hatte er sich noch nie den Kopf zerbrochen und jetzt war erst recht nicht der Zeitpunkt dafür.
Verdammt, er könnte längst zu Hause sein, wäre er nicht in die falsche Richtung geflohen. Saublöd von ihm. Und was jetzt? Am besten wäre es, wenn er hier wartete und später zurückging. Aber wie lange warten? Ab wann konnte er sicher sein, dass sie ihm nicht mehr auflauerten? Wenn es dunkel wurde? Aber es wurde jetzt immer erst spät dunkel. Seine Mutter würde sich Sorgen machen und wütend werden, und noch wütender wäre sein Vater. Falls der zu Hause war. Das wusste man bei ihm leider nie im Voraus. Andrej saß in der Falle. Das Dorf bestand mehr oder weniger aus der Hauptstraße, von der kurze Straßen abzweigten, wie die Rippen von einer Wirbelsäule. Schwer möglich, den Ort zu durchqueren, ohne von seinen Feinden gesehen zu werden. Und vor Andrej lag der Wald. Unweigerlich musste er an die unheimlichen Geschehnisse denken, die sich in Wäldern abspielten, und an die Wesen, die dort wohnten: Wölfe, Luchse, Wildschweine, Schlangen. Außerdem Räuber, Hexen und fiese, krüppelige Zwerge. Aber dieser Wald war nicht besonders groß, fiel Andrej ein. Wenn er am Wohnzimmerfenster stand, konnte er weit in die Landschaft schauen und der Wald bedeckte lediglich die Kuppe des Hügels, hinter dem immer die Sonne unterging. Wie eine Mütze. Wenn er diesem Weg folgte und hinter dem Wald über die Felder ging, müsste er bei den Fischweihern herauskommen, dort wo Ivo schon einmal eine Forelle mit der Hand gefangen hatte. Ab da kannte er sich aus. Das Ganze war zwar ein Riesenumweg und er käme viel später als sonst nach Hause, aber das ließ sich nun einmal nicht ändern. Er kletterte wieder hinunter, nahm seinen Ranzen und trat in den Schatten des Waldes. Augenblicklich begann er zu frösteln. Obwohl die Sonne schon recht warm war, spürte man hier, im Dämmerlicht der Bäume, sofort eine erdige Kühle, die einem die Beine hinaufkroch. Vielleicht lag tief im Wald sogar noch Schnee. Er ging schneller, bis er fast schon wieder rannte. Ihm war kalt und ja, er fürchtete sich auch ein wenig. Oder sogar ziemlich.
Der Waldweg war während der Holzernte von schweren Fahrzeugen zerfurcht worden und der aufgewühlte Boden roch faulig-scharf. Bäume standen neben dem Weg, abweisend und streng wie Soldaten. Andrej horchte im Gehen auf die Geräusche seiner Umgebung: das Vogelgeschwätz, das Rauschen des Windes in den Baumkronen. Und immer war irgendwo am Boden ein Krispeln und Knispeln, ein Rascheln und Tuscheln. Eichelhäher krächzten, ein Greifvogel flatterte mit lautem Flügelklatschen dicht über ihm von einem Ast auf. Andrej fuhr zusammen, hastete weiter. Immer wieder sanken seine Sneakers in die schwarze Erde, sie waren schon völlig verdreckt. Am Wegrand hockten unheimliche Gestalten: ein buckliger Gnom, eine sprungbereite Raubkatze, ein kriechendes Krokodil. Manchmal hatte er das Gefühl, dass rechts oder links von ihm Zweige knackten, als würden sie gerade zertreten werden, und ihm war, als beobachtete ihn jemand oder etwas aus der grünlichen Dunkelheit heraus. Was, wenn er sich irrte, wenn dies hier ein ganz anderer, viel größerer Wald war als der, den er vom Fenster aus sah?
Dann wurde es heller. Er passierte einen Streifen aus Birken, deren Stämme von silbernen Flechten bedeckt waren, und dort brach endlich wieder die Sonne durch die Bäume. Dünne, goldene Saiten aus Licht. Der Wald war zu Ende.
Hatte er vorhin vorübergehend die Orientierung verloren, so wusste er jetzt schlagartig wieder, wo er war: oberhalb der alten Ziegelei. Dort war er schon einmal mit Ivo gewesen. Der Hang, der nun vor ihm lag, war vor kurzem abgeholzt worden, abgeschälte Rindenstücke und Äste lagen herum, dazwischen wucherten Brombeeren. Andrej vergaß, dass er es eigentlich eilig hatte, nach Hause zu kommen und kämpfte sich durch das Gestrüpp den Abhang hinab. Die Ruinen übten eine seltsame Anziehungskraft aus, auch wenn ihm dabei nicht ganz geheuer war. Doch wer weiß, vielleicht fand sich irgendwo noch etwas Interessantes, etwas, das er Ivo mitbringen könnte, als Beweis dafür, dass er sich allein hierhergewagt hatte.
Das Fabrikgebäude aus roten Backsteinen war zur Hälfte eingestürzt und man konnte hineinsehen wie in ein Puppenhaus: mächtige eiserne Stahlträger, Rohre, die im Nichts endeten. Der hölzerne Dachstuhl war noch größtenteils vorhanden, aber die Ziegel waren herabgefallen und lagen zerbrochen und von Unkraut überwuchert auf dem Boden. In der Mitte der ehemaligen Fabrikhalle stand noch der Brennofen, ein riesiger, gemauerter Kasten, darauf ein mächtiger Schlot, der jedoch in Höhe der Dachkante eingestürzt war. Die Vorderfront des Ofens bildete eine dicke Platte aus geschwärztem Eisen. Das Tor zur Hölle! Es gab drei kleinere Nebengebäude, von denen nur noch Skelette aus Holz und Mauerresten übrig waren.
Er entdeckte die Spuren eines Lagerfeuers und ein paar leere Bierdosen, die er eine nach der anderen gegen einen gemauerten Kreis kickte, der zwischen dem Fabrikgebäude und den Resten eines Schuppens aufragte. Ein seltsamer, dumpfer Laut ließ ihn innehalten. Menschlich beinahe, und doch irgendwie auch wieder nicht. Unmöglich zu sagen, wo das Geräusch hergekommen war. Er sah sich um, horchte, aber alles blieb still. Nein, da war niemand. Eine Geisterstimme aus dem Nichts. Vielleicht der Wind, der durch die Eisenrohre strich. Er kickte weiter Dosen hin und her. Da war es wieder, das Geräusch, und dieses Mal kam es ihm so vor, als hätte jemand »aaah« gerufen oder »iiih«. Oder vielleicht auch »Hallo«, aber sehr undeutlich und gedämpft. Die Dosen lagen vor der runden Mauer, die von einer hölzernen Platte verschlossen wurde, wie ein Topf von einem Deckel. Andrej hätte geschworen, dass diese … Stimme von dort gekommen war. Er fragte sich, was Ivo an seiner Stelle täte. Na was wohl? Nachsehen. Was war das überhaupt für ein rundes Ding? Andrej versuchte, den Holzdeckel zu bewegen, aber der rührte sich keinen Millimeter. Doch jetzt war er neugierig geworden. Der Deckel musste weg. Er suchte sich einen festen Halt im schütteren Gras, legte die Hände an die Kante und stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen. Mit letzter Kraft schaffte er es, den Deckel ein klein wenig beiseitezuschieben, gerade so viel, dass er hinabspähen konnte. Doch da war nichts als Schwärze. Bestimmt, dachte er, war das mal ein Brunnen gewesen, so einer wie in dem Märchen vom Froschkönig. Er warf einen kleinen Stein hinunter, der mit einem schlichten, trockenen Plopp auf Grund traf. Es hatte sich nach Erde angehört, nicht nach Wasser. Sehr tief konnte der Schacht auch nicht sein, der Fall des Steins hatte kaum eine Sekunde gedauert. Andrej schirmte seine Augen gegen das Sonnenlicht ab und starrte hinab. Allmählich gewöhnten sich seine Pupillen an die Finsternis, er erkannte die groben Mauersteine der Wände, und ganz unten irgendetwas Helles. Das sah aus wie ein … Gesicht! Er zog scharf die Luft ein und einem ersten Impuls gehorchend, wollte er zurückweichen. Aber er erinnerte sich an die »Ungeheuer« des Waldes, die sich allesamt als Büsche, Baumstümpfe, Felsbrocken oder bizarr geformte Wurzeln erwiesen hatten. Wenn er jetzt hochsah, würde es wieder eine Weile dauern, bis er im Dunkeln etwas erkennen konnte. Dieses Helle sah wirklich aus wie ein Gesicht, und war das da vorn nicht ein menschliches Bein? Unmöglich, dachte Andrej, als sich das helle Oval bewegte. Ja, es war ein Gesicht, es hatte zugekniffene Augen, eine Nase, einen Mund, umrahmt von einem dunklen, dichten Bartgestrüpp, und jetzt bewegte sich der Mund und er hörte wieder die Stimme. Sie klang nicht mehr gedämpft, aber heiser und brüchig und ganz leise.
»Hallo!«
Andrej hielt vor Schreck den Atem an.
Wieder tönte die Stimme aus dem Brunnen, dieses Mal waren es mehrere Worte, sie klangen wie »bist du« oder »wer bist du?«. Andrej wurde von einem nie zuvor gekannten Grauen erfasst. Sein Schrei blieb ihm im Hals stecken, er fuhr zurück und torkelte ein paar Meter, so als hätte er vergessen, wie man geht.
»Bleib hier«, röchelte es aus dem Schacht.
Automatisch griff Andrej nach seinem Ranzen, der neben der Feuerstelle lag. Er nahm sich nicht einmal die Zeit, ihn aufzusetzen, er umklammerte ihn nur mit den Armen und rannte damit davon, den Hügel hinab, über die rissigen Betonplatten, die noch übrig geblieben waren von der Straße, die einst zur Ziegelfabrik geführt hatte.
Als Andrej die Wohnung betrat, merkte er sofort, dass etwas anders war als sonst. So als hätte jemand die Möbel umgestellt. Aber das war es nicht. Doch es hatte eine atmosphärische Veränderung stattgefunden, vielleicht nur ein veränderter, kaum wahrnehmbarer Geruch? Und dann fiel es ihm ein: Ivo. Er war nicht in ihrem gemeinsamen Zimmer. Er war doch krank, er hätte da sein müssen. Aber die Bettdecke lag ordentlich einmal gefaltet auf dem Bett, so als wäre er verreist oder als käme er nie wieder. Andrej suchte nach einer Nachricht ihrer Mutter, den gewohnten Anweisungen in einem knappen Telegrammstil – Essen im Kühlschrank, Mikrowelle 5 Min., komme nach 8 –, als kostete sie jedes überflüssige Wort ein Vermögen. Ein solcher Zettel klebte auch jetzt am Kühlschrank. Ivo Krankenhaus. Die vertrauten Blockbuchstaben waren schlampiger hingeschrieben worden als sonst. Kein Hinweis, was er essen sollte.
Seine erste Regung war Enttäuschung. Er hatte darauf gebrannt, Ivo von der Stimme im Brunnen zu erzählen. Als Nächstes fragte er sich, was aus ihm werden würde, sollte Ivo sterben. Denn es musste seinem Bruder sehr schlechtgehen, sonst wäre er ja nicht im Krankenhaus. Im Krankenhaus wurden Kinder geboren und Leute starben. Wer würde ihn dann beschützen?
Eine halbe Stunde später kam ihre Mutter nach Hause. Sie wirkte etwas abgekämpft. Andrej hatte zwei Scheiben trockenes Brot gegessen und ein Glas Milch getrunken und saß jetzt auf einem der Küchenstühle, die Arme um die Knie geschlungen, in düstere Gedanken gehüllt.
Ivo sei nur zur Beobachtung in der Klinik, sagte sie. Eine Vorsichtsmaßnahme. Und nein, Andrej dürfe Ivo nicht besuchen.
Sie lügt, dachte Andrej. Er wird sterben.
Wurde es Abend, oder lag es an seinen Augen? Wie lange hatte er schon keinen Sonnenstrahl mehr gesehen? Unmöglich, das einzuschätzen, denn das Wissen um Tage, Jahre oder auch nur Stunden war ihm genommen worden.
Wieder erleben, wie es Abend wird. Eine langsam einsetzende Dunkelheit, statt einer Lampe, die willkürlich an- und ausgeschaltet wird.
Sein Magen fühlte sich an wie ein Stein. Nach dem Hunger zu urteilen, der in seinem Inneren wütete, mussten seit der letzten Nahrungsaufnahme Tage vergangen sein. Tage oder Nächte, es war kein Unterschied. Er erinnerte sich an seine letzte Mahlzeit, dasselbe pampige Zeug wie immer. Und wie immer hatte er sich gierig darauf gestürzt und alles aufgegessen, denn dass es bis zum nächsten Essen sehr lange dauern konnte, das wusste er schon. Danach blieb er immer so lang wie möglich wach, um den Zustand des Sattseins auszukosten, doch letztes Mal musste er gleich eingeschlafen sein. Aufgewacht war er, weil er fror und seine Decke nicht finden konnte. Die absolute Dunkelheit, die ihn umgab, hatte ihn im ersten Moment nicht allzu sehr beunruhigt. Das kannte er, so war es oft. Ebenso wie die Lampe manchmal sehr lange ohne Unterbrechung brannte. Aber schon bald hatte er begriffen, dass er woanders war, und hatte eine Art inneres Flattern verspürt, als wäre in seinem Körper etwas, das Flügel besaß. Es war Angst, unbändige Angst. Die Veränderung hatte zu keiner Verbesserung seiner Situation geführt. Im Gegenteil: Er lag auf einem unebenen Untergrund und ringsherum waren Wände, die sich jedoch anders anfühlten als die, die er kannte. Er hatte Schmerzen bei jedem Atemzug und jeder Bewegung. Seine Schulter tat besonders weh, vielleicht war etwas gebrochen. Nachdem sich die erste Panik gelegt hatte, war er ganz ruhig geworden. Hatte zusammengekauert dagelegen und gedacht: Das ist also das Ende. Lebendig begraben in irgendeinem kalten Loch unter der Erde. Denn so roch es, nach feuchter Erde und Moder. Er würde hier verhungern, verdursten, verfaulen. Es gab angenehmere Arten zu sterben, aber trotzdem hatte er den bevorstehenden Tod freudig begrüßt wie einen alten Freund, mit dem man schon gar nicht mehr gerechnet hatte.
Anfangs – was hieß das, wie lange war das her? – hatte er sich nach Freiheit gesehnt, nach anderen Menschen, nach gutem Essen, Wärme, Musik, Sex. Bis er begriffen hatte, dass er nie wieder frei sein würde. Von da an hatte er sich gewünscht, zu sterben, aber nie so intensiv wie nun, an diesem neuen Ort. Jetzt war es nur noch eine Frage von Tagen oder Stunden. Hier, in diesem Erdloch, war für ihn Endstation. Mit einem eigenartig distanzierten Interesse registrierte er, wie seine Kräfte zum Erliegen kamen. Es gelang ihm kaum noch, sich aufzusetzen, und schon das Heben eines Arms kostete ihn ungeheure Anstrengung. Gleichzeitig verfluchte er sein Herz und seine Lungen, die immer noch arbeiteten, obwohl es doch vollkommen sinnlos geworden war, und er war wütend auf diesen Schwächling, der die feuchten Wände ableckte wie eine Eiswaffel und dadurch den Tod doch nur hinauszögerte. Aber der Durst brannte in seiner Kehle, die Zunge fühlte sich an, als wäre sie aus Leder, und gleichzeitig lähmte die Kälte seine Hände und Füße, dann die Arme und Beine, bis er sie nicht mehr spürte. Irgendwann war auch sein Hirn vollkommen leer und es verblassten auch noch die wenigen letzten Erinnerungen an sein altes Leben. Jetzt und hier zu sterben war das Einzige, woran er denken konnte. Die Todessehnsucht und das Wissen um sein nahes Ende hatten ihn zwischenzeitlich so euphorisiert, dass er die Schmerzen, die Kälte und den Hunger kaum noch wahrnahm und sein Geist sich öffnete und sich dem überließ, was sein würde. Ganz egal, was es war, alles war diesem leidvollen Dasein vorzuziehen, selbst wenn es das schiere Nichts sein würde oder brüllendes Höllenfeuer. Doch plötzlich hatte er dieses Geräusch gehört, dieses helle Scheppern, und dann war Licht eingedrungen, Licht, das wie ein Messer in die Augen schnitt. Und jetzt war da noch immer ein Streifen schwindender Helligkeit, der bezeugte, dass er keiner Halluzination aufgesessen war. Er dachte an dieses … Wesen, das zu ihm hinabgeschaut hatte. Das geatmet hatte. Nur einen Schatten hatte er erkennen können, aber er war ganz sicher, einen Kopf gesehen zu haben. Ein Kind vielleicht. Ein Kind, das sich erschreckt hatte, denn ein Erwachsener hätte ihm doch wohl geantwortet und wäre nicht einfach verschwunden. Aber wo ein Mensch war, waren bestimmt noch andere. Vielleicht kam bald noch jemand. Jemand, der blieb, jemand, der mit ihm redete, der ihm half, ihn rettete. Vielleicht waren diese Menschen schon auf dem Weg hierher. Der Lichtstreifen wurde blasser. Er stellte sich einen Abendhimmel vor, rosarot wie Zuckerwatte. Zum ersten Mal seit unendlich langer Zeit schöpfte er wieder Hoffnung, während sich die Nacht herabsenkte und die letzte Wärme aus seinem Körper saugte.
Am Montag kam Ivo wieder nach Hause. Er hatte noch immer leichtes Fieber, aber seine Backen sahen nicht mehr aus wie die eines Hamsters, und er konnte wieder beinahe schmerzfrei kauen und schlucken. Dennoch bekam er von ihrer Mutter Haferbrei und püriertes Gemüse serviert, und Andrej musste das Zeug mitessen. Aber er hätte alles gegessen, solange er nicht ohne Ivo zur Schule musste.
Der Doktor, der Andrej am Freitag untersucht hatte, hatte gemeint, er sei gesund, dürfe aber so lange nicht in die Schule, bis man ganz sicher sein konnte, dass er sich nicht bei seinem Bruder mit Mumps angesteckt hatte. Nicht in die Schule! Das wenigstens war eine gute Nachricht gewesen.
Am Dienstag saß ihr Vater am Küchentisch, und Andrej schwante, dass etwas nicht stimmte. Er kannte diesen lauernden Blick aus halb geschlossenen Augen. Für gewöhnlich bekam Ivo die Launen des Vaters zu spüren. Nun aber, da Ivo krank war, hatte Andrej die Befürchtung, dass er an der Reihe war. Oder hatte es gar nichts damit zu tun? Ivo war zwölf und schien in letzter Zeit keine Angst mehr vor seinem Vater zu haben. Es war schon eine ganze Weile her, dass er zum letzten Mal Prügel kassiert hatte.
»Warum lungerst du hier herum, musst du nicht in die Schule?«
»Der Arzt hat gesagt, ich darf noch nicht. Wegen der Ansteckung.«
»Der Arzt! Was weiß der schon?«
Andrej war in die Küche gekommen, um etwas zu trinken, doch nun bereute er es. Und er hätte besser auch den Arzt nicht erwähnt. Sein Vater hasste die Studierten, diese »Kopfficker«.
Andrej wusste nicht, was sein Vater arbeitete. Manchmal hockte er wochenlang in der Wohnung herum, dann wieder war er kaum zu sehen oder man musste tagsüber leise sein, weil er schlief. Wenn er tagelang fort war, hoffte Andrej jedes Mal insgeheim, sein Vater würde nie wiederkommen.
Seine Wut hing wie eine Rauchwolke in der Luft. Er war oft wütend. Wut schien eine Art Grundstimmung bei ihm zu sein, und wenn er sich freute, dann war es stets eine grimmige Schadenfreude.
»Die Schlampe von nebenan hat sich bei mir beschwert.« Jetzt schaute er Andrej durchdringend an, die Augen kleine, boshafte Schlitze. »Hast du dazu was zu sagen?«
Andrejs Verstand arbeitete fieberhaft. Worum ging es? Redete er von Elenas Mutter? Warum sollte die sich über ihn beschweren? Er hatte die Frau doch immer gegrüßt, wie ihre Mutter es verlangte. »Ich weiß nicht«, sagte Andrej unsicher. Er wünschte, seine Stimme würde weniger piepsig klingen.
Sein Vater stand auf, beugte sich über den Tisch. Kurze, kräftige Arme, ein massiger Körper und ein runder Kopf, der halslos überging in einen fleischigen Nacken. »Was ist das für eine beschissene Geschichte, die du da in der Gegend rumerzählst?«
Ihre Mutter duldete nicht, dass er und Ivo solche Worte sagten, ihrem Vater hingegen war das nicht abzugewöhnen. Andrej wünschte, ihre Mutter würde nach Hause kommen, jetzt, in diesem Augenblick.
»Geschichte?«, flüsterte Andrej, der allmählich kapierte. Elena musste die Sache mit dem Geist im Brunnen ihrer Mutter erzählt haben. Dabei sollte es doch ihr Geheimnis bleiben.
»Machst dich wohl gerne wichtig, was? Bist ein kleiner Wichtigtuer, ein kleiner Klugscheißer. Denkst, du bist bald klüger als dein Vater, hm?«
Andrej versuchte, dem Atem zu entkommen, der ihm warm ins Gesicht blies und nach Alkohol und Tabak roch.
»Nein.«
»Nein? Wieso muss ich mich dann von dieser Alten anscheißen lassen, weil ihr Blag nachts heult und sich einpisst? Weil mein Herr Sohn Geistergeschichten erzählt?« Er war laut geworden, und sein Gesicht bekam einen Stich ins Violette.
»Aber es ist wahr«, sagte Andrej wider besseres Wissen trotzig.
Sein Vater griff nach Andrejs Ohr und drehte es um. Andrej presste die Lippen aufeinander, um nicht vor Schmerz zu schreien. Sein Ohr wurde nach oben gerissen, und er wappnete sich innerlich gegen die Prügel, die nun folgen würden. Aber dann, von einer Sekunde auf die andere, schien sein Erzeuger die Lust an der Erziehungsmaßnahme verloren zu haben. Er ließ Andrejs Ohr wieder los, mit dem Hinweis, er solle in Zukunft seine vorlaute Schnauze halten.
Das Ohr brannte und fühlte sich größer an als vorher.
»Ab morgen geht ihr zwei wieder in die Schule, mir reicht das jetzt hier!«
»Was war denn los?«, fragte Ivo, als Andrej zurück ins Zimmer kam.
»Nichts«, flüsterte Andrej.
Sie hörten ihren Vater fluchen, etwas rumpelte, dann fiel die Wohnungstür zu.
»Du glaubst mir doch das mit dem Geist?«
Ivo runzelte die Stirn, so dass seine beiden Augenbrauen einen geraden, fast durchgehenden schwarzen Strich bildeten. Er hatte versprochen, mit Andrej zur Ziegelei zu gehen und nach dem Geist zu sehen, sobald er wieder das Haus verlassen durfte.
»Ja«, sagte er. »Klar.«
Als das Wetter nach drei regnerischen Tagen wieder aufklarte, unternahm eine Gruppe, die aus sieben Erwachsenen und sechs Kindern bestand, einen Ausflug zur alten Ziegelei. Von Zwingenrode war es ein Fußmarsch von einer knappen Stunde. Sie würden sich Zeit lassen und ein munteres Picknick daraus machen. Alles, was man dazu brauchte, hatten sie dabei: Decken, kalten Früchtetee, Apfelchips und Blaubeermuffins.
Am Anfang ließen sie sich Zeit. Die Erwachsenen genossen den Frühlingstag. Silke Fosshage kehrte die Lehrerin heraus und machte die Kinder auf Pflanzen und Vögel aufmerksam, als unterrichte sie Biologie und nicht Kunst. Aber die Kinder wollten nicht wirklich etwas über Waldmeister, Veilchen oder den Kuckuck hören. Die Wonnen des Maitags ließen sie kalt, und je näher sie ihrem Ziel kamen, desto schneller liefen sie, allen voran die beiden Söhne der Meyers. Der neunjährige Oskar hatte die Geistergeschichte, die seit Tagen kursierte, lediglich mit einem herablassenden Grinsen kommentiert, aber sein zwei Jahre jüngerer Bruder Moritz war schon einige Nächte hintereinander weinend aufgewacht. Dennoch hielt er jetzt eifrig mit Oskar Schritt, dicht gefolgt von Ann-Kathrin Totzke und Mia Gelling, beide acht Jahre alt. Leon und Lisa, die zwei Sechsjährigen, stolperten atemlos hinterher.
Tagsüber, in der Schule oder beim Spielen am Nachmittag, hatten sie über den Geist im Brunnen gelacht und sich darin übertrumpft, neue schaurige Details zu erfinden. Aber in der Nacht sah die Sache anders aus. Als Leon Gelling plötzlich wieder ins Bett zu machen begann und seine Schwester Mia bei den Eltern schlafen wollte, hatten diese die Faxen endgültig dicke gehabt. Etwas musste geschehen. Also hatten sie sich diesen Nachmittag freigenommen, ebenso wie die Totzkes und die Meyers. Auch Silke Fosshage, die Kunstlehrerin, hatte sich ihnen angeschlossen. Deren Tochter Lisa weigerte sich seit Wochenbeginn aus Angst vor Albträumen überhaupt noch zu schlafen.
Während es den Eltern um die zarten Psychen ihres Nachwuchses und um die Wiederherstellung ihrer ungestörten Nachtruhe ging, indem sie beweisen wollten, dass am Grund dieses besagten Brunnens nichts war, waren die sechs Kinder darauf gefasst, dort einen Geist vorzufinden. Oder ein schreckliches Tier, ein Ungeheuer, einen Zombie. Die Ängste der Nacht waren der Neugier gewichen. In der Gruppe und begleitet von ihren Eltern fühlten sie sich stark und beschützt, und die Spannung unter ihnen wuchs mit jedem Schritt.
Unwillkürlich passten sich die Erwachsenen dem erhöhten Tempo an. Bettina Totzke kam dabei gehörig ins Schwitzen. Sie besaß füllige Hüften, für die Thomas Gelling vorhin gegenüber seiner Frau Sigrid einen weniger charmanten Ausdruck benutzt hatte. Aber sie wollte nicht hinter den anderen zurückbleiben, schon allein deshalb, weil ihr Mann Günter neben Silke Fosshage herging. Die Lehrerin trug – wie unpassend für einen Ausflug ins Grüne! – einen dünnen, weiten Rock, der ihre elfengleiche Figur bei jedem Windstoß apart umspielte. Sie stammte nicht von hier, erst zu Beginn des Schuljahres war sie aus Hannover hergezogen. Alleinerziehende Mütter, dachte Bettina. Da war Wachsamkeit angesagt. Worüber redeten sie? Sie hatte nicht verstanden, was ihr Mann sonor gebrummt hatte, aber Silke Fosshage war gut zu hören. »Ich weiß auch nicht, wer das aufgebracht hat. Die Geschichte schwirrt schon die ganze Woche in Lisas Klasse herum.«
Ihre Stimme klang schnatterig und das Gesagte in Bettinas Ohren unaufrichtig. Ihre Ann-Kathrin jedenfalls hatte die Geistergeschichte von einer gewissen Elena aus den Hochhäusern. Klar, woher auch sonst? Es gab doch ständig Ärger mit diesem Gesocks.
Die Gruppe hatte den Wald durchschritten, und die alte Ziegelei kam in Sicht. Pflanzen, die sich im Lauf der Zeit ihren Raum zurückerobert hatten, verliehen dem halb verfallenen Gemäuer etwas Romantisches.
Das sähe ja unglaublich malerisch aus, jubilierte denn auch prompt Silke Fosshage, und Stefan Meyer wusste zu berichten, dass er schon als Kind mit seinen Freunden dort unten in der Ruine gespielt habe. »Heimlich geraucht und Feuerchen gemacht«, fügte er verträumt lächelnd hinzu.
»Pscht!«, mahnte seine Frau, aber die Kinder hasteten bereits ohne Rücksicht auf die Brombeerranken einen abgeholzten Hang hinab, und als die Erwachsenen ankamen, standen die sechs erwartungsvoll um das gemauerte Rund. »Das muss der Brunnen sein«, sagte Oskar altklug. »Es ist das einzige Ding, das hier wie ein Brunnen aussieht.«
Ein Holzdeckel saß bündig auf der Mauer. Keines der Kinder hatte es gewagt, ihn anzufassen. Das war Sache der Väter, darin waren sie sich einig, ohne darüber gesprochen zu haben. Die Mütter ließen indessen jegliches Gespür für den magischen Moment vermissen und kümmerten sich lieber um das Picknick. Sie fanden eine ebene, halbwegs saubere Stelle und breiteten die mitgebrachten Decken aus. Bettina Totzke ließ sich stöhnend zu Boden sinken. Schweißperlen glänzten auf ihrer Oberlippe und das T-Shirt hatte dunkle Flecken unter den Achseln. Die Männer setzten die Rucksäcke neben den Decken ab und gingen dann hinüber zum Brunnen, wo die Kinder ungeduldig in der Sonne standen und warteten. Mia Gelling kaute an den Fingernägeln. Die Schuhspitzen der Meyer-Jungs malten Linien in die Erde.
»Jetzt kommt der Geisterjäger«, verkündete Stefan Meyer und wedelte mit einer riesigen Taschenlampe vor ihren Gesichtern herum. Es sollte ein Scherz sein, aber Silke Fosshage nahm ihre Lisa bei der Hand und zog sie ein paar Schritte vom Brunnen weg. Günter Totzke und Thomas Gelling schoben den Holzdeckel mit einem Hauruck zur Seite und lehnten ihn gegen die Mauer. Die drei Männer beugten sich über den Rand, Stefan Meyer knipste die Lampe an. Der Lichtfleck glitt die bemoosten Ziegelwände hinab. Ein schrilles Quieken tönte aus dem Grund zu ihnen herauf, und dann dauerte es ein paar Sekunden, ehe der Verstand begriff, was die Augen sahen: ein Gewimmel von kleinen, haarigen Leibern und nackten Schwänzen. Sie krochen übereinander her und die Ersten begannen nun, an den Brunnenwänden hinaufzuklettern, dem Licht entgegen.
Oberkommissarin Dante telefonierte seit elfeinhalb Minuten. Wie immer, wenn sie italienisch sprach, gestikulierte sie, als stünde der Gesprächspartner vor ihr, und wurde dabei so laut, dass Jessen sie durch die Glaswände seines Büros hören konnte. Er hätte es niemals zugegeben, aber ihm gefielen diese melodiösen Kaskaden von Vokalen, von deren Bedeutung er nur einzelne Brocken verstand. So bekam das vermutlich Banale etwas Geheimnisvolles.
Prinzipiell allerdings missbilligte er es, wenn im Dienst Privatgespräche geführt wurden. Nur konnte er im Augenblick schlecht meckern, denn er hatte sich bestechen lassen. Mit profiteroles, diesen cremigen Windbeuteln, Teufelszeug, unwiderstehlich. Seit zwei Monaten erst war Oberkommissarin Francesca Dante in seinem Dezernat, und er hatte schon ein Kilo zugenommen. Gut, er konnte das vertragen, aber wenn das so weiterging? Nein, das durfte nicht so weitergehen. Ab morgen war Schluss damit. Nur noch diesen einen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!