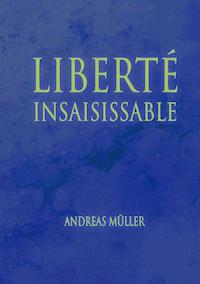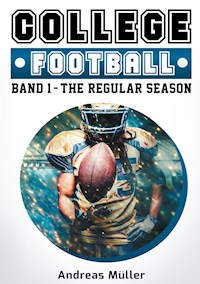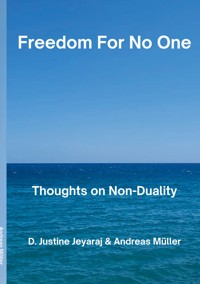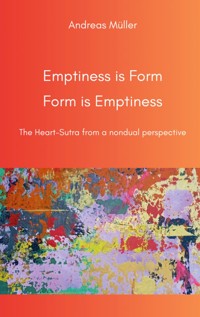Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ca. vier Millionen Menschen in Deutschland konsumieren regelmäßig Cannabis. Sie alle müssen mit der Angst vor strafrechtlicher Verfolgung und sozialer Stigmatisierung leben. Der landesweit bekannte Jugendrichter Andreas Müller legt dar, welche gravierenden Folgen das Verbot der Droge hat und warum damit endlich Schluss sein muss. Legalisierung heißt Schutz, besonders auch für Jugendliche, davon ist Müller überzeugt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Müller
Kiffen und Kriminalität
Der Jugendrichter zieht Bilanz
In Zusammenarbeit mit Carsten Tergast
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © shutterstock
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-80530-1
ISBN (Buch) 978-3-451-31276-2
Inhalt
Das Bewusstsein erweitern und verändern – Warum dieses Buch notwendig ist
Kapitel 1Cannabis und ich – Autobiografisches
Kapitel 2Kiffen ist nicht kriminell – die konfuse Rechtslage
Haschisch, Marihuana, Cannabis: Kleine Begriffskunde
Politik in der Pflicht: Mein Vorstoß gegen die Gesetzgebung
Strafverfolgung und die ungleichen Grenzwerte der Bundesländer
Gravierende Folgen: Berufsverbote und Führerscheinentzug
Die Opfer der Prohibition
Die Null-Toleranz-Strategie: Beispiel Görlitzer Park
Internationale Vorbilder für die Legalisierung: Von den Niederlanden bis zu den USA
Kapitel 3Schluss mit den Dogmen – die Legalisierungsdiskussion
Blick in die Historie der Kriminalisierung
Die Kontrahenten: Von Polizei bis zu Verbänden
Konservative Sozialromantik der etablierten Parteien und unerwartete Koalitionen
Meine Haltung als Jugendrichter: Echter Jugendschutz und öffentlicher Einsatz
Entkriminalisierung, Legalisierung, Regulierung
Kapitel 4Kiffen – Klischees und Realität
Wissenschaft und Ideologie
Die Mär von der Einstiegsdroge
Alkoholmissbrauch und die Cannabisdiskussion
Exkurs: Die Alkoholprohibition in den USA
Cannabis als Medizin
Meine Agenda für die Legalisierung
Kapitel 5 Obama und Merkel kiffen – ein Ausblick
Nachwort
Dank
Anhang
Anmerkungen
Das Bewusstsein erweitern und verändern – Warum dieses Buch notwendig ist
Ich höre sie schon, die Stimmen aus der Politik, von besorgten Pädagogen, von den ewigen Mahnern und auch von denen, die sich aus dem einen oder anderen berechtigten Grund Sorgen machen. »Der hat wohl zu viel gekifft!«, wird es heißen, oder: »Wie kann ausgerechnet ein Richter, noch dazu ein Jugendrichter, sich für die Legalisierung einer Droge einsetzen?«
Zugegeben: Auf den ersten Blick scheint es absurd. Ich bin Jugendrichter und als solcher intensiv mit dem Thema Jugendschutz befasst. Mir obliegt es in vielen Fällen, einzugreifen, wenn bei Jugendlichen und Heranwachsenden ein Drogenproblem offensichtlich wird und gar zu Straftaten geführt hat.
Sollte so einer nicht die harte Linie vertreten? Auf »Null Toleranz« gegenüber Drogen plädieren und diese Linie in seinen Urteilen durchzusetzen versuchen? Das ist die Vermutung, die mein Amt und wohl auch mein Ruf als »härtester Jugendrichter Deutschlands« nahelegen.
Doch nur selten sind die Dinge, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Verschiedene Stationen in meinem beruflichen und privaten Leben haben dazu geführt, dass die deutsche Drogenpolitik und speziell der Umgang mit dem Thema Cannabis zu meinen Lebensthemen geworden sind. Ich bin unter anderem deshalb Richter geworden, um dieses Gebiet aktiv gestalten zu können. Das hat zu vielen frustrierenden Erfahrungen geführt, ist aber auch der Grund, warum ich heute von mir sagen kann, einen so tiefgehenden Einblick in die Thematik zu haben wie nur wenige andere. Zu diesen wenigen anderen gehört beispielsweise Wolfgang Nešković , ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof (BGH), der bereits 1992 formulierte, er sei der festen Überzeugung, die Drogenpolitik in Deutschland könne ganz anders aussehen, wenn man den Menschen die entsprechenden harten Fakten an die Hand geben würde. Die Akzeptanz der bestehenden Drogenpolitik lasse sich vor allem auf Fehlinformationen zurückführen, aufgrund derer Laien ihr Urteil fällen.
Es geht in diesem Buch nicht um eine Verharmlosung von Drogen. Nicht um ein locker-leichtes »Am Morgen ein Joint und der Tag ist dein Freund.« Im Gegenteil: Es geht darum, sich der Thematik endlich vorurteilsfrei und pragmatisch zu nähern, Vorteile einer Legalisierung darzustellen, ohne die Gefahren eines Missbrauchs von Drogen allgemein zu verschweigen. Kurz: Es geht um die Behebung des von Nešković vor über 20 Jahren beklagten Informationsdefizits, das heute kaum geringer zu sein scheint.
Klar ist: Dies ist ein Plädoyer für die Legalisierung von Cannabis. Es gibt viele gute Gründe für diese Haltung, die ich ausführlich darstellen werde. Grundsätzlich gilt: Drogenkonsum im Allgemeinen und Cannabiskonsum im Speziellen sind weniger ein juristisches als vielmehr ein gesellschaftliches und gesundheitspolitisches Problem. Deshalb sollten sie auch primär auf der gesellschaftlichen Ebene angegangen werden, bevor wir uns ihnen auf strafrechtlichem Gebiet widmen.
Derzeit stehen die Vorzeichen günstig, dass sich in der Bewertung von Cannabis bald etwas ändern wird. Die Legalisierungstendenzen sind unübersehbar. Was jetzt nötig ist, ist Information. Information, um auch diejenigen zu überzeugen, die beim Wort »Cannabis« immer noch zusammenschrecken, die alle Drogen in einen Topf schmeißen und die den Mythos von der Einstiegsdroge weiter pflegen. Die meisten Menschen denken und handeln so, weil sie es nicht besser wissen und weil die Anti-Cannabis-Lobby sehr stark ist. Aus dieser Richtung kommen immer wieder manipulative Beiträge, die einem vernünftigen Umgang mit dem Thema Cannabis im Weg stehen und ganz sicher nicht dazu beitragen, den Konsum dieser Droge in den Griff zu bekommen.
Vernunft ist jedoch das entscheidende Stichwort. Wir brauchen einen vernunftgesteuerten Umgang mit dem Thema Cannabis. Und wer die Vernunft walten lässt, kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass eine Legalisierung in möglichst naher Zukunft unumgänglich ist.
Kapitel 1Cannabis und ich – Autobiografisches
Nachdem ich mein erstes Buch veröffentlicht hatte, fühlte ich mich wie leer geschrieben. Ich hatte so lange darüber nachgedacht, zu schreiben und meine Ansichten zum Jugendrecht einem größeren Publikum zu präsentieren, dass ich erst einmal sicher war, nicht noch einmal als Autor an die Öffentlichkeit treten zu wollen. Die zusätzliche zeitliche Belastung durch die Auftritte und Lesungen zum Buch neben meiner Richtertätigkeit führte mich an die Grenzen meiner Kraft.
Eine meiner ersten Lesungen brachte mich direkt mit meiner Vergangenheit in Berührung. Ich hatte in meiner Heimatstadt Meppen zu tun gehabt und brach von hier aus ins ostfriesische Leer auf, wo mein Co-Autor in Zusammenarbeit mit der örtlichen Tageszeitung eine Lesung organisiert hatte. Auf dem Weg dorthin fuhr ich an Börgermoor vorbei, wo sich die Jugendbesserungsanstalt Johannesburg befindet. In den Siebzigerjahren war das eine jener berüchtigten Einrichtungen, in die man die »schwer erziehbaren« Jugendlichen steckte, diejenigen, bei denen es, aus welchen Gründen auch immer, mit dem normalen bürgerlichen Leben und Aufwachsen nicht so recht klappte. In der Johannesburg war auch mein Bruder untergebracht gewesen, auch bei ihm war es mit dem angepassten und zielgerichteten Leben nichts geworden.
Die Fahrt rief viele Erinnerungen an meine Jugend wach. Ich nahm auf dem Rückweg nach Berlin intuitiv die nördliche Route über Hamburg, weil ich den inneren Drang verspürte, meinen dort lebenden Bruder zu besuchen. Aus Zeitgründen – ich war spät dran, und in Berlin wartete ein voller Schreibtisch auf mich – fuhr ich dann aber doch unverrichteter Dinge und ohne Besuch an Hamburg vorbei.
Drei Wochen später erreichten mich gleichzeitig zwei Anrufe ehemaliger Freundinnen meines Bruders: Er war tot.
Der Entschluss
Wenn geliebte Menschen uns verlassen, ist das immer eine Zäsur in unserem Leben. Das habe ich mehrmals selbst erlebt. So nach dem Tod meines Vaters, der als Kriegsheimkehrer seine Erinnerungen in Alkohol ertränkt hatte. Er hat den Kampf gegen den Feind aus der Flasche irgendwann verloren, woraufhin ich mir schwor, nicht so zu enden. Und auch nach dem Tod meiner Mutter, die dem Krebs nicht mehr standhalten konnte und mir auf dem Sterbebett das Versprechen abnahm, die Richterlaufbahn einzuschlagen.
Der Tod meines Bruders nun, nach seiner langen »Karriere« als Junkie, änderte meine Einstellung im Hinblick auf meine bereits beendet geglaubte Autorenlaufbahn. Ich ordnete seinen Nachlass, las mich in alten Unterlagen fest und fand unter anderem ein 2008 ergangenes Urteil des Hamburger Amtsgerichtes. Man hatte ihn mit zwei Gramm Cannabis am Bahnhof festgenommen, zusätzlich warf ihm die Anklage Widerstand gegen die Staatsgewalt vor, weil er sich angeblich der Festnahme entziehen wollte.
Jonas, der in seiner Jugend Hans gerufen wurde, war zu jener Zeit bereits seit zehn Jahren im Methadonprogramm der Stadt Hamburg. Im Alter von 30 Jahren hatte er erstmals Heroin genommen und war süchtig geworden, hatte diverse Entzüge hinter sich. Er wurde also vom Staat mit Ersatzdrogen vollgepumpt und traf auf eine Justiz, die die Gelegenheit nutzte, dem Junkie, den sie anscheinend verachtete, noch einen mitzugeben. Juristisch wäre es möglich gewesen, sich auf die Anklage wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu beschränken. In anderen Bereichen wird dies gemacht, etwa wenn bei Gewaltverbrechen nach § 154 der Strafprozessordnung die Tat mit der niedrigeren Straferwartung nicht weiter verfolgt wird. Statt sich auf die eine Anklage zu beschränken und das Verfahren wegen des Cannabisfundes einzustellen, wurde aber die Gelegenheit genutzt, wegen zwei Gramm Gras aus der ganzen Sache eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten zu machen. Angesichts des offensichtlichen Zustandes meines Bruders und seiner Geschichte ist das aus meiner Sicht ein menschenverachtendes Urteil, entstanden nicht zuletzt aus einer undifferenzierten Interpretation des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG).
Die Lektüre dieses Urteils machte mich wütend, weil es die konsequente Fortführung all der Fehler dokumentierte, die in Jonas’ Leben passiert waren und die ihn zu dem gemacht hatten, was er war und woran er letztlich zugrunde ging. Ich spürte eine Verantwortung gegenüber meinem Bruder und eine Verpflichtung, dieses große Thema doch noch ein letztes Mal in all seinen Facetten anzugehen, um endlich öffentlich klarzumachen, warum die Legalisierung von Cannabis nicht einfach nur irgendeine marginale juristische Frage ist, sondern die Lebenswirklichkeit von Millionen Menschen in Deutschland positiv beeinflussen würde. Und nicht nur das: Sie würde dem Staat Ausgaben in Milliardenhöhe ersparen, die derzeit Jahr für Jahr durch überflüssige Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz entstehen. Darüber hinaus könnten Steuereinnahmen in Milliardenhöhe für viele sinnvollere Dinge – von der Bildungs- bis zur Gesundheitspolitik – genutzt werden.
Eigene Cannabiserfahrungen
Ich spreche oft und gerne über das Thema Cannabislegalisierung, nicht zuletzt war es mir deshalb auch ein Anliegen, in meinem ersten Buch aufzuzeigen, wie die konservative Sozialromantik in diesem Land das Thema instrumentalisiert und ideologisch auflädt. Eine Frage, die häufig auftaucht, ist die nach meinen eigenen Cannabiserfahrungen. Habe ich selbst überhaupt schon einmal gekifft? Sollte mich nicht das Schicksal meines Bruders frühzeitig davon abgehalten haben? Wie stehe ich heute als arrivierter Richter dazu? Müsste ich die Frage nach meinen eigenen Erfahrungen nicht mit aller Vorsicht beantworten, so wie der USamerikanische Politikprofessor Mark Kleiman das im Februar 2014 in einem Interview mit dem Magazin NEON gemacht hat? Kleiman, der als Vordenker einer fortschrittlichen Drogenpolitik gilt, antwortete auf die Frage nach seinen Drogenerfahrungen:
Ich bin ein Kind der Sechzigerjahre und halte mich für einen relativ liberalen Menschen. Aber wenn man als Berater für Drogenpolitik arbeitet und gefragt wird, ob man Drogen konsumiert, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man: »Ja, ich bin ein Gesetzesbrecher. Bitte kommt doch vorbei, verhaftet mich und ignoriert alles, was ich sage.« Oder man sagt: »Nein, ich habe keine Ahnung, über was ich verdammt noch mal spreche.« Da beide Möglichkeiten für mich wenig vorteilhaft sind, beantworte ich die Frage nicht.
Die ältere Generation, zu der ich mich mittlerweile wohl auch zählen muss, hat die Pflicht, die Lehren aus den eigenen Erfahrungen vor allem auch zum Schutz der Jugend einzusetzen. Das funktioniert in allen denkbaren Bereichen: Wir können frei über unser Sexualleben berichten, über unsere Alkoholexzesse, können von dem Mist erzählen, den wir in unserer Jugend gebaut haben, von allen möglichen Fehlern, die wir gemacht haben. Wir können Außenminister werden, obwohl wir in der Jugend auf Polizisten eingeschlagen haben. Joschka Fischer ist der beste Beweis. Und wir können all das sogar in der Öffentlichkeit preisgeben.
Geht es aber um Cannabiskonsum in der Jugend, während des Studiums und auch im Erwachsenenleben, so hat sich unsere Gesellschaft eine Art Schweigegelübde auferlegt. Die meisten Erwachsenen meiden Fragen nach eigenen Cannabiserfahrungen wie die sprichwörtliche Pest. Und wenn sie antworten, dann in aller Regel möglichst ausweichend, etwa so, dass sie mal am Joint gezogen haben (aber niemals inhaliert, wie es etwa der ehemalige US-Präsident Bill Clinton zugab), es ihnen aber gar nichts gebracht habe. Rechtfertigung: Man sei halt jung gewesen. Über aktuellen Konsum höre ich ganz selten Menschen reden.
In der Vorbereitungsphase für dieses Buch habe ich möglichst alles, was im Zusammenhang mit der aktuell aufgeflammten Legalisierungsdebatte stand, sehr genau verfolgt. So ehrlich wie Barack Obama, der öffentlich über seine Kiffervergangenheit als Mitglied einer Bande namens Choom-Gang berichtete, ist kaum ein Deutscher gewesen. Hinter den Kulissen erzählen aber viele Leute oft und gerne von ihren Kifferfahrungen. Sobald jedoch die Kameras angehen, wird nicht mehr darüber geredet.
Ich habe unzählige Sendungen gesehen, die das Thema Cannabis zum Gegenstand hatten. Sofern Künstler oder Musiker zum Thema befragt werden, gehört es fast schon zum guten Ton, zuzugeben, zumindest in der Jugend regelmäßig gekifft zu haben. Politiker allerdings oder andere Personen des öffentlichen Lebens räumen bestenfalls ein, mal an einem Joint gezogen zu haben, oder sie sagen gar nichts dazu. So habe ich noch keinen Politiker im Deutschen Bundestag über seine Cannabiserfahrungen berichten gehört – geschweige denn, dass es ihm auch noch Spaß gemacht hätte.
Kaum einer hat den Mut, über die eigene Kiffervergangenheit zu erzählen. Dabei wäre das genauso nötig, wie es in der großen Abtreibungsdebatte in den Siebzigern nötig war, öffentlich im stern zu bekunden: »Ja, ich habe abgetrieben.«
Ich sehe es an mir selbst. Wie oft schon wurde mir die Frage nach meiner eigenen Kifferzeit gestellt. Ich war eigentlich immer gezwungen, zu lügen, musste einen Teil meines eigenen Lebens verleugnen im Interesse der Absicherung meines gutbürgerlichen Daseins und weil man als Jugendrichter eben mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Worin dieses »gute« Beispiel besteht, wird meistens nicht hinterfragt. Ich, der ich eigentlich ganz schlecht im Lügen bin und als katholisch sozialisierter Mensch auch gar nicht lügen darf, musste mich immer wieder herausreden oder Hilfsbeispiele bringen wie: »Ein Richter muss ja auch keinen Raub begangen haben, um über Bankräuber zu richten.« Am besten kommt man in der Regel davon, wenn man einfach sagt: »Na ja, ich war auch mal jung«, und damit alles im Ungefähren belässt.
Wie oft hätte ich gerne mit den mir anvertrauten jungen Menschen über meine eigenen Erfahrungen geredet, und wie oft hätte ich dadurch auch als Richter ein gutes Stück glaubwürdiger sein können. Wie oft hätte ich durch so ein Gespräch vielleicht früher erkennen können, ob die Jugendlichen tatsächlich ein Suchtproblem haben oder einfach nur aus Lust und Freude konsumieren. Dieses mir und anderen durch die Gesellschaft auferlegte Schweigen, das eine Verlogenheit der ganzen Gesellschaft ist, gilt es zu durchbrechen. Menschen, die wie ich für eine Legalisierung eintreten, müssen und sollen offen zumindest über ihre eigene Jugend berichten dürfen. Das ist Teil eines ehrlichen Umgangs und trägt dazu bei, Suchtverhalten früher erkennen zu können.
Also werde ich mich nicht hundertprozentig an die Devise Kleimans halten, auch wenn er natürlich prinzipiell recht mit seiner Aussage hat. So wie er als Berater laufe auch ich als Richter schnell Gefahr, mich mit entsprechenden Ausführungen aufs Glatteis zu begeben. Einige, insbesondere aus der christlich-konservativen Ecke, werden wohl meinen Kopf fordern und mich als Gefahr für unserer Kinder darstellen. Vor 500 Jahren, als es noch um die Frage ging, ob die Erde eine Scheibe oder eine Kugel ist, hätte man mich, zumal ich auch noch rothaarig bin, vielleicht als Ketzer verbrannt. Trotzdem möchte ich in diesem Buch anhand einiger Geschichten aus meinem Leben auf das Thema eingehen. Nur so erschließt sich mein überdurchschnittliches Engagement auf diesem Gebiet vollständig. Außerdem kann ich so mit meiner eigenen Verlogenheit zumindest ein wenig aufhören.
Drogenparadies Emsland
Ich stamme gebürtig aus dem Emsland, einem flächenmäßig recht großen Gebiet im Nordwesten Deutschlands. Diese Region ist bekannt für ihre bodenständige norddeutsche Mentalität, sie ist aber auch bekannt für die Trinkfestigkeit ihrer Bewohner. Es mag Gegenden im Bundesgebiet geben, in denen Saufgelage ebenfalls an der Tagesordnung sind. Die Alkoholgewöhnung der Menschen in meiner Heimat war für mein Leben leider früh von Bedeutung. Als ich elf Jahre alt war, starb mein Vater. Er hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes totgesoffen. Seinen letzten Rückfall überlebte er nicht und starb nur sechs Monate nach der scheinbar erfolgreichen Rückkehr aus einer Trinkerheilanstalt, wie man das damals nannte.
Mein Bruder, der fast fünf Jahre älter war als ich, versuchte sich dem Drama daheim mit dem ständig angetrunkenen Vater, der leidenden Mutter sowie dem jüngeren Bruder bisweilen zu entziehen. Im Emsland gab es damals eine große amerikanische Garnison in Sögel, und vor allem über die GIs kamen die emsländischen Jugendlichen in den Discos der Umgebung leicht mit Cannabis in Berührung. Zu diesem Zeitpunkt, es war Anfang der Siebzigerjahre, hatte sich auch bei uns in der Provinz eine lebhafte Hippieszene herausgebildet, die ihrem amerikanischen Vorbild nicht nur im Look und in den politischen Ansichten nacheiferte, sondern auch dem Umgang mit Drogen eher neugierig und positiv gegenüberstand. So kifften mein Bruder und seine Freunde eben.
Doch nicht nur das, mein Bruder entwickelte schnell ein Gespür dafür, dass er mit dem Verkauf kleiner Mengen Cannabis sowohl seine Stellung im Freundeskreis festigen als auch ein wenig Geld verdienen konnte. Bald war er dem Reiz des Verbotenen so sehr erlegen, dass er kleinere Diebstähle tätigte, um neues Haschisch zu besorgen, und darüber hinaus bald als Kiffer stadtbekannt war. Schließlich flog er vom städtischen Gymnasium und sorgte damit unfreiwillig für meine eigene erste Bekanntschaft mit dem Thema. Denn ich war trotz einer Lese-Rechtschreibschwäche einige Wochen später auf das Maristenkloster umgeschult worden, ein durch Pater geleitetes, privates Gymnasium. Dort wurde ich von einem Lehrer, der gleichzeitig vom städtischen Gymnasium zum Maristenkloster gewechselt war, auf dessen ganz eigene Art und Weise begrüßt. Als er registrierte, wer ich war, titulierte er mich als »den Bruder des stadtbekannten Haschers« und verpasste mir zur Einstimmung und im Rahmen des noch geltenden Züchtigungsrechtes gleich mal zwei heftige Ohrfeigen. Das war vierzehn Tage, nachdem mein Vater sich endgültig zu Tode gesoffen hatte.
So lernte ich den Zusammenhang zwischen Cannabis und Strafe sehr direkt und schmerzhaft kennen und lernte, dass Cannabisgegner keine Argumente brauchten, weil sie sich ohnehin auf der Seite der Guten und Gerechten fühlten. Das ist heute leider häufig noch genauso.
Ich, der weinende Fünftklässler, verstand das alles nicht, wurde aber in den nächsten Jahren immer wieder mit der Thematik konfrontiert. Bis mein Bruder irgendwann den Hauptschulabschluss schaffte und schließlich in die Jugendbesserungsanstalt geschickt wurde, standen bei uns regelmäßig Autos vor dem Haus, deren Bedeutung ich bald kannte: Es fand mal wieder eine Hausdurchsuchung statt, und jedes Mal wurde auch mein Kinderzimmer durchsucht, in dem Glauben, mein Bruder könne dort Cannabis deponiert haben. Dies und auch die zeitweilige Abwesenheit meines Bruders, der in irgendwelchen Kifferwohnungen Unterschlupf fand, gehörten bald zu einer etwas seltsamen »Normalität« für meine vaterlose Familie.
Trotz seiner laufenden »Drogenkarriere« absolvierte mein Bruder dann eine Schriftsetzerlehre in der Johannesburg. Gleichzeitig dealte er von dort aus. Nun handelte es sich oft auch nicht mehr nur um geringe Mengen für ein paar Freunde, sondern um sogenannte »Hecks«, also 100-Gramm-Pakete (bisweilen sogar Kilos) Cannabis. Da sowohl er als auch die Kumpels, die ihm halfen, blutige Amateure waren, ging das nicht lange gut. Man schnappte sie, mein Bruder wurde eine Zeitlang per Haftbefehl gesucht. Als er dann vor dem Richter stand, kam es zu einer ersten Bewährungsstrafe, der weitere folgten. Schließlich wurde er Jahre später zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, weil das Landesgericht Osnabrück die Urteile früherer Prozesse aufsummierte. So wurde er lange Zeit zwar als Krimineller be- und verurteilt, spürte davon aber kaum etwas. Bis es sich aufgrund der langen Strafe dann plötzlich wie Schwerstkriminalität anfühlen musste.
Mein Bruder wäre der klassische Fall für einen effizienten Warnschussarrest gewesen. Dies darf nicht mit einer Inhaftierung im Sinne von Jugendgefängnis verwechselt werden, sondern hätte ihm für eine begrenzte Arrestzeit aufgezeigt, wie sich Freiheitsentzug anfühlt und wie ernst die Lage ist. Für das in weiten Kreisen verpönte juristische Mittel des Warnschusses habe ich schon in »Schluss mit der Sozialromantik« plädiert. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass meinem Bruder die dramatischen Verschlimmerungen seiner Drogenkarriere dadurch erspart geblieben wären. Stattdessen tat der Staat das, was er heute leider immer noch tut. Er scherte alle Rauschmittel jenseits von Nikotin und Alkohol über einen Kamm und machte aus harmlosen Kiffern, die Anleitung und Hilfe gebraucht hätten, Straftäter.
Und ich selbst? Hätte ich nicht auch fast automatisch diesen Weg gehen müssen, allein schon aufgrund der Drogenkarrieren in meinem engsten Umfeld?
Ich kann nicht leugnen, dass die Gefahr durchaus bestand. Als ich ins Teenageralter kam, hatten auch bei uns in der Provinz längst diverse Discos aufgemacht, die zum Teil heftige Kifferschuppen waren. Unweit unseres Wohnhauses lag die Top-Disco, ein damals bei der Meppener Jugend äußerst beliebter Laden. In ihm sahen wir alles verwirklicht, was uns junge Menschen damals bewegte: andere Musik, Rock statt Schlager, lange Haare statt ordentlich-militärischer Kurzhaarschnitte, ein anderes Leben als das der Eltern. Und dazu gehörten eben auch Drogen.
Mit 14 Jahren schaffte ich es zum ersten Mal, mit älteren Freunden Einlass in die Top-Disco zu bekommen. Die Inhaberin schaute nicht so genau hin, der Umsatz war ihr wichtiger. Und so stand ich dort auf der Tanzfläche, hörte Uriah Heep und war stolz wie Bolle. In den folgenden Jahren wurde die Top-Disco für mich zu einem zentralen Ort der Freizeitgestaltung, drogentechnisch hielt ich mich allerdings zunächst an Alkohol. Als ich 15 oder 16 war, kiffte jedoch schon etwa die Hälfte meiner Freunde. Ich selbst trank nur Wein, süßen Wein, niemals Bier. Psychologisch lässt sich das im Nachhinein leicht erklären: Ich kiffte nicht, weil ich das angesichts der Geschichten meines Bruders meiner Mutter nicht antun wollte, und ich trank kein Bier, weil ich meinen Vater immer nur Bier hatte trinken sehen.
Lange Zeit sahen die Wochenenden also so aus: Meine Freunde waren bekifft, ich war betrunken. Im Alter von 18 Jahren entschied ich mich dann doch, gelegentlich mitzukiffen. Ich wollte nicht betrunken sein, während die anderen vom Cannabis lustig wurden und diesen anderen Rausch erlebten. Schließlich näherte ich mich dem Thema Cannabis doch auf der praktischen Ebene. Allerdings war das gar nicht so einfach, da ich es nicht schaffte, zu inhalieren. Der Wirkstoff kam dadurch gar nicht erst in meine Lunge, und ich merkte gar nichts. Um Abhilfe zu schaffen, kaufte ich mir meine erste Schachtel Zigaretten und begann das Rauchen zu üben. Und dies, obwohl ich zuvor als Schülersprecher auf geradezu militante Weise versucht hatte, in der Schule die Raucherecken abzuschaffen. Als ich endlich inhalieren konnte, brauchte ich allerdings noch einige Versuche, bis ich endlich meinen ersten Cannabisrausch erleben durfte. Für mich hieß das: Ich hatte nun endlich die Möglichkeit, zwischen Alkohol und Cannabis zu wählen. Übrigens war es aus heutiger Sicht falsch, es so zu machen wie beschrieben. Ich hätte mit Haschtee oder Cannabiskeksen beginnen sollen oder pur rauchen, dann wäre mir die lebenslängliche Abhängigkeit von Nikotin erspart geblieben.
In der Folge rauchte ich während meiner Abiturzeit gelegentlich den einen oder anderen Joint. Allerdings nie allein, sondern immer zusammen mit Freunden. Und irgendwann spürte ich auch intensiv die gewünschte Wirkung. Das Kiffen entspannte, machte nicht aggressiv, wie es bei Alkohol schon mal vorkommen konnte, und ich war innerhalb meines Bekanntenkreises (heute würde man von Peergroup sprechen) beim Thema Cannabis nicht länger außen vor.
An Haschisch, das damals überwiegend konsumiert wurde, zu kommen, war übrigens nicht schwer. Die niederländische Grenze war so nah, dass man notfalls mit dem Fahrrad rüberfahren konnte. Dort war Cannabis seit ich denken konnte immer frei verkäuflich. Wir nannten die Besorgungsfahrten damals »Ameisenverkehr«, weil jeder einzelne immer kleine Mengen, meist zwei oder drei Gramm, transportierte. Bevorzugtes Versteck für den Schmuggel: die Mundhöhle. Dort wurde entweder nicht kontrolliert, oder man konnte den Stoff schnell hinunterschlucken.
Das Thema Legalisierung trieb mich im Übrigen bereits zur damaligen Zeit so sehr um, dass ich ihm Artikel in der Schülerzeitung widmete und mir damit Riesenärger mit der Schulleitung einhandelte. Trotzdem blieb ich bei meiner Haltung, und die Erfahrungen dieser Jugendjahre prägen mich bis heute. Ich selbst hatte nie einen problematischen Umgang mit Cannabis. Obwohl ich ab und an mit den anderen kiffte, litten weder meine Schulleistungen noch vernachlässigte ich verantwortungsvolle Aufgaben, die ich beispielsweise als Schülersprecher übernommen hatte. Natürlich gab es einzelne Schüler, bei denen der Konsum problematische Ausmaße annahm. Ich erinnere mich an einen Mitschüler, dessen Abgang von der Schule vor dem Abitur in direktem Zusammenhang mit seinem erheblichen Konsum zu tun hatte. Soweit ich das verfolgt habe, sind jedoch selbst die, die damals ein konkretes Problem hatten, heute ganz normale Mitglieder der Gesellschaft.
Ein Phänomen, das mir heute noch als Jugendrichter häufig begegnet, konnte ich damals in der Schule bereits beobachten, nämlich die durch die Strafandrohung für Cannabiskonsum erzeugte Sprachlosigkeit. Und dies, obwohl fast die Hälfte aller Schüler, genau wie übrigens heute auch noch, gelegentlich kifften. So kam es vor, dass in der Oberstufe Schüler bekifft im Unterricht saßen. Das ist ein Unding, doch es kam nie wirklich zur Sprache. Man drückte sich um das Thema herum, weil auch die Lehrer sehr genau wussten, was sie auslösen würden, wenn sie das an die große Glocke hängten. Jeden angetrunkenen Schüler hätte man sofort aus dem Unterricht befördert und Gegenmaßnahmen ergriffen. Die Kiffer bekamen keine Reaktion, weil immer die Kriminalisierung im Hinterkopf herumspukte. So ist es bis heute.
Mein eigener Konsum hielt sich immer in Grenzen. Ich erinnere mich an einen Trip mit mehreren Freunden nach Sizilien, für den einer von uns, der gute Kontakte hatte, vorher Haschisch besorgt hatte. Da es sich um eine größere Menge handelte, teilten wir diese unter uns auf und vereinbarten, dass jeder ein paar Gramm mit sich führen sollte. So sollte es zum einen nicht so schlimm werden, falls jemand erwischt würde, und zum anderen hätte der Rest der Truppe für diesen Fall noch etwas übrig. So funktioniert das auch heute noch bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Einer besorgt den Einkauf, verteilt und deckt seinen eigenen Bedarf damit kostengünstig ab. Derjenige mit den besten Beziehungen, die sich möglicherweise rein zufällig ergeben haben, lebt, da er die großen Mengen einkauft, strafrechtlich immer am gefährlichsten. Manche jungen Menschen entwickeln sich so zu Dealern.
Bei uns kam es damals anders. Einer von uns wurde erwischt, genauer gesagt: Ich wurde erwischt. Allerdings nicht von der Polizei, sondern von meiner eigenen Mutter. Ich hatte nämlich die Tasche, in der ich meine Ration transportierte, am Abend vor unserer Abreise nach Sizilien nach einer heftigen Feier bei uns daheim im Garten verloren. Als ich morgens mit dickem Kopf aus dem Fenster schaute, stand meine Mutter dort mit der Tasche in der Hand und inspizierte ihren Inhalt. Leugnen war zwecklos, immerhin konnte ich noch glaubhaft versichern, das Haschisch nur für jemand anderen aufbewahrt zu haben, so dass meine Mutter nicht auch noch ihren zweiten Sohn an die Droge zu verlieren glaubte. Selbstverständlich bestand sie auf der sofortigen Vernichtung des Fundes und war auf dem besten Wege, alles in den Ofen im Garten zu stecken, um es zu verbrennen. Zum Glück konnte ich das gerade noch verhindern, indem ich ihr klarmachte, dass diese Art und Weise der Entsorgung mit Sicherheit eine Geruchsbelästigung in der ganzen Umgebung ergeben würde, die unangenehme Folgen nach sich ziehen konnte. Wir spülten es schließlich gemeinsam in der Toilette hinunter. Meine Mutter war beruhigt, ich fuhr nach Sizilien und kiffte ein wenig von dem Hasch meiner Freunde mit.
Unsere Abifahrt ging dann nach Kopenhagen, wo wir trotz des Verbotes durch unsere Lehrer nach Christiania fuhren, um dort unser Rauschmittel für den Abend zu besorgen. Christiania ist bis heute ein legendärer Kiez, in dem man Cannabis in allen Mengen und Sorten frei erwerben konnte, während die Obrigkeit wegschaute. Zurück im Hotel kochten wir dann einen Cannabistee und wurden kurze Zeit später »massiv breit«, wie wir es damals nannten.
Diese Form der sogenannten oralen Aufnahme von Cannabis wurde von uns häufiger als Alternative zum Rauchen genutzt. Man verarbeitet dabei Haschisch oder Marihuana in Lebensmitteln. Möglich sind sowohl Getränke wie Tee als auch feste Nahrungsmittel wie Kekse. THC ist zwar kaum wasser-, jedoch sehr gut fettlöslich, daher nimmt man fetthaltige Nahrungsmittel wie Butter oder Schokolade zum Auflösen des Ausgangsstoffes. Gerade auch für Nichtraucher ist dies eine wichtige Alternative zum klassischen Joint. Allerdings ist die Dosierung hierbei ein kleines Vabanquespiel, da die Wirkung des THC in dieser Verarbeitungsform deutlich später einsetzt als beim Rauchen. Als Faustregel kann man von einer halben Stunde bis zu einer Stunde nach dem Verzehr ausgehen. Gerade für ungeübte Konsumenten kann das durchaus zu Überdosierungen führen, die als überraschend bis unangenehm empfunden werden. Zudem hält die Wirkung deutlich länger an als beim Rauchen. Abhängig von der Dosierung kann der »Spaß« dann schon mal ziemlich lange dauern.
Unsere Truppe jedenfalls trieb sich nach dem Genuss des Tees im Kopenhagener Rotlichtviertel herum, und wir genossen es, das zu tun, was die meisten Menschen im Alter von 18, 19 oder 20 Jahren tun: Wir frönten mit Riesenspaß der Unvernunft. Diese bestand allerdings lediglich darin, von einer Hotdog-Bude zur nächsten zu laufen, um das ausgelöste Hungergefühl zu stillen.
Als Drogensüchtiger ist übrigens keiner der damals Beteiligten geendet. Jedoch hatten viele meiner Freunde Probleme mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft und den Gerichten. So kam es, als ich 21 Jahre alt war, zeitgleich zu etwa 200 Ermittlungsverfahren gegen junge Leute aus dem Meppener Raum. Einer der Kleindealer hatte bei der Polizei umfassend ausgesagt, um im Rahmen der seit Januar 1982 geltenden Kronzeugenregelung Strafmilderung zu erlangen. Das bedeutete nun für 200 Kleinkiffer, -dealer oder -besorger Strafverfahren. Monatelang hatten alle, mich eingeschlossen, Angst davor, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. In vielen Familien war der Haussegen über Monate gestört oder nachhaltig zerbrochen. Und das alles nur, weil die Gesellschaft verzweifelt versuchte, der vermeintlich hochgefährlichen Droge Cannabis Herr zu werden.
Trotz der Strafverfahren – einige erhielten tatsächlich sogar Haftstrafen ohne Bewährung – hörte niemand mit dem Kiffen auf, so dass sich die »furchtbare« Droge weiter verbreitete. Was letztlich blieb, war für viele der Eindruck, ungerecht behandelt worden zu sein. Damit verbunden ging auch ein gutes Stück Glauben an die staatliche Autorität verloren. Ich selbst wurde nicht denunziert, doch auch mein Respekt vor dem Staat war nachhaltig erschüttert. Das und die Inhaftierungen meines Bruders waren Beweggründe für mich, Jura zu studieren, um anschließend, so mein Plan, als Rechtsanwalt für Gerechtigkeit zu sorgen. Für den uns alle verfolgenden Staat zu arbeiten und Richter zu werden, lag für mich zu diesem Zeitpunkt außerhalb jeglicher Vorstellungskraft.
Fast alle damals Beteiligten ließen das Kiffen nicht sein, machten aber trotzdem gute Ausbildungen, studierten, haben heute ehrenwerte Berufe, sind engagiert und in der Gesellschaft anerkannt. Nur wenige kifften wirklich zu viel, so dass man von einem problematischen Konsumverhalten sprechen muss. Als Erwachsene ließen es manche von ihnen ganz, von einigen weiß ich, dass sie noch heute gelegentlich kiffen, ohne dadurch Schwierigkeiten in ihrer Lebensführung zu haben.
Kiffender Richter?
Und mein Umgang mit der Droge als Erwachsener? Natürlich ist das die Frage, die immer wieder aufkommt. Habe ich noch Cannabis konsumiert, nachdem ich mein Jurastudium aufgenommen hatte? Als Rechtsreferendar? Heute, als Jugendrichter? Sagen wir es so: Ich würde heute jedem THC-Test ganz ruhig entgegensehen.
Ganz so sicher war ich mir allerdings 1994 nicht, als ich mich nach Studium und Referendariat schließlich auf meine konkrete juristische Laufbahn vorbereitete und als Richter bewarb. Mein Referendariat hatte ich zum Teil in Bayern abgeleistet, und so musste ich einen verpflichtenden Teil des Vorlaufs zur Richterlaufbahn ebenfalls dort absolvieren: die medizinische Untersuchung beim Amtsarzt, verbunden mit einer Urinprobe zum Zwecke der Untersuchung auf Drogen. Die allerdings hatte ich bis zum Zeitpunkt der Bewerbung gar nicht auf dem Plan gehabt. Und so begann ich zu zittern und zu überlegen: Wann hast Du das letzte Mal gekifft?
Denn natürlich hatte ich nach dem Wechsel ins Studium, nach West-Berlin, dem scheinbaren Hort von Freiheit und Anarchie in den Achtzigerjahren, gar keine Chance, nicht mit Cannabis in Berührung zu kommen. Auch während des Studiums und der Referendarszeit war der eine oder andere Joint nicht an mir vorübergegangen. Allerdings bewegte sich mein Konsum immer auf einem sehr niedrigen Niveau. Meist griff ich nur dann zu Cannabis, wenn meine sich damals bereits latent vorhandenen Depressionsphasen manifestierten. Allein an meinem eigenen Umgang mit dem Cannabis lässt sich für meine Begriffe im Übrigen gut zeigen, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Droge sehr wohl möglich ist.
Doch all das half mir vor meiner ärztlichen Untersuchung auch nichts. Ich wusste wirklich nicht mehr, wann genau ich zum letzten Mal konsumiert hatte, was ich aber sehr wohl wusste, war, dass THC viele Monate später noch im Urin nachweisbar ist. Also begann ich darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten der Beeinflussung es für ein negatives Ergebnis geben könnte, und erinnerte mich daran, dass ich während meiner Studentenzeit mein Geld auch mit legalen Medikamententests verdient hatte. Ein Freund von mir war bei einem Institut dafür verantwortlich, Probanden zu besorgen, und tat dies unter anderem in seinem Freundeskreis, in dem fast alle kifften. Da diese Tests sehr gut bezahlt wurden, wollten alle diese Jobs. Allerdings musste auf die Einnahme von Cannabis verzichtet werden, um an diese gut dotierte Tätigkeit zu kommen, denn im Vorfeld der Tests wurde man mittels Urinkontrollen auch auf THC untersucht. Also hörten selbst die Dauerkiffer Wochen vor der Untersuchung mit dem Kiffen auf, und die wenigsten hatten Probleme damit, auf ihr Genussmittel zu verzichten. Da Cannabis noch sehr lange nach dem Konsum nachweisbar ist und sich im Körperfett ablagert, gab es zudem noch einen todsicheren Tipp: Vor der Untersuchung sollte man so viel Wasser wie nur möglich trinken, denn das würde zur Ausschwemmung der THC-Rückstände führen. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben niemals wieder so viel Wasser getrunken wie in den Wochen vor der Untersuchung. Ob es an dieser Methode gelegen hat oder nicht, werde ich wohl nie erfahren, auf jeden Fall ergab die amtsärztliche Untersuchung nichts Auffälliges und ich konnte Richter werden.
Und seither? Nun, es scheint eine Art inneres Gesetz für Richter zu geben, das einem sagt: Als Richter tut man das nicht, man ist ja schließlich Vorbild. Man fährt nicht zu schnell, man betrügt nicht bei der Steuer und hält sich an Gesetze, seien sie auch noch so dumm. Mit anderen Worten auf unser Thema bezogen: Man säuft, statt zu kiffen. Allerdings wäre ich nicht der, der ich bin, wenn ich mich so einfach mit der in dieser Hinsicht fragwürdigen Vorbildrolle abgefunden hätte.
Direkt nach meiner Vereidigung zum Richter saß ich im Auto und hatte diese für eine Richterkarriere gefährlichen Gedanken: »Wie hältst Du es künftig mit der Kifferei? Warum solltest Du es lassen, schließlich sind die besten Leute die, die Erfahrung mit dem haben, über das sie zu richten haben.« Ich wusste instinktiv, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte: Entweder ich mache heimlich weiter und hoffe, dass keiner was merkt, oder ich lasse es tatsächlich von heute auf morgen völlig bleiben.
Aus Angst vor Konsequenzen für meinen gerade angetretenen Job entschied ich mich dafür, künftig die Finger von Hasch und Marihuana zu lassen. Nebenbei bemerkt: Das ging problemlos, was auch ein Licht auf die Diskussion über das Abhängigkeitspotenzial von Cannabis wirft. Allerdings stellte ich fest, dass ich trotzdem ein Suchtmensch blieb. Zu diskutieren, was einen Menschen dazu macht, würde hier zu weit führen, allerdings glaube ich durchaus, dass meine lebenslange ständige Berührung mit dem Thema Sucht durch die Alkoholkrankheit meines Vaters und die Drogenkarriere meines Bruders schon eine Rolle spielten. Die Konsequenz war letztlich glasklar: Um meine Stellung nicht zu gefährden, ließ ich von der illegalen Droge ab und trank, wie als Jugendlicher, wieder mehr, konsumierte Drogen also nur noch auf die legale Weise. Mein Alkoholkonsum stieg dementsprechend an. Zwar schaffte ich es mit dem Wissen um das Schicksal meines Vaters im Hinterkopf immer, nicht in ein Trinkverhalten zu rutschen, das mir ernsthafte Probleme bereitet hätte, doch merkte ich irgendwann selbst, dass ich mit meinem Alkoholkonsum zum Teil auch den inneren Frust kompensierte, mit dem Kiffen aufgehört zu haben. Denn das Kiffen hatte für mich immer auch einen äußerst positiven Effekt: Ich trank keinen Alkohol mehr, rauchte keine Zigaretten, aß die Reste aus dem Kühlschrank und schlief bald darauf ein. Am Morgen danach hatte ich keinen dicken Kopf und sparte auch noch Geld. Für mich galt in diesem Sinne: Die Summe aller Laster blieb nicht gleich, sondern sie reduzierte sich sogar spürbar.
Letztlich wäre es dann eine Frage der Vernunft gewesen, zu entscheiden, weniger zu trinken und dafür doch lieber zumindest ab und zu einen Joint durchzuziehen. Ich war seit Beginn meiner Richtertätigkeit beruflich äußerst beansprucht, gerade durch die nach und nach immer größer werdende Welle an Verfahren im rechtsradikalen Milieu, die mich auch persönlich an die Grenzen meiner psychischen und körperlichen Belastbarkeit brachten. Dies und die privaten Schicksalsschläge führten dazu, dass ich ab Ende der Neunzigerjahre wieder verstärkt mit Depressionen zu kämpfen hatte, die mich bis heute nie wirklich losgelassen haben. Dagegen bekam ich Medikamente verschrieben, deren Beipackzettel über Inhaltsstoffe und Nebenwirkungen bisweilen dazu führten, dass sich mir die Nackenhaare aufstellten. Einmal mehr wurde mir klar, wie viel Gift in Form von Medikamenten jeder Mensch in Deutschland legal zu sich nehmen durfte, während ein vergleichsweise harmloser Stoff wie Cannabis zu einer hochgefährlichen Droge gemacht wurde. Allein in Deutschland geht man von 2,3 Millionen (!) Medikamentenabhängigen aus. 700.000 Kinder und Jugendliche erhalten regelmäßig hochdosierte Drogen (Medikamente) wie Concerta, Ritalin und Medikinet. 1,5 Millionen Menschen sind abhängig von Medikamenten mit Suchtpotenzial.
Ich hatte mich mittlerweile über Cannabis auch theoretisch so schlau gemacht, dass ich die Versprechen kannte, THC und Cannabinoide würden auch bei Depressionen Linderung verschaffen. Nun hätte ich mich eigentlich zum Selbstversuch entschließen müssen. Aus der Erfahrung meiner Jugend und Studentenzeit war ich mir absolut sicher, dass Cannabis mir helfen konnte. Jetzt aber war ich Richter, Jugendrichter noch dazu, außerdem Familienvater, verantwortlich also für sehr viele Menschen. Diese Überlegungen führten schließlich dazu, dass ich mich in letzter Konsequenz dann doch nicht zum Selbstversuch entschloss. Ich setzte also die mir verschriebenen Medikamente nicht ab und nutzte Cannabis auch nicht zur Eigentherapie. Schlechter wäre es dadurch auf jeden Fall nicht geworden. Die paar Joints, die ich gegebenenfalls geraucht hätte, hätten meiner Überzeugung nach sehr viel weniger negative gesundheitliche Begleiterscheinungen gehabt als die heftigen Chemiebomben, die mir verschrieben worden waren.