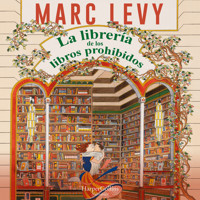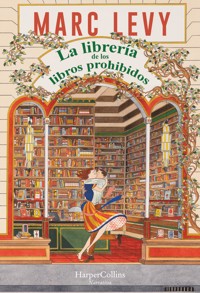9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einzigartiger Roman über die Kraft der Hoffnung, die Sehnsucht nach Freiheit und den Mut derer, die für den Frieden alles riskieren ...
»Wir kämpfen nicht, um zu sterben, sondern um zu leben.« Das ist die erste Lektion, die der achtzehnjährige Jeannot lernt, als er sich mit seinem Bruder während des Zweiten Weltkrieges der Résistance in Toulouse anschließt. Seite an Seite kämpfen sie mit mutigen jungen Frauen und Männern für den Frieden in Europa. Doch dann werden die Brüder während einer gefährlichen Aktion verhaftet und in ein berüchtigtes Gefängnis gebracht. Was ihnen bleibt, ist die Hoffnung, dass irgendwann eine Zukunft ohne Hass und Gewalt möglich sein wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Toulouse während des Zweiten Weltkriegs: Frankreich ist besiegt und von deutschen Truppen besetzt. Angst und Misstrauen beherrschen die Bevölkerung, die Résistance arbeitet mit allen Mitteln gegen die deutschen Besatzer, darunter auch Raymond und sein Bruder Claude. Als einer ihrer Freunde im Kampf schwer verletzt wird und im Sterben liegt, gibt Raymond ihm ein Versprechen: »Eines Tages musst du unsere Geschichte erzählen, sie darf nicht einfach so verschwinden wie ich.«
Jahre später, in Zeiten des Friedens, löst Raymond sein Versprechen ein …
Autor
Marc Levy wurde 1961 in Frankreich geboren. Nach seinem Studium in Paris lebte er in San Francisco. Mit siebenunddreißig Jahren schrieb er für seinen Sohn seinen ersten Roman, Solange du da bist, der von Steven Spielberg verfilmt und auf Anhieb ein Welterfolg wurde. Seitdem wird Marc Levy in zweiundvierzig Sprachen übersetzt, und jeder Roman ist ein internationaler Bestseller. Marc Levy lebt zurzeit mit seiner Familie in New York.
Von Marc Levy bei Blanvalet bereits erschienen:
Solange du da bist Am ersten Tag Die erste Nacht Wer Schatten küsst
MARC LEVY
Kinder der Hoffnung
ROMAN
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Bettina Runge
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die französische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Les enfants de la liberté« bei Editions Robert Laffont, S.A., Paris1. Auflage
Deutsche Taschenbuchneuausgabe Oktober 2018 bei Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Editions Robert Laffont, S.A. Paris, Susanna Lea Associates, Paris.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: bürosüd, München
Umschlagmotiv: The New York Historical Society/Archive Photos/Getty Images
KW · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-21166-0V001www.blanvalet.de
Ich liebe dieses Verb »widerstehen«.Dem widerstehen, was uns einengt,den Vorurteilen, den voreiligen Schlüssen, der Lust zu urteilen,all dem widerstehen, was schlecht ist in uns und nur darauf wartet, zum Ausdruck zu kommen,dem Bedürfnis aufzugeben, bedauert zu werden,zum Schaden anderer von sich zu sprechen,den Moden widerstehen, dem krankhaften Ehrgeiz,der allgemein herrschenden Verwirrung.Widerstehen und … lächeln.
Emma DANCOURT
Für meinen Vater,für seinen Bruder Claude,für alle Kinder der Hoffnung.Für meinen Sohnund für Dich, meine große Liebe.
Ich werde dich morgen lieben, denn heute kenne ich dich noch nicht. Ich bin die Treppe des alten Hauses, in dem ich wohnte, hinuntergegangen – ein wenig eilig, das muss ich gestehen. Im Erdgeschoss rochen meine Finger nach dem Bienenwachs, das die Concierge jeden Montag bis zum zweiten Stock und jeden Donnerstag bis zur letzten Etage auf den Handlauf des Geländers auftrug. Trotz des Sonnenlichts, das die Fassaden mit einem goldenen Schimmer überzog, war der Gehweg vom morgendlichen Regen noch wie marmoriert. Wenn man bedenkt, dass ich in diesem Moment noch nichts von dir wusste, von dir, die du mir eines Tages sicher das schönste Geschenk machen wirst, mit dem das Leben den Menschen beglücken kann.
Ich betrat das kleine Café an der Rue Saint-Paul, ich hatte Zeit. Zu dritt standen wir an der Theke und gehörten an diesem Frühlingsmorgen sicherlich zu den wenigen, die so viel Zeit hatten. Und dann, die Hände im Rücken verschränkt, kam mein Vater in seinem Gabardinemantel herein, stützte die Ellbogen auf den Tresen, so als hätte er mich nicht gesehen – eine für ihn typische taktvolle Haltung. Er bestellte einen Espresso, und ich konnte das Lächeln sehen, das er mehr schlecht als recht vor mir verbarg. Mit einem leichten Klopfen auf die Zinkplatte gab er mir zu verstehen, dass die Luft rein war, dass ich mich endlich nähern konnte. Als ich seinen Ärmel streifte, spürte ich seine Kraft und das Gewicht der Traurigkeit, die auf seinen Schultern lastete. Er fragte mich, ob ich immer noch »sicher« sei. Ich war mir über gar nichts sicher, aber ich nickte. Daraufhin schob er sehr diskret seine Tasse zu mir her. Unter dem Teller lag ein Fünfzig-Franc-Schein. Ich wollte ablehnen, doch er stieß leise zwischen den Zähnen hervor, wer Krieg führen wolle, dürfe keinen leeren Magen haben. Ich steckte den Schein ein, und sein Blick sagte mir, dass ich jetzt gehen solle. Ich rückte meine Schiebermütze zurecht, trat auf die Straße und entfernte mich.
Als ich am Fenster des Cafés vorüberging, sah ich meinen Vater an. Da bedeutete er mir mit einem letzten Lächeln, dass mein Kragen schief saß.
In seinen Augen lag etwas Dringliches, das ich erst viele Jahre später begriff. Und noch heute brauche ich die meinen nur zu schließen und an ihn zu denken, um diesen letzten Ausdruck deutlich vor mir sehen zu können. Ich weiß, dass mein Vater traurig über mein Fortgehen war, ich glaube auch, dass er ahnte, dass wir uns nicht wiedersehen würden. Nicht den eigenen Tod hatte er sich vorgestellt, sondern meinen.
Ich denke an diesen Moment im Café des Tourneurs zurück. Es musste einen Vater viel Kraft gekostet haben, in Gedanken seinen Sohn zu begraben, während er direkt neben ihm einen Zichorienkaffee trinkt, dabei zu schweigen und nicht zu sagen: »Du gehst jetzt auf der Stelle nach Hause und machst deine Schulaufgaben.«
Ein Jahr zuvor hatte meine Mutter unsere gelben Sterne auf dem Kommissariat abgeholt. Das war für uns das Zeichen zum Exodus, und wir brachen nach Toulouse auf. Mein Vater war Schneider, und niemals würde er dieses verdammte Ding auf ein Stück Stoff nähen.
An diesem 21. März 1943 – ich bin achtzehn Jahre alt – steige ich in eine Straßenbahn. Ich fahre zu einer Station, die auf keinem Plan verzeichnet ist: Ich werde mich einer Widerstandsgruppe anschließen.
Vor zehn Minuten hieß ich Raymond, doch an der Endhaltestelle der Linie 12, heiße ich Jeannot. Jeannot, mehr nicht. Zu dieser noch friedlichen Stunde des Tages haben viele meiner Leute keine Ahnung von dem, was ihnen widerfahren wird. Papa und Maman wissen nicht, dass man ihnen bald eine Nummer auf den Arm tätowieren wird, Maman ahnt nicht, dass man sie auf einem Bahnsteig von diesem Mann trennen wird, den sie fast mehr liebt als uns.
Und ich weiß nicht, dass ich in zehn Jahren am Denkmal von Auschwitz in einem etwa fünf Meter hohen Berg von Brillen das Gestell wiedererkennen werde, das mein Vater, als ich ihn zum letzten Mal im Café des Tourneurs gesehen hatte, in die Brusttasche seiner Jacke steckte. Mein kleiner Bruder Claude weiß nicht, dass ich ihn bald holen werde und dass, wenn er nicht Ja gesagt hätte und wir diese Jahre nicht gemeinsam durchgemacht hätten, keiner von uns überlebt hätte. Meine sieben Freunde – Jacques, Boris, Rosine, Ernest, François, Marius, Enzo – wissen nicht, dass sie sterben und dabei »Vive la France« rufen werden, fast alle mit einem ausländischen Akzent.
Ich weiß, dass meine Gedanken wirr sind, dass die Worte in meinem Kopf durcheinanderwirbeln, doch von diesem Montagmittag an wird mein Herz zwei Jahre lang in einem Rhythmus schlagen, den ihm die Angst vorgibt; zwei Jahre lang hatte ich Angst, und manchmal wache ich noch immer nachts mit diesem verdammten Gefühl auf. Doch jetzt schläfst du neben mir, meine Liebste, auch wenn ich das damals noch nicht wusste. Hier also ein Stück der Geschichte von Charles, Claude, Alonso, Catherine, Sophie, Rosine, Marc, Émile, Robert, meinen spanischen, italienischen, polnischen, ungarischen, rumänischen Freunden – den Kindern der Hoffnung.
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Du musst den Kontext verstehen, in dem wir lebten – der Kontext ist wichtig, zum Beispiel für einen Satz. Aus seinem Kontext herausgenommen, verändert sich oft der Sinn, und im Lauf der kommenden Jahre sollten viele Sätze aus ihrem Kontext gerissen werden, um parteiisch urteilen und leichter verurteilen zu können. Das ist eine Gewohnheit, die sich nicht so leicht ablegen lässt.
Während der ersten Septembertage hatten Hitlers Armeen Polen überfallen, Frankreich hatte Deutschland den Krieg erklärt, und niemand hier oder dort bezweifelte, dass unsere Truppen den Feind an den Grenzen zurückdrängen würden. Belgien war von den deutschen Panzerdivisionen überrollt worden, und innerhalb weniger Wochen starben Hunderttausende unserer Soldaten auf den Schlachtfeldern im Norden und an der Somme.
Marschall Pétain wurde zum Staatschef ernannt, woraufhin ein junger General, der sich nicht mit der Niederlage abfinden wollte, von London aus zum Widerstand aufrief. Pétain aber unterzeichnete lieber eine Verzichtserklärung, die all unsere Hoffnungen zunichtemachte. Wir hatten den Krieg so schnell verloren.
Indem er sich dem nationalsozialistischen Deutschland beugte, trieb Marschall Pétain Frankreich in eine der düstersten Perioden seiner Geschichte. Die Republik wurde zugunsten des sogenannten »État français« abgeschafft. Die Karte des Landes wurde durch eine horizontal verlaufende Linie in zwei Zonen unterteilt, in die nördliche, besetzte Zone und in die südliche, sogenannte freie Zone. Doch die Freiheit hier war relativ. Jeden Tag wurden neue Dekrete erlassen, mit denen die Rechte von zwei Millionen Ausländern – von Männern, Frauen, Kindern –, die in Frankreich lebten, immer mehr beschnitten wurden: das Recht, ihren Beruf auszuüben, die Schule zu besuchen, sich frei zu bewegen, und sehr bald auch das Recht, einfach nur zu existieren.
Dabei hatte die Nation vergessen, wie dringend sie diese Ausländer aus Polen, Rumänien und Ungarn, die Flüchtlinge aus Spanien und Italien damals gebraucht hatte. Man hatte ein ausgeblutetes Land, in dem eineinhalb Millionen Soldaten auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs gefallen waren, gut zwanzig Jahre zuvor wieder bevölkern müssen. Fast all meine Freunde waren Ausländer, und jeder hatte jahrelang unter dem Machtmissbrauch und den Repressalien in seiner Heimat zu leiden gehabt. Die deutschen Demokraten wussten, wer Hitler war, die spanischen Kämpfer im Bürgerkrieg kannten Francos Diktatur, die italienischen den Faschismus Mussolinis. Sie waren die ersten Zeugen all des Hasses gewesen, all der Intoleranz, dieser Pandemie, die Europa mit Tod und Elend verpestet hatte. Alle wussten bereits, dass die Niederlage nur ein Vorgeschmack war und das Schlimmste noch bevorstand. Aber wer mag schon den Überbringern schlechter Nachrichten zuhören? Jetzt brauchte Frankreich diese Immigranten nicht mehr. Deshalb wurden sie, die aus dem Osten und Süden gekommen waren, verhaftet und in Lager gesteckt.
Marschall Pétain hatte nicht nur aufgegeben, er sollte auch mit den europäischen Diktatoren paktieren. Und in unserem Land, das um diesen Greis herum vor sich hin zu dämmern begann, drängten sich bereits Minister, Präfekten, Richter, Gendarmen, Polizisten, Milizionäre, einer eifriger als der andere, um ihr schmutziges Gewerbe auszuüben.
Kapitel 2
Alles fing an wie ein Kinderspiel, vor drei Jahren, am 10. November 1940. Der triste Maréchal de France, umgeben von lorbeerbekränzten Präfekten, begann in Toulouse seine »Tour de France« durch die freie Zone eines Landes, das nach seiner Niederlage in Ketten lag.
Ein befremdliches Paradoxon, diese hilflosen Massen, entzückt beim Anblick des erhobenen Marschallstabs, Zepter eines Armeechefs a. D., der als Vertreter einer neuen Ordnung wieder an die Macht gekommen war. Die neue Ordnung Pétains aber würde die des Elends, der Segregation, der Denunziationen, Ausschlüsse, Morde und der Barbarei sein.
Unter denen, die bald unsere Brigade bilden sollten, kannten manche die Lager, in denen die französische Regierung all jene untergebracht hatte, die den Makel hatten, Ausländer, Juden oder Kommunisten zu sein. Und in diesen Lagern im Südwesten, ganz gleich ob in Gurs, Argelès, Noé oder Rivesaltes, war das Leben entsetzlich. Und, glaube mir, diejenigen, die Freunde oder Angehörigen dort wussten, empfanden den Aufstieg des Marschalls als Angriff gegen den winzigen Rest an Freiheit, der uns geblieben war.
Und da die Bevölkerung sich anschickte, ihm, diesem Marschall, zuzujubeln, mussten wir Sturm läuten, die Menschen aus dieser gefährlichen Angst reißen, die sie lähmte und dazu brachte, sich geschlagen zu geben und alles hinzunehmen, zu schweigen und die eigene Feigheit dadurch zu entschuldigen, dass der Nachbar es genauso macht, und wenn der Nachbar es genauso macht, dann musste es eben so gemacht werden.
Für Caussat, einen der besten Freunde meines kleinen Bruders, wie für Bertrand, Clouet oder Delacourt kommt es gar nicht infrage, sich geschlagen zu geben oder zu schweigen, und die triste Parade, die in den Straßen von Toulouse stattfinden soll, wird das Terrain für ein Meisterstück sein.
Heute geht es darum, dass Worte der Wahrheit, des Mutes und der Würde auf den Zug niederprasseln. Der Text klingt zwar unbeholfen, aber trotzdem beklagt er, was zu beklagen ist. Und was tut es da schon zur Sache, wie er letztlich formuliert ist? Bleibt noch zu überlegen, auf welche Weise die Flugblätter am besten verteilt werden können, ohne dass wir sofort von den Ordnungskräften festgenommen werden.
Doch die Freunde sind gut vorbereitet. Ein paar Stunden vor dem Umzug überqueren sie die Place Esquirol, die Arme schwer beladen mit Paketen. Die Polizei hat bereits Stellung bezogen, doch wer kümmert sich schon um diese so unschuldig wirkenden Jungen? Sie sind bereits am richtigen Ort, einem Gebäude Ecke Rue de Metz, angekommen. Alle vier schlüpfen durch die Eingangstür ins Treppenhaus, steigen hinauf zum Dachboden und hoffen, dort auf keine Wachposten zu stoßen. Doch die Luft ist rein, und die Stadt breitet sich zu ihren Füßen aus.
Caussat baut den Mechanismus zusammen, den seine Freunde und er gebastelt haben. Am Rand des Daches liegt ein kleines Brett auf einem Holzklotz, bereit, sich zu neigen wie eine Wippe. Auf die eine Seite legen sie den Stapel mit Flugblättern, die sie auf einer Schreibmaschine getippt haben, auf die andere einen mit Wasser gefüllten Kanister. Unten in den Behälter bohren sie ein kleines Loch, und das Wasser tropft in die Regenrinne, während sie schon wieder die Treppe hinunter auf die Straße laufen.
Der Wagen des Marschalls nähert sich, Caussat hebt den Kopf und lächelt. Die offene Limousine rollt langsam heran. Der Behälter auf dem Dach ist fast leer, er wiegt kaum noch etwas; da kippt das Brett, und die Blätter wirbeln hoch. Dieser 10. November 1940 ist der erste Herbsttag für den verräterischen Marschall. Sieh den Himmel an, die Blätter tanzen herab, und – Krönung des Ganzen für diese Straßenjungen, die allen Mut zusammengenommen haben – mehrere landen auf dem Mützenschirm von Marschall Pétain. Die Menschen bücken sich und heben die Flugblätter auf. Die Verwirrung ist perfekt, die Polizei läuft kreuz und quer herum, und diejenigen, die glauben, diese Jungs würden wie alle anderen dem Aufmarsch applaudieren, ahnen nicht, dass sie im Grunde ihren ersten Sieg feiern.
Sie zerstreuen sich, und jeder entfernt sich vom Ort des Geschehens. Als er an diesem Abend nach Hause kommt, kann Caussat nicht ahnen, dass er drei Tage später denunziert und verhaftet sein und zwei Jahre in den Kerkern der Zentrale in Nîmes verbringen wird. Delacourt weiß nicht, dass er in wenigen Monaten von der französischen Polizei in einer Kirche von Agen, in die er sich geflüchtet hat, zu Tode geprügelt wird. Clouet ahnt nicht, dass er in einem Jahr in Lyon erschossen wird. Und was Bertrand betrifft, so wird niemand das Fleckchen Erde finden, in dem er ruht. Als Caussat mit von Tuberkulose zerfressener Lunge das Gefängnis verlässt, schließt er sich dem Widerstand an. Nach seiner erneuten Verhaftung wird er deportiert. Er ist zweiundzwanzig Jahre alt, als er in Buchenwald stirbt.
Du siehst, für die Freunde hat alles wie ein Kinderspiel angefangen, ein Spiel von Kindern, die nicht die Zeit hatten, erwachsen zu werden.
Von ihnen muss ich dir erzählen, von Marcel Langer, Jan Gerhard, Jacques Insel, Charles Michalak, José Linarez Diaz, Stefan Barsony und von all jenen, die sich in den folgenden Monaten ihnen zugesellen werden. Sie nämlich sind die ersten Kinder der Hoffnung, diejenigen, die die 35. Brigade gegründet haben. Warum? Um Widerstand zu leisten! Es ist ihre Geschichte, um die es geht, nicht die meine, und verzeih mir, wenn mein Gedächtnis bisweilen versagt, wenn ich verwirrt bin oder die Namen verwechsle.
Was zählen die Namen, hat mein Kumpel Urman eines Tages gesagt, wir waren nur wenige, und im Grunde waren wir nur einer. Wir lebten in Angst, im Untergrund, wir wussten nicht, was der nächste Tag bringen würde, und es ist immer schwierig, die Erinnerung heute auf einen einzelnen dieser Tage zu konzentrieren.
Kapitel 3
Der Krieg war nie wie im Film, das kannst du mir glauben. Keiner meiner Kameraden hatte etwas von einem Robert Mitchum, und wenn Odette auch nur ansatzweise Beine wie Lauren Bacall gehabt hätte, dann hätte ich sicher versucht, sie zu küssen, statt vor dem Kino wie ein Idiot zu zögern. Zumal sie am nächsten Tag an der Ecke Rue des Acacias von zwei Nazis erschossen wurde. Seither habe ich etwas gegen Akazien.
Am schwierigsten war es, zum Widerstand zu kommen, so unvorstellbar das auch erscheinen mag.
Seit Caussat und seine Kameraden verschwunden waren, bliesen mein kleiner Bruder und ich Trübsal. Zwischen den antisemitischen Anspielungen des Geschichte- und Erdkundelehrers und den sarkastischen Äußerungen der Schüler des Philosophiekurses, mit denen wir uns im Gymnasium prügelten, war das Leben nicht lustig. Ich verbrachte meine Abende vor dem Radioapparat, um die englischen Nachrichten auf BBC zu hören. Nach den großen Ferien fanden wir auf unseren Bänken kleine Heftchen mit dem Titel »Combat« vor. Ich hatte den Jungen gesehen, der sich heimlich aus der Klasse stahl; es war ein elsässischer Flüchtling mit Namen Bergholtz. Ich bin ihm nachgerannt bis auf den Schulhof, um ihm zu sagen, dass ich es machen wolle wie er – Flugblätter verteilen für die Résistance, den französischen Widerstand. Er lachte zwar nur, aber trotzdem wurde ich sein Helfer. An den folgenden Tagen erwartete ich ihn nach Schulschluss auf dem Gehweg. Sobald ich ihn um die Ecke biegen sah, ging ich los, und er beschleunigte den Schritt, um mich einzuholen. Gemeinsam steckten wir gaullistische Flugblätter in die Briefkästen, manchmal warfen wir sie auch von der Straßenbahnplattform, bevor wir absprangen und das Weite suchten.
Eines Abends erschien Bergholtz nicht am Ausgang des Gymnasiums, am folgenden Tag auch nicht …
Von nun an nahm ich nach Schulschluss zusammen mit meinem Bruder Claude den Zug, der nach Moissac fuhr. Heimlich begaben wir uns zum »Manoir«, einem geräumigen Herrenhaus, in dem etwa dreißig Kinder von deportierten Eltern lebten. Pfadfinderinnen hatten sie aufgelesen und kümmerten sich um sie. Claude und ich gruben den Gemüsegarten um, und manchmal gaben wir den Jüngsten Nachhilfe in Rechnen und Französisch. An jedem dort verbrachten Tag flehte ich Josette, die Leiterin, an, mir einen Tipp zu geben, wie ich mich der Résistance anschließen könnte. Und jedes Mal sah sie mich an, verdrehte die Augen und tat so, als wüsste sie nicht, wovon ich sprach.
Eines Tages aber nahm mich Josette mit in ihr Büro.
»Ich glaube, ich hab da was für dich. Geh heute Nachmittag um zwei zur Rue Bayard, Nummer fünfundzwanzig. Ein Passant wird dich nach der Uhrzeit fragen. Du antwortest ihm, deine Uhr sei stehen geblieben. Wenn er dann erwidert: ›Sie sind nicht zufällig Jeannot?‹, dann ist es der Richtige.«
Und genauso hat es sich abgespielt …
Ich habe meinen kleinen Bruder mitgenommen, und vor der Nummer 25 der Rue Bayard in Toulouse sind wir Jacques begegnet.
Er trat in einem grauen Mantel mit Filzhut und einer Pfeife im Mundwinkel auf die Straße und warf seine Zeitung in den Papierkorb, der an einem Laternenpfahl befestigt war; ich nahm sie nicht heraus, weil dies nicht vereinbart war. Die Weisung lautete vielmehr zu warten, bis er mich nach der Uhrzeit fragte. Er blieb auf unserer Höhe stehen, musterte uns eindringlich, und als ich ihm antwortete, dass meine Uhr stehen geblieben sei, sagte er, er hieße Jacques und wollte wissen, wer von uns beiden Jeannot sei. Ich trat daraufhin einen Schritt auf ihn zu, weil ich ja Jeannot war.
Jacques rekrutierte die Partisanen selbst. Er vertraute niemandem, zu Recht. Ich weiß, es ist nicht sehr nett, das zu sagen, doch man muss es im Kontext sehen.
In diesem Augenblick wusste ich nicht, dass in wenigen Tagen ein Widerstandskämpfer namens Marcel Langer zum Tode verurteilt werden würde, weil ein Vertreter der Staatsanwaltschaft seinen Kopf gefordert und bekommen hatte.
Und niemand in Frankreich – egal, ob in der freien oder in der besetzten Zone – konnte ahnen, dass kein Gerichtshof es erneut wagen würde, den Kopf eines verhafteten Partisanen zu fordern, nachdem einer der unseren diesen Generalstaatsanwalt an einem Sonntag auf dem Weg zur Messe erschossen hatte.
Ich wusste auch nicht, dass ich einen Schweinehund umbringen würde, ein hohes Tier der Miliz – Denunziant und Mörder vieler junger Widerstandskämpfer. Besagter Milizionär hat nie erfahren, dass sein Leben an einem seidenen Faden hing. Ich hatte solche Angst davor abzudrücken, dass ich mir fast in die Hose gemacht und meine Waffe hätte fallen lassen. Und hätte dieser Dreckskerl nicht um Erbarmen gefleht, er, der mit niemandem Erbarmen gehabt hatte, so wäre ich nicht wütend genug gewesen, um ihn mit fünf Kugeln in den Bauch niederzustrecken.
Wir haben getötet. Ich habe Jahre gebraucht, um es auszusprechen. Das Gesicht desjenigen, auf den man zielt, vergisst man nie. Doch wir haben niemals einen Unschuldigen, nicht mal einen Dummkopf, erschossen. Ich weiß es, auch meine Kinder werden es wissen, und das allein zählt.
Jacques mustert mich, versucht, mich einzuschätzen, beschnuppert mich fast wie ein Tier, er verlässt sich auf seinen Instinkt. Dann baut er sich vor mir auf, und was er schließlich sagt, wird mein Leben auf den Kopf stellen.
»Was genau willst du?«
»Ich will nach London.«
»Dann kann ich leider nichts für dich tun. London ist weit, und ich habe keine Verbindung dorthin.«
Ich bin schon darauf gefasst, dass er sich abwendet und geht, doch Jacques bleibt vor mir stehen. Sein Blick ist weiterhin auf mich gerichtet, und ich wage einen zweiten Versuch.
»Können Sie mich mit den Maquisards, den Partisanen, bekannt machen? Ich möchte an ihrer Seite kämpfen.«
»Auch das ist nicht möglich«, erwidert Jacques und zündet erneut seine Pfeife an.
»Warum?«
»Weil du sagst, du willst kämpfen. Man kämpft nicht im Maquis. Bestenfalls überbringt man Päckchen oder Nachrichten, doch der Widerstand ist noch passiv. Wenn du kämpfen willst, dann mit uns.«
»Uns?«
»Bist du bereit, auf den Straßen zu kämpfen?«
»Was ich will, ist, einen Nazi töten, bevor ich selbst sterbe. Ich will einen Revolver.«
Das sage ich mit stolzer Miene. Jacques lacht auf. Ich verstehe nicht, was daran lustig sein soll, ich finde das eher dramatisch! Und genau das bringt Jacques zum Lachen.
»Du hast zu viele Bücher gelesen, man wird dir beibringen müssen, deinen Kopf zu benutzen.«
Seine herablassende Bemerkung kränkt mich ein wenig, doch das darf ich mir unter keinen Umständen anmerken lassen. Seit Monaten versuche ich, Kontakt zum Widerstand zu bekommen, und jetzt laufe ich Gefahr, alles zu verderben.
Ich suche nach den richtigen Worten, die ich aber nicht finde, nach einer Bemerkung, die beweist, dass ich einer bin, auf den man sich verlassen kann. Jacques ahnt, was in mir vorgeht, er lächelt, und plötzlich nehme ich in seinen Augen einen Anflug von Zärtlichkeit wahr.
»Wir kämpfen nicht, um zu sterben, sondern um zu leben, verstehst du?«
Dieser Satz scheint so dahingesagt, doch er trifft mich wie ein Schlag in die Magengrube. Das sind die ersten Worte der Hoffnung, die ich seit Kriegsbeginn höre, seit jenem Tag, da ich ohne Rechte, ohne Status, ohne Identität in diesem Land lebe, das gestern noch das meine war. Mein Vater fehlt mir, meine restliche Familie auch. Was ist geschehen? Alles ringsumher hat sich aufgelöst, man hat mir mein Leben gestohlen, nur deshalb, weil ich Jude bin, was für viele schon Grund genug ist, meinen Tod zu wünschen.
Hinter mir wartet mein kleiner Bruder. Er spürt, dass etwas sehr Wichtiges im Gange ist, und so hüstelt er, um daran zu erinnern, dass er auch noch da ist. Jacques legt mir eine Hand auf die Schulter.
»Komm, lass uns nicht hierbleiben. Eines der ersten Dinge, die du lernen musst, ist, nie lange an einem Ort zu verweilen, sonst verrät man sich. Ein Bursche, der in Zeiten wie diesen auf der Straße herumsteht, macht sich immer verdächtig.«
Und so laufen wir, Claude im Schlepptau, durch eine finstere Gasse.
»Ich habe vielleicht Arbeit für euch. Heute Abend schlaft ihr in der Rue du Ruisseau, Nummer fünfzehn bei Madame Dublanc. Ihr sagt ihr, dass ihr beide Studenten seid. Sicher fragt sie euch, was Jérôme widerfahren ist. Antwortet, dass ihr seinen Platz einnehmt, dass er zu seiner Familie im Norden aufgebrochen ist.«
Ich stelle mir eine Geheimtür vor mit Zugang zu einem Dach oder vielleicht sogar zu einem beheizten Zimmer. Und da ich meine Rolle sehr ernst nehme, frage ich, wer dieser Jérôme ist, um Bescheid zu wissen, für den Fall, dass diese Madame Dublanc mehr über ihre neuen Mieter erfahren will. Jacques bringt mich sogleich auf den Boden sehr unsanfter Tatsachen zurück.
»Er ist vorgestern gestorben, nur zwei Straßen von hier entfernt. Und wenn die Antwort auf meine Frage: ›Willst du direkten Kontakt zum Krieg bekommen?‹ noch immer Ja lautet, dann können wir sagen, dass du ihn ersetzt. Heute Abend wird jemand an deine Tür klopfen. Er wird dir mitteilen, dass Jacques ihn schickt.«
Bei seinem Akzent ist mir klar, dass »Jacques« nicht sein wirklicher Vorname ist, doch ich weiß auch, wer sich dem Widerstand anschließt, dessen Vorleben und Name existieren nicht mehr. Jacques steckt mir einen Umschlag zu.
»Solange du die Miete bezahlst, stellt Madame Dublanc keine Fragen. Lasst euch fotografieren, im Bahnhof steht ein Automat. Und jetzt verschwindet. Wir haben noch Gelegenheit, uns zu sprechen.«
Jacques setzt seinen Weg fort, und seine hochgewachsene Gestalt verschwindet im Sprühregen.
»Gehen wir?«, fragt Claude.
Ich bin mit meinem Bruder in ein Café gegangen, und wir haben nur etwas Warmes zu trinken bestellt. Von einem Tisch am Fenster aus sah ich die Straßenbahn vorbeifahren.
»Bist du sicher?«, fragte mich Claude und hob die dampfende Tasse zum Mund.
»Und du?«
»Ich bin nur sicher, dass ich sterben werde; alles andere weiß ich nicht.«
»Wenn wir uns dem Widerstand anschließen, dann, um zu leben, und nicht, um zu sterben. Verstehst du?«
»Woher hast du denn das?«
»Das hat Jacques vorhin zu mir gesagt.«
»Na, wenn Jacques es sagt …«
Daraufhin verfielen wir in ein langes Schweigen. Zwei Milizionäre traten ein und nahmen Platz, freilich ohne uns Beachtung zu schenken. Ich befürchtete schon, Claude könne eine Dummheit machen, doch er zuckte nur mit den Schultern. Sein Magen knurrte.
»Ich habe Hunger«, sagte er schließlich. »Ich halte diesen ewigen Hunger nicht mehr aus.«
Ich war beschämt, einen Jungen von siebzehn Jahren vor mir zu haben, der sich nicht satt essen konnte, beschämt wegen meiner eigenen Ohnmacht. Doch heute Abend würden wir uns vielleicht endlich dem Widerstand anschließen, und dann, da war ich ganz sicher, würde sich alles ändern. Eines Tages kehrt der Frühling zurück, hat Jacques einmal gesagt, und dann werde ich mit meinem kleinen Bruder in eine Konditorei gehen und ihm alles Gebäck der Welt kaufen, das er verschlingen wird, bis er nicht mehr kann, und dieser Frühlingstag wird der schönste meines Lebens sein.
Wir verließen das Lokal und machten uns nach einem kurzen Halt in der Bahnhofshalle auf den Weg zu der Adresse, die Jacques uns genannt hatte.
Madame Dublanc stellte keine Fragen. Sie meinte nur, Jérôme würde wohl keinen gesteigerten Wert auf seine Sachen legen, wenn er einfach so verschwände. Ich händigte ihr das Geld aus, und sie übergab mir den Schlüssel zu einem Zimmer im Erdgeschoss mit Blick auf die Straße.
»Es ist nur für eine Person!«, fügte sie hinzu.
Ich erklärte, Claude sei mein kleiner Bruder, der mich für einige Tage besuche. Ich denke, Madame Dublanc ahnte, dass wir keine Studenten waren, doch solange wir bezahlten, ging sie das Leben ihrer Mieter nichts an. Das Zimmer war nicht sehr einladend: ein altes Bett, ein Wasserkrug und eine Schüssel. Die Notdurft wurde in einem Schuppen am Ende des Gartens verrichtet.
Den Rest des Nachmittags warteten wir. Bei Einbruch der Dunkelheit klopfte es an der Tür. Nicht auf die Art, bei der man zusammenschreckte, nicht dieses entschlossene Hämmern der Miliz, wenn sie einen verhafteten, nur ein zweifaches Pochen an den Türstock. Claude öffnete. Émile trat ein, und ich wusste sofort, wir würden Freunde.
Émile war nicht sehr groß, und er konnte es nicht leiden, wenn jemand sagte, er sei klein. Seit einem Jahr lebte er jetzt schon im Untergrund, und alles an seiner Haltung zeigte, wie sehr er bereits dort verwurzelt war. Émile war ruhig und hatte ein sonderbares Lächeln, so als wäre für ihn nichts mehr von Bedeutung.
Mit zehn Jahren ist er aus Polen geflohen, weil man seine Familie dort verfolgte. Mit knapp fünfzehn, als er Hitlers Armeen durch Paris marschieren sah, wurde Émile klar, dass diejenigen, die ihn bereits in seinem Heimatland hatten umbringen wollen, bis hierher gekommen waren, um ihre schmutzige Arbeit zu vollenden. Seine Kinderaugen waren ihm geöffnet worden, ohne dass er sie jemals ganz wieder hatte schließen können. Vielleicht hatte er deshalb dieses sonderbare Lächeln; nein, Émile war nicht klein, er war nicht sehr groß, aber kräftig.
Es war seine Concierge, die Émile das Leben gerettet hat. Man muss sagen, dass es in diesem tristen Frankreich ein paar fantastische Zimmerwirtinnen gab, die Menschen mit anderen Augen sahen, und nicht akzeptierten, dass man anständige Leute umbrachte, nur weil sie eine andere Religion hatten. Frauen, die nicht vergessen hatten, dass Kinder – Ausländer oder nicht – heilig sind.
Émiles Vater hatte von der Präfektur den Brief erhalten, in dem er aufgefordert wurde, die gelben Sterne abzuholen, die, gut sichtbar, wie es hieß, in Brusthöhe an die Mäntel genäht werden mussten. Damals lebten Émile und seine Familie in Paris, in der Rue Sainte-Marthe, im zehnten Arrondissement. Émiles Vater war ins Kommissariat in der Avenue Vellefaux gegangen; er hatte vier Kinder, deshalb hatte man ihm vier Sterne gegeben, dazu einen für ihn selbst und einen für seine Frau. Émiles Vater hatte für die Sterne bezahlt und war mit gesenktem Kopf nach Hause zurückgekehrt, wie ein gebrandmarktes Tier. Kaum trug Émile seinen Stern, fingen die Razzien an. Wie sehr er sich auch auflehnte und seinen Vater anflehte, dieses üble Ding abreißen zu dürfen, es nützte alles nichts. Émiles Vater war ein Mann, der immer rechtschaffen gelebt hatte, und er hatte Vertrauen in dieses Land, das ihn aufgenommen hatte; hier konnte man ehrlichen Menschen nichts Schlimmes antun.
Émile hatte eine winzige Kammer unter den Dächern von Paris gefunden. Eines Tages, als er gerade die Treppe herunterkam, war ihm die Concierge nachgerannt.
»Geh schnell zurück, sie verhaften alle Juden in der Straße, überall sind Polizisten. Sie sind verrückt geworden. Émile, beeil dich, versteck dich oben.«
Sie sagte, er solle die Tür abschließen und niemandem antworten, sie würde ihm etwas zu essen bringen. Einige Tage später verließ Émile das Haus ohne Stern. Er kehrte in die Rue Sainte-Marthe zurück, doch in der Wohnung seiner Eltern war niemand mehr; weder sein Vater noch seine Mutter, weder seine beiden kleinen Schwestern noch sein Bruder, den er so inständig gebeten hatte, bei ihm zu bleiben und nicht mehr in die Wohnung in der Rue Sainte-Marthe zu gehen.
Émile hatte niemanden mehr, all seine Freunde waren verhaftet worden. Zwei von ihnen hatten an einer Demonstration an der Porte Saint-Martin teilgenommen und durch die Rue de Lancry fliehen können, als deutsche Soldaten auf Motorrädern mit Maschinenpistolen in die Menge schossen. Trotzdem waren sie später eingefangen und vor einer Mauer exekutiert worden. Ein bekannter Widerstandskämpfer mit Namen Fabien hatte am folgenden Tag Vergeltung geübt und auf dem Bahnsteig der Metrostation Barbès einen feindlichen Offizier erschlagen, doch dadurch waren Émiles Freunde auch nicht wieder lebendig geworden.
Nein, Émile hatte niemanden mehr, außer André, einem letzten Kameraden, mit dem er einen Buchhaltungskurs besucht hatte. Also hatte er ihn aufgesucht, um ihn um Unterstützung zu bitten. Andrés Mutter hatte ihm die Tür geöffnet. Und als Émile ihr erzählte, dass seine Familie verschleppt worden und er jetzt ganz allein sei, hatte sie ihm Andrés Geburtsurkunde gegeben und ihm geraten, so schnell wie möglich Paris zu verlassen. »Vielleicht erhalten Sie damit sogar einen Personalausweis.« Andrés Familienname war Berté, er war kein Jude, das Papier war ein Passierschein von unschätzbarem Wert.
Doch zunächst wartete Émile auf dem Bahnsteig der Gare d’ Austerlitz auf den Zug nach Toulouse. Dort hatte er einen Onkel. Er stieg ein und versteckte sich unter einer Sitzbank, ohne sich zu rühren. Die Fahrgäste in dem Abteil ahnten nicht, dass ein Junge, der um sein Leben bangte, hinter ihren Füßen kauerte.
Der Zug setzte sich in Bewegung, und Émile verharrte stundenlang reglos unter dem Sitz. Als die Grenze zur freien Zone passiert war, kam er unter der Bank hervorgekrochen. Die Reisenden machten große Augen, als sie ihn auftauchen sahen. Er gestand, dass er keine Papiere habe. Ein Mann sagte daraufhin, er solle sich sofort wieder verstecken, er würde die Strecke gut kennen, die Gendarmen kämen gleich zu einer zweiten Kontrollrunde. Er würde Bescheid geben, wann er herauskommen könne.
Siehst du, in diesem tristen Frankreich gab es nicht nur fantastische Concierges und Vermieterinnen, sondern auch großherzige Mütter und verständnisvolle Mitreisende, anonyme Menschen, die auf ihre Art Widerstand leisteten, anonyme Menschen, die sich weigerten, so zu handeln wie der Nachbar, die Regeln ignorierten, die sie für unwürdig erachteten.
*
In dieses Zimmer, das mir Madame Dublanc seit einigen Stunden vermietet hat, tritt also Émile mit seiner ganzen Geschichte, seiner ganzen Vergangenheit. Und auch wenn ich die Geschichte von Émile noch nicht kenne, spüre ich doch an seinem Blick, dass wir uns gut verstehen werden.
»Du bist also der Neue?«, fragt er.
»Wir sind das«, erwidert mein kleiner Bruder, der es satthat, dass jeder so tut, als wäre er nicht da.
»Habt ihr Fotos?«, will Émile wissen.
Er zieht zwei Personalausweise aus der Tasche, Lebensmittelkarten und einen Stempel. Als die Papiere fertig sind, steht er auf, dreht den Stuhl um und setzt sich rittlings darauf.
»Sprechen wir über deine erste Mission. Nun, da ihr zwei seid, sagen wir: über eure erste Mission.«
Mein Bruder hat glänzende Augen, und ich weiß nicht, ob es vom Hunger kommt, der seinen Magen ständig peinigt, oder von der Aussicht, endlich handeln zu dürfen. Auf jeden Fall sehe ich, dass seine Augen glänzen.
»Ihr müsst Fahrräder stehlen«, sagt Émile.
Mit finsterer Miene wendet sich Claude ab.
»Soll das der Widerstand sein? Fahrräder klauen? Hab ich diese ganze Reise gemacht, damit man mir aufträgt, ein Dieb zu werden?«
»Glaubst du etwa, du wirst deine Aktionen mit dem Auto erledigen? Der beste Freund des Widerstandskämpfers ist das Fahrrad. Denk zwei Minuten nach, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Niemand beachtet einen Mann auf einem Fahrrad; du bist nur einer, der von der Fabrik heimkommt oder hinfährt, je nach Uhrzeit. Ein Radfahrer geht in der Menge unter, er ist mobil, er schlängelt sich überall durch. Du erledigst deinen Auftrag, machst dich mit dem Rad aus dem Staub, und bis die Leute auch nur im Ansatz verstehen, was passiert ist, bist du schon am anderen Ende der Stadt. Wenn du also wichtige Missionen erledigen willst, dann klau dir erst mal ein Fahrrad.«
Die Lektion sitzt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo man am besten Räder klaut. Émile kommt meiner Frage zuvor. Er hat sich schon umgesehen und nennt uns einen Hauseingang, wo drei Fahrräder stehen, die nie angekettet sind. Wir müssen sofort handeln; wenn alles gut geht, sollen wir ihn am frühen Abend bei einem Freund treffen, dessen Adresse ich auswendig lernen muss. Das Haus befindet sich einige Kilometer entfernt in einem Vorort von Toulouse, ein kleiner stillgelegter Bahnhof im Loubers-Viertel. »Beeilt euch«, beharrt Émile, »ihr müsst vor Beginn der Sperrstunde dort sein.« Es ist Frühling, es wird erst in ein paar Stunden dunkel, und das Haus mit den Fahrrädern ist nicht weit entfernt. Émile geht, und mein kleiner Bruder macht ein langes Gesicht.
Schließlich gelingt es mir, Claude zu überzeugen, dass Émile nicht unrecht hat und dass es sicher eine Prüfung sein soll. Mein kleiner Bruder schimpft zwar, ist schließlich aber doch bereit, mir zu folgen.
Wir haben diese erste Aufgabe wunderbar gemeistert. Claude stand auf der Straße Schmiere, für Fahrraddiebstahl riskierte man immerhin zwei Jahre Gefängnis. Der Eingang war verlassen, und, wie Émile gesagt hatte, dort standen drei nicht angekettete Fahrräder.
Émile hatte mir empfohlen, die beiden ersten zu nehmen, doch das dritte, das direkt an der Wand, war ein Rennrad mit einem leuchtend roten Rahmen und einem Lenker mit Ledergriffen. Ich stellte das vordere Fahrrad zur Seite, das mit ohrenbetäubendem Lärm umfiel. Ich sah mich schon gezwungen, die Concierge zu knebeln, doch, Glück gehabt, sie war nicht da, und niemand störte mein Vorhaben. Das Fahrrad, das mir gefiel, war nicht leicht zu ergattern. Wenn man Angst hat, sind die Hände weniger geschickt. Die Pedale waren ineinander verhakt, und ich konnte sie nicht voneinander lösen. Mit endlosen Mühen und darauf konzentriert, mein Atmen zu kontrollieren, kam ich zum Ziel. Mein kleiner Bruder steckte die Nase zur Tür herein; ihm wurde die Wartezeit draußen zu lang.
»Was treibst du so lange, verdammt noch mal?«
»Komm, nimm dein Rad, statt zu meckern.«
»Und warum kriege ich nicht das rote?«
»Weil es zu groß für dich ist!«
Claude schimpfte weiter, und ich musste ihn darauf hinweisen, dass wir einen Auftrag zu erfüllen hätten und dass deshalb nicht der rechte Moment sei zu streiten. Er zuckte nur mit den Schultern und schwang sich auf seinen Sattel. Eine Viertelstunde später strampelten wir an den stillgelegten Gleisen vorbei, die zu dem kleinen Bahnhof von Loubers führten.
Émile öffnete uns die Tür.
»Sieh dir diese Fahrräder an, Émile!«
Émile schnitt eine komische Grimasse, als wäre er nicht gerade begeistert, uns zu sehen, dann ließ er uns eintreten. Jan, ein langer Kerl, betrachtete uns lächelnd. Auch Jacques war im Raum. Er beglückwünschte uns beide, und als er das rote Fahrrad entdeckte, das ich gewählt hatte, brach er in Lachen aus.
»Charles wird daran herumbasteln müssen, damit die Räder nicht wiederzuerkennen sind«, fügte er hinzu und lachte noch lauter.
Ich verstand nicht, was daran lustig sein sollte, Émile auch nicht, so wie er dreinblickte.
Ein Mann im Unterhemd kam die Treppe herunter. Er war der Bewohner dieses kleinen stillgelegten Bahnhofs, und ich traf zum ersten Mal auf den Handwerker der Brigade. Er war derjenige, der die Räder auseinander- und wieder zusammenbaute, der Bomben bastelte, um Lokomotiven in die Luft zu sprengen, der erklärte, wie man von einer Eisenbahnplattform aus Sabotageakte an Flugzeugen verüben konnte, die in den Werkhallen der Umgebung produziert wurden, oder wie man die Kabel an den Tragflächen deutscher Bomber durchschnitt, damit Hitlers Maschinen nicht so schnell starten konnten. Ich muss dir von Charles erzählen, diesem Freund, der während des Spanischen Bürgerkriegs alle Vorderzähne verloren und so viele Länder durchquert hatte, dass er die Sprachen vermischte und einen eigenen Dialekt erfunden hatte, sodass ihn am Ende niemand mehr richtig verstand. Ich muss dir von ihm erzählen, denn ohne ihn hätten wir niemals das zustande bringen können, was wir in den nächsten Monaten ausgeführt haben.
Wir alle, die wir uns an diesem Abend im Erdgeschoss eines stillgelegten Bahnhofs versammelt haben, sind zwischen siebzehn und zwanzig Jahre alt und wollen bald Krieg führen. Und trotz seines Lachanfalls vorhin, als er mein rotes Fahrrad sah, scheint Jacques besorgt. Ich sollte bald verstehen, warum.
Es klopft an der Tür, und diesmal tritt Catherine ein. Sie ist bildhübsch, und bei dem Blick, den sie mit Jan wechselt, könnte ich schwören, dass sie zusammen sind, doch das ist unmöglich. Regel Nummer eins: keine Liebesgeschichten in der Résistance, erklärt uns Jan später beim Essen zum Thema »Verhalten des Widerstandskämpfers«. Das ist viel zu riskant, denn im Fall einer Verhaftung läuft man Gefahr zu reden, um die geliebte Person zu retten. »Grundvoraussetzung für einen Widerstandskämpfer ist es, sich nicht zu binden«, sagt Jan. Und doch bindet er sich an jeden von uns, das ahne ich. Mein kleiner Bruder hört überhaupt nicht zu, er verschlingt das Omelett von Charles; mehrmals sage ich mir, wenn er nicht aufhört, wird er am Ende auch noch die Gabel essen. Ich sehe, wie er nach der Pfanne schielt. Charles sieht es auch, er lächelt, erhebt sich und gibt ihm noch mehr zu essen. Es stimmt, Charles’ Omelett ist köstlich, und das umso mehr, als unsere Mägen schon so lange leer sind.
Hinter dem Bahnhof hat Charles einen Gemüsegarten angelegt, er hat drei Hühner und sogar Kaninchen. Charles ist Gärtner, das ist jedenfalls sein Tarnberuf, und die Leute aus der Umgebung mögen ihn, obwohl er einen schrecklichen Akzent hat. Er schenkt ihnen Salat. Außerdem ist sein Gemüsegarten ein Farbfleck in diesem tristen Viertel. Deshalb mögen die Leute ihn, diesen improvisierenden Meister der Farbgebung, auch wenn er einen schrecklichen Akzent hat.
Jan spricht mit gesetzter Stimme. Er ist kaum älter als ich, wirkt aber schon wie ein reifer Mann, und seine ruhige Art flößt Respekt ein. Wir lauschen ihm fasziniert, ihn umgibt so etwas wie eine Aura. Jans Worte sind erschütternd, als er uns von den Missionen Marcel Langers und der ersten Mitglieder der Brigade erzählt. Bereits ein Jahr operieren Marcel, Jan, Charles und José Linarez in der Region von Toulouse. Zwölf Monate, im Laufe derer sie Granaten mitten in ein Bankett mit nationalsozialistischen Offizieren geworfen, einen Lastkahn voll Benzin in Brand gesetzt und eine Werkstatt mit deutschen Lastwagen angezündet haben. So viele Aktionen, die an einem einzigen Abend gar nicht alle aufgezählt werden können. Jans Worte sind erschütternd, und doch geht von ihm eine Art Zärtlichkeit aus, die uns allen hier fehlt, uns, den verlassenen Kindern.
Jan ist verstummt. Catherine kommt mit Neuigkeiten von Marcel, dem Brigadechef, aus der Stadt zurück. Er ist festgenommen und ins Gefängnis Saint-Michel gebracht worden.
Die Umstände der Verhaftung waren lächerlich. Er fuhr nach Saint-Agne, um von einem jungen Mädchen der Brigade einen Koffer in Empfang zu nehmen. Der enthielt Sprengstoff, Dynamitstäbe von fünfundzwanzig Millimeter Durchmesser. Sympathisierende spanische Minenarbeiter, die in den Steinbrüchen von Paulilles arbeiteten, hatten diese Sechzig-Gramm-Stäbe heimlich abgezweigt.
José Linarez hatte die Übergabe organisiert und es strikt abgelehnt, dass Marcel in den kleinen Zug stieg, der zwischen den Pyrenäen-Städten hin und her pendelte. Das junge Mädchen und ein spanischer Freund waren allein nach Luchon gefahren, um das Paket abzuholen. Die Übergabe sollte in Saint-Agne stattfinden. Die Haltestelle von Saint-Agne war eher ein beschrankter Bahnübergang als ein Bahnhof im eigentlichen Sinn. Diese ländliche Gegend war dünn besiedelt; Marcel wartete hinter der Sperre. Zwei Gendarmen machten ihre Runde auf der Suche nach Reisenden, die eventuell Lebensmittel für den regionalen Schwarzmarkt bei sich hatten. Als das junge Mädchen ausstieg, traf ihr Blick auf den eines der Gendarmen. Da sie sich beobachtet fühlte, wich sie einen Schritt zurück und weckte somit das Interesse des Mannes. Marcel war auf der Stelle klar, dass sie kontrolliert werden würde, und er ging ihr deshalb entgegen. Er machte ihr ein Zeichen, sich der Sperre zu nähern, nahm ihr den Koffer ab und befahl ihr zu verschwinden. Dem Gendarm war nichts von der Szene entgangen, und er stürzte auf Marcel zu. Auf die Frage, was der Koffer enthielt, erwiderte Marcel, er hätte keinen Schlüssel. Als der Gendarm ihn aufforderte, ihm zu folgen, sagte Marcel, es sei ein Gepäckstück für die Résistance. Er hoffte dabei wohl, auf Wohlwollen zu stoßen.
Der Beamte glaubte ihm nicht, und so wurde er zum Hauptkommissariat geführt. Im Bericht wurde festgehalten, dass ein Terrorist im Besitz von sechzig Dynamitstäben am Bahnhof von Saint-Agne verhaftet worden sei.
Die Angelegenheit war von einiger Brisanz. Ein Kommissar mit Namen Caussié übernahm den Fall, und Marcel wurde tagelang geschlagen. Er gab jedoch nichts preis, nicht einmal eine Adresse. Gewissenhaft, wie er war, begab sich Caussié nach Lyon, um sich mit seinen Vorgesetzten zu besprechen. Die französische Polizei und die Gestapo konnten endlich einen exemplarischen Fall vorweisen: ein Ausländer im Besitz von Sprengstoff, obendrein Jude und Kommunist. Sozusagen ein perfekter Terrorist und willkommenes Beispiel, dessen sie sich bedienen würden, um der Bevölkerung jede Lust am Widerstand auszutreiben.
Nach der Anklageerhebung war Marcel der Sectionspéciale, dem Sondergericht von Toulouse, überantwortet worden. Der Generalstaatsanwalt Lespinasse, ein Mann der extremen Rechten, Kommunistenhasser und Anhänger des Vichy-Regimes war der ideale Staatsanwalt, und die Regierung des Marschalls konnte auf seine Loyalität zählen. Er würde das Gesetz gnadenlos, ohne mildernde Umstände, ohne Rücksicht auf den Kontext anwenden. Kaum in seinem Amt bestätigt, schwor Lespinasse voller Stolz, vor Gericht die Todesstrafe durchzusetzen.
In der Zwischenzeit hatte das junge Mädchen, das der Verhaftung knapp entgangen war, die Brigade informiert. Die Genossen nahmen sogleich Kontakt mit Maître Arnal auf, dem Präsidenten der Anwaltskammer, einem der besten Anwälte. Für ihn war Deutschland der Feind, und somit war der Moment gekommen, Stellung zugunsten dieser Menschen zu beziehen, die grundlos verfolgt wurden. Die Brigade hatte Marcel verloren, doch sie hatte stattdessen einen Mann gewonnen, der Einfluss und Respekt in der Stadt genoss. Als Catherine über sein Honorar sprechen wollte, weigerte sich Arnal, überhaupt eines anzunehmen.
Den Partisanen bleibt der Morgen des 11. Juni 1943 in schrecklicher Erinnerung. Jeder führt sein Leben, und bald werden die Schicksale sich kreuzen. Marcel ist in seiner Zelle und sieht durch das vergitterte Fenster den Morgen grauen. Heute wird das Gericht das Urteil über ihn sprechen. Er weiß, man wird ihn zum Tode verurteilen, er hat keine Hoffnung mehr. In einer Wohnung, nicht weit entfernt, ordnet der alte Anwalt, der ihn verteidigt, seine Notizen. Seine Haushälterin betritt sein Arbeitszimmer und fragt, ob sie ihm ein Frühstück bereiten solle. Doch Maître Arnal hat keinen Hunger an diesem Morgen des 11. Juni 1943. Die ganze Nacht über hat er gehört, wie der Staatsanwalt den Kopf seines Mandanten fordert. Die ganze Nacht hat er sich in seinem Bett hin und her gewälzt und nach schlagkräftigen Argumenten gesucht, nach treffenden Worten, die das Plädoyer seines Gegners, des Generalstaatsanwalts, entkräften würden.
Und während Maître Arnal seine Unterlagen immer wieder durchgeht, betritt der gefürchtete Lespinasse das Esszimmer seines stattlichen Hauses.
In seiner Zelle trinkt Marcel das warme Getränk, das der Aufseher ihm bringt. Soeben hat ihm ein Amtsdiener die Vorladung vor das Sondergericht im Justizpalast von Toulouse ausgehändigt. Marcel schaut durch das vergitterte Fenster, der Himmel ist etwas heller als zuvor. Er denkt an seine kleine Tochter, seine Frau irgendwo in Spanien, jenseits der Pyrenäen.
Die Frau von Lespinasse erhebt sich und küsst ihren Mann auf die Wange, sie macht sich auf den Weg zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Der Generalstaatsanwalt streift seinen Gehrock über, betrachtet sich im Spiegel, stolz auf sein elegantes Äußeres und sicher zu gewinnen. Ein schwarzer Citroën wartet vor seinem Haus und fährt ihn zum Justizpalast.
Am anderen Ende der Stadt wählt ein Gendarm aus dem Wandschrank sein schönstes Oberhemd – weiß mit gestärktem Kragen. Er war es, der den Beschuldigten festgenommen hat, weshalb er jetzt zum Prozess vorgeladen ist. Während er seine Krawatte bindet, hat der junge Gendarm Cabannac feuchte Hände. Was da abläuft, ist nicht in Ordnung, hat einen üblen Beigeschmack, das weiß Cabannac. Und übrigens – wäre er noch einmal in derselben Lage, so würde er diesen Burschen mit dem schwarzen Koffer laufen lassen. Die Feinde, das sind die Boches