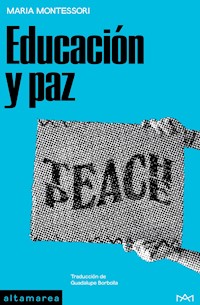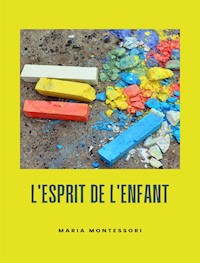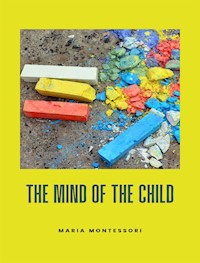19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Das Hauptwerk Maria Montessoris neu herausgegeben Maria Montessori bereitete der Pädagogik der Moderne die Bahn. In ihrem wichtigsten Buch plädiert sie für eine Pädagogik des freien Lernens und für die Offenheit der Eltern und Erzieher, jedes einzelne Kind in seiner individuellen Entwicklung zu fördern. Bis heute bietet dieser Klassiker der Bildungsgeschichte gültige Einsichten in die Grundlagen freiheitlicher Pädagogik und zeigt Wege zu einer besseren Erziehung und Bildung auf. Wie können Kinder ihr Potential am besten entfalten? Wie gelingt ein angstfreies, freudvolles und freies Lernen? Welche Lernatmosphäre und welche Umgebung lassen Heranwachsende zu konzentriert lernenden und aufmerksamen jungen Menschen werden? Die italienische Ärztin, Philosophin, und Pädagogin Maria Montessori entwickelte schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihrem zentralen Buch über das Geheimnis der Kindheit wegweisende Vorschläge für ein autodidaktisches Lernen. Ihre Erkenntnisse sind noch heute von Belang. Schon früh erkannte die Reformerin, was sie in eindringlichen Worten zu formulieren verstand: Erst durch die fördernde Begleitung einfühlsamer Eltern oder Erzieher wird Kindern eine Entwicklung in Freiheit ermöglicht. Montessori zeigt auf, wie erfüllend es ist, ein unbedingtes Vertrauen in das Heranwachsen sich frei entfaltender Kinder zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MARIA MONTESSORI
KINDER SIND ANDERS
Vom selbständigen Lernen
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Jürgen Overhoff
Aus dem Italienischen von Percy Eckstein und Ulrich Weber
KLETT-COTTA
Impressum
Die Übersetzung dieses Buches aus dem Italienischen wurde im Auftrag der Erben der Verfasserin bearbeitet von Helene Helming.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Il segreto dell’infanzia« bei Garzanti, Mailand, 1950
Für die deutsche Ausgabe
© 1952/2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Julia Forsman / Stocksy
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98821-5
E-Book ISBN 978-3-608-12369-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Frauenrechtlerin, Ärztin und Reformpädagogin – Die Weltkarriere der Maria Montessori
Die natürlichen Anlagen des Menschen. Zwischen Determinismus und Handlungsfreiheit
Umwelt und Spielmaterialien des Kindes
»Hilf mir, es allein zu tun« – Selbständiges Lernen, Individualität und Konzentration
Jenseits von Strafen und Belohnungen – Die intrinsische Motivation
Disziplin und Korrektur
Das Kind als Messias, Lehrmeister und Vater des Menschen
Die Kindheit als Geheimnis, Rätsel und Phase der Abgeschiedenheit
Über die Würde des Kindes und seine Rechte
Maria Montessoris bleibende Bedeutung
Maria Montessori
Kinder sind anders.
Einleitung
Kindererziehung als soziale Frage
Erster Teil
1. Kapitel
Das Zeitalter des Kindes
Die Psychoanalyse und das Kind
Das Geheimnis des Kindes
2. Kapitel
Der Erwachsene als Angeklagter
3. Kapitel
Biologisches Zwischenspiel
4. Kapitel
Das Neugeborene
5. Kapitel
Die natürlichen Instinkte
6. Kapitel
Der geistige Embryo
7. Kapitel
Der Aufbau der kindlichen Seele
Die sensiblen Perioden
Einsicht in das Wirken der sensiblen Perioden
Beobachtungen und Beispiele
8. Kapitel
Der Ordnungssinn
Die innere Ordnung
9. Kapitel
Die Intelligenz
10. Kapitel
Die Kämpfe auf dem Weg des Wachstums – Schlafen
11. Kapitel
Das Gehen
12. Kapitel
Die Hand
Elementare Handlungen
13. Kapitel
Der Rhythmus
14. Kapitel
Die Substitution der Persönlichkeit
Die Liebe zur Umwelt
15. Kapitel
Die Bewegung
16. Kapitel
Die Verständnislosigkeit
17. Kapitel
Die Schaukraft der Liebe
Zweiter Teil
18. Kapitel
Die Erziehung des Kindes
Die Ursprünge unserer Methode
19. Kapitel
Die Wiederholung der Übungen
20. Kapitel
Die freie Wahl
21. Kapitel
Die Spielsachen
22. Kapitel
Belohnungen und Strafen
23. Kapitel
Die Stille
24. Kapitel
Die Würde
25. Kapitel
Die Disziplin
26. Kapitel
Der Beginn des Unterrichts
27. Kapitel
Körperliche Parallelentwicklungen
28. Kapitel
Folgerungen
29. Kapitel
Kinder aus bevorzugten Gesellschaftsschichten
30. Kapitel
Die innere Vorbereitung des Lehrers
31. Kapitel
Abwegigkeiten
32. Kapitel
Fluchterscheinungen
33. Kapitel
Hemmungen
34. Kapitel
Heilungen
35. Kapitel
Die Abhängigen
36. Kapitel
Der Besitztrieb
37. Kapitel
Die Begierde nach Macht
38. Kapitel
Der Minderwertigkeitskomplex
39. Kapitel
Die Angst
40. Kapitel
Die Lüge
41. Kapitel
Seelenleben und Körper
Dritter Teil
42. Kapitel
Der Kampf zwischen Kind und Erwachsenem
43. Kapitel
Der Arbeitsinstinkt
44. Kapitel
Die beiden Arbeitsarten
Die Arbeit des Erwachsenen
Die Arbeit des Kindes
Vergleich zwischen den beiden Arbeitsarten
45. Kapitel
Die Leitinstinkte
46. Kapitel
Das Kind – unser Lehrmeister
47. Kapitel
Die Aufgabe der Eltern
48. Kapitel
Die Rechte des Kindes
Ecce Homo!
Anmerkungen
EINLEITUNG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. KAPITEL
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
20. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
32. Kapitel
36. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
Editorische Notiz
Literaturverzeichnis
Register
Vorwort
Von Jürgen Overhoff
Montessori(1) fordert zum Widerspruch heraus: »Wer meine Erziehungsbewegung verfolgt hat, weiß, dass sie stets umstritten war und es noch heute ist«
Die italienische Ärztin und Reformpädagogin Maria(2) Montessori, die 1870 in der Nähe von Ancona(1) an der Adriaküste geboren wurde, in Rom(1) Karriere machte und nach längeren Aufenthalten in den USA(1), Spanien(1) und Indien(1) ihren Lebensabend in den Niederlanden verbrachte, wo sie 1952 in Noordwijk(1) aan Zee starb und auch begraben wurde, polarisiert bis auf den heutigen Tag und erregt noch immer die Gemüter. An ihrer Person und ihrer Erziehungslehre, die beide international über einen außergewöhnlich hohen Bekanntheitsgrad verfügen, scheiden sich weltweit die Geister. Von den einen wird ihre Pädagogik, die das selbständige Lernen(1) des Kindes und dessen stets zu respektierende Individualität(1) ins Zentrum stellt, als befreiender Wurf gepriesen, mit dem die willensstarke Italienerin zu Beginn des 20. Jahrhunderts alle unnötig gängelnden, einengenden, strafenden und mit Vorgaben überfrachteten Erziehungsmodelle der älteren Zeit zurückwies. Demzufolge gilt sie als Pionierin einer modernen, zugewandten, kinderfreundlichen Erziehung, die der freien Entfaltung der Persönlichkeit(1) endlich den nötigen Raum gibt. Ihre Kritiker hingegen halten ihr dessen ungeachtet in aller Schärfe vor, dass sie sich zumindest zeitweilig an einem biologistisch-deterministischen(1), von eugenischen(1) Vorstellungen durchtränkten und in Teilen auch rassistischen Menschenbild orientierte. Dabei habe sie sich allzu bereitwillig dem faschistischen Regime des Diktators Benito Mussolini(1) angedient und in diesem Zuge auch ihre eigene Person – mit einem außerordentlich großen Geschick zur Selbstvermarktung – überhöht und stilisiert, zu einer geradezu prophetengleichen Gestalt, die aber eigentlich nur daran interessiert gewesen sei, aus ihrer großen Popularität maximalen finanziellen Gewinn zu schlagen.
Wie immer man die unterschiedlichen Ansichten der begeisterten Anhänger und erbitterten Gegner Montessoris einschätzen und beurteilen mag – und es lassen sich jeweils stichhaltige Gründe anführen, die sowohl der einen als auch der anderen Seite Recht geben –, so ist doch in jedem Fall eines ganz klar: Den Streit um die pädagogischen Meinungen und Praktiken der Montessori(3), den schon ihre Zeitgenossen seit dem ersten Moment ihres öffentlichen und überaus wirkungsvollen Auftretens austrugen, kalkulierte die italienische Reformpädagogin ihrerseits sehr selbstbewusst ein. Als sie in ihrem siebten Lebensjahrzehnt, also im schon weit fortgeschrittenen Alter, im 1938 in der Schweiz(1) publizierten Buch »Il segreto dell’infanzia« – das zwei Jahre zuvor schon in Frankreich(1) und in den USA(2) vorab in französischer und englischer Übersetzung erschienen war und dann in ihrem Sterbejahr auch erstmals auf Deutsch veröffentlicht wurde – einen Rückblick auf ihre ganz erstaunliche internationale Laufbahn wagte, schrieb sie in dem besonders wichtigen Kapitel »Die Erziehung des Kindes« nicht ohne Stolz: »Wer [meine] Erziehungsbewegung verfolgt hat, weiß, dass sie stets umstritten war und es noch heute ist.«
Montessori(4) war streitlustig. Zeitlebens brauchte sie die elektrisierende Spannung einer kämpferisch geführten Auseinandersetzung, die sie deshalb suchte, weil sie ihr ein Ansporn zur höchsten Produktivität war und auch zum Beweis der eigenen Stärke diente. Jeder Streit mit ihren Gegnern bot ihr gleichsam einen willkommenen Anlass zur Selbstbehauptung. Selbst ihre engsten Weggefährten blieben von ihrem explosiven Naturell nicht verschont und attestierten der Pädagogin daher übereinstimmend einen schwierigen Charakter. Auch Freunden und der Familie gegenüber gab sie sich häufig barsch und unwirsch, sie war oftmals regelrecht herrisch. Und doch war sie genauso in der Lage, ein von ihr zu schroff behandeltes Gegenüber spontan(1) um Verzeihung zu bitten oder eine ihrer üblen Launen(1) durch ein plötzliches Gelächter oder eine zärtliche Gefühlsaufwallung augenblicklich in Heiterkeit und Freundlichkeit umzuwandeln. Vertreter der unterschiedlichsten politischen Richtungen und Parteien (ob Sozialisten, Liberale oder Monarchisten), der katholischen Kirche oder auch der akademischen Wissenschaft, mit denen sie sich einließ – und sie war, um ihre Ziele zu verfolgen, in einer nahezu hemmungslosen Weise opportunistisch –, wussten nicht minder um ihre anstrengende Seite. Als Streitende war sie durchaus gefürchtet.
Als streitbare Person war Montessori(5) aber auch geachtet. Sogar viele ihrer Kritiker, die ihre Pädagogik entweder als zu radikal, zu deterministisch(2) oder auch als eine die Kindheit in falscher Weise verklärende Erziehungslehre schalten, mussten doch immerhin anerkennen, dass die Italienerin seit ihrem ersten Auftreten als Reformerin – die sich erstaunlich rasch globale Aufmerksamkeit verschaffte – durch ihren kämpferischen Einsatz für pädagogische Innovationen den Blick der Erwachsenen auf die Kinder weltweit, dauerhaft und spürbar veränderte. Denn sie popularisierte neue Formen des freien und auf autonome Lernerfahrungen zielenden Unterrichts, ohne die das moderne Nachdenken über die Grundlagen der Erziehung und die konkrete Ausgestaltung einer modernen pädagogischen Praxis nicht denkbar ist.
Auch wenn es paradox klingt: Als Streitende wollte Montessori(6) mit ihrem pädagogischen Angebot zum dauerhaften Frieden(1) in der Welt beitragen, dessen Fundament in ihren Augen nur ein rundum erneuertes, deutlich verbessertes und somit erst wirklich angemessenes Verhältnis von Eltern und Erziehern zu den ihnen anvertrauten Kindern sein konnte. Von daher ist es verständlich und wenig überraschend, dass sie in ihren letzten drei Lebensjahren immer wieder, Jahr um Jahr, für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, der ihr dann allerdings wohl deshalb nicht zugesprochen wurde, weil sie sich – ganz ohne Frage – viel zu spät von der Diktatur Mussolinis(2) gelöst und allzu lange mit den Behörden im faschistischen Italien(1) kollaboriert hatte.
Wer sich ein eigenes Bild von der schwierigen, umstrittenen und auch an inneren Widersprüchen reichen Persönlichkeit der Maria(7) Montessori machen möchte, muss die wichtigsten Stationen ihrer Lebensgeschichte zur Kenntnis nehmen und nachvollziehen, welche Positionen sie wann und warum bezog, welche Wandlungen sie durchmachte und wie sie selbst ihre eigene Biographie als über achtzigjährige Frau resümierend deutete. Und wer sich dann noch ein abgewogenes Urteil sowohl über die Irrtümer als auch über die befreienden Perspektiven ihrer Pädagogik erlauben will, ist gut beraten, ihre bereits erwähnte Schrift »Il segreto dell’infanzia«, die man aus guten Gründen als die beste und kompakteste Zusammenfassung ihrer Erziehungslehre bezeichnen kann, aufmerksam und mit aller nötigen Sorgfalt zu lesen.
Die bewährte deutsche Übersetzung dieses Buches, die von Percy Eckstein(1) und Ulrich Weber(1) erstellt wurde, erschien erstmals im Jahr 1952 unter dem Titel »Kinder sind anders« im Verlag von Ernst Klett(1). Diese deutsche Ausgabe wurde dann vom 1977 gegründeten Verlag Klett-Cotta in immer neuen Auflagen weiter veröffentlicht. Ab dem Jahr 2009 erschien sie dort erweitert um ein kurzes Vorwort der Montessori-Expertin Ingeborg Waldschmidt(1). Seither sind nun aber wieder viele neue und wichtige Studien zur Montessoris Leben und Wirken erschienen, wohlwollende wie kritische, die die Sicht auf die Tätigkeit der italienischen Reformerin weiter erhellen. So schien es dem Verlag geboten, die seit Jahrzehnten gut eingeführte deutsche Übersetzung des Buches »Kinder sind anders« in einer wiederum veränderten Ausgabe in etwas anderer Gestalt zu veröffentlichen, versehen mit einem nun sehr viel ausführlicheren Vorwort des neuen Herausgebers, das den jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Montessori-Forschung gebührend Rechnung trägt. Um diese neue Ausgabe handelt es sich bei dem vorliegenden Buch, das überdies über einen umfassenden Kommentarteil und über ein Verzeichnis der wichtigsten, vornehmlich deutschsprachigen einschlägigen Literatur verfügt.
Frauenrechtlerin, Ärztin und Reformpädagogin – Die Weltkarriere der Maria Montessori
Maria(8) Montessori kam am 31. August 1870 in der kleinen Gemeinde Chiaravalle(1) in der Nähe der Stadt Ancona(2) an der Küste des Adriatischen Meeres zur Welt. Hineingeboren wurde sie in eine strebsame Familie des italienischen Bildungsbürgertums, die sich am gesellschaftlichen Fortschritt orientierte und dem Gemeinwohl verpflichtet war. Ihre Mutter Renilde(1) war eine sehr belesene und ehrgeizige Frau, die bis zu ihrer Eheschließung auch als Lehrerin gearbeitet hatte, doch diesen Beruf dann wegen der Heirat aufgeben musste, was sie durchaus bedauerte. Der Vater Alessandro(1) war Finanzbeamter im gehobenen Dienst. Er verfügte über ein auskömmliches Gehalt. Fünf Jahre nach der Geburt seines einzigen Kindes ließ er sich mit Frau und Tochter in die Hauptstadt Rom(2) versetzen, wo es weit mehr Möglichkeiten zur Vervollkommnung der Bildung gab als in der italienischen Provinz.
Im Alter von sechs Jahren wurde Maria(9) in Rom(3) in der öffentlichen Schule an der Via di San Nicolo da Tolentino angemeldet, mitten im historischen Trevi-Viertel unweit des berühmten Brunnens. Sie war zunächst keine allzu gute Schülerin, da sie sich für den Unterricht nicht sonderlich interessierte. Dieser war auch wenig dazu angetan, ihre Phantasie zu beflügeln und den Verstand zu entfalten, denn die italienischen Grundschulen der damaligen Zeit stellten sich als überfüllte, schmutzige und dunkle Orte dar, die einer guten Didaktik wenig Raum boten. Gehorsam und Drill waren wichtiger als Kreativität. Als Mädchen wollte die aufgeweckte Maria viel lieber Schauspielerin werden, angeregt durch zahlreiche Besuche in den römischen Theatern, wohin ihre bildungsbeflissenen Eltern sie schon früh mitnahmen. Die aufmerksamen Lehrer des Schauspielkurses, den sie auf eigenen Wunsch und mit Zustimmung der Eltern neben der Schule absolvierte, bescheinigten ihr denn auch großes Talent – doch änderte sich der feste Entschluss des zwölfjährigen Mädchens plötzlich und unvermittelt, als sich im Jahr 1883 in Italien(2) die Bildungsbedingungen für junge Frauen schlagartig verbesserten, weil das nunmehr veränderte Gesetz ihnen ab sofort ganz grundsätzlich den Weg für eine höhere Schullaufbahn und sogar das Studium an der Universität öffnete.
Nach eingehenden Gesprächen mit der Mutter entschloss sich Maria(10) dazu, die weiterführende Schule zu besuchen. Zwar reichten ihre nur durchschnittlichen Zensuren für die Aufnahme in das humanistische Gymnasium nicht aus, doch wechselte sie von der Grundschule auf die naturwissenschaftlich ausgerichtete Sekundarschule »Regia Scuola Tecnica Michelangelo(1) Buonarotti«, wo es seit Neuestem einen Zweig auch für Mädchen gab. Im Verbund mit etwa einem Dutzend anderen Mädchen, die an dieser Schule unterrichtet wurden, entwickelte sich Maria zu einer Schülerin, die Bestnoten schrieb. Zudem entdeckte sie an der technischen Oberschule ihre Neigung zu den am Ende des 19. Jahrhunderts als besonders modern und fortschrittlich geltenden biologischen Wissenschaften. Die Evolutionstheorie von Charles Darwin(1) war zu dieser Zeit in aller Munde. Sie veränderte die Sicht der Menschen auf die eigene Entwicklungsgeschichte in dramatischer Weise und beeindruckte auch die jungen Schülerinnen sehr. Als die sechzehnjährige Montessori den Besuch der Oberschule im Jahr 1886 mit Bestnoten abschloss, hatte sie sich dafür entschieden, ein Studium aufzunehmen, um ihre naturwissenschaftlichen Interessen zu vertiefen. So schrieb sie sich in einem nächsten Schritt in Rom(4) am »Regio Istituto Tecnico« ein, an einer Technikhochschule, an der zu dieser Zeit mit Matilde Marchesini(1) nur noch eine weitere junge Frau studierte. Um von den jungen Männern nicht belästigt zu werden, wurden die beiden Studentinnen in den Pausen von ihren besorgten Lehrern im Seminarraum eingeschlossen.
Im Alter von zwanzig Jahren legte Montessori(11) ihre Abschlussprüfungen mit einem neuen Vorsatz ab: Sie wollte nun an der Universität in Rom(5) Medizin studieren, weil sie dieses Fach als interessanteste Variante einer zur Anwendung gebrachten Biologie verstand. Es eröffnete eine Perspektive auf bislang ungeahnte Möglichkeiten zur Verbesserung der Gesundheit(1) aller Menschen und ihrer Lebensumstände. Ihre Mutter, die den Studienwunsch der Tochter unterstützte, konnte auch den Vater zur Zustimmung bewegen, was unverzichtbar war, da die Tochter während des gesamten Studiums bei ihren Eltern wohnte und auch von ihnen durchgängig finanziert wurde. Bevor die Studentin Montessori sich allerdings an der medizinischen Fakultät immatrikulieren konnte, musste sie noch das Latinum erwerben, da die Alten Sprachen nicht an der technischen Oberschule unterrichtet worden waren. Sie schrieb sich zunächst nur für die Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Physik und Mathematik ein und lernte nebenher mit Eifer die lateinische Sprache. Im Frühjahr 1892 legte sie schließlich mit Bravour alle nötigen Prüfungen ab, die sie dazu berechtigten, mit dem Medizinstudium zu beginnen.
Später behauptete sie, dass sich sogar Papst Leo(1)XIII. für das Frauenstudium eingesetzt habe. Besonders das Medizinstudium habe der Heilige Vater als besten Beruf für Frauen angepriesen. Montessoris Kritiker spotteten, dass sie hier der katholischen Kirche eine Aufgeschlossenheit für die Belange der Frau attestiert habe, die zu keinem Zeitpunkt gegeben gewesen sei. Dabei wird jedoch übersehen, dass schon im 18. Jahrhundert ein besonders aufgeklärter Papst, Benedikt(1)XIV., zu den wichtigsten Förderern einer Frau gehörte, die sich bereits damals in der Welt der Medizin einen großen Namen gemacht hatte: Anna Morandi Manzolini(1) hatte es unter anderem einer Ausnahmeerlaubnis des Papstes zu verdanken, dass sie als bedeutende Anatomin ihrer Zeit gefeiert wurde und ihrem für eine Frau ungewöhnlichen Beruf nachgehen konnte. Der Bezug Montessoris auf den Papst als Unterstützer ihrer Absichten war also im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht aus der Luft gegriffen.
Die junge Medizinstudentin zeigte sich nach Überwindung anfänglicher Hemmungen(1) als ebenfalls versierte Anatomin. Dabei war sie an der Wende zum 20. Jahrhundert eine der Pionierinnen ihres Landes, denn unter den etwas mehr als 20 000 Studierenden befanden sich zu dieser Zeit gerade einmal 132 weibliche Studenten. Die wenigsten davon studierten Medizin. In ihrem Studiengang in Rom(6) war Montessori(12) zu Beginn sogar die einzige Frau. Sozialmedizin stand an der Fakultät hoch im Kurs, denn es ging darum engagierte Ärzte auszubilden, die zukünftig Arme und Kinder von schrecklichen Krankheiten(1) wie Tuberkulose(1) und Rachitis(1) oder auch von den Folgen einer Mangelernährung befreien würden. In Vorlesungen über Psychiatrie(1) wurden vor den angehenden Ärzten zudem die neuesten Erkenntnisse über das Wechselspiel von Geist, Seele und Körper ausgebreitet. Als Montessori im Sommer 1896 ihr Examen ablegte, reichte sie eine Doktorarbeit ein, in der sie über ihre ausführlichen Untersuchungen von Patienten der Psychiatrischen Klinik berichtete, die unter paranoiden Störungen und Verfolgungswahn litten. Ihre Arbeit erhielt von allen Prüfern glänzende Bewertungen und die zur »Dottoressa« promovierte Frau erhielt umgehend ein Stellenangebot an dem der Universität angeschlossenen Krankenhaus.
Im Verlauf ihres Studiums hatte sich Montessori(13) jedoch nicht nur für die Inhalte ihres Faches interessiert. Nebenher war sie auch als engagierte Frauenrechtlerin in Erscheinung getreten, die sich mit Verve dafür einsetzte, dass beide Geschlechter für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten sollten. Auch plädierte sie dafür, dass die Frauen dieselben politischen Rechte erhalten sollten wie die Männer. Das Wahlrecht sollte dahingehend reformiert werden, dass Frauen sich an den Abstimmungen beteiligen konnten. Als weiblicher Doktor der Medizin war sie aus Sicht ihrer auf Emanzipation drängenden Geschlechtsgenossinnen eine wahre Vorzeigefrau, ein neues Rollenvorbild gar – oder schlicht eine »neue Frau« [»Una donna nuova«], wie sie sich selbst bezeichnete –, weshalb sie der italienische Frauenverband »Associazione per la Donna« einen Monat nach ihrem Examen als Delegierte zu einem Internationalen Frauenkongress entsandte, der im Herbst 1896 in Berlin(1) stattfand.
In Berlin(2) fiel die sich bewusst elegant und feminin kleidende Montessori(14) nicht nur durch ihr Aussehen auf, sondern sie beeindruckte vor allem auch durch ihre kämpferischen Redebeiträge. Dabei gelang es ihr, die Zuhörer zu überzeugen – und nicht nur die Kongressteilnehmerinnen, die sich dem liberalen, bürgerlichen Lager der Frauenbewegung zurechneten. Sie sprach auch außerhalb der Tagung zu sozialistischen Gegendemonstrantinnen, denen sie versicherte, dass sie sich genauso für die Verbesserung der Lebensbedingungen der einfachen Arbeiterinnen einsetze. Am Ende ihrer Ansprache spendeten ihr die revolutionär gestimmten Sozialistinnen warmen Applaus. Montessori lernte in Berlin, auf den politischen Gegner zuzugehen, um gemeinsam mit ihm die ihr wichtigen Ziele durchzusetzen.
Nach ihrer Rückkehr nach Italien(3) arbeitete die junge Ärztin außer im Hospital auch im Hygieneinstitut(1), wo sie den jungen Kollegen Guiseppe Montesano(1) kennenlernte, an dem sie großen Gefallen fand. Auch er verliebte sich in die intelligente Frau und couragierte Feministin. Ihre politischen Ziele teilte er aus voller Überzeugung. Beide engagierten sich als Mediziner fortan besonders für jene Patienten, die sich in psychiatrischer Behandlung befanden. Als Montesano im Jahr 1898 zum Chefarzt der Psychiatrischen(2) Klinik in Rom(7) ernannt wurde, arbeitete er dort mit seiner Geliebten auf Augenhöhe. Mehr und mehr begann sich das junge Paar auch für geistig behinderte(1) Kinder zu interessieren, die man damals noch als »Idioten«, »Schwachsinnige« oder »Irre« bezeichnete und konsequent wegsperrte, ohne sie in irgendeiner Weise zu fördern oder ihnen eine angemessene Aufmerksamkeit zu schenken. Montessori(15) und Montesano(2) fassten den Entschluss, diese Kinder aus ihrer bedauernswerten Isolation zu befreien, um mit ihnen Lernexperimente zu veranstalten. Das Ärztepaar wollte den Beweis erbringen, dass auch geistig Behinderte Lernfortschritte machen konnten, sofern man ihnen nur die nötige Zuwendung zuteilwerden ließ.
In diesem Zusammenhang begann sich Montessori(16) erstmals mit Eifer für pädagogische Fragestellungen zu interessieren. Ihr Berufsleben erhielt nun eine ganz neue Richtung. An der Universität besuchte sie regelmäßig die Pädagogikvorlesungen und studierte alles, was es an Literatur über geistige Behinderungen gab. Dabei entdeckte sie die fast vergessenen Schriften des französischen Arztes Édouard Séguin(1), der schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über eine geeignete Erziehung für sogenannte »Idioten« nachgedacht hatte. Schon 1846 hatte er das erste systematische Lehrbuch für die Bildung geistig behinderter(2) Kinder unter dem Titel »Traitement moral, hygiène et éducation des idiots« herausgegeben, in welchem er die Vorstellung von einem prinzipiellen Unterschied beim Lernen zwischen behinderten und nicht-behinderten Kindern zurückwies. Montessori brachte Séguins Methoden in Rom(8) zur erneuten Anwendung, experimentierte mit ihnen und feierte Erfolge. 1900 wurde ihr gemeinsam mit Montesano(3) die Leitung der neugegründeten »Scuola Ortofrenica« übertragen, einem medizinisch-pädagogischen Institut, an dem Lehrerinnen und Lehrer mit geistig behinderten Kindern weiter an der Verbesserung ihrer Bildung arbeiten sollten.
Just im Moment dieses beachtlichen beruflichen Aufstiegs hatten Maria(17) Montessori und Guiseppe Montesano(4) jedoch eine große private Herausforderung zu meistern. Ihre emanzipierte und freie Liebesbeziehung führte zu einer ungewollten Schwangerschaft, die von der werdenden Mutter erst spät bemerkt wurde. Sie trug das Kind aus, brachte es 1898 aber heimlich zur Welt, indem sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog und vorgab, sich auf eine längere Reise zu begeben. Ihren Sohn Mario(1) vertraute sie nach der Geburt einer Stillamme an, die 45 Kilometer von Rom(9) entfernt in der kleinen Gemeinde Vicovaro(1) lebte. Die junge Ärztin glaubte sich nicht zu ihrem Kind bekennen zu können, ohne damit zugleich ihre Karriere zu zerstören. Den Vater wollte sie deshalb nicht heiraten, weil sie sich damit nicht nur finanziell von ihm abhängig gemacht hätte. So sah sich die angesehene Direktorin der neuen Schule für geistig behinderte Kinder selbst nicht dazu in der Lage, für ihr eigenes Kind zu sorgen, das nun in einer Gastfamilie fernab von Rom auf dem Land aufwuchs. Nur von Zeit zu Zeit besuchte sie den kleinen Mario.
Montesano(5) wollte sich mit dieser Situation als Vater nicht abfinden. Im Herbst 1901 erkannte er Mario(2) einseitig vor dem Gesetz als seinen Sohn an, beließ ihn jedoch in der Obhut der Pflegemutter in Vicovaro(2). Nur wenige Tage nach dieser Entscheidung heiratete er eine andere Frau namens Maria Aprile(1). Die von diesen Vorgängen völlig überraschte Montessori(18) durfte ihren Sohn in der Folge für viele Jahre nicht mehr sehen. Erst als dieser 15 Jahre alt war, nahm sie ihn zu sich, weil Mario zu diesem Zeitpunkt unbedingt bei ihr leben wollte, was der Vater dann auch respektierte – und der verlorene Sohn nahm den Nachnamen seiner Mutter an. Mit der Eheschließung Montesanos war nicht nur seine Beziehung zu Montessori zu einem jähen Ende gekommen, auch professionell verband die beiden Elternteile fortan nichts mehr. Die Ärztin kündigte jegliche berufliche Zusammenarbeit mit ihrem ehemaligen Geliebten auf und betrat die »Scuola Ortofrenica« nicht mehr. Sie brach auch jeden persönlichen Kontakt mit ihm ab und verachtete den Vater(6) ihres Sohnes für den Rest ihres Lebens als einen charakterlosen Mann.
Über ihre fürchterliche Enttäuschung kam sie(19) nur sehr langsam hinweg. Sie lebte nun aber umso beharrlicher als freie, emanzipierte Frau und verdiente erstmals ihr eigenes Geld: Ab 1903 erteilte sie bezahlte Vorlesungen über pädagogische Anthropologie(1), zunächst an einem Privatinstitut in der Nähe von Bologna(1), seit 1904 dann auch regelmäßig an der Universität Rom(10). Diese Vorlesungen gab sie später – im Jahr 1910 – unter dem Titel »L’Antropologia pedagogica« in Druck. Neben wichtigen Thesen über die Bedeutung von gesunden Schulmahlzeiten und geeigneten Unterrichtsräumen, fanden auch die damals kursierenden kruden Vorstellungen über angebliche rassische Unterschiede verschiedener Menschentypen in Afrika(1), Australien(1), Europa(1) und Asien(1) Eingang in dieses Buch, wobei Montessori(20) den Europäern den Vorzug vor allen anderen Völkern gab. Sie schrieb aber auch von der Bedeutung der Liebe(1), die ein Lehrer für seinen Beruf und für die ihm anvertrauten Schüler aufbringen muss.
Im Jahr 1907 wurde Montessori(21) von der Baugesellschaft Istituto Romano di Beni Stabili (IRBS) die wissenschaftliche Leitung einer im römischen Arbeiterviertel San Lorenzo(1) gelegenen Kindertagesstätte angetragen. Sofort erblickte sie die Chance, an diesem Ort mit den armen und noch gänzlich ungebildeten Kindern gewöhnlicher Arbeiter ihre zuvor schon mit Behinderten ausprobierten neuen Lernmethoden in einer neuen und ganz anderen Lernsituation anzubringen, die sie als »normalen« Unterricht beschrieb. Dabei kamen auch Lernmaterialien(1) zur Anwendung, die sich in ihrer Behindertenpädagogik bereits bewährt hatten. Die Spiel-(1) und Lernmaterialien orientierten sich an geometrischen Formen, Bausteinen, Zylindern, Würfeln und bestimmten Farbfolgen und sollten zur spontanen(2), freien und experimentellen Auseinandersetzung einladen und die Kreativität und Phantasie der Kinder beflügeln. Montessoris Ziel war es dabei, zum selbständigen Lernen(2) anzuregen, das sich allein der intrinsischen Motivation(1) der Kinder verdankte.
Noch im selben Jahr erhielt dieser Kinderhort den Namen »Casa dei bambini« (dt. Kinderhaus(1)). In kürzester Zeit wurde ganz Rom(11) auf Montessoris(22) Schule aufmerksam. Selbst Mitglieder der royalen Familie Italiens(4) – vor allem die Königinnen Margherita(1) und Elena(1) – besuchten und unterstützen die Ärztin, die nun völlig in ihrer pädagogischen Mission aufging. Als sie 1909 das Buch »Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini« veröffentlichte, in dem sie ihre Erziehungsmethode umfassend beschrieb, wurde sie gleichsam über Nacht ein Star: Das Buch wurde rasch in mehr als 20 Sprachen übersetzt und machte die Autorin zu einer internationalen Berühmtheit. Noch im Jahr seines Erscheinens richtete sie ein weiteres Modell-Kinderhaus im römischen Stadtviertel Esquilino(1) in einem Franziskanerinnenkloster ein. Damit dokumentierte sie zugleich, dass ihre Erziehungsvorstellungen sich aus ihrer Sicht im Einklang mit den Lehren der katholischen Kirche befanden, deren bekennendes Mitglied Montessori(23) zeitlebens war.
In ihrem nunmehr fünften Lebensjahrzehnt erklomm sie einen weiteren Gipfelpunkt ihres Ruhmes, als sie ihre nun als »Montessori-Methode« werbewirksam etikettierte Pädagogik auf verschiedenen Reisen in die Vereinigten Staaten(3) den für alle Innovationen aufgeschlossenen Amerikanern persönlich nahebringen konnte. Im Dezember 1913 hielt sie in der vollbesetzten Carnegie Hall vor tausenden Zuhörern einen Vortrag, der von keinem Geringeren als dem Vorsitzenden des amerikanischen Lehrerverbandes und Professor an der New Yorker(1) Columbia University, John Dewey(1), kenntnisreich moderiert wurde. Zwei Jahre später nahm sie(24) auch ihren Sohn Mario(3), der nun endlich bei ihr lebte, mit in die USA(4) – auch weil der Erste Weltkrieg ausgebrochen war und sie den bald im wehrpflichtigen Alter befindlichen Teenager vor der Einberufung schützen wollte. Anlass dieser zweiten Amerikareise war eine Weltausstellung, die vom 20. Februar bis zum 4. Dezember 1915 im kalifornischen San Francisco(1) stattfand. Auf dem Ausstellungsgelände wurde auch ein Montessori-Klassenraum mit einer gläsernen Wand errichtet, um den Besuchern zu demonstrieren, wie in einem Kinderhaus(2) gearbeitet wird. Drinnen gaben sich dreißig Kinder in höchster Konzentration(1) der Lernarbeit hin, in einem Klassenzimmer mit Möbeln(1), die auf Kindergröße zugeschnitten waren. Ein Lehrerpult fehlte. Staunend nahmen die Ausstellungsbesucher zur Kenntnis, dass die Kinder sich völlig frei bewegen(1) konnten, selbständig mit Montessoris Unterrichtsmaterial(2) lernend(3), wobei den anwesenden Lehrerinnen nur eine beobachtende und assistierende Rolle zugebilligt wurde.
Die letzten Kriegsjahre verbrachte Montessori(25) mit ihrem Sohn(4) – der 1917 ihre amerikanische Schülerin Helen Christy(1) heiratete – überwiegend im neutralen Spanien(2), in der katalanischen Stadt Barcelona(1), bis sie dann an der Wende zur nächsten Dekade der 1920er Jahre wieder für längere Abschnitte in ihr Heimatland(5) zurückkehrte, um dort ihre Lernmethode nach Möglichkeit auch in allen öffentlichen Schulen als Standardpädagogik zu etablieren. Fatalerweise glaubte sie, dass ihr dabei ausgerechnet die aufkommende faschistische Bewegung die erwünschten Hilfsdienste leisten würde. Als der Faschistenführer Benito Mussolini(3), der als junger Mann als Grundschullehrer tätig gewesen war, im Jahr 1922 vom König Vittorio Emanuele III.(1) zum Ministerpräsidenten Italiens ernannt wurde und sich bis 1926 zum totalitär herrschenden Diktator des Landes wandelte, setzte Montessori(26) die allergrößten Hoffnungen in ihn. In verschiedenen Briefen an Mussolini hob sie hervor, wie sehr ihre Pädagogik dazu imstande sei, die Schulen des neuen Italiens zu befruchten. Eine Zeitlang kam es auch zur Zusammenarbeit. Doch der Diktator bot ihr langfristig nicht das, was sie sich von ihm versprach. Nach der Kollaboration kam es ab 1933 zum Bruch.
Bis 1936 verbot das Regime in Italien(6) dann schrittweise alle Schulen, in denen Montessoris Methode zur Anwendung gekommen war. Für die Reformpädagogin(27) war das ein tiefer Einschnitt, doch problematisierte sie auch nach dem Zerwürfnis mit Mussolini(4) zu keinem Zeitpunkt die verstörende Tatsache, dass sie sich vorübergehend auf die Faschisten eingelassen hatte. Sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg behauptete sie in dem 1949 erschienen Buch »La mente del bambino« [dt.: »Das kreative Kind«] anerkennend, dass Mussolini und Adolf Hitler(1) als erste die drängende Aufgabe des Staates erkannt hätten, sämtliche Kinder organisiert und vom frühesten Alter an konsequent auf ein gesamtgesellschaftliches »Ideal« hin zu erziehen – wobei sie dann immerhin einräumte, dass »der moralische Wert« dieser Absicht im konkreten Falle der beiden Diktatoren verderblich gewesen sei.
Im Alter von 66 Jahren, dem doch eigentlich üblichen Renteneintrittsalter, war Montessori(28) aufgrund der politischen Umstände dazu gezwungen, außerhalb ihrer italienischen Heimat einen neuen Anfang zu wagen. Da sich Spanien(3) seit 1936 im Bürgerkrieg befand, war Barcelona(2), wo sie sich seit dem ersten Weltkrieg so oft und so gerne aufgehalten hatte, ebenfalls keine zukunftsträchtige Option mehr. Auf der Suche nach neuen Ufern nahm sie zunächst eine Einladung nach England(1) an. In dieser auch finanziell für sie prekären Situation legte sie ein neues Buch vor, in welchem sie über ihr Leben und über ihre Karriere Rechenschaft ablegte. Die Abhandlung »Il segreto dell’infanzia«, die sie einem Fachpublikum in Oxford(1) vorstellte, ging der italienischsprachigen Ausgabe um zwei Jahre voraus und erschien unter dem Titel »The Secret of Childhood«. Präsentiert wurde das Buch im Rahmen eines internationalen Montessori-Kongresses, der in der altehrwürdigen englischen Universitätsstadt an Themse und Cherwell vom 7. bis zum 17. August 1936 stattfand. Das neue Buch fasste alle wesentlichen Gesichtspunkte und Entwicklungsprozesse der Montessori-Pädagogik zusammen, wie sie die Ärztin seit den 1890er Jahren über Jahrzehnte hinweg auf der Basis kontinuierlicher Unterrichtsexperimente herausgebildet hatte. Mit einem entsprechend großen Interesse wurde das Buch dann auch außerhalb der Fachwelt von einem Lesepublikum in der ganzen Welt studiert.
In England(2) fasste Montessori(29) dann den Entschluss, dauerhaft in die Niederlande(1) zu emigrieren, wo sie ab Oktober 1936 wechselweise in Amsterdam(1) und in der benachbarten Gemeinde Laren(1) lebte. An beiden Orten befanden sich bereits seit einiger Zeit Montessori-Schulen. Nach Holland(1) hatte sie Ada Pierson(1) eingeladen, eine niederländische Anhängerin ihrer Lehre, die nach dem Scheitern der ersten Ehe Mario(5) Montessoris die zweite Schwiegertochter der italienischen Pädagogin wurde. Nach dem Umzug nach Holland wurden die Niederlande zum Zentrum aller internationalen Montessori-Aktivitäten, wobei die Familie Montessori das kleine Land an der Nordsee noch einmal während des Zweiten Weltkriegs für mehre Jahre verließ, um auf einer ausgedehnten Reise durch Pakistan(1) und Indien(2) die Montessori-Methode auch in Asien(2) zu verbreiten. In dieser Zeit entwickelte sich Montessori – die zwischen 1919 und 1929 zur vierfachen Großmutter geworden war – zu einer glühenden Apologetin der weltweiten Kinderrechte(1), deren Durchsetzung die nun zur Kosmopolitin gereifte Frau als Menschheitsaufgabe verstand. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr nach Holland besorgte sie eine Neuausgabe ihres 1950 nun erstmals auch in Italien(7) publizierten Buches »Il segreto dell’infanzia«, das sie als ihr schriftstellerisches Vermächtnis begriff.
Nur zwei Jahre später starb sie(30) am 6. Mai 1952 im Haus einer befreundeten Familie im holländischen Küstenort Noordwijk(2) aan Zee. Gemäß einem zuvor geäußerten Wunsch wurde sie an ihrem Sterbeort beigesetzt. So befindet sich ihre letzte Ruhestätte auf dem katholischen Friedhof von Noordwijk aan Zee, wo auf einem sanft geschwungenen weißen Grabstein im Halbrund in Form eines ausladenden Schriftzugs ihre letzte Bitte in ihrer italienischen Muttersprache formuliert ist: »Io prego i cari bambini che possono tutto di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo« [dt: »Ich bitte die lieben Kinder, die alles vermögen, sich mit mir zusammenzuschließen, um für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten«]. Noch im Jahr ihres(31) Todes erschien dann »Il segreto dell’infanzia« erstmals unter dem Titel »Kinder sind anders« in der Bundesrepublik Deutschland(1) wo es sich seither zu ihrem meistverkauften Buch entwickelt hat. Wer es gründlich liest, wird darin die folgenden wichtigsten Überlegungen sowohl zur ideengeschichtlichen Grundlage als auch zur pädagogischen Praxis ihrer Methode versammelt finden.
Die natürlichen Anlagen des Menschen. Zwischen Determinismus und Handlungsfreiheit
Montessori(32) erhielt ihre dauerhafte wissenschaftliche Prägung als Schülerin einer technisch-naturwissenschaftlichen Oberschule, die sie in den 1880er Jahren besuchte. Damals wurde sie mit den seinerzeit heißdiskutierten Theorien der Biologen Charles Darwin(2), Jean-Baptiste de Lamarck(1) und Hugo de Vries(1) konfrontiert, deren Lehren sie dann als Studentin der Medizin noch intensiver durchdrang und in sich aufnahm. Durch die begeisterte und zustimmende Auseinandersetzung mit Darwins Evolutionstheorie, auf die sie sich noch in »Kinder sind anders« kenntnisreich und wie selbstverständlich bezieht, wurde ihr klar, dass die Entwicklung der Menschheit wie des einzelnen Individuums(2) immer auch durch Umwelteinflüsse(1) gelenkt und verändert wird. Doch gab ihr die Lektüre der Schriften des Basler Anatoms Wilhelm His(1) gleichzeitig zu verstehen, dass sich die Eizelle des Menschen nach der Befruchtung und der daraus hervorgehende Embryo(1) ganz unabhängig davon und sehr weitgehend nach einem zuvor feststehenden Muster fortentwickelt. So spricht sie im »Biologisches Zwischenspiel« betitelten 3. Kapitel, in dem sie vor dem Leser ihre Ansichten zur Embryologie(1) ausbreitet, von »einem vorherbestimmten Plan«, der jeweils in jedem einzelnen Menschen angelegt ist und »ganz von sich aus« zur Entfaltung kommt. Diesen Plan, diese Grundanlage kann der Mensch nicht verändern, er muss ihm gehorchen. Wollte er sich dagegen wehren, wäre das genauso unsinnig wie der Befehl, »mit dem Wachstum seiner Zähne innezuhalten«.
Dazu passt auch Montessoris(33) Vorstellung von der Wirkmacht der natürlichen Instinkte(1), denen sie ebenfalls ein ganzes Kapitel widmet. Die Bezeichnung Instinkt leitet sich vom lateinischen Wort instinctus ab, was sich am besten mit »Anreiz« oder »Antrieb(1)« übersetzen lässt. Nachdem schon im 18. Jahrhundert über die Triebe, Kunsttriebe oder Instinkte der Tiere geforscht wurde, machten sich dann in der Zeit, in der Montessori Medizin studierte, der deutsche Zoologe Heinrich Ernst Ziegler(1) und der britisch-amerikanische Psychologe William McDougall(1) daran, auch das instinktive Verhalten des Menschen zu erforschen. Auch die auf dieser Grundlage entwickelte Instinktlehre legt die Auffassung nahe, dass die Menschen sich kaum von den in ihnen angelegten Triebkräften frei machen können und ihrer inneren Bestimmung folgen müssen – ob sie wollen oder nicht.
Im Kontext dieses biologischen Determinismus(3) hatte Montessori(34) dann auch kurz nach Abschluss ihres Studiums Überlegungen zu den angeblich unverrückbar feststehenden Unterschieden zwischen sogenannten Rassetypen angestellt. Ein solches Denken war an der Wende zum 20. Jahrhundert zwar durchaus verbreitet und es fußte auf Rassetheorien, die schon seit dem 18. Jahrhundert in der akademischen Welt debattiert wurden. Doch hatte es dagegen ebenfalls schon seit dem Zeitalter der Aufklärung entschiedenen Widerspruch gegeben. So hielt der Göttinger(1) Wissenschaftler August Ludwig Schlözer(1) in seiner »Vorbereitung zur Weltgeschichte für Kinder« von 1806 dem an seiner Universität lehrenden, offen rassistisch denkenden Kollegen Christoph Meiners(1) in aller Klarheit entgegen: »Es gibt keine Spezies im Menschengeschlecht wie bei den allermeisten Tiergeschlechtern. Noch hat kein Anatomiker etwas finden können, das auf wirklich verschiedene Menschenrassen hinweise.«
Montessori(35) war also nicht einfach, wie oft gesagt wird, ›ein Kind ihrer Zeit‹, wenn sie rassistischen Theorien zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere zunächst viel abgewann. Sie konnte sich zwischen menschenherabsetzenden Rassetheorien und einer langen Tradition der expliziten Rassismuskritik durchaus entscheiden. Erst spät löste sie sich von ihren anfänglichen Überzeugungen. Immerhin ist ihr Buch »Kinder sind anders« von rassistischen Vorstellungen frei. Wenn sie dort an einer Stelle von der »Gesundheit(2) der Rasse(1)« spricht, dann meint sie die Menschheit im Sinne der heute im Englischen gebräuchlichen Wendung »the human race«. Und wenn sie im 2. Kapitel fordert, dass sich alle Menschen »ohne Unterschied des Standes, der Rasse oder der Nation« für den »moralischen Fortschritt der Menschheit« einsetzen sollen, erinnert diese Wortwahl der deutschen Übersetzung von 1952 eben auch an den erst drei Jahre zuvor im Mai 1949 verabschiedeten Grundgesetz-Artikel 3, Absatz 3, Satz 1: »Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden«. Dies ist der Geist, der denn auch in ihrem Spätwerk weht.
Dennoch: Die körperliche Entwicklung und der moralische Fortschritt des Menschen scheinen in ihren Augen entscheidend davon abzuhängen, wie sein innerer Bauplan, der unverrückbar feststeht, beschaffen ist. Insbesondere vor diesem Hintergrund wird dann auch verständlich, dass sich Montessori(36) mit Überzeugung an den holländischen Biologen Hugo de Vries(2) anlehnt, der in seinen Arbeiten die Empfänglichkeitsperioden(1) bei Tieren beschrieben hatte. Auf die Entwicklung von einer Raupe zum Schmetterling verweisend folgte de Vries, dass auch alle anderen Lebewesen nur zu ganz bestimmten Zeiten über »Empfänglichkeiten« verfügen, die das stufenweise erfolgende Heranwachsen erst ermöglichen. Diese Erkenntnis übertrug Montessori auf die Entwicklungsprozesse der Kinder, von denen jedes einzelne ihrer Ansicht nach ebenfalls über bestimmte »sensible Perioden« verfügt, an denen nicht zu rütteln ist und deren Beginn niemand künstlich erzwingen kann. Diese beschreibt sie näher im gleichnamigen Abschnitt des 7. Kapitels. Wieder scheint sie hier einem ehernen Determinismus(4) das Wort zu reden, wenn sie schreibt: »Auf diese grundsätzlichen Entwicklungsstadien vermag der Erwachsene in keiner Weise von außen her einzuwirken«.
Umso überraschender ist es dann, dass Montessori(37) dennoch jedem Menschen »ein gewisses Maß von Handlungsfreiheit(1)(1)« zuspricht. Was er im Verlauf seines Entwicklungsprozesses aus sich selbst hervorbringt, das hängt immer auch von seinem eigenen bewussten Zutun ab. Jeder junge Mensch verfügt demnach über einen grundsätzlich freien und also auch spontan(3) wirkenden Gestaltungswillen, von dem er Gebrauch machen kann. Jedes Kind und jeder Heranwachsende soll also mit Fug und Recht versuchen, sich gezielt selbst zu formen, um sich geradezu davon überraschen zu lassen, was in ihm steckt. Und dabei ist es sowohl für den im Aufwachsen befindlichen Menschen wie auch für das ihn beobachtende und fördernde Elternteil oder für den unterstützenden Erzieher ganz und gar »unvorhersehbar«, welche »Ergebnisse« eine solche auf sich selbst ausgerichtete »Durchformung« hervorbringt, die letztlich »jedes Individuum(3) von sich aus vornehmen muss«, wenn es beim Lernen(4) mit der Selbstbildung beschäftigt ist.
Welches exakte Verhältnis nun aber zwischen Determinismus(5) und Handlungsfreiheit(2)(2) besteht oder wie die Gewichtung zwischen der sich Bahn brechenden Kraft der natürlichen Anlagen und der bewusst vorgenommenen Kultivierung der eigenen Talente genau beschaffen ist, das ist und bleibt für Montessori(38) »ein Geheimnis(1), in das wir nicht eindringen können«. Niemand kann hier im Entwicklungsprozess etwas forcieren oder durch Zwang(1) hervorbringen. Allenfalls können Eltern und Erzieher durch geschickte Anregungen hervorlocken, was ins Dasein treten will. Der ganze Vorgang bleibt aber rätselhaft und sperrt sich gegen ungestümes pädagogisches Handeln. So schreibt Montessori im 6. Kapitel: »Jeder neue Mensch ist ein Rätsel(1) und wird uns Überraschungen bereiten; davon aber sieht man lange Zeit nichts, wie denn auch der Schöpfer(1) eines Kunstwerkes dieses lange in der Abgeschlossenheit seines Arbeitszimmers verwahrt und es mit seiner Persönlichkeit(2) ausfüllt, ehe er es den Blicken des Publikums preisgibt.«
Umwelt und Spielmaterialien des Kindes
Um den Entwicklungsprozess des Kindes, den man unter gar keinen Umständen erzwingen kann, in seinem freien Verlauf jedoch so weitgehend wie möglich zu begünstigen, um weiterhin viele Möglichkeiten zur idealen Entfaltung der jeweiligen natürlichen Anlagen eines Jungens oder eines Mädchens zu eröffnen, kommt es nun allerdings entscheidend darauf an, dass Eltern oder Erzieher für eine geeignete und anregende Umgebung des Aufwachsens sorgen. Es sollte dies eine vornehmlich kindgerechte Umwelt(2) sein, nicht ausschließlich »eine Umwelt der Zivilisation(1), in der sich das Leben der Erwachsenen abspielt« und die in erster Linie auf das Leben von Erwachsenen zugeschnitten ist. Kinder sollten sich an ihren Aufenthaltsorten nicht als Störfaktor in der Welt der Erwachsenen fühlen, in der sie »nichts berühren« dürfen, was ihnen »nicht gehört«, und wo alles »unantastbares, ausschließliches Eigentum des Erwachsenen und für die Kinder verboten« ist. Vielmehr sollten sie überall spüren, dass sie in einer Welt, die wie für sie gemacht scheint, willkommene Gäste sind. Immer wieder kommt Montessori(39) in ihrem Buch darauf zu sprechen. Und es ist wichtig zu sehen und daran zu erinnern, dass dieser Gedanke noch bis weit ins 20. Jahrhundert neu und wenig selbstverständlich war.
Deutlich wird das vor allem dann, wenn man sich einmal vor Augen führt, dass erst seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert Möbel(2) produziert wurden, die auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten waren. Gleich in der Einleitung von »Kinder sind anders« erinnert die Autorin ihre Leser noch einmal daran: »Vor einigen Jahrzehnten gab es noch nicht einmal einen Stuhl für Kinder«. Tatsächlich fertigte die in Wien ansässige Fabrik der Brüder Thonet(1) – die erste Produktionsstätte in Europa(2) überhaupt, die Stühle und Bänke eigens für Kinder in der ihnen angemessenen Größe herstellte – solche Kindermöbel erst ab 1885 in Serie. Und dann dauerte es noch einmal viele Jahre, bis nach der Jahrhundertwende kindgerechte Tische, Stühle und Schemel ganz allmählich auch Eingang in Schulen und Kindergärten fanden.
Montessori(40) war eine der ersten Erzieherinnen, die solche Möbel in ihren pädagogischen Einrichtungen konsequent verwendete. Ab 1907 richtete sie ihrer Kinderhäuser(3) entsprechend ein. Im 18. Kapitel erinnert sie sich daran, wie sie sich daran machte, »die materielle Umwelt(3) der kindlichen Körpergröße anzupassen«: »Unsere hellen, lichtdurchfluteten Räume mit niedrigen, blumengeschmückten Fenstern, mit ihren kleinen Möbeln jeglicher Form, die ganz der Einrichtung eines modernen Wohnhauses gleichen, die Tischchen, die Sesselchen(3), die bunten Vorhänge, die niedrigen Schränke in Reichweite der Kinder, die dort nach Belieben Dinge aufstellen oder fortnehmen konnten« – all das erschien wie »eine praktisch bedeutsame Verbesserung des Kinderdaseins.« Auch kleine und niedrige Betten, in die Kinder ohne fremde Hilfe hineinfinden und aus denen sie nachts auch bei Bedarf schnell eigenständig aufstehen können, befürwortet die Reformpädagogin. Kinder sollen sich in ihrer Umwelt möglichst frei und uneingeschränkt bewegen(2) können. Nur so werden sie in die Lage versetzt, sich völlig ungehindert auszuprobieren, was für ihre Entfaltung die unabdingbare Voraussetzung ist.
In einer Umwelt(4), in der Kinder ihre motorischen, geistigen und kognitiven Fähigkeiten in ihrem eigenen Tempo zur Reife gelangen lassen sollen, haben klassischen Spielsachen(2) keinen Platz und keinen Wert. Sie lenken nur ab, wie Montessori(41) befindet, und führen nicht zum Ziel. Deshalb bringt die Italienerin eigene Materialien(3) zum Einsatz, teilweise unter Rückgriff auf Vorarbeiten des französischen Arztes Édouard Séguin(2) und des deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel(1). Sie orientiert sich dabei an geometrischen Formen, Bausteinen, Zylindern, Würfeln und bestimmten Farbfolgen. Diese sollen zur experimentellen Auseinandersetzung einladen und die Kreativität und Phantasie der Kinder beflügeln. Ihr Buch, in dem sie ihre Methode schildert, ist durchzogen von Beschreibungen des Umgangs mit diesem neuerstellten Unterrichtsmaterial, das zur geeigneten Umwelt der Kinder dazugehört. So erzählt sie etwa, wie ein dreijähriges Mädchen mehrere Holzzylinder(4), die Flaschenkorken ähneln, in verschieden abgestuften Größen in die jeweils passenden Öffnungen eines vorgefertigten Blocks schiebt. Das Kind hantiert mit äußerster Geduld und wiederholt seine Übung(1) ein ums andere Mal.
Kinder im Vorschulalter müssen nicht zwingend lesen(1) lernen(5), doch wenn sie sich an Büchern und Buchstaben interessiert zeigen, soll ihnen zumindest auch hier ein entsprechendes Angebot in ihrer Umgebung zu Verfügung stehen. Montessori(42) berichtet, wie sie einst in ihrem römischen Kinderhaus(4) die Buchstaben so anregend zu machen wusste, dass sich schon die kleinsten Kinder gerne und von alleine damit zu beschäftigen begannen. Sie ließ Buchstaben nicht nur aus glattem Karton ausschneiden, sondern auch aus farbigem Schmirgelpapier. Dabei machte sie die Feststellung, dass die Kinder lieber mit den angerauten Lettern arbeiteten und mit ihnen häufiger den Versuch unternahmen, daraus Worte zu legen, die sie dann allmählich auch zu lesen(2) lernten. Mit ihren Händen zeichneten sie die Schriftzeichen nach, die sich ihnen auf diese Weise besonders gut einprägten.
Auch hier aber bringt Montessori(43) ihren Lesern mit Nachdruck zu Bewusstsein(1), dass sich niemand von dem Gedanken verführen lassen sollte, von Kindern plötzlich raschere Fortschritte in ihrer Entwicklung zu erhoffen, nur weil sie sich in einer geeigneten Umwelt(5) befinden in denen schöne und anregende Materialien(5) auf sie warten. Es lässt sich in der Pädagogik nichts künstlich beschleunigen. Auch das Lesenlernen hängt vom Interesse(1) der Kinder ab, das sich von selbst einstellt oder auch nicht. Im 26. Kapitel, in welchem das Erlernen des Schreibens(1) und Lesens(3) thematisiert wird, schreibt die Reformpädagogin: »Eine allzu große Eile unsererseits im Erklären der Druckbuchstaben hätte dieses Interesse und diesen Eifer im Erraten nur Dämpfen können.« Und auch »unzeitgemäßes Bestehen auf Üben(2) des Lesens von Wörtern in Büchern hätte eine negative Hilfe bedeutet und um eines nebensächlichen Zweckes willen die Energie dieser tatendurstigen Gemüter herabgemindert.« Jedes Kind geht also seinen eigenen Weg und hat seinen eigenen Rhythmus(1).
»Hilf mir, es allein zu tun« – Selbständiges Lernen, Individualität(4) und Konzentration(2)
Alles Lernen(6) geht bei Montessori(44) im Wesentlichen autodidaktisch vonstatten und vollzieht sich gemäß einem höchst individuellem Entwicklungsmuster. Jedes einzelne Kind hat seine eigene, nur ihm angemessene Vorgehensweise. Insofern wird denn auch einem radikalen Individualismus das Wort geredet. Im 28. Kapitel, in welchem die Autorin auf »Folgerungen« zu sprechen kommt, die sich durch diese Sicht auf die Kinder ergeben, plädiert sie dann auch vom Grundsatz her für die »Abschaffung der gemeinsamen Lektionen«. In einer zugehörigen Fußnote erklärt sie dann zwar noch ein wenig relativierend, dass das nun nicht automatisch bedeute, in den Schulen niemals gemeinsame Unterrichtsmomente zuzulassen – denn das wäre doch wieder zu dogmatisch gedacht. Schließlich können Kinder auch eine Lerngruppe bilden wollen. Die Gemeinschaftsstunden stellen aber »weder das einzige noch auch nur das hauptsächlichste Unterrichtsmaterial(6) dar«, denn sie »dienen lediglich zu besonderen Darlegungen und Fähigkeiten«.
Dem Lehrer oder der Lehrerin fällt somit nur die Rolle eines aufmerksam beobachtenden Assistenten jedes einzelnen Kindes zu, der dieses nur dann unterstützt, wenn es die Situation erforderlich macht. Ein Erzieher soll demnach »ruhig sein«, sich nicht in den Vordergrund drängen, sondern lieber wie auf einer Nebenbühne agieren. Deshalb muss er auch auf das erhöhte Katheder verzichten, jene mit einer besonderen Aura umgebene Sitzgelegenheit des Lehrers, die im Unterricht doch seit Jahrhunderten den Ort und die besondere Stellung seiner Lehrautorität ausgewiesen und diese materiell untermauert hat. Damit ist es nun vorbei. Ein am äußersten Rande des Geschehens aufgestellter fester Tisch, auf dem die der Lernarbeit beiwohnende Lehrperson ihre Utensilien ausbreiten kann, muss stattdessen genügen. Aus alledem geht hervor, dass der die Kinder beim Lernen aufmerksam betrachtende Erwachsene hauptsächlich seinerseits lernen muss, ihre Bedürfnisse zu verstehen, »um ihnen durch entsprechende Vorkehrungen in einer wirklich geeigneten Umgebung behilflich zu sein«. Er muss einsehen und erkennen, dass er selbst im Unterrichts- und Lernkontext nicht die Hauptperson ist, sondern »eine zweite Stelle« einnimmt, damit er dem Kind gerecht wird und versteht, »sich zu seinem Helfer zu machen«, der ihm nur dann zur Hand geht, wenn es danach verlangt.
Die berühmte Formel, auf die Montessori(45) dieses Unterrichtsprinzip gebracht hat, ist die folgende, häufig zitierte Wendung, mit der jemand am raschesten ausdrücken kann, worum es bei der Montessori-Pädagogik im Kern geht: »Hilf mir, es selbst zu tun« oder auch »Hilf mir, es allein zu tun«. Im 44. Kapitel behauptet die Reformpädagogin, dass dieser Satz einst von den Kindern im ersten Kinderhaus(5) in Rom(12) selbst ausgesprochen worden sei. Vielleicht ist das eine Stilisierung. Aber Montessori hebt ausdrücklich hervor, dass sich etwas derartiges zugetragen hat. Es hat sich so oder so ähnlich ereignet; sie hat es beobachtet und gibt es weiter: »Lässt man dem Kind nur ein klein wenig Spielraum, so wird es den Willen zur Selbstbehauptung sogleich mit einem Ausruf kundgeben wie: ›Das möchte ich tun, ich!‹« In den kindgemäßen Umgebungen der Kinderhäuser hätten die ambitionierten Kleinen immerfort »ihr inneres Bedürfnis mit dem bezeichnenden Satz ausgedrückt: Hilf mir, es allein zu tun.«
Dieser Satz ist ein klassisches Paradoxon und er ist somit in gewisser Weise, wie Montessori(46) klar erkennt, ein »widerspruchsvolle[r] Ausruf!« Der Erwachsene soll dem Kind einerseits helfen, zuarbeiten und unter die Arme greifen, um das, was es nicht vermag, zu bewerkstelligen – und doch soll das alles nur dazu dienen, dass das Kind dann wiederum seine eigene Lernarbeit eigenständig ausführen kann. Das heißt, dass der Erwachsene dem Kind gerade nicht jede herausfordernde, schwierige oder anstrengende Tätigkeit abnimmt. Noch viel weniger ist damit gemeint, dass er nur passiv neben dem Kind sitzt und es sich völlig selbst überlässt. Erfordert ist ein Geschick, ein Gefühl, eine nur durch Erfahrung zu erwerbende Sensibilität dafür, den richtigen Zeitpunkt erkennen zu können, in dem einem Kind sachte und liebevoll(2) geholfen werden soll, um es zu sich selbst zu führen.
Bedeutsam und maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, dass das selbständig lernende(7) Kind von einem helfenden Lehrer oder von einer unterstützenden Lehrkraft niemals aus seiner Konzentration gerissen wird. Das allem übergeordnete Ziel der Lernarbeit ist es, wie sie im 25. Kapitel schreibt, dass die Kinder gemeinsam still und vor allem »ruhig« sind, »jedes ganz mit seiner eigenen Aufgabe beschäftigt«. Das gilt insbesondere dann, wenn sie sich mit den Kartonbuchstaben beschäftigen, mit denen sie Lesen(4) lernen. Immer wieder spricht Montessori(47) von der »begeisternden Beschäftigung« der Kinder mit der Schrift, mit den Buchstaben, »auf die sich die Seelen der Kinder völlig konzentriert(3) hatten«, wenn sie sich schon in den ersten Tagen des Kinderhauses(6) in Rom(13) damit beschäftigten.
Konzentration(4) ist die absolute Versenkung ins eigene Tun, in die Arbeit(1) an einem interessanten Gegenstand, der die Aufmerksamkeit im Idealfall so sehr absorbiert, dass äußere Unruhe und Ablenkung vom Kind gar nicht mehr als solche wahrgenommen werden. Im 19. Kapitel berichtet Montessori(48) von einem Experiment, dass sie einst mit einem dreijährigen Mädchen durchführte, um zu sehen, wie vertieft ein Kind im Extremfall sein kann. Als sie beobachtete, wie sich dieses Mädchen einmal aus einem eigenständigen Interesse(2) heraus mit dem ihm zur Verfügung gestellten Material(7) – Zylinder und Steckblöcke – intensiv und hochkonzentriert beschäftigte, wollte die Pädagogin feststellen, »bis zu welchem Punkt die eigentliche Konzentration der Kleinen gehe«. So ersuchte sie als Leiterin des Kinderhauses(7) eine dort mitarbeitende Lehrerin darum, alle übrigen Kinder singen und herumlaufen zu lassen, was auch geschah, ohne dass das Mädchen sich in seiner Konzentration hätte stören lassen. Auch als Montessori das Sesselchen ergriff, in dem sich das spielende Kind befand, und auf einen Tisch stellte, spielte sie mit dem Material(8) auf dem Schoß immer weiter. Erst als es für sich die Arbeit(2) für beendet erklärte, blickte sie auf, schaute sich um, »so als erwachte sie aus einem Traum, und lächelte mit dem Ausdruck eines glücklichen Menschen«. Es war offenbar geworden, dass sie keines der Ablenkungsmanöver bemerkt oder beachtet hatte. Wer konzentriert ist und sich nicht von seiner Sache abbringen lässt, handelt vollständig aus eigenem Antrieb(2).
Jenseits von Strafen(1) und Belohnungen(1) – Die intrinsische Motivation(2)
Indem Montessori(49) den größten Wert darauf legt, dass jedes einzelne Kind immer ganz aus sich heraus handelt – und deshalb auch auf eine im hohen Maße anregende Umwelt(6) mit auch noch so geeigneten Spiel-(3), Lern- und Arbeitsmaterialien(9) letztlich nicht reflexartig reagieren soll, sondern ein solches Angebot nur freiwillig und spontan(4) annimmt oder auch nicht –, hält sie auch ein jedes System von Strafen(2) und Belohnungen(2) für vollkommen abwegig. Schon der führende Pädagoge des Zeitalters der Aufklärung, der Engländer John Locke(1), der seine Karriere ebenfalls als Arzt begonnen hatte, hatte an der Wende zum 18. Jahrhundert erklärt, dass den Kindern das Lernen als Lernen(8) so schmackhaft gemacht werden sollte, dass es ihnen schon für sich genommen als der beste Lohn erscheinen musste. Darüber hinaus konnte ein äußerer Lohn kaum etwas bewirken und sollte auch nur so sparsam wie möglich verteilt werden. Aus dem gleichen Grund sprach sich Locke gegen Strafen aus, denn diese würden niemals die Lust am Lernen(9) vermitteln können, um die es doch letztlich beim erfolgreichen Unterricht ging. Auch Prügelstrafen sollten daher nur als äußerstes Mittel zum Einsatz kommen.
Was Locke(2) und andere Aufklärungspädagogen in seiner Nachfolge mit diesen Überlegungen schon lange vor ihr vorbereitet hatten, das radikalisierte Montessori(50) nun noch einmal. Nicht sparsamer Lohn oder nur seltene Bestrafung(3) war nunmehr ihr Motto, sondern sie setzte sich dafür ein, zukünftig im Kontext des Lernens überhaupt keinen Lohn mehr auszusprechen und gar keine Strafen zu verteilen. Im 22. Kapitel, das die Überschrift »Belohnungen(3) und Strafen« trägt, führt sie diese Auffassung näher aus. Sie erinnert sich in diesem Zusammenhang daran, dass die Kinder zuvor ohnehin nicht besonders viel auf Belohnungen oder Strafen gegeben hätten. Als es dann auch durch Montessoris Einwirken gar keine Sanktionierungsmittel mehr gab und das Lernen(10) für sich überzeugte, sei in den Kindern »ein Bewusstsein(2) und Gefühl der Würde(1) erwacht, das sie vorher nicht gekannt hatten.«
Eine gute Pädagogik ist demnach darauf aus, alles aus der Lernsituation zu verbannen, was einen von außen winkenden Lohn als Köder anbietet oder, was noch schlimmer ist, eine angedrohte Strafe(4) als Angstmittel nutzt. Kinder sollten also niemals zu etwas gebracht werden, was sie nicht von sich aus tun wollen, sonst gleicht die Erziehung einem Willkürakt, mechanischem Drill oder einer Dressur. Da die von Montessori(51) verpönte Strafe ja prinzipiell mit Angst(1) arbeiten will, widmet sie auch diesem für Kinder so lähmenden Gefühl mit dem 39. Kapitel einen längeren Abschnitt im Buch. Ein ängstlich gemachtes Kind ist möglicherweise fügsam, aber zugleich verstört, gehemmt und schüchtern. Auch kann es bei ihm zu Psychosen(1), Neurosen oder gar Wahnzuständen kommen. Schon in ihrer Doktorarbeit hatte Montessori sich mit Formen der Paranoia beschäftigt. Daher weiß sie sehr gut, dass Angstpsychosen, die sich bei Erwachsenen zeigen, auf Formen der Angst zurückgehen, die sie als Kinder entwickelt haben – zumeist deshalb, weil sie einst unter der Gewalt von Erwachsenen standen, die Gehorsam erzwangen, indem sie »die unklare Bewusstseinsstufe des Kindes« dazu ausnutzen, um ihnen Angst geradezu »einzuimpfen«. So empfindet Montessori es als einen der wichtigsten Aufträge aller Schulen und aller dort wirkenden Erzieher, darauf hinzuwirken, dass Ängste bei Kindern nach Möglichkeit völlig abgebaut werden. Sie ist stolz darauf, dass in ihren Einrichtungen jede Form der Angst »entweder sehr bald spurlos verschwand oder sich überhaupt gar nicht erst zeigte.«
Wenn ein Kind ohne Angst(2) vor Strafen(5) und ohne Aussicht auf Belohnung(4) spontan(5) und gerne lernt, dann stellt es damit unter Beweis, dass es sich beim Lernen(11) letztlich um eine Tätigkeit handelt, die um ihrer selbst willen ausgeübt und angestrebt wird. Montessori(52) setzt diese auf der Grundlage einer intrinsischen Motivation(3) durchgeführte Lernaktivität in Beziehung zum sogenannten »Arbeitsinstinkt(2)« – dessen Beschreibung sie das 43. Kapitel widmet –, der ihres Erachtens in jedem Menschen angelegt ist und waltet. Wenn beispielsweise gesagt wird, dass das Kind spielt, dann sollte man daher eigentlich eher davon sprechen, dass das Kind einer freiwilligen Arbeit(3) nachgeht, wodurch es herausfindet, »was ihm zur Entwicklung der eigenen Funktionen erforderlich ist«. Dadurch wird sich das Kind der eigenen Kräfte und Fähigkeiten bewusst, wird befähigt zur selbständig vorgenommenen »Persönlichkeitsbildung« oder zu dem, »was man die Freiheit des Kindes« nennen kann. Denn »ohne Arbeit kann sich die Persönlichkeit(3) nicht bilden«. Die Arbeit, zu der hin ein Weg ohne Belohnung und ohne Bestrafung beschrieben werden muss, ist laut Montessori »eine innere Neigung der menschlichen Natur«, der in den Schulen endlich der ihr gebührende Freiraum eröffnet werden muss.
Die kindliche Arbeit(4) ist, weil sie experimentell und spielerisch vorgeht, eine besonders kreative Tätigkeit, die deswegen auch stark der Arbeit eines Forschers ähnelt. Deshalb sagt Montessori(53) über sie vergleichend: »So sieht etwa die Arbeit des Erfinders aus, die Arbeit des Künstlers und die Arbeit dessen, der unter heldenhaften Anstrengungen ein unbekanntes Gebiet der Erde erforscht.« Aus solchen Impulsen geht die menschliche Kultur(1) hervor wie auch der Fortschritt der Gattung, weshalb die Art der Arbeit, wie sie von Kindern ausgeübt wird, »reizvoll und unwiderstehlich« ist. Sie hebt den Menschen »über alle Irrungen und Abwegigkeiten hervor.« Montessori wird fast hymnisch, wenn sie den Lobpreis der schöpferischen(2) Arbeit anstimmt und sagt: »Denn ausschließlich durch das Kind wird der Mensch aufgebaut.« Die Lernarbeit des Kindes, sein Ausprobieren der vorhandenen Möglichkeiten, folgt nicht dem Gesetz des geringsten Kraftaufwandes, sondern eher einem gegenteiligen Programm, »denn es verbraucht für eine zwecklose Arbeit eine ungeheure Energiemenge«. Zugleich führt dieser Energieverbrauch zu gesteigertem Energiegewinn: »Das Kind ermüdet nicht bei der Arbeit; es wächst an der Arbeit und die Arbeit(5) erhöht seine Energie.« Derart beschaffen ist die Qualität der intrinsischen Motivation(4), die Montessori mit einem wahren Wunder(1) vergleicht. Und dieser »innere Antrieb(3) des Kindes« ist das, was ein guter Erzieher in seiner beobachtenden und helfenden Tätigkeit mit Freuden zur Entfaltung kommen lassen soll.
Disziplin(1) und Korrektur(1)
Da nun die eigenständige, spontane(6) und freiwillige Beschäftigung des Kindes gegen alle äußeren Formen des Zwanges(2) und andere bevormundenden Erziehungsvorgaben in ihrem Eigenrecht als von einem natürlichen Instinkt(3) geleitet geschützt werden soll, mag es zunächst in gewisser Weise unverständlich wirken, dass Montessori(54) auch auf Maßnahmen der Disziplin(2) beharrt. Denn ist Disziplinierung nicht etwas, was der angestrebten und von den Kindern auch gerne in Anspruch genommenen völligen Freiheit der Wahl(3) nicht geradewegs zuwiderläuft? Doch insistiert die Autorin im 25. Kapitel ihres Buches, dessen Überschrift schlicht »Disziplin« heißt, explizit auf dem gleichzeitigen »Zusammenbestehen« von »Disziplin und Spontaneität«. Was ist darunter zu verstehen? Oder, wie sie selbst rhetorisch fragt, woher stammt jeweils bei den unter ihrer Aufsicht spielerisch arbeitenden Kindern »diese vollkommene Disziplin, die noch im tiefen Schweigen vibrierte, dieser Gehorsam, der im Voraus erriet, was er ausführen sollte?«
Man kann Disziplin(3) gewiss als eine unter äußerem Druck und nur notgedrungen erworbene Charaktereigenschaft bezeichnen, als ein erfolgreiches Ergebnis von harschen und unerbittlichen Disziplinierungsmaßnahmen, die sich auf den Begriff der Zucht(1) bringen lassen. Doch das ist bei Montessori(55) nun gerade nicht gemeint. Für sie ist Disziplin, ganz im Gegenteil, eine bewusste Haltung – oder besser noch: eine Aktivität –, die sich einzig der von ihr immer wieder angesprochenen intrinsischen Motivation(5) verdankt, jedenfalls dann, wenn es sich um eine aus ihrer Sicht echte und nicht nur aufgenötigte Disziplin handelt. Denn jede Form von Disziplin, die diesen Namen verdient, ist in ihrem Ursprung Selbstdisziplin. Sie erwächst aus einer ständig wiederholten Tätigkeit, die für sich genommen so interessant ist, dass sie immer von neuem angestrebt wird. Insofern ist Disziplin nichts anderes als die – wie es im Titel des 19. Kapitels heißt – freiwillige »Wiederholung der Übungen(3)« mit jenen in dieser Hinsicht geeigneten Materialien(10), die Montessori den Kindern bereitstellt. Dieses Verständnis von Disziplin stimmt im Übrigen mit der ursprünglichen Bedeutung der lateinischen Vokabel disciplina überein, die so viel heißt wie »beständige Übung« oder »regelmäßiges Exerzitium«. Ohne diese Art der Disziplin könnte es niemals Könnerschaft geben, und ohne ein auf Können beruhendes Virtuosentum ließe sich wiederum keine Freiheit denken.
Lässt man dieses Verständnis von Disziplin(4) als Leser auf sich wirken, scheint es einmal mehr so, als habe nichts und niemand das Recht und die Befugnis, von außen auf das Kind einzuwirken – weder fordernd, noch mit Zwang(3), noch auch nur in irgendeiner anderen Weise korrigierend(2). Diese Auffassung der vollständigen pädagogischen Zurückhaltung ist nun schon im frühen 20. Jahrhundert, als Montessoris Lehre weltweite Berühmtheit erlangte, von scharfsichtigen Gelehrten als fundamentales Manko beschrieben worden. Eine der klügsten Kritiken der Pädagogik des ausschließlich selbständigen, freiwilligen und nur intrinsisch motivierten(6) Lernens(12) stammt aus der Feder des protestantischen Theologen Karl Barth(1). Als er im Wintersemester 1928/29 an der Universität Münster(1)