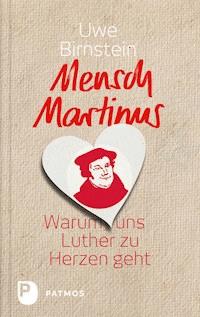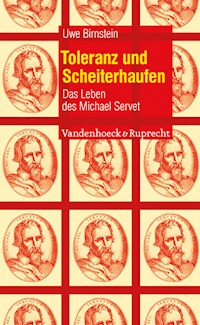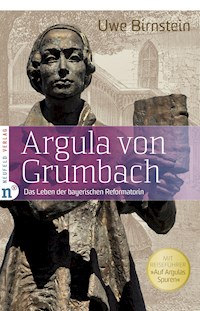7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wissenswertes von einem, der weiß, wie man mit Vorurteilen aufräumt
- Ein populärwissenschaftliches Lexikon – spritzig, intelligent und kenntnisreich geschrieben
- Auch zum Verschenken geeignet!
Mit ironischem Augenzwinkern und der ihm eigenen Leichtigkeit bahnt Uwe Birnstein einen Weg durch die unzähligen Vorurteile, die es über das Christentum gibt. Dabei schöpft er aus seinem immensen Wissensfundus und seziert unterhaltsam und humorvoll die geläufigsten Irrtümer aus den Bereichen Bibel, Kirchengeschichte, Konfession und christliches Leben.
Wer also wissen möchte, ob die Bibel keine Lügen enthält, die Priester keinen Sex haben oder Christen die besseren Menschen sind, ist mit diesem Kleinen Lexikon christlicher Irrtümer bestens bedient.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen
Der evangelische Theologe Uwe Birnstein (geboren 1962) arbeitet seit 1989 als Autor und Redakteur für Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen. Er veröffentlichte mehrere Bücher zu theologischen und historischen Themen. Letzte Buchveröffentlichung: »… und führe sie in Versuchung!« Das geheime Handbuch des Teufels, München 2010.
www.birnstein.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
»Das Elementarwissen über den christlichen Glauben nimmt ab!« Selten sieht man Gesichter von Kirchenvertretern so besorgt wie angesichts dieses Befundes. Es ist ja auch deprimierend: Da lebt man schon im Abendland, dessen Geschichte ohne das Christentum gänzlich anders verlaufen wäre; da mühen sich Heerscharen von Geistlichen ab, Sonntag für Sonntag den Glauben zu erklären und auszulegen; da sind immerhin zwei Drittel der Gesellschaft noch Mitglieder einer Kirche – trotzdem sieht es mau aus, geht es um die Inhalte des christlichen Glaubens. Weihnachten ist noch bekannt – aber Pfingsten, was war da doch gleich? Und warum feiern Katholiken den frohen Leichnam? Bei der frohen Botschaft des Matthäus denken viele eher an die Jungfraueneskapaden des gleichnamigen Fußballers als an die Bergpredigt. Und das Wichtigste an Ostern sind die Eier. Jeder Kirchenskandal verdeckt das Wissen um die vielfältigen Arbeitsgebiete der Kirchen und um das unersetzbare Engagement der Christen für eine humane Gesellschaft. In den bemüht glaubenskritischen Titelgeschichten der großen Publikumszeitschriften, die diese ihren Lesern alljährlich zum Heiligen Abend unter den Baum legen, wird mit pubertärem Pathos ein Glaube zerpflückt, der eher einem Zerrbild als den Tatsachen entspricht. Armes Christentum. Wäre es doch nur der Mangel an Wissen, wäre da doch nur Leere beim Stichwort »Christentum«! Der Befund ist noch verheerender: Halbwissen verbindet sich mit Vorurteilen und Klischees; sich sonst kritisch gebärdende Zeitgenossen tragen unkritisch Irrtümer über das Christentum weiter. Sie meinen zu wissen, dass Jesus nicht auferstanden ist, sondern scheintot war; in jedem Beichtstuhl, erst recht in jedem Pfarrhaushalt vermuten sie Unanständiges, außerdem bezichtigen sie Christen des Duckmäusertums und der Prüderie.
Und dann gibt es da noch eine weitere Gruppe, die Irrtümer hegt und pflegt: Viele Gläubige zimmern sich in bewundernswerter, fast schon anarchischer Weise einen Glauben zusammen, der fröhlich Christliches mit Volkstümlichem mischt. Sie bilden die sympathische Fraktion der Irrtums-Apostel. Sie zu belehren steht allenfalls jenen an, die nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Humor und Leichtigkeit versuchen, das Schwere leicht zu sagen. Irrlehrer wurden lange mit bitterernstem Eifer verfolgt. Irrtümer als solche zu entlarven, kann hingegen eine lustvolle Angelegenheit sein, bei der erlösende »Aha«-Momente und herzhaftes Lachen erlaubt sind. Christen dürfen nicht streiten? Heilige haben sündlos gelebt? Päpste leb(t)en keusch? Gott wohnt in Kirchen? Lachen befreit — auch die Neugier. Und weist all jene in die Schranken, die zwar dogmatisch korrekt glauben, darüber aber die Leichtigkeit des gläubigen Seins verloren haben. Gott bewahre!
Berlin-Kreuzberg (nein, dort wurde Jesus nicht gekreuzigt!) im März 2011
Uwe Birnstein
A
Das ABENDMAHL verbindet die Christen miteinander
Ein Hauch von Harmonie wehte im Jahr 2003 durch die Berliner Frühlingsluft. Erstmals hatten die evangelische und die römisch-katholische Kirche ihre Gläubigen zum gemeinsamen Kirchentag eingeladen. Nicht die Unterschiede, sondern die Einheit der Konfessionen sollte auf diesem Glaubenstreffen im Vordergrund stehen.
Dennoch war ein Trennendes nicht aus der Welt zu schaffen. Evangelische und katholische Christen würden auf dem Kirchentag trotz aller Einheitsbekundungen wieder nicht gemeinsam Abendmahl feiern. Für einen Gottesdienst lang wurde der Wille zur Gemeinsamkeit außer Kraft gesetzt. Katholische besuchten die Eucharistie, Evangelische das Abendmahl. Jede Konfession für sich.
Aus der Distanz betrachtet ein skurriler Sachverhalt: Christen, die sich auf die Bibel berufen, dürfen nicht gemeinsam »an den Tisch des Herrn treten«, wie es in der kirchlichen Sprache heißt. Warum eigentlich nicht? Wo doch Jesus der biblischen Überlieferung zufolge seine zwölf Jünger, sogar seinen Verräter Judas, zu Brot und Wein einlud. »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird«, sagte Jesus am Abend vor seiner Gefangennahme seinen Jüngern, »das tut zu meinem Gedächtnis.«
Gerade an diesen Worten hat sich ein bisweilen unerbittlicher Streit entzündet, der bereits seit Jahrhunderten andauert. Die Gründe für die Trennung klingen theologisch nachvollziehbar; dass sie jedoch kirchentrennend wirken, können viele Christen beider Konfessionen schwer verstehen. Aus katholischer Sicht verwandeln sich während der Liturgie Brot und Wein in Leib und Blut Christi. »Ein Mysterium«, erklären Theologen und beharren darauf, dass sich die Substanz der irdischen Zutaten real und wesenhaft verändere. (In Fachgesprächen wird diese Wandlung »Transsubstantiation« genannt, der die tatsächliche Anwesenheit, die »Realpräsenz« Christi folge.) Nur katholische Christen dürfen den Herrn in dieser Form aufnehmen.
Die Kirchen der evangelischen Tradition verstehen das Abendmahl hingegen eher als Gedächtnismahl, bei dem Brot und Wein Zeichen der Gegenwart Christi sind. Die Gemeinschaft der Christen, die an den Altar tritt, ist ihnen wichtiger als die reale Verwandlung. Mit diesem offenen Verständnis können Evangelische vollen Herzens katholische Mitchristen einladen und mit ihnen am Altar die Gemeinschaft feiern. Denen ist es aber bislang verboten. Dass sich diese Trennung der Christenheit aufheben möge, betonen Christen aller Konfessionen. Einen Zeitpunkt mag niemand nennen.
ABLASS gab es nur im Mittelalter
Wie kann ich meine Sünden und begangenen Fehler ungeschehen machen? Eine naheliegende Frage, nicht nur für Gläubige. Die Kirche hat sich eine spirituelle Methode einfallen lassen, den »Ablass«. Er kehrt die Sünden nicht unter den Teppich, aber verringert die Zeit der Strafen dafür, zahlt sie ab aus dem sogenannten Gnadenschatz, den die Kirche verwahrt. Eine päpstliche Behörde legt fest, zu welchen Zeiten Ablass gewährt wird — zuletzt war das beispielsweise im »Priesterjahr« 2009 möglich, ebenso beim Weltjugendtreffen in Köln 2005. Im 15. Jahrhundert funktionalisierte die Kirche den Ablass zur praktischen Geldmaschine: Der Petersdom sollte errichtet werden, viel Geld war nötig. Überall im Reich wurden Ablassbriefe verkauft — Urkunden, die eben jenen Straferlass schwarz auf weiß zusicherten. Das brachte den Wittenberger Augustinermönch Martin Luther dermaßen in Rage, dass er 95 Thesen gegen den Ablass veröffentlichte – was schließlich zu einer Kirchenspaltung führte. Schon am Ende des 16. Jahrhunderts sah die katholische Kirche ein, dass Ablassbriefe nicht im Sinne des christlichen Glaubens sind. Jeder, der sie weiter verkaufte, wurde mit Exkommunikation bedroht. Der Ablass jedoch wird bis heute praktiziert und provoziert evangelische Christen wie eh und je.
Das Christentum vertritt einen ABSOLUTHEITSANSPRUCH
»Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.« So steht’s geschrieben, bei Johannes im 14. Kapitel, Vers 6. Das ist Klartext, da ist nichts dran zu deuteln: Wer Gott finden will, muss an Jesus Christus glauben; wer es nicht tut, geht in die Irre. Eigentlich praktisch. Schließlich kann man sich ja seines eigenen Glaubens gar nicht mehr sicher sein bei der Fülle an Religionen und Glaubensaussagen, denen man täglich überall begegnet. Doch was ist bloß mit den Menschen los: Obwohl so eindeutig in der Bibel steht, wie sie Gott finden können – sie wollen es partout nicht wahr haben! Man sollte diesen Glaubensstörern die Wahrheit überhaupt mal deutlicher vor Augen führen, vielleicht lassen sich einige von ihnen dadurch noch retten. Schließlich hat Jesus ja gesagt: »Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe« (Matthäus 28,19f). So weit, so biblisch — oder? Gäbe es da nicht auch andere Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Da heißt es nämlich: »Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen?, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst« (Matthäus 7,3ff). So einfach scheint es also nicht zu sein mit dem Glauben und der einen Wahrheit für alle.
Jede Religionsgemeinschaft geht natürlich davon aus, dass ihre Überzeugungen wahr sind. Ein solcher Anspruch auf Wahrheit aber bedeutet auch, dass diese Wahrheit eigentlich für alle Menschen Gültigkeit beanspruchen müsste. In der Realität sieht es jedoch so aus, dass unterschiedlichste Religionen verschiedenste Überzeugungen vertreten und jeweils für die richtige halten. Christen glauben, dass sich im Leben, Wirken und Sterben Jesu Christi Gott selbst den Menschen offenbart und ihnen damit den Weg hin zu sich eröffnet hat. Eine schöne und als Glaubensaussage akzeptable Vorstellung. Problematisch wird es allerdings, wenn der Absolutheitsanspruch ins Spiel kommt: »Niemand kommt zum Vater denn durch mich« – und behauptet wird, die Menschheit finde ihre Erfüllung nur, wenn alle diesen einen Weg gehen. Lässt sich ein solcher Anspruch heutzutage überhaupt noch glaubwürdig vertreten?
Ja, meint die katholische Kirche bis heute — während der Protestantismus sich nicht festlegen mag – und fordert zusätzlich die Anerkennung der Autorität der Kirche als Vermittlerin der Wahrheit. Da die Kirche jedoch auch ein Interesse an dieser Vermittlung hat, sieht sie Angehörige anderer Religionen nicht etwa sofort als verloren an, sondern richtet ihr Augenmerk auf »das Religiöse« an diesen Religionen und erkennt dies an, da nur so eine Auseinandersetzung mit Andersgläubigen möglich sei. Fragt sich nur, wer festlegt, was »das Religiöse« eigentlich ist und wie dialogbereit sich die Kirche zeigt, wenn die Andersgläubigen einfach nicht einsehen wollen, dass allein die katholische Kirche den richtigen Weg kennt.
Geschichtlich gesehen, ist der Absolutheitsanspruch eine recht junge Erscheinung. Zwar tauchen, wie an Jesu Aussage im Johannesevangelium zu erkennen ist, ähnliche Gedanken schon in der Bibel auf. Allerdings sollte man sich bewusst machen, dass Bibeltexte Glaubensaussagen von Menschen formulieren, die für ihre Überzeugungen werben wollten, und nicht in erster Linie als Selbstdefinition einer Religion zu lesen sind. Das Johannesevangelium beispielsweise wurde erst rund 100 Jahre nach Jesu Tod aufgeschrieben, es ist also relativ unwahrscheinlich, dass Jesus selbst diese Aussage formuliert hat. Viel wahrscheinlicher ist es, dass ihm der schon gewachsene Glaube seiner Anhänger in den Mund gelegt wurde, um die ersten Christen im Glauben zu bestärken.
Zur Zeit der Aufklärung wurde den Menschen immer bewusster, dass die Vorstellung von der einen wahren Religion kaum zu halten ist. Der Absolutheitsbegriff, der von der Vorstellung, alle anderen Religionen führten auf direktem Weg ins Verderben, bis zu der Vorstellung, alle Religionen würden sich im Laufe der Geschichte hin zum Christentum entwickeln, die unterschiedlichsten Denkmodelle hervorbrachte, konnte das Problem allerdings auch nicht lösen. Eine Position, die auch heute noch bedenkenswert scheint, stellte Lessing mit seiner Ringparabel in »Nathan der Weise« dar: Die Menschen können gar nicht erkennen, welche Religion die wahre ist und ob nur eine oder doch alle auf unterschiedliche Weise zum Ziel führen. Nicht die einzelne Religion steht im Mittelpunkt, sondern das Ziel, auf das sie alle zuführen und das wir Menschen nur unterschiedlich zu erklären versuchen. Eine reizvolle Position, die allerdings, wenn sie zu dem Eindruck führt, letztendlich sei alles gleichgültig, ihr Potenzial nicht ausschöpft. Denn ohne die Verankerung in einer konkreten Glaubensgemeinschaft verliert jeder Glaube schnell seine Grundlage. Als (protestantischer) Christ kann ich glauben, dass der Weg zum Ziel über den Glauben an Jesus Christus führt, aber ich kann nicht wissen, ob dies der einzige Weg für alle ist. Dennoch gibt es auch unter evangelischen Christen Verfechter eines rigorosen Absolutheitsanspruchs. In der Überzeugung, den richtigen Weg gefunden zu haben und Gottes Willen wortwörtlich aus der Bibel ablesen zu können, grenzen sie sich einerseits strikt gegen alles ab, was ihren Glauben in Frage stellen könnte, und versuchen andererseits mit großem missionarischem Eifer die Menschheit zu ihrem Glauben zu bekehren. Dafür, dass ein solches Verhalten einem friedlichen Zusammenleben auf der Welt nicht dienlich ist, hält die Geschichte unzählige Beispiele bereit. Echter Glaube lässt sich eben nicht erzwingen.
Was aber lässt sich dann tun, wenn ich mir angesichts der unzähligen Möglichkeiten, die mir offenstehen, gar nicht mehr sicher sein kann, was überhaupt richtig oder falsch ist? Wie einfach wäre es doch, wenn man nur die Bibel aufschlagen und nach passenden Versen für seine Überzeugung suchen müsste, um sich bestätigt und seines Glaubens sicher zu fühlen. Wenn es Prediger gäbe, die mir klar sagten, wo es langgeht. So einfach ist es nicht und das ist gut so. »Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?« Wenn man nicht alles bitterernst nimmt, was in der Bibel steht und sich einfach durch die Texte inspirieren lässt, könnte man sich zum Beispiel vornehmen, zunächst einmal das Brett vor dem eigenen Kopf zu entfernen, um dann zusammen mit anderen den besseren Ausblick zu genießen und gegenseitig an den noch verbliebenen Splittern arbeiten zu können. Sich auf der Grundlage des eigenen Glaubens mit dem Fremden auseinandersetzen – ein anstrengender Weg. Aber ein spannendes Unterfangen, bei dem man seine Identität nicht aufgeben muss, sondern im Gegenteil viel über sich selbst und eigene und fremde Wege lernen kann.
Auf dem ALTAR wird geopfert
Irrtum oder nicht? Die Beantwortung dieser Frage entscheidet sich letztlich auch an den unterschiedlichen Vorstellungen der Konfessionen. Denjenigen, die noch nie einen Gottesdienst in einer Kirche besucht haben, sei aber zur Beruhigung gesagt: Dort werden keine blutigen Opferrituale vollzogen, auch wenn das den Christen zu Beginn ihrer Geschichte tatsächlich unterstellt wurde. Und damit wären wir am Anfang. Zur Zeit der ersten Christen nämlich gab es in den Versammlungsräumen noch gar keine Altäre als feste Einrichtungsgegenstände. In Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern wurde zu den Gottesdiensten jeweils ein mit einem weißen Tuch bedeckter Holztisch in den Raum hineingetragen, der »Tisch des Herrn«. Die ersten Christen grenzten sich zunächst sogar scharf von der Vorstellung ab, dass an diesen Tischen Opfer dargebracht würden. Im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss des Messopfergedankens – der Vorstellung also, im Vollzug des Abendmahls wiederhole beziehungsweise vergegenwärtige sich unblutig der Opfertod Christi am Kreuz – änderten sich allerdings auch Nutzung und Gestaltung der christlichen Altäre. Aus dem beweglichen »Tisch des Herrn« wurden feststehende Steinaltäre im Zentrum des Kirchenraumes, die in ihrer Quaderform und Ausgestaltung eher antiken Opferaltären als Tischen ähnelten. Auch die aufkommende Heiligenverehrung brachte neue Aspekte in die Gestaltung der Altäre ein. Zunächst wurden immer mehr Kirchen und Altäre über den Grabstätten von Märtyrern errichtet. Da aber nicht überall genug Märtyrer zur Verfügung standen, begann man damit, Reliquien in den Altar einzumauern – daher die sargähnliche Form einiger Altäre der Renaissancezeit. Auch heute noch befindet sich in katholischen Kirchen in jedem Altar eine solche Reliquie.
Von den Reformatoren wurde der Gedanke einer Darbringung des Messopfers verworfen. Dass Luther die Vorstellung einer Vergegenwärtigung dieses Opfers im Abendmahlsgeschehen nicht ganz so strikt verwarf wie Calvin und Zwingli, zeigte sich in der Folge darin, dass er den Begriff Altar beibehielt, während seine Kollegen den Altar nun wieder »Tisch« nannten. Gebete der Gemeinde vor dem Altar und besonders die geschmückten Erntedankaltäre zeigen dennoch, dass auch den evangelischen Kirchen die Vorstellung des Altars als Ort des Opfers im Sinne eines Dankopfers nicht völlig fremd ist. Das Verständnis des Altars als »Tisch des Herrn« hat sich allerdings sowohl in den evangelischen als auch in der katholischen Kirche bis heute als das vorherrschende durchgesetzt.
Christen haben keine ANGST vor dem Tod
Wir alle sind sterblich. Als Menschen wissen wir darum und dennoch erscheint der Tod den meisten von uns als etwas Fremdes, Bedrohliches. Mit dem Tod konfrontiert, werden wir uns unserer eigenen Begrenztheit bewusst. Unkontrollierbar kann er in unser Leben hineingreifen und uns trennen von allem, was uns vertraut und lieb ist. Paulus nennt den Tod in einem Brief an die Korinther den »letzten Feind« (1. Korinther 15,26), und er erinnert die Gemeinde an die Hoffnung, die Christen angesichts des Todes haben dürfen: Jesus Christus hat den Tod überwunden und ist auferstanden und hat auch uns damit den Weg zur Auferstehung eröffnet. Weil Gott seine Schöpfung liebt und sie nicht untergehen lässt, hat er uns seinen Sohn geschickt, der uns den Weg über den Tod hinaus weist. Nicht der Tod behält das letzte Wort, sondern Gott in seiner Liebe zu uns, die über den Tod hinaus reicht. Das ist die Hoffnung der Christen. Dennoch haben Christen, wie alle anderen Menschen auch, Angst vor dem Tod. Denn letztendlich bleibt der Tod auch für uns etwas Unbegreifliches. Selbst Paulus, der so überzeugt ist von der Auferstehung Jesu, da er den Auferstandenen »gesehen« hat, kann im Grunde nur sagen, dass im Tod alles ganz anders wird. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland, die sich als Christen bezeichnen, glauben nicht daran, dass es nach dem Tod noch etwas geben könnte. Nur jeder zehnte Deutsche denkt überhaupt häufiger an seinen eigenen Tod. Mit Ungewissheit und der beängstigenden Fremdheit des Todes müssen also auch Christen leben. Wenn aber Angst, Hoffnungslosigkeit und das Verdrängen des Todes die Überhand gewinnen, was bleibt dann noch von der christlichen Botschaft? Schon Paulus sagt in seinem Brief an die Korinther: Wenn wir nur für das irdische Leben auf Christus hoffen, haben wir die eigentliche Botschaft nicht verstanden, die sich immer auch auf das Himmlische bezieht, und sind im Grunde schon jetzt verloren. Eine traurige Vorstellung. Dabei kann das Wissen darum, dass wir sterblich sind, nicht nur Angst machen, sondern uns Menschen nachdrücklich vor die Frage stellen, wie wir eigentlich leben wollen. Im Wissen um unsere Endlichkeit können wir die Verantwortung erkennen, unser Leben bewusst und sinnvoll zu gestalten. In diesem Sinne muss der Tod nicht nur ein fremder, furchteinflößender Feind bleiben, er kann auch zu einem wunderbaren Ratgeber werden. Wer seinen Tod befragt, erfährt, was wirklich wichtig ist im Leben und was nicht. Die Zeit hier ist begrenzt. Der Tod lehrt uns, dass wir sie nicht vergeuden und jede Gelegenheit nutzen sollten, unser Leben im Blick auf das wirklich Wesentliche zu gestalten. Der Tod bleibt nur solange ein Feind des Lebens, wie wir ihn ignorieren und verdrängen, solange wir uns einbilden, wir hätten die alleinige Kontrolle über den Verlauf unseres Lebens, solange wir meinen, Verantwortung und Entscheidungen über Wesentliches und Unwesentliches immer wieder auf morgen verschieben zu können. Nur wenn wir ihn verdrängen, bis er überraschend kommt, um uns zu zeigen, was wir versäumt haben, lassen wir ihn zu einem quälenden Feind werden. Wer aber mit seinem Tod lebt, kann sich von ihm die Fülle des Lebens zeigen lassen. Im Vertrauen auf die Treue Gottes, die über den Tod hinaus trägt, können wir so schon jetzt etwas von der Qualität des ewigen Lebens erahnen. Wer auf die Zusage vertraut, die Gott den Menschen nach christlichem Glauben in Jesu Tod und Auferstehung macht, hat den Tod schon jetzt überwunden und das ewige Leben in sich (Johannes 11,25f). Christen können darauf vertrauen, dass der Tod nicht das letzte Wort behält. »Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?«, kann Paulus angesichts dieser Hoffnung fragen.
Jesus war ASKET
Das Christkind in der ärmlichen Krippe. Ein Mann, der sich von dem Wüstenbewohner Johannes hat taufen lassen und daraufhin selbst vierzig entbehrungsreiche Tage in der Wüste verbrachte. Ein besitzloser Wanderprediger, der der Ansicht war: »Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme« (Markus 10,25). Und der leidende Gekreuzigte: Dieser Mann muss doch ein entbehrungsreiches Leben geführt haben! Und hat er das mit seinen radikalen Forderungen nicht auch von seinen Jüngern verlangt? – Er »gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe, und nicht zwei Hemden anzuziehen« (Markus 6,8f). Soll er nicht sogar den Essenern nahegestanden haben, dieser strenggläubigen jüdischen Sekte, deren Mitglieder nach radikalen Vorschriften enthaltsam und abgeschieden lebten? Ganz klar: Jesus muss ein Asket gewesen sein.
Warum aber wurde ihm dann von einigen Gegnern vorgehalten, er sei »ein Fresser und Weinsäufer« (Matthäus 11,19)? Und tatsächlich, bei einer Hochzeit hat er sogar Wasser in Wein verwandelt und auch sonst häufig mit seinen Jüngern und Mitmenschen zusammen gegessen und gefeiert. Wie lebte Jesus denn nun wirklich? Was erwartete er von seinen Jüngern? Und wie passte dies zu seiner Botschaft? Anders als der Täufer Johannes, der in der Wüste lebte, sich von Heuschrecken und Honig ernährte und der das unmittelbar bevorstehende Gericht Gottes verkündete, war Jesus kein Asket. Jesus erzählte den Menschen in vielen seiner Gleichnisse davon, dass das Reich Gottes schon hier auf Erden angebrochen sei. Für ihn war das ein Grund zur Freude. Daher konnte er auch keinen Anlass dafür sehen, warum Menschen versuchen sollten, durch besondere Enthaltsamkeit oder demonstratives Fasten die Nähe zu Gott zu suchen. Wenn das Reich Gottes schon angebrochen ist, kommt es nur noch darauf an, es zu erkennen und anzunehmen. Als Jesus gefragt wurde: »Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, und deine Jünger fasten nicht?«, antwortete er mit der Gegenfrage: »Wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist?« (Matthäus 9,18f). Askese als Selbstzweck fordert Jesus also nicht. Die Menschen werden vielmehr bewusst vor die Entscheidung gestellt, welches Verhalten ihnen angesichts des schon angebrochenen Gottesreiches angemessen erscheint.
In einer Zeit der Freude darf gefeiert werden; wer sich allerdings entscheidet, Jesu Botschaft anzunehmen, der muss sich ganz dafür entscheiden können – wenn ihm sein Besitz oder irgendetwas sonst auf der Welt wichtiger ist, wird ihm dies immer im Wege stehen. So kann Jesus zu dem jungen Mann, der ihn nach einer Möglichkeit fragt, das ewige Leben zu erlangen, sagen: »Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und komm und folge mir nach« (Markus 10,21). Ja, es kann sogar nötig sein, Heimat und Familie zu verlassen, um sich voll und ganz für das Reich Gottes entscheiden zu können. Jesus predigt Armut nicht als Ideal, sondern er weiß, wie leicht Besitz abhängig machen und von der Entscheidung für Gott abbringen kann. Nur wer sich von derartigen Abhängigkeiten frei macht, kann sich ganz in Gottes Hände begeben.
Aufgepasst aber, dass man bei einem solchen Vorhaben nicht gleich in neue Abhängigkeiten gerät! Denn auch davor warnt Jesus: Wer seinen Verzicht öffentlich macht, damit prahlt und sich von anderen bewundern lässt, ist gleich in die nächste Falle getappt. Er rät daher: »Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten« (Matthäus 6,16ff). Jesus stellt die Menschen vor die Entscheidung für Gott. Dazu braucht es keine Askese und kein frommes Verhalten. Gott ist schon da und das ist ein Grund zur Freude, die Menschen müssen sich nur für ihn entscheiden und alles, was dem im Wege steht, loslassen.
B
Jesus hatte einen BART
Seltsam, obwohl die Evangelien nichts über das Aussehen Jesu überliefern, erscheint er in allen gängigen Darstellungen wiedererkennbar als europäisch wirkender, bärtiger und langhaariger Mann. Kann Jesus tatsächlich so ausgesehen haben? Und wie kommt es zu dieser Einheitlichkeit der Darstellungen? Den ersten Christen ging es allein um die Botschaft von und über Jesus. Die Frage, wie er ausgesehen haben könnte, spielte dabei gar keine Rolle. Auch als vom dritten Jahrhundert an Abbildungen aufkamen, dienten sie zunächst hauptsächlich dazu, etwas über Jesus zu erzählen. Der jeweilige Künstler stellte Jesus einfach so dar, wie er ihn sich vorstellte. Ab dem vierten Jahrhundert jedoch kamen plötzlich die Darstellungen des bärtigen, langhaarigen Jesus auf, die bis heute unser Jesusbild prägen. Noch verwunderlicher scheint die Einheitlichkeit dieser Darstellungen, wenn man sich bewusst macht, dass sich die Künstler weder an Überlieferungen orientieren konnten noch einfach das gängige Schönheitsideal ihrer eigenen Zeit übernahmen. Woran also orientierten sie sich?
Das Turiner Grabtuch, ein Tuch, auf dem der Gesichtsabdruck eines bärtigen, langhaarigen Mannes zu erkennen ist, könnte den entscheidenden Hinweis geben. Unabhängig von der bis heute andauernden Diskussion um die Echtheit dieser Reliquie, die Jesus zeigen soll: Die frühen Darstellungen Jesu ähneln in verblüffender Weise dem Gesichtsabdruck auf dem Turiner Tuch, das zu damaliger Zeit im Besitz Kaiser Konstantins gewesen sein soll. Es scheint also wahrscheinlich, dass unser heutiges Jesusbild auf dieses Tuch zurückzuführen ist. Ob der Mann, dessen Gesicht dort verewigt ist, tatsächlich Jesus sein könnte, lässt sich allerdings wohl nie klären.
Wissen können wir heute nur, dass Jesus zwischen dreißig und vierzig Jahre alt wurde und für seine Zeit kein junger Mann mehr war. Da Judas ihn küssen musste, um ihn zu verraten, scheint Jesus sich in Gestalt und Aussehen wohl nicht auffällig von seinen Zeitgenossen unterschieden zu haben. Mumienporträts aus Ägypten und römische Münzen, auf denen Juden abgebildet sind, zeigen bärtige Südländer. Aber ob Jesus, dem Gebote nur wichtig waren, wenn sie der Entscheidung der Menschen für Gott dienten, sich an die alttestamentliche Vorschrift »Ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden noch euren Bart stutzen« (3. Mose 19,27) hielt oder nicht, wissen wir nicht. Auch wenn es in unserer an Bildern orientierten Zeit noch so faszinierend erscheint, nach dem wahren Aussehen Jesu zu forschen – was gelegentlich zu seltsamen Auswüchsen führt, so präsentierte der Sender BBC vor einigen Jahren ein angeblich wissenschaftlich rekonstruiertes Bild, das Jesus als einen urwüchsigen Typen mit breiter Nase und wirrer Kurzhaarfrisur zeigt –, vielleicht sollten wir uns lieber an das alte Gebot halten: »Du sollst dir kein Bildnis machen« (5. Mose 5,8). Schließlich kommt es auf Jesu Aussehen wirklich nicht an, sondern auf seine Botschaft.
Bei den Evangelischen gibt es keine BEICHTE
Kommt man als evangelischer Christ in eine katholische Kirche, fallen einem schnell einige Einrichtungsgegenstände auf, die man aus der eigenen Kirche nicht kennt. Vom Weihwasserbecken über den Tabernakel bis hin zu Heiligenfiguren und -altären. Am auffälligsten aber sind – besonders in älteren Kirchen – die großen schrankartigen Beichtstühle. Manch ein Film mag dem befremdeten Protestanten dann in den Sinn kommen, Gedanken an sündige Taten, das Beichtgeheimnis und sich daraus ergebende Verstrickungen, zehn Ave Maria für den begehrlichen Blick in Richtung Nachbarsjüngling — nein, so etwas gibt es bei den Evangelischen doch nicht! Oder?