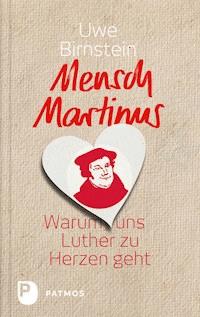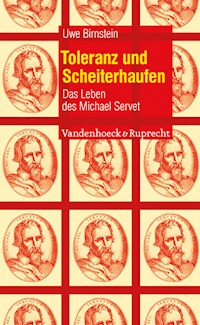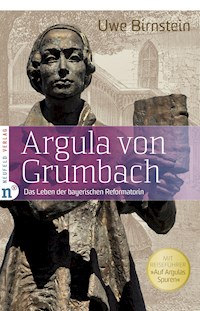7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pattloch eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Immer noch wartet Deutschland auf die Wiedervereinigung, immer noch trennt eine Mauer das Land: hier Katholiken, dort Protestanten. Sie wissen wenig voneinander, reden viel übereinander und sind überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen. Doch immer öfter wagen sie einen Blick über die Mauer und sehen blühende Gärten statt trockener Wüsten. Mit ironischem Augenzwinkern leuchten die Autoren den ökumenischen Alltag aus und haben einen sicheren Blick für das geliebte Vorurteil und die eigene Selbsttäuschung. Katholisch? Never! / Evangelisch? Never! von Uwe Birnstein und Georg Schwikart: als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Uwe Birnstein / Georg Schwikart
Katholisch? Never Evangelisch? Never
Warum Katholiken überflüssig und Evangelische die wahren Christen sindWarum Evangelische überflüssig und Katholiken die wahren Christen sind
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Immer noch wartet Deutschland auf die Wiedervereinigung, immer noch trennt eine Mauer das Land: hier Katholiken, dort Protestanten. Sie wissen wenig voneinander, reden viel übereinander und sind überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen. Doch immer öfter wagen sie einen Blick über die Mauer und sehen blühende Gärten statt trockener Wüsten. Mit ironischem Augenzwinkern leuchten die Autoren den ökumenischen Alltag aus und haben einen sicheren Blick für das geliebte Vorurteil und die eigene Selbsttäuschung.
Inhaltsübersicht
Uwe Birnstein Katholisch? Never!
Ach, ihr Katholiken!
Erst die Werke, dann die Gnade
Solus Katechismus
Ein Fels, auf dem alles ruht
Der dürre Zweig der Kirchengeschichte
Abendmahl – aber nicht mit allen!
Maria und die vielen anderen Heiligen
Die Last mit der Lust
Ja, wir Protestanten …
Glaube pur
Die Kraft des Wortes
Sinn und Geschmack für das Unendliche
Die Gedanken sind frei
Das protestantische Prinzip
Glaubensmut in dunklen Zeiten
Liturgie für den ganzen Menschen
Nicht alles, was glänzt …
Protestantische Profillosigkeit
Hirten unter Druck
Luther – ein evangelischer Heiliger?
Bibelglaube auf Abwegen
Ein Einfallstor für Fundamentalismus?
Die roten Kirschen jenseits des Zaunes …
Himmlische Gesten
Ein Lob der Beharrlichkeit
Zölibat oder Pfarrfamilie?
Viele Kirchen, eine Kirche
Gibt es im Himmel noch Protestanten und Katholiken?
Georg Schwikart Evangelisch? Never!
Ach, ihr Protestanten!
Immer auf der Suche nach dem gnädigen Gott
»Allein die Schrift« steht nicht in der Schrift
Die Sehnsucht nach Reinheit
Gottesdienst: Unterricht auf Kirchenbänken
Jeder Christ ein Held der Arbeit?
Die Protestanten und der Staat
Freiheit, die ihr meint
Zersplittert und mühsam zusammengehalten
Synodalissimus
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
Profile und Neurosen
Ja, wir Katholiken …
»Glaube de luxe«
Wurzel, Stamm und Krone
Messe für Geist, Leib und Seele
Unser aller Papst
Die Zentrale – der Vatikan
Bekenntnisfreude, Lebensfreude
Allen voran Maria
Die Tante im Kloster
Im Dialog mit den Religionen
Katholisch sein – ein Schicksal
Nicht alles, was glänzt …
Kritik aus Liebe
Der Zölibat – alles auf eine Karte setzen
Scheidung auf katholisch?
Der Protestant – das unbekannte Wesen
Die roten Kirschen jenseits des Zaunes …
Sehnsucht nach dem »Markt der Möglichkeiten«
Viele Kirchen, eine Kirche
Gibt es im Himmel noch Katholiken und Protestanten?
Uwe Birnstein Katholisch? Never!
Warum Katholiken überflüssig und Evangelische die wahren Christen sind
Ach, ihr Katholiken!
Ohne Ökumene geht es nicht – so weit besteht Einigkeit zwischen uns Protestanten und euch Katholiken. Doch was uns trennt, sollte nicht unter den Teppich gekehrt werden. Um also – werte katholische Christen – die Stimmung gleich ein wenig anzuheizen, wende ich mich zunächst den Irrtümern zu, denen ihr Katholiken anhängt.
Erst die Werke, dann die Gnade
»Wie finde ich einen gnädigen Gott?« Die Frage, die Martin Luther vor knapp 500 Jahren in seiner Klosterzelle schier verzweifeln ließ, klingt alt, ist aber noch immer aktuell. Modern formuliert lautet sie so: Ich racker mich ab, leiste viel, mache und tue – und fühle mich dennoch ständig ungenügend. Ich opfere meine Zeit, meinen Einsatz, meine Kraft für andere – und nichts kommt zurück. Ich gebe mir Mühe, eine gute Mutter, ein interessanter Partner, ein hilfreicher Mensch zu sein – und spüre Leere und Schuld. Ich tue gute Werke, bete und beichte, gehe regelmäßig zur Kirche – aber Gott bleibt mir seltsam fremd.
Wer so spricht und fühlt, stammt höchstwahrscheinlich aus katholischer Tradition. Katholisch sein bedeutet: »Ich möchte an den gnädigen Gott glauben. Aber ich trau mich nicht.« Vielen Menschen fällt es schwer, sich beschenken zu lassen. Auch wir Evangelische tun uns hart damit. Aber die Botschaft des sich ohne Gegenleistung verschenkenden Gottes fällt bei uns auf fruchtbaren Boden. Die Entlastung kommt an. Evangelische können den eigenen Ängsten ins Auge blicken. Nur »erschrockene Gewissen« können den Glauben verstehen, waren die Reformatoren überzeugt. »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«, sangen sie und fragten: »Wer kann, Herr, vor dir bleiben?« Martin Luthers Antwort trifft bis heute ins Herz:
Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst,
die Sünde zu vergeben
es ist doch unser Tun umsonst
auch in dem besten Leben.
Darum auf Gott will hoffen ich
auf mein Verdienst nicht bauen.
Katholiken bleibt diese Glaubenserfahrung der geschenkten Liebe bedauerlicherweise fremd. Der Begriff Werkgerechtigkeit ist ein Schlagwort, er lässt sich trefflich besser umschreiben: Katholiken haben nicht gelernt, dass sie ohne Befolgung ihrer Kirchenrituale und ohne das Vollbringen guter Werke von Gott geliebt sind. Sie kommen mir vor wie Petrus. Vom Schiff aus sah er Jesus auf dem Wasser gehen und möchte dasselbe tun. »Komm her«, macht Jesus ihm Mut. Ein paar Schritte schafft Petrus, dann siegt die Angst, und Jesus muss ihn retten. »Du Kleingläubiger«, schüttelt er den Kopf, »warum hast du gezweifelt?« Hätte Karl Valentin diese Szene nachgespielt, hätte er Petrus an dieser Stelle sagen lassen: »Mögen hätten wir schon gewollt, aber dürfen haben wir uns nicht getraut.«
Katholizismus als kleingläubige Spielart des Christentums. Sie zweifeln daran, dass sie alleine gehen können. Als Symbol und Zentrum haben sie sich Petrus gewählt, ausgerechnet jenen Jünger, der aus Angst versinkt. Diese Ehrlichkeit rührt mich. Andererseits machen sie aus diesem Petrus einen Mächtigen, der die göttliche Lizenz zum Binden und Befreien hat. Welch Tragik spielt sich da ab in der katholischen Seele: Die eigene Hilflosigkeit kann sie nicht ertragen, also stilisiert sie sie zur Übermacht. Statt mutig in Jesu Arme zu gehen, ziehen sich Katholiken ins Schneckenhaus kirchlicher Gesetze und Vorschriften oder unter den Mantel einer imaginären Himmelskönigin zurück. Ihr anfänglicher Glaubensmut verpufft in Reglementierungen. Ihre Spiritualität führt sie in die Regression, in einen kindlich-naiven Glauben, in dem die eigene spirituelle Entwicklung vom warmen Mutterschoß kaltgestellt wird. »Maria wird’s richten. Die Kirche wird’s richten. Du erfülle deine katholische Pflichten und schweig stille. Und versuch bloß nicht, direkt mit Gott in Kontakt zu treten. Wenn es sein muss, bitte die Heiligen um Fürsprache. Und wenn du Schuld loswerden möchtest, beichte es deinem Priester! Wir sorgen für dich, sei getrost!«
Selber glauben ist anstrengend. Mit einem ausgeklügelten System der religiösen Abhängigkeit versucht die katholische Kirche, ihre Gläubigen im Zustand des Kleinglaubens zu halten. Christlicher Glaube wird zum Machtspiel. Die Trümpfe, die die katholische Kirche ausspielt, sind wirksam und fechten bisweilen sogar uns Evangelische an. Theodor Fontane hat darum gewusst, als er seine Romanfigur Effi Briest beschrieb:
Effi war fest protestantisch erzogen und würde sehr erschrocken gewesen sein, wenn man an und in ihr was Katholisches entdeckt hätte; trotzdem glaubte sie, dass der Katholizismus uns gegen solche Dinge ›wie da oben‹ besser schütze.
Die katholische Kirche spielt mit der Angst der Menschen. »Da oben« könnte uns ja am Ende etwas gar Schlimmes erwarten: das Fegefeuer! Höllische Strafen!
Die Schlüssel für dieses »da oben«, so will die katholische Kirche bis heute glauben machen, besitze allein sie. Es sind dieselben wie vor fünfhundert Jahren: Absolution und Ablass. Damit meint die Kirche den »Nachlass zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist«, erklärt der »Codex Iuris Canonici«, das Gesetzbuch der katholischen Kirche. Weiter heißt es darin: »Jeder Gläubige kann Teilablässe oder vollkommene Ablässe für sich selbst gewinnen oder fürbittweise Verstorbenen zuwenden.« Ablass funktioniert, indem der Gläubige »die auferlegten Werke … in der festgesetzten Zeit und in der gebotenen Weise erfüllt«. Ein besonders deutlicher Beleg für katholische Werkgerechtigkeit. Erst die Werke, dann die Gnade. Das ist die Lehre Jesu auf den Kopf gestellt.
»Auf den Glauben folgen die Werke, gleich wie der Schatten dem Leibe folgt«, beschrieb Martin Luther die biblische Auffassung des Verhältnisses von Glaube und Werken. Mit keinem guten Werk kann man Gottes Gnade erzwingen. Die gibt es gratis. Eine Grundeinsicht, die Luther nicht entwickelt, sondern in der Bibel gefunden hat. »Der Gerechte wird aus Glauben leben«, sagt der Apostel Paulus im Römerbrief. Allein der Glauben reicht: Sola fide! Luthers Lehre von der Rechtfertigung des Sünders hat die Christenheit vor 500 Jahren zur Quelle zurückgeführt. Die katholische Kirche hat seitdem offensichtlich nur eines widerwillig gelernt: Ablässe gegen Geld zu verkaufen übersteigt die Grenzen des religiösen Anstands. Ansonsten: business as usual. Siehe »Codex Iuris Canonici«, siehe katholischer Katechismus. Angst ist Trumpf. Durch Ablässe – also durch Werke – können Gläubige sogar noch im Totenreich Gutes tun: »Dadurch werden den Verstorbenen im Purgatorium für ihre Sünden geschuldete zeitliche Strafen erlassen.«
Die Kirche gebärdet sich dabei als die große Umverteilerin: Sie verwaltet »den Schatz der Verdienste Christi und der Heiligen«; sobald ein reuiger Sünder um Ablass bittet, greift sie in ihre Schatzkiste, »damit er vom Vater der Barmherzigkeit den Erlass der für seine Sünden geschuldeten zeitlichen Strafen erlangt«. Wer ist denn bitte schön der »Vater der Barmherzigkeit«: Gott? Der Papst? Fest steht: Ohne die Kirche kein Heil und keine Sündenvergebung.
Mit diesem Satz bin selbst ich der Versuchung katholischen Denkens aufgesessen. Das hätten die Katholiken gerne, dass man den Begriff »Kirche« mit der römisch-katholischen Kirche gleichsetzt! Nach evangelischer Sicht ist die Kirche größer und einfacher zugleich: »Das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden.« So haben wir Evangelischen es 1530 im »Augsburger Bekenntnis« zeitlos und evangeliumsgemäß formuliert.
Die Einheit der Kirche ist leicht herzustellen. Wir laden ein zur bunten Vielfalt im Garten Gottes, einem respektvollen Miteinander unterschiedlicher Kirchen und Lebensformen. Einzige Bedingung für das friedliche Zusammenleben: Niemand behaupte, die gottgefälligere Kirche zu sein. Genau das aber fällt der katholischen Kirche bekanntlich schwer.
Denn der Katholizismus hat ein Problem: Er weiß zwar, wo er herkommt. Er weiß aber nicht, wo er hin will. Die Verheißung von Sicherheit durch eine zentralistische Kirche mag vom Frühmittelalter bis zur Moderne ein Programm gewesen sein. Aber in der globalisierten Welt suchen die Menschen etwas anderes. Sie sind der Patentrezepte und Bevormundungen überdrüssig. Sie suchen Freiheit. Respekt. Netzwerk. Gemeinschaft. Die katholische Kirche bietet das nicht. Sie verzettelt sich in autoritär gelösten Machtfragen: Holocaustleugner werden in die Kirche aufgenommen. Kondome bleiben trotz Aids verboten. Die lateinische Messe wird wieder eingeführt. Laien werden bevormundet. Selbst das freundliche Lächeln des bayerischen Papstes kann nicht darüber hinwegtäuschen: Die katholische Kirche verhilft nicht der Liebe an die Macht, sondern sie liebt die Macht. Und übt sie oft ohne Rücksicht auf Verluste aus. Wer kann diesem Gewicht schon standhalten?
Es steht ernst um den Katholizismus. Darüber können auch schmissige Buchtitel nicht hinwegtäuschen: »Katholisch und trotzdem gut drauf« oder »Es ist schön, Christ zu sein – und noch viel schöner katholisch«. Humor ist der Narren letzte Hoffnung. Mit Humor kennen Katholiken sich aus:
Fünfundneunzig Thesen,
die sind uns viel zu viel.
Wir brauchen hundert Tresen
und ’nen Tisch zum Kartenspiel
singt der rheinische Kabarettist Jürgen Becker. Liebe Katholiken, gerne spielen wir auch mal mit euch Karten. Und zeigen euch: Lachen kann man nicht nur, wenn man am Abgrund steht. Es kommt auf die Mischung an. Nur wer um das Wesentliche des Glaubens weiß, kann wirklich aus ganzem Herzen fröhlich sein. So wie der niederrheinische Kabarettist Hanns Dieter Hüsch (†) es aus evangelischer Gesinnung in Worte fasste:
Ich bin vergnügt
erlöst
befreit
Gott nahm in seine Hände
Meine Zeit
Mein Fühlen Denken
Hören Sagen
Mein Triumphieren
Und Verzagen
Das Elend
Und die Zärtlichkeit.
Das ist der Unterschied: Katholiken feiern Karneval. Evangelische freuen sich des Lebens.
Katholiken sündigen, weil sie sich der Absolution sicher sein können. Evangelische denken nach – und verzichten lieber auf eine Sünde zu viel. Denn sie wissen: Auch Christen kann das Lachen im Halse stecken bleiben.
Bei alldem sei zugegeben: Auch innerhalb der katholischen Kirche gibt es unterschiedliche Strömungen. Das Panorama ist breit und reicht vom rechten Rand (»Opus Dei«, »Piusbrüder«) bis zu liberalen Laienorganisationen. Sie alle sind dem Papst verbunden – besser gesagt: an den Papst gebunden, der mit seiner unmittelbaren Machtfülle die Weichen stellt und Gehorsam einfordert.
Vereint sind sie alle auch in ihrer Ablehnung evangelischer Frömmigkeit. Das hat schon Johann Wolfgang von Goethe erkannt: »Die Katholiken vertragen sich unter sich nicht, aber sie halten immer zusammen, wenn es gegen einen Protestanten geht. Sie sind einer Meute Hunde gleich, die sich untereinander beißen, aber sobald sich ein Hirsch zeigt, sogleich einig sind und in Masse auf ihn losgehen.«
Bange machen gilt nicht, weder durch Hunde noch durch Fegefeuer. Wir lassen uns das Röhren nicht verbieten:
Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen!
Solus Katechismus
Unsere Welt wirkt heute so unübersichtlich. Was sollen wir glauben? Was sollen wir tun? Da gibt es mehr als nur eine mögliche Antwort. Das war früher nicht anders; die Sehnsucht nach klaren Verhältnissen ist schon sehr alt. Dem Wunsch nach Eindeutigkeit entspringt auch der »Katechismus der Katholischen Kirche«. In seiner deutschen Ausgabe 824 Seiten stark. »Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich«, lautet der erste Satz des Prologs. Klingt erst mal prima. Freundlich. Einen glücklichen Gott kennt man sonst nur in fernöstlichen Religionen, etwa in Form eines mild lächelnden Buddhas. Chapeau!
Den geneigten Leser lässt dieser Einstieg dennoch etwas ratlos zurück. Beginnt ein Autor ein Buch so und will über 800 Seiten hinweg die Spannung halten, hat er Großes vor sich. Da schwant nicht nur dem Kirchenkenner Dramatisches.
Im Prinzip sind zwei Varianten möglich, wie das so begonnene Buch weitergeführt wird. Variante A: Der glückliche Gott hat den Menschen erschaffen; nur leider hat der die ihm geschenkte Freiheit schändlich missbraucht, an verbotenen Früchten genascht und auf diese Weise dafür gesorgt, dass sich in das göttliche Glück Gottes Zorn, Wut und Nerverei gemischt haben. Das gilt es abzustellen oder auszumerzen. Variante B: Gott kann seinen Glückszustand nur halten, indem er gar nicht mehr genau hinsieht, was da in seiner Schöpfung geschieht. Gott macht es Unzähligen vom Leben und den Mitmenschen Enttäuschten gleich und geht in die innere Emigration. Was durchaus nachvollziehbar wäre.
Alles ist offen also in diesem Monumentalwerk. Nicht nur das: Der Einstieg verheißt allerhöchste Lesefreuden. Offensichtlich traut sich hier ein Mensch, über das Glück Gottes zu räsonieren, und offenbart sich damit als kreativer Freigeist. Offensichtlich tut er es überdies mit feinem Humor. »Prolog« heißt der Bucheinstieg – nur gänzlich Ungebildete werden die Parallele zum Prolog des Johannesevangeliums übersehen, das beginnt: »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.« Und nun, feinsinnig paraphrasiert: Im Anfang war der glückliche Gott. Grandios.
Beginnt ein Buch dermaßen verheißungsvoll, lohnt es sich auch, Zeit für das Lesen des Vorwortes zu opfern, das dem Prolog vorangestellt ist. Womöglich will der Autor seinen Lesern wichtige Dinge mitteilen, ein Fundament zum Verstehen des aus Worten und Gedanken bestehenden Hauses legen, damit es nicht auf Sand gebaut ist? Womöglich will er Biographisches von sich selbst preisgeben und so dem Leser ermöglichen, den Plot im Leben des Autors so verorten zu können, dass schwer verständliche Wendungen nicht ganz und gar unsinnig erscheinen? Also frohgemut sechs Seiten zurückgeblättert.
»Apostolische Konstitution ›Fidei Depositum‹« steht in Versalien über der Einleitung, deren Verfasser sich als »Bischof Johannes Paul II., Diener der Diener Gottes« vorstellt. Das klingt mysteriös. Wären die Buchstaben nicht unerwartet groß, könnte man meinen, hier walte tatsächlich dienende Demut. Die Anrede an die Leser macht stutzig. »An die ehrwürdigen Brüder Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe, Priester und Diakone und an alle Glieder des Volkes Gottes.« Seltsam. Soll das Humor sein oder ist’s ernst gemeint? Warum so viele kirchliche Berufe nennen – wenn doch alle Glieder des Volkes Gottes gemeint sind? Oder meint der Satz, dass die herausgestellten Angeredeten nicht Glieder des Volkes Gottes sind? Werden sie aus diesem Grund extra aufgeführt? Das hätte wahrlich schon wieder einen genial sarkastischen Unterton. Auch weil ausschließlich Männer aus dem »Volke Gottes« extrahiert worden wären.
Dann weiht Verfasser Johannes Paul II. seine Leser in die Entstehungsgeschichte des Buches ein: »Der Herr hat seiner Kirche die Aufgabe anvertraut, das Glaubensgut zu hüten, und sie erfüllt diese Aufgabe zu allen Zeiten.« Der ursprünglich, wie wir bereits wissen, zeitlos glückliche Gott hat also verfügt, eine menschliche Institution – die Kirche – solle seine Lehren, seine Weisheit, seine Gebote, seinen Wunsch und Willen in Worte fassen und zu Papier bringen. Was hiermit geschehen sei. Der vorliegende Katechismus sei eine »sichere Norm für die Lehre des Glaubens«, liest der noch vor Minuten sehr geneigte Leser und sieht die Vorfreude aufs Lesen arg gedämpft.
Dieses Buch ist ernst gemeint. Durch und durch. Auch ist ernst gemeint, dass sich der anfangs als Bischof vorgestellte Johannes Paul II. vier Seiten später als »Nachfolger Petri« bezeichnet. Auch ist ernst gemeint, dass er im Schlussakkord der Einleitung die »allerseligste Jungfrau Maria, die Mutter des menschgewordenen Wortes und Mutter der Kirche«, bittet, sie möge »mit ihrer mächtigen Fürbitte den katechetischen Dienst der gesamten Kirche auf allen Ebenen in dieser Zeit« unterstützen.
Schluss mit lustig. Das ist der volle Ernst.
Schluss mit leicht. Das ist schwere Kost.
Schluss mit Kreativität. Das ist Lehre.
Die wahre Lehre.
Ich gestehe: Angesichts dieses Begriffes kostet es Mühe, die Vorlage zum naheliegenden Wortspiel ungenutzt zu lassen. »Wahre Leere« – das wäre unter Niveau, erst recht für einen evangelischen Christen. Jesus hat nie diffamiert, hat Andersgläubige nie herablassend behandelt. Natürlich hat die katholische Lehre auch nichts mit Leere zu tun. Die 824 Seiten des Katechismus sind ja prall gefüllt. Da werden das Glaubensbekenntnis und die »Feier des christlichen Mysteriums« erklärt, »die sieben Sakramente der Kirche« und »das Leben in Christus«, schließlich auch die Zehn Gebote und das christliche Gebet. Das Register listet von »Aberglaube« bis »Zweifel« so ziemlich alles auf, was Katholiken wichtig zwischen Himmel und Erde ist – pardon: sein sollte. Denn wer kennt oder hält sich schon die 2865 durchnummerierten Abschnitte, die mehr Anweisungen als Weisheiten von sich geben?
Nein, leere Lehre kann man dem katholischen Katechismus wahrlich nicht unterstellen. Er steckt voller Prinzipien. Da bleibt nichts der Phantasie oder dem Zufall überlassen.
Das Buchkonzept gibt die Richtung und die Wertigkeit vor, vor lauter Selbstverständlichkeit entgeht dem flüchtigen Betrachter fast: Nicht die Bibel steht hier an erster Stelle, sondern das Glaubensbekenntnis – also das Ergebnis eines Theologenstreits um rechte Lehre und Irrglaube, das im Jahr 325 festgeschrieben wurde. Das Vaterunser, einer der ursprünglichen Texte Jesu von Nazareth, biblischer geht’s nimmer, steht am Ende. Sollte Gott etwa durch einen menschlichen Bekenntnistext glücklicher gestimmt werden als durch ein einfaches biblisches Gebet?
Auch ein Blick auf die Seitenumfänge ist erhellend. Das Vaterunser: 25 Seiten. Das Glaubensbekenntnis: 256 Seiten. Ziemlich genau zehnmal so viel. Und zwischen Anfang und Ende: Zitate von Kirchenvätern, ja, auch einige aus der Bibel, theologische Begründungen von Dingen wie Marienverehrung, Firmungssakrament, Zölibat – allesamt menschliche Traditionen, von denen nichts in der Bibel steht.
Nun müsste man die Bibel nicht höher schätzen als andere Bücher oder menschliche Gesetze und Riten – wenn man sich nicht Christ und die eigene Organisation Kirche nennen würde. Im vorliegenden Fall liegt der Fall bekanntlich anders. Wie befremdlich – um es vorsichtig auszudrücken –, dass eine Kirche eine Zusammenfassung des Glaubens schreibt und ihm quasi göttliche Weihen verleiht, in dem die Bibel erst am Ende vorkommt. »Sola scriptura« – allein die Schrift soll gelten: Im 16. Jahrhundert hat die Reformation diesen schlagwortartigen Begriff geprägt. Allein die Schrift reicht, um zu wissen, zu glauben und zu verstehen, worum es im Glauben und im Menschsein geht. Allein »die Schrift« – die Bibel also. Die Reformatoren, Martin Luther allen voran, haben diese eigentlich selbstverständliche Autorität der Bibel gegen die Widerstände der damaligen Kirche wieder ins Bewusstsein rücken müssen. »Heilige Schrift« wird sie auch in der katholischen Kirche bis heute genannt. Mit großer Show wird sie über den Köpfen der Priester und Gemeinde in den Gottesdienst getragen. Inbrünstig wird sie während des Gottesdienstes geküsst. Wie passt das zusammen mit dem kümmerlichen Dasein, das sie im Katechismus fristet?
Psychotherapeuten, die Seelenkundigen unserer Tage, schildern einen abgrundtiefen Zusammenhang von Liebesbekundung und Beziehungsunfähigkeit: Allzu häufige, allzu penetrante Liebesbekundungen können auf eine besonders subtile Form der Distanz oder Verachtung hinweisen. Könnte diese Beobachtung aus dem zwischenmenschlichen Bereich bei der Erhellung des geschilderten Katholikenphänomens helfen? Oder ist es unzulässige Übertragung psychologischer Erkenntnisse auf das Gebiet des Glaubens?
Wie auch immer man diese Frage beantworten mag: Wer nicht die Bibel in den Mittelpunkt des christlichen Glaubens stellt, öffnet der theologischen Willkür Tür und Tor. »Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen.« Das sagte einer, der für seinen Glauben und seine Mitmenschlichkeit großes Leid auf sich nahm: der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der kurz vor Kriegsende von den Nazis hingerichtet wurde. Wer demütig fragt, findet die Antworten in der Bibel. Sola scriptura – allein die Bibel reicht! Dieses reformatorische Prinzip hat sich Bonhoeffer zu eigen gemacht.
Unablässig kritisierte er Christen, die leichtfertig Gott instrumentalisieren. »Man versucht, der mündig gewordenen Welt zu beweisen, dass sie ohne den Vormund ›Gott‹ nicht leben könne«, meinte Bonhoeffer. Mit der Bibel in der Hand schlug er vor, angesichts des inflationären Gebrauchs des Begriffes »Gott« einige Zeit auf dessen Nennung zu verzichten. Ob denn die Christen überhaupt »religiös« reden müssten, fragt er, »wie sprechen wir von Gott – ohne Religion, das heißt eben ohne die zeitbedingten Voraussetzungen der Metaphysik, der Innerlichkeit und so weiter? Wie sprechen (oder vielleicht kann man aber nicht einmal mehr davon ›sprechen‹ wie bisher) wir ›weltlich‹ von ›Gott‹, wie sind wir ›religionslos-weltlich‹ Christen, wie sind wir εκ-κλησία, Herausgerufene, ohne uns religiös als Bevorzugte zu verstehen, sondern vielmehr als ganz zur Welt Gehörige?« So können nur Menschen denken, die die evangelische Freiheit des Glaubens erfahren haben.
Bonhoeffers leider fragmentarisch gebliebene Ideen bieten ein kühnes Gegenmodell zum umfangreichen katholischen Katechismus. Der fordert von Christen, sich als religiös bevorzugt zu verstehen. Und offenbart die Tragik der Katholiken: Sie tappen in die Religionsfalle. Gott im Mund zu führen, seine Gebote zu formulieren und über seine Allmacht zu sinnieren muss nichts mit dem Glauben zu tun haben. Im Gegenteil: Es kann Menschen sogar vom Glauben wegführen. »Es werden nicht alle, die zu mir sagen: ›Herr, Herr!‹, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.« Der Wille Gottes lässt sich nicht 824 Seiten lang in Worte fassen. Um ihn zu erkunden, genügt die Bibel.
Ein Fels, auf dem alles ruht
Dankenswerterweise hat die katholische Kirche bemerkt, dass es selbst für glaubensbereite Katholiken eine zu große Herausforderung sein könnte, sich durch 824 Seiten Lehre durchzuarbeiten. Also veröffentlichte sie 2005 ein Kompendium des Katechismus. 256 Seiten Glaube kompakt. »Ich bin Gott, dem Herrn, unendlich dankbar, dass er der Kirche diesen Katechismus geschenkt hat«, schreibt Papst Benedikt XVI. im Geleitwort des Buches, für das ich 12,90 Euro bezahlt habe.
Die Frage, ob der Katechismus ein Gottesgeschenk oder Fleißprodukt unzähliger vatikanischer Redaktionskommissionen ist, sei für einen Moment zur Seite gestellt. Stellen wir uns lieber Papst Benedikt auf der Suche nach der eigenen Standortbestimmung vor. Würde er Antworten bei Dietrich Bonhoeffer suchen, könnte er an dessen ergreifender Identitätsfindung teilhaben: »Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!« Bonhoeffer lässt Fragen offen. Das wird einen Katholiken nicht befriedigen – den Papst erst recht nicht. Wozu auch fragend durch die Welt laufen? – Sieh, die Antwort liegt so nah! Zum Beispiel im Kompendium des katholischen Katechismus. In Abschnitt 182 kann Benedikt XVI. lesen, wer er ist: »… Nachfolger des heiligen Petrus, das immerwährende und sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Kirche, der Stellvertreter Christi … Aufgrund göttlicher Einsetzung hat er über die ganze Kirche die höchste, volle, unmittelbare und allgemeine Vollmacht.«
»Stellvertreter Christi«, »göttlich eingesetzt«: Was mögen diese Antworten in einem Menschen, im Papst, hervorrufen? An ihnen zweifeln darf er nicht. Jedenfalls nicht öffentlich. Denn das I. Vatikanische Konzil hat festgestellt: Wer sagt, der Papst »besitze lediglich das Amt der Aufsicht bzw. Leitung, nicht aber die ganze Fülle dieser höchsten Vollmacht …«, der wird ausgeschlossen. Muss ein Stellvertreter Christi eigentlich vor Kritik bewahrt werden? Fest steht: Im Umfeld des Jesus von Nazareth herrschte kein Denkverbot. Auch wurden seine Jünger nicht durch einen Eid auf ihren religiösen Meister, dem sie sich angeschlossen hatten, fixiert. Statt Paragraphen und Gehorsam standen Liebe und Freiwilligkeit im Vordergrund. »Ich werde die Disziplin der Gesamtkirche befolgen und fördern und alle kirchlichen Gesetze einhalten, vor allem jene, die im Codex des kanonischen Rechtes enthalten sind. In christlichem Gehorsam werde ich dem Folge leisten, was die Bischöfe als authentische Künder und Lehrer des Glaubens vortragen oder als Leiter der Kirche festsetzen.« Diese Eidesformel muss jeder heutige in der Verkündigung stehende Mitarbeiter der katholischen Kirche sprechen. Nur wer sich die Mühe macht, in den Codex des kanonischen Rechtes, das Gesetzbuch der katholischen Kirche, zu blicken, wird merken, dass er sich soeben freiwillig in ein geschlossenes System der Unfreiheit hineinbegeben hat. Beschwerden gegen päpstliche Anordnungen sind nicht nur unerwünscht, sondern ausgeschlossen.
Ein protestantischer Christ reibt sich verwundert die Augen. Wie kann es sein, dass Christen die biblische Botschaft von der Liebe mir nichts, dir nichts in ein machtkonzentriertes System umwandeln? Was um Himmels willen treibt freie Christenmenschen in die Abhängigkeit? »Zur Freiheit seid ihr berufen«: Warum schallt dieser Ruf des Apostels Paulus nicht bis in unsere Gegenwart hinein?
Vielleicht, weil sich die katholische Kirche mehr auf Petrus statt auf Paulus beruft? Tu es Petrus – Du bist Petrus steht in Stein gemeißelt an der Fassade des Petersdomes. Auf diese Worte gründet das Papsttum seine Macht. Sie stammen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 18. Jesus sagt zu Petrus: »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein.«
Eigentlich könnten sich Protestanten über den katholischen Rückgriff auf die Bibel freuen. Doch leider stellt sich ein fader Nachgeschmack ein. Von Petrus ist die Rede – jenem liebenswürdigen Menschen, der seinen Herrn so gerne lieben wollte, der so gerne perfekt sein wollte und doch in entscheidenden Momenten versagte. Sich an Petrus zu erinnern ist fast ein Allheilmittel gegen fromme Überheblichkeit. Dass die katholische Kirche es schafft, aus diesem fehlbaren Menschen einen unfehlbaren Papst zu kreieren – Respekt!
Allerdings: Wer die Bibel ernst nimmt, kommt zu anderen Schlüssen. Zum einen nimmt er die Ergebnisse der historisch-kritischen Bibelforschung zur Kenntnis. Viele Exegeten mutmaßen aufgrund plausibler Indizien: Nicht Jesus hat gesagt: »Du bist Petrus …«, sondern der Evangelist Matthäus hat es ihm in den Mund gelegt. Um das Jahr 80 herum hat Matthäus sein Evangelium geschrieben, also rund fünfzig Jahre nach dem Tod Jesu. Matthäus wollte keine historische Jesusbiographie verfassen, sondern hatte ein theologisches Ansinnen. Dazu gehörte auch, dass er Petrus, der in der Urkirche eine Vorrangstellung einnahm, rückwirkend aus dem Jüngerkreis hervorheben wollte. Wie hätte das besser funktionieren können, als ihm im Nachhinein eine Beauftragung durch Jesus zuzuschreiben? Mit seinem literarisch-theologischen Coup legte Matthäus das Fundament für die katholische Kirche.
Doch leider: In der Bibel verlieren sich die Spuren des Petrus rasch. Frühchristliche Schriften aus dem zweiten Jahrhundert behaupten, Petrus sei nach Rom gereist. Dort sei er in Streit mit dem im Auftrag Kaiser Neros arbeitenden Magier Simon geraten. Auf der Flucht sei ihm an einem Stadttor Jesus begegnet; »Quo vadis – Wohin gehst du?«, habe er ihn gefragt, woraufhin Jesus geantwortet habe: »Nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu lassen.« Daraufhin sei Petrus zurück nach Rom gegangen und habe sich freiwillig ins Martyrium begeben. »Da ich nicht würdig bin, wie mein Herr am Kreuze zu sein«, habe er seine Henker gebeten: »Kehrt mein Kreuz um und kreuzigt mich mit dem Haupt nach unten!« Über seinem Grab soll Kaiser Konstantin um das Jahr 324 eine Basilika errichtet haben, die 1506 dem monumentalen Petersdom gewichen ist, Zentrum und Papstkirche der römisch-katholischen Christenheit bis heute.