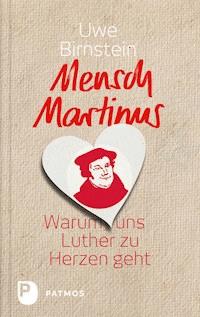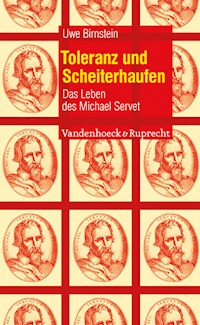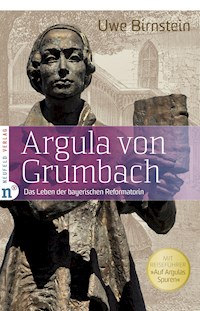16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die bewegende Lebensgeschichte der »Bischöfin der Herzen« Wie wurde Margot Käßmann zu einer der populärsten und angesehensten Persönlichkeiten Deutschlands? Welche Kindheitserfahrungen haben sie geprägt? Wie lernte sie Toleranz und Courage, woher stammen ihre Geradlinigkeit, ihr Mut und ihre Friedensliebe? Wie bringt sie Familienleben und Beruf unter einen Hut? Und vor allem: Welche Rolle spielt der christliche Glaube in ihrem Leben, wie schenkt er ihr Trost und Bestärkung? Uwe Birnstein, ein langjähriger Wegbegleiter, hat sich auf Spurensuche im Leben Margot Käßmanns begeben. Gemeinsam fuhren sie an die Stätten ihrer Kindheit. Margot Käßmann gewährte ihm Einblick in private Fotoalben und verschlossene Erinnerungsschatullen. Auf diese Weise ist ein feinfühliges Porträt entstanden, das viele bislang unbekannte Seiten Margot Käßmanns zeigt. Lernen Sie auch die stille, private Seite der Frau kennen, die oft im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit steht. Mit zahlreichen unveröffentlichten Fotos aus dem Privatarchiv von Margot Käßmann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Uwe Birnstein
Margot Käßmann – Folge dem, was Dein Herz Dir rät
Biografie
Knaur e-books
Über dieses Buch
Die bewegende Lebensgeschichte der »Bischöfin der Herzen«. Welche Kindheitserfahrungen haben sie geprägt? Wie lernte sie Toleranz und Courage, woher stammen ihre Geradlinigkeit, ihr Mut und ihre Friedensliebe? Wie bringt sie Familienleben und Beruf unter einen Hut? Und vor allem: Welche Rolle spielt der christliche Glaube in ihrem Leben, wie schenkt er ihr Trost und Bestärkung?
Uwe Birnstein, ein langjähriger Wegbegleiter, hat sich auf Spurensuche im Leben Margot Käßmanns begeben. Gemeinsam fuhren sie an die Stätten ihrer Kindheit. Margot Käßmann gewährte ihm Einblick in private Fotoalben und verschlossene Erinnerungsschatullen. Auf diese Weise ist ein feinfühliges Porträt entstanden, das viele bislang unbekannte Seiten Margot Käßmanns zeigt. Lernen Sie auch die persönliche Seite der Frau kennen, die oft im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit steht.
Mit zahlreichen unveröffentlichten Fotos aus dem Privatarchiv von Margot Käßmann.
Inhaltsübersicht
Folge dem, was dein Herz dir rät!
Manchmal habe ich mich im Leben fast bedrängt gefühlt von Ratgebern. Vieler Rat war gewiss gut gemeint. Mancher Rat aber gewiss auch von eigenen Interessen mitbestimmt. Mir hat es dann immer wieder geholfen, mich zurückzuziehen, Ruhe zu finden, um dann eine Entscheidung zu treffen. Das hört sich vielleicht allzu pathetisch
an, aber ich denke schon, dass der Mensch der Stimme des eigenen Herzens folgen kann. Wenn du genug Abstand gewinnst, weißt du am Ende ja doch, was der richtige Weg ist. Aber dazu braucht es auch solchen Rückzug, Stille vielleicht, Zeit auf jeden Fall. Manchmal dachte ich auch:
Der Weg ist ja eigentlich schon klar, die Entscheidung ist doch längst getroffen – nur habe ich noch nicht gewagt, das auszusprechen oder mich den Konsequenzen zu stellen. Im Hebräischen ist das Herz übrigens ja durchaus auch der Sitz des Verstandes und nicht nur der Emotion.
Margot Käßmann
VORWORT
Sieben Jahre lang habe ich sie zu Terminen begleitet, in Talkshows und in Konferenzzentren, in Kirchen, Hallen und Gemeindehäuser, durch die Menschenmassen bei Kirchentagen und beim Reformationsjubiläum. Viele, viele Stunden sinnierten wir über Gott und das Leben, den Schatz des Glaubens und die Sehnsucht nach Freiheit, über das, was gelang und was so richtig in die Brüche gegangen ist in unser beider Leben. Wir lachten lauthals und empörten uns, tauschten uns über die Freuden und Herausforderungen des Elternseins aus, staunten über wundersame Begegnungen und ärgerten uns über unverschämte Zeitgenossen. Und einmal kamen uns beiden sogar die Tränen.
Kennengelernt haben wir uns Mitte der 80er-Jahre in einer Zeitschriftenredaktion. Sie war schon Pastorin, ich noch Theologiestudent. Sie wurde Bischöfin, ich Journalist. Wir hielten Kontakt. Am 20. Februar 2010 lebte ich in Österreich und erfuhr von ihrer Alkoholfahrt. Kann jedem passieren, dachte ich und wünschte ihr per SMS viel Kraft. Drei Tage später sah ich in der Tagesschau ihre Rücktrittserklärung. »Folge dem, was dein Herz dir rät«, sagte sie vor zig Mikrofonen im Blitzlichtgewitter. Die Anspannung war ihr anzumerken. Ebenso der Trost, den sie aus dem Satz des Autors Arno Pötzsch zog: »Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand.« Ihre vier Töchter saßen stolz zwischen den Journalisten. Wow. Was für ein Abgang. So ist Margot, dachte ich: standhaft. Sie klebt nicht an der Macht, sondern steht zu ihren Schwächen wie zu ihren Stärken. In den folgenden Wochen sah ich sie auf den Titelblättern aller wichtigen Magazine. Die Öffentlichkeit zollte ihr Respekt. Im Sommer trafen wir uns. Sie war – wie ich – nach Berlin gezogen. Im Gepäck: Wäschekörbe voll Zuschriften, Anfragen, privater Briefe, offizieller Einladungen und Interviewwünsche sämtlicher Medien. Ihr Buch In der Mitte des Lebens führte monatelang die Bestsellerlisten an. Margot Käßmann war zu einem der populärsten Menschen Deutschlands geworden.
Im Sommer 2010 fragte sie mich, ob ich ihr bei der Bewältigung der un- zähligen Anfragen helfen könnte. Ihre Arbeitgeberin, die evangelische Kirche, konnte ihr kein Büro mehr zur Verfü- gung stellen. Seitdem arbeiten wir eng zusammen. Sie, Pastorin – zeitweise – ohne Amt, ich, ihr Berater. Viel Zeit verbrachten wir miteinander, und ich erfuhr viel aus ihrem Leben. Schließ- lich öffnete sie mir ihre privaten Foto- alben und Erinnerungsschatullen und erzählte mir aus ihrer Kindheit und vom Kriegsschicksal ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Zusammen fuhren wir an die Orte, an denen sie gelebt hat. Und nach Hinterpommern, wo ihre Mutter aufgewachsen war. Verwandte und Wegbegleiter gaben mir Auskunft. Mir wurde klar, weshalb ihr Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit so sehr am Herzen liegen. Immer besser verstand ich, was Margot Käßmann die Kraft und Energie gibt, ihr Leben so grad- linig zu meistern. »Folge dem, was dein Herz dir rät«: Diesen biblischen Rat hat Margot Käßmann nicht erst bei ihrem Rücktritt, sondern in vielen kritischen Phasen ihres Lebens befolgt.
Ein guter Grund also, auch diese Biografie so zu betiteln.
Ich danke Margot Käßmann für das Vertrauen und viele Gespräche, mit denen sie dieses Projekt unterstützt hat.
Uwe Birnstein
Prolog
1945, Ende April. Land in Sicht: Kopenhagen. Doch von Bord gehen darf Gertraut Storm nicht. Seit Tagen lebt die 22-Jährige beengt mit Hunderten weiterer Männer, Frauen und Kinder. Wenig Essen, wenig Trinken. Kranke. Bootsflüchtlinge.
Eigentlich sollte das Schiff die Deutschen nach Schweden bringen, dort hofften sie auf Sicherheit vor der herannahenden Roten Armee. Nazi-Deutschland, das den Krieg angezettelt hatte, war quasi besiegt. Von allen Seiten rückten die alliierten Streitkräfte vor, die Reichshauptstadt Berlin war im Bombenhagel zerstört worden und besetzt. Gertraut Storm hatte Glück. Sie hatte eines der letzten Schiffe erreicht, die von Saßnitz auf Rügen gen Norden aufbrachen.
Schreckliche Bilder hat Gertraut Storm im Kopf. Zigtausend Menschen: Kinder, Alte, Verletzte, die in Saßnitz warteten, voller Angst vor neuen Bombenangriffen, voller Angst vor Hunger und Tod. Ihre Eltern, die sie in Köslin zurückgelassen hatte.
Diese Bilder des Leides mischen sich mit schönen Erinnerungen: ihre glückliche Kindheit in Latzig, wo ihr Vater als Gutsverwalter gearbeitet hatte, wo sie mit ihren drei Geschwistern unbeschwert aufgewachsen war. Traumhafte Landschaften: riesige Kornfelder, die sich am Horizont mit dem klaren blauen Himmel verbanden. Prächtige Eichenalleen. Jeden Tag fuhr Gertraut mit anderen Kindern des Gutsdorfes mit dem Fahrrad zum nächsten Bahnhof, zwei Kilometer, dort schlossen sie ihre Räder ab und stiegen oft in letzter Sekunde in den Bummelzug nach Köslin, der sie zur Schule brachte.
Jahre später dann der Abschied aus Latzig: Gertraut durfte auf eine Schwesternschule gehen, einen richtigen Beruf sollte das Mädchen erlernen, das war ihren Eltern wichtig.
Muttertränen zum Abschied. 1943 zog Gertraut sogar nach Berlin, mitten im Krieg so weit weg! Am Urbankrankenhaus hatte sie ihre erste Schwesternstelle gefunden. Die 21-Jährige plagte das Heimweh. Doch das Berliner Kulturleben schenkte ihr wunderbare Ablenkungen, die Lustigen Weiber von Windsor schoben den Kummer für wenige Stunden fort. Zwei Tage nach der Vorstellung ein Luftangriff, »60 000 Obdachlose, 5000 Tote«, notierte Gertraut am 27. August 1943 in ihr Tagebuch. »Wie einsam bin ich doch in der Großstadt«, und: »Oft fragt man mich, warum ich so viel träume, ja, warum? Weil es mich immer nach draußen zieht.« Die Kriegsmeldungen bewirken »die dollsten Vorstellungen«. Wie es ihren Eltern wohl geht und ihren Freundinnen?
© Uwe BirnsteinGeburtshaus der Mutter in Latzig
Gertraut lernte Klavierspielen. Was für ein Luxus in diesen Zeiten! Der Krieg rückte immer näher, Stunde um Stunde. Bomben fielen, sogar aufs Krankenhaus. Heulten die Sirenen, musste Gertraut mit den Kranken in Luftschutzkeller umziehen oder, wenn noch Zeit war, in den Bunker. Schließlich wurden die Kranken evakuiert, in den sicheren Norden, nach Rügen. Gertraut Storm begleitete sie. Noch einmal fuhr sie nach Köslin, zu ihren Eltern. Die lebten inzwischen als Ruheständler in einer Mietwohnung. »Ihr müsst hier weg!«, riet sie ihnen eindringlich. »Der Russe kommt nicht bis hierher«, hielt ihr Vater ihr entgegen, »bis Ostpreußen, ja – aber nicht nach Hinterpommern!« Und das, obwohl Tag für Tag Flüchtlingstrecks durch Köslin zogen.
Gertraut teilte seinen Optimismus nicht. Ende Februar fuhr sie allein zurück nach Rügen. In Bergen verfolgte sie die Berichte über die heranrückenden »Feinde«: die Alliierten. »Wie lange werde ich es noch gut haben? Das weiß nur Gott«, klagte sie ihrem Tagebuch. Im Radio hört sie Propagandaberichte der Nazis – die Lage sei gar nicht so hoffnungslos! –, aber auch die Zauberflöte. Am 22. April der letzte Eintrag – danach packte sie ihre wichtigsten Habseligkeiten in einen Koffer und marschierte los. Nach fünf Stunden erreichte sie Saßnitz, die Hafenstadt auf Rügen. Am 25. April bestieg sie dort das Schiff, zusammen mit zwei Kolleginnen, Ilse und Lore.
Nun wartet Gertraut Storm. Vor Kopenhagen hat ihr Schiff den Anker geworfen. Schweden hatte sich geweigert, die Flüchtlinge aufzunehmen. Auch Dänemark hält die Grenzen geschlossen. Warum sollte man Deutsche ins Land lassen, unter die sich womöglich Nazis gemischt hatten? Warten. Stunden, Tage. Land in Sicht. Aber keine Chance, hineinzukommen. Zum Verzweifeln.
Dann endlich die erlösende Nachricht: Gertraut Storm und ihre Leidensgenossen dürfen an Land.
In Kopenhagen versuchen die Behörden, dem Chaos Herr zu werden. So viele Kranke. Gertraut ist Krankenschwester, sie wird gebraucht. Im Internierungslager versucht sie, die schlimmsten Leiden zu lindern und den Kranken beizustehen.
Nur selten darf sie das Lager verlassen, wenn sie Kinder zu Untersuchungen bringen muss. Einmal bleibt einer der Sprösslinge vor einem Bäckerladen stehen und starrt hungrig auf die Auslage. Eine Frau, die dort einkauft, sieht es, kommt heraus und steckt Gertraut heimlich ein Stück Brot in die Manteltasche. Paula heißt sie. Gertraut, Paula und deren Mann Harald freunden sich an. Im Geheimen, denn Kontakte zu Deutschen sind den Dänen strikt verboten. Dass dies der Beginn einer Lebensfreundschaft ist, ahnen die beiden jungen Frauen damals noch nicht.
© Archiv Margot Käßmann/Kolja WarneckeBriefe
»Sind wir jetzt im Himmel?«
Gertraut Storms Gedanken und Gefühle sind bei ihrer Familie. Zwei Jahre lang. Ihre Mutter Maria schrieb mehrmals an die zuständigen dänischen Behörden, sie sollten doch bitte ihrer Tochter die Ausreise ermöglichen. Doch die lehnten ab, zuletzt im April 1947. Die Begründung ist nachvollziehbar: Im Internierungslager »befinden sich verhältnismäßig sehr wenige ausgebildete Krankenschwestern unter dem deutschen Sanitätspersonal«, deswegen könne man auf ihre Dienste momentan nicht verzichten. Sobald die Zahl der kranken Flüchtlinge sinke, könne über eine Heimreise neu nachgedacht werden.
Noch im selben Jahr ist es so weit: Gertraut Storm darf zurück nach Deutschland. Sie fährt nach Hessen, kommt irgendwann im Jahr 1947 in einem idyllisch gelegenen Forsthaus des Dorfes Burgholz an. Endlich kann sie ihre Mutter und Geschwister wieder in die Arme schließen. Endlich zu Hause – auch wenn das nun in der Fremde liegt.
In Burgholz erfährt Gertraut Storm vom Schicksal ihrer Eltern. Die Sowjetarmee war doch bis kurz vor Köslin herangerückt. Die Eltern entschlossen sich zu fliehen – zusammen mit ihrer schwangeren Schwester Hanni und deren zwei kleinen Kindern. Der letzte Zug von Köslin in Richtung Westen fuhr am 2. März 1945. Doch ihnen wurde die Mitfahrt verweigert: »Eine Gebärende können wir hier in diesem Zug nicht mitnehmen.« Gertrauts Vater wurde später festgenommen und interniert. In einem Gefangenentreck marschierte er 70 Kilometer nach Stolp, dort wurden die Männer auf Züge verladen.
Seine Frau Maria und die anderen blieben in Köslin, sahen, wie die Rote Armee die Stadt besetzte und unter den Deutschen wütete. Die Frauen erlebten den Horror der Besatzung. Gewalt, Vergewaltigungen, Hunger.
Im Mai 1946 gelang ihnen endlich die Ausreise. Ihr Ziel: Burgholz, ein kleines Dorf in Hessen. Dort lebte Maria Storms Schwester Minni. Sie hatte einen Förster geheiratet. 700 Kilometer Bahnreise und Fußweg lagen vor Maria Storm, ihrer Tochter und den drei Kindern. Unvorstellbare Strapazen. Im Sommer erreichten sie ihr Ziel. Der dreijährige Peter, eines der Kinder, rief beim Anblick der für sie mit weißer Bettwäsche bezogenen Betten aus: »Mama, sind wir jetzt im Himmel?«
Drinnen jedoch war es eng. 27 Menschen wohnten schließlich in dem Forsthaus. Die Neuankömmlinge aus Köslin waren völlig verlaust, voller Krätze und mussten sich erst mal gründlich waschen. Der Platz war knapp, das verlangte allen Bewohnern große Disziplin ab. Bei einigen herrschte große Hilfsbereitschaft, bei anderen die Angst, zu kurz zu kommen. Die Kinder spielen auf dem Hof, die Männer besorgen Holz aus dem Wald; um Lebensmittel zu bekommen, sind kilometerweite Strecken zu bewältigen.
Und Gertrauts Vater? Die Sowjetarmee hatte ihn nach Sibirien deportiert. Irgendwo auf der schweren Reise nach Sibirien war er an der Ruhr erkrankt und am 28. April gestorben.
© Uwe BirnsteinIm Forsthaus von Burgholz trafen viele Flüchtlinge der Familie Schulze ein
Neues Glück
Gertrauts Sehnsucht nach Leben ist größer als die Trauer um die Vergangenheit. In Burgholz beginnt ihr Leben neu. Überall in der Gegend kommen Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten an. Viele Einheimische sind freundlich; andere behandeln die Zugezogenen feindselig, weil sie zwangsweise Wohnraum zur Verfügung stellen müssen.
Arbeit gibt es genug. Auch Gertraut Storm findet eine Stelle. 1948 beginnt sie als Krankenschwester in der amerikanischen Kaserne im nahe gelegenen Neustadt. Dort trifft sie eines Tages Robert Schulze, einen attraktiven, lustigen Mann: rundes Gesicht, dunkle Haare, Hornbrille. Er arbeitet als Automechaniker beim amerikanischen Militär, wohnt mit seiner Mutter auf engstem Raum in Allendorf, neun Kilometer von seiner Arbeitsstelle entfernt. Auch Robert hat einiges miterlebt. Er stammt aus Hagen in Westfalen. 1939 war er eingezogen worden, gerade mal 19 Jahre alt, kämpfte erst in einer Panzerdivision, am Ende wurde er als Motorradkurier eingesetzt. Sein Vater war im Krieg gefallen, seine Schwester bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Nun kümmert sich seine Mutter um ihn, versorgt ihren »Bubi« mit wertvollen Lebensmitteln, am wichtigsten ist ihr, dass er immer gute Butter bekommt, in Kriegszeiten Mangelware.
Am Silvestertag 1949 heiraten Gertraut Storm und Robert Schulze. Gertraut zieht zu ihm nach Allendorf.
© Archiv Margot Käßmann
© Archiv Margot KäßmannHochzeit 1949 von Gertraut Storm und Robert Schulze
Schon bald können sie aus den beengten Verhältnissen ausbrechen. Sie ziehen mit Roberts Mutter in eine eigene kleine Wohnung, Gertrauts Mutter wohnt nebenan, ihre Schwester mit den drei kleinen Kindern hat eine Wohnung unter dem Dach im Nachbarhaus. Sie wollen sich voller Tatendrang ein stabiles Leben in der neuen Heimat aufbauen. Gegenüber ihrer Wohnung ist ein Grundstück frei. Robert Schulze tut, was er kann: Autos reparieren. Er eröffnet eine Autowerkstatt und eine Tankstelle, legt die Meisterprüfung ab. Nun kann er auch Lehrlinge ausbilden. Viele Lichtblicke – obwohl die finanziellen Sorgen noch drücken.
1951 wird das erste Kind geboren: Ursula, zwei Jahre später folgt Gisela. Der Betrieb wächst, die Kunden kommen gerne zum gut gelaunten und gutmütigen Meister Schulze: Mal schenkt er einem Jugendlichen Benzin, mal repariert er einem Mittellosen umsonst das Auto. Seine Freigiebigkeit teilt seine Frau nicht immer. Gertraut Schulze denkt oft an die Mangelerfahrungen der Kriegszeit. Sie kümmert sich neben dem Haushalt um die Finanzen, schreibt Rechnungen, fährt aber auch mal Taxi und sitzt an der Kasse der Tankstelle. Säumen Kunden die Zahlung, steigt sie aufs Fahrrad, setzt die kleine Gisela auf den Gepäckträger und treibt die offenen Beträge ein.
Die Kinder werden hauptsächlich von Kindermädchen Helga umsorgt. Alles gut. Doch 1957 legt sich ein Schatten über die Familie. Gertraut Schulze ist zum dritten Mal schwanger. Es gibt Komplikationen, am Ende eine Frühgeburt. Sohn Robert wird am Tag seiner Geburt notgetauft, stirbt bereits nach wenigen Tagen.
Gertraut Schulze hat so viel Leid gesehen im Krieg und im dänischen Lager. Das hilft ihr, mit dem persönlichen Schicksal nicht zu sehr zu hadern.
Bald wird sie erneut schwanger. Anfang Juni 1958 spürt sie: Die Geburt steht bevor. Ihr Mann Robert fährt sie in die Klinik nach Marburg. Dort erblickt am 3. Juni ihr viertes Kind das Licht der Welt. Wieder eine Tochter: Margot.
© Archiv Margot Käßmann
»Der kleine Robert«
Die Welt ist überschaubar. Margots Leben spielt sich zwischen Elternhaus und Autowerkstatt ab, zehn Meter Luftlinie. Beide Eltern sind gefordert. Drei Kinder, die Großmutter. Da muss Geld reinkommen. Deutschland, Wirtschaftswunderland: Autos werden für immer mehr Menschen erschwinglich. Gute Zeiten für Werkstätten und Tankstellen. Die Schulzes haben ein Gespür für den Trend. Mit Autos ist der Lebensunterhalt zu verdienen. Er, Robert, kennt sich aus mit Motoren. Sie, Gertraut, kann aufs Geld achten. Eine gute Kombination.
© Archiv Margot KäßmannMit Puppenwagen
© Archiv Margot KäßmannMargot mit ihrer Mutter
Die älteren Schwestern gehen zur Schule. Margot, die Kleine, muss beaufsichtigt werden. Es wäre gut, wenn sie zum Kindergarten ginge, das würde etwas Freiraum geben, niemand müsste auf sie aufpassen. Doch Margot mag nicht dort sein. Da sind so viele fremde Kinder. Und Erzieherinnen, die ihren Beruf bisweilen mit strenger Hand ausüben. Backpfeifen gehören dazu. Einmal erbricht ein Kind seinen Spinat; zur Strafe muss es das Erbrochene aufessen. Warum also sollte Margot dorthin gehen? In der Werkstatt ist es doch viel schöner!
© Archiv Margot KäßmannMargot mit ihren Schwestern Gisela und Ursula
Margot reagiert körperlich. Drei Tage Kindergarten – und sie wird krank. Schnupfen, Husten, Bauchweh – alles in ihr wehrt sich gegen die Kindergarten-Ausflüge. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Drei Tage Kindergarten – Krankheit. Drei Tage Kindergarten – Krankheit. Nach einer Weile wird es der Mutter zu bunt. Dann geht es eben nicht. Dieses Kind ist zu eigensinnig, als dass man es nach Gutdünken verplanen kann.
Anstrengend ist Margot ja eigentlich gar nicht. Wenn die Omi gegen Mittag von ihrer kleinen Wohnung zum Haus der Schulzes hinunterkommt, um das Mittagessen für alle zu kochen, ist Margot nie weit. Mit ihr verbringt sie Zeit im Garten oder in der Küche.
»Wie gern sie Paul-Gerhardt-Lieder sang! Viele Strophen kenne ich bis heute auswendig, weil sie zum Kartoffelschälen oder Gulaschkochen dazugehörten«, erinnert sich Margot. Außerdem hatte die Omi für fast jede Situation ein passendes Bibelzitat parat, zum Beispiel: »Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen!« Margot erinnert sich gern an den lebensnahen und fröhlichen Glauben, den ihr die Omi vermittelte.
© Archiv Margot KäßmannMit der Großmutter auf Wyk, 1968
© Archiv Margot KäßmannMit Geselle Günter Trexler in der Werkstatt
Auch wenn sie den Betrieb in der Werkstatt beobachten kann, ist Margot selig. »Der kleine Robert« wird sie dort genannt. »Ich habe immer das Bild von meinem Vater im Kopf, wie er lacht, wenn er mich sieht!« Er konnte aber auch mal jähzornig werden oder schlechte Laune haben. In der Werkstatt kann sie tun, was sie will – zu Hause warten ihre Schwestern auf sie und lauter Aufgaben. Auch in den Ferien. Die drei finden dann Zettel auf dem Tisch liegen: »Margot Waschbecken, Ursula Küche putzen, Gisela Unkraut jäten«. Wenn sie etwas gut gemacht haben, finden sie auch mal einen Zettel mit mütterlichem Lob. »Mutti eine Freude machen, das war ein großes Thema«, erinnert sich Margot. »Mein Vater war schon eher so, dass er einen mal gedrückt hat oder einen Kuss gegeben hat. Meine Mutter war da distanzierter. Knuddeln oder kuscheln, so war sie nicht.«
© Julia BaumgartVor der Werkstatt heute
Ab und an, etwa einmal im Jahr, gibt es eine Unterbrechung des Alltags. Dann lädt Vater Robert seine kleine Margot zum Essen ein. Im »Goldenen Hahn«, dem einzigen Restaurant in Allendorfs Innenstadt. Der kleine und der große Robert Schulze. Jägerschnitzel mit Pommes gibt es: Das ist das Größte.
Gerne trifft Margot sich auch mit Cousine Monika. Beide bringen ihre Puppen mit, spielen dann im Sandkasten oder streunen durch den Obst- und Gemüsegarten. Ein riesiges Gelände wartet hinter der Werkstatt, die Mädchen können machen, was sie wollen. Ein Kinderparadies.
© Archiv Margot KäßmannMit Papa
© Archiv Margot KäßmannEinschulung
Die Einschulung ist auch zu Beginn der 60er-Jahre schon etwas Besonderes, das merkt Margot. Die Mutter ist aufgeregt. Sonst trägt Margot selbst genähte Kleidung. Für diesen Tag kauft ihr die Mutter einen dunkelblauen Mantel und ein Kopftuch. Margot fühlt sich sehr schick.
Und sie freut sich. Endlich gehört sie zu den Schulkindern und darf das lernen, was die Großen schon können. Auch freut sie sich, dass sie nicht alleine gehen muss. Cousine Monika wird ebenfalls eingeschult. Mit ihren Schultüten präsentieren sie sich Margots Vater, der stolz ist auf seine »kleine Schwarze«. Nun wird sie nicht mehr den ganzen Tag in der Werkstatt herumtoben!
Im vierten Schuljahr posiert die Grundschulklasse mal für ein Klassenfoto. Alle Mädchen tragen Röcke. Alle? Nein: Margot trägt Hosen. Röcke findet sie unpraktisch. Am liebsten mag sie diese Stretchhose, ein Bügel unten um den Fuß hält sie straff, die Bügelfalte wirkt wie eingraviert. Strumpfhosen dagegen mag sie nicht, die kratzen so.
Die Großmutter sitzt an der Nähmaschine und versorgt die drei Schwestern mit neuer Kleidung. Manchmal bekommen die drei auch ein neues Kleid geschenkt, jede dasselbe. Margot als Jüngste muss dann auch die Kleider der beiden Älteren auftragen. Das nervt sie. Und nun mit Hosen in der Schule. »Bist du die Margot von dem Robert von der Tankstelle?«, fragt der Klassenlehrer. »Ja.« – »Das sieht man!«
© Archiv Margot Käßmann4. Klasse Abschluss Grundschule
Margots Schulweg ist ein Erlebnis: Alleine geht sie los mit ihrem Ranzen, dann holt sie Frank ab und dann Jürgen, genannt »Gucki«. Es gibt immer etwas Spannendes zu bereden, bis die Clique in der Waldschule ankommt und sich alle auf ihre Schulbänke setzen. Margot sitzt neben Frank, einem lebhaften und zu allen Späßen und Mutproben bereiten Jungen. Frank imponiert den anderen schon mal dadurch, dass er einen Regenwurm isst oder beim Malunterricht den ganzen Pinselbecher austrinkt, ex und hopp. An seiner Seite fühlt Margot sich wohl. In den Pausen fangen die Mädchen die Jungs, dann die Jungs die Mädchen. Schule ist lustig, ganz anders als der Kindergarten. Außerdem weiß sie ja, weshalb sie hier ist: Sie möchte Lesen und Schreiben lernen, damit sie endlich das kann, was ihre Schwestern können.
Dafür tut sie, was die Lehrer von ihr erwarten. Margot merkt aber auch: Manche sind mit Vorsicht zu genießen. Der Klassenlehrer zum Beispiel. Geduld gehört nicht zu seinen Stärken. Ärgert er sich zu sehr, wirft er schon mal mit seinem dicken Schlüsselbund nach den Kindern. Schnell lernt Margot, dem Geschoss und damit verbundenen Scherzen auszuweichen.
Auf dem Rückweg haben die Kinder meist genauso viel Spaß wie am Morgen. Nach und nach verabschieden sich alle, bis Margot alleine wieder vor ihrer Haustür steht. Dort riecht es bereits nach Mittagessen: Die »Omi« hat gekocht. Dann geht Margot zur Werkstatt. Ihre Großmutter ist damit manchmal nicht einverstanden, lockt sie sogar mit Schokolade zum Zuhausebleiben. Dann lässt sich Margot Gründe einfallen. Einmal lässt sie so-gar Luft aus ihrem Fahrradreifen und sagt, sie müsse ihn unbedingt vom Vater reparieren lassen. »Na, kleine Schwarze!?«, begrüßt der sie und gibt ihr erst mal einen Mohrenkopf aus dem Tankstellenshop.
© Archiv Margot KäßmannAuf dem Werkstattgelände
Auch die Gesellen Manfred und Günter, beide Mitte 20, freuen sich über die Abwechslung. Im Sommer bringen sie Margot Erdbeeren mit, sie ist selig. Und dann gibt es da noch den Lehrling Robert. Immer wenn Margots Mutter ihn ruft, fühlt auch ihr Mann sich angesprochen. Also bekommt der Lehrling einen Spitznamen: Bobbi.
Der Hof vor den vier Werkhallen ist groß. Da kann Margot Fahrrad fahren. Sie muss nur aufpassen, dass sie nicht gegen die Autos brettert. Einmal passiert es, ein Kratzer, das gibt Ärger.
Samstagmittags wird das Tor geschlossen. Wochenende. Der Hof ist leer. Eine geschützte Fläche mitten in Allendorf. Viel Platz zum Rollschuhfahren, zum ausgelassenen Toben, zum Stelzenlaufen und zum Tischtennisspielen. »Ich habe den Geruch nach Öl und Reifen noch in der Nase«, erinnert sich Margot.
Und die Tankstelle? In die hat Meister Schulze zusätzlich eine Kneipe gebaut. Die »Raststätte«. Eine Theke, ein Zapfhahn, ein Fernseher. Platz für rund 20 Gäste, mehr müssen es auch nicht sein. Zum Mittagessen und einem ausführlichen Mittagsschlaf kam Robert nach Hause, abends saß er spätestens um 20 Uhr zur Tagesschau mit einem Gläschen Bier vor dem Fernseher im Wohnzimmer. Werkstatt, Tankstelle und Raststätte sind sein Reich. Hier treffen sich die Männer, gucken Fußball, Boxkämpfe, die Mondlandung. Eine Männerwelt, in der die kleine Margot tagsüber aufwächst. Ohne Rock – mit Hosen.
© Archiv Margot KäßmannMit Gisela in Berlin, 1965
Manchmal macht der Vater mit Margot auch Ausflüge. Das Sechstagerennen in Berlin lockt ihn. Der Ford wird klargemacht. Alleine fahren will er nicht. Er nimmt seine Gesellen mit, auch Margot und ihre Schwester Gisela. Im Sommer 1965 gehen die Schwestern über den Ku’-damm, Café Kranzler, Tiergarten: Was für eine riesige Stadt! Währenddessen kaufen die Gesellen Asbach Uralt und Zigaretten, die sind hier billiger als zu Hause. Die Abreise führt die hessischen Berlin-Touristen über die Transitautobahn durch die DDR. Die Grenzkontrollen sind streng. Ein Grenzer fragt sie, ob sie etwas zu verzollen haben. »Nein!«, sagen die drei Männer gelassen. Margot sitzt auf der Rückbank. »Aber ihr habt doch Schnaps und Zigaretten gekauft!«, sagt sie ehrlicherweise. Den Männer stockt der Atem. Den Grenzer bringt Margot mit ihrem Einspruch jedoch zum Lachen. »Dummes Geschwätz«, sagt er und winkt den Wagen durch.
Immer wieder Sonntags
Die Woche bei Schulzens ist klar durchgetaktet. Montags bis samstags bedeutet das für Margot Schule, am Sonntag selbstverständlich Kindergottesdienst. »Wenn der liebe Gott die ganze Woche für dich Zeit hat, wirst du ja wohl am Sonntag eine Stunde für den lieben Gott Zeit haben!«, argumentiert die Mutter. Dabei braucht sie gar keine Überredungskünste. Margot macht der Kindergottesdienst Spaß, sie geht gerne in die Herrenwaldkirche. Dass der Glaube nichts vom Alltag Abgetrenntes ist, erfährt sie auch zu Hause. Ihre Großmutter und ihre Mutter spickten das Leben mit biblischen Weisheiten. Jeden Morgen liest die Mutter die Herrnhuter Losung. Wird das Leben zu schwierig und wirr, sucht Gertraut Schulze Halt in der Bibel und im Glauben. Und diese Lebenshaltung vermittelt sie auch den Töchtern.
© Archiv Margot KäßmannMargot, 1963
Natürlich kennt sie auch das Gebot, den Feiertag zu heiligen. Aber wie soll das gehen, wenn man eine Tankstelle hat? Die Leute brauchen doch auch am Sonntag Benzin! Pünktlich um acht Uhr geht Mutter Schulze sonntags in die Tankstelle. Und pünktlich um zehn Uhr löst ihr Mann sie ab, damit sie um Viertel nach zehn rechtzeitig zum Gottesdienst in der Kirche sitzt. Der ist ihr eine Kraftquelle.
Robert Schulze respektiert die Frömmigkeit seiner Frau – teilt sie aber nicht. »Mein Vater war ›Normalchrist‹«, blickt Margot Käßmann später zurück, »Kirche gehörte für ihn irgendwie zum Leben.« Zur Kirche aber ging er nur an Weihnachten oder zu Familienfesten wie Taufen, Hochzeiten, Trauerfeiern. Und an Wahlsonntagen. Da ging auch er erst in den Gottesdienst, dann ins Wahllokal. Demokratie, die Stimme abgeben: Das war quasi etwas Heiliges! »Es war schon ein religiöses Elternhaus, Gott spielte eine Rolle«, sagt Margot Käßmann heute, »aber nicht mit Druck: ›Du sollst …‹, ›du musst …‹ oder ›der strafende Gott sieht alles‹!«
© Archiv Margot KäßmannIm Kreis der Familie
Nach der Kirche gibt es Mittagessen. Um drei kommen Tanten und Onkel zu Kaffee und Kuchen. Damals im heimatlichen Allendorf habe sie eine »positive Sonntagskultur« kennengelernt, sagt Margot Käßmann heute. An solchen Tagen liest Margot auch viel. Sie verschlingt die Bücher über Hanni und Nanni – jene ungleichen Teenie-Zwillinge, die im Mädcheninternat Lindenhof viel erleben. »Hanni und Nanni sind immer dagegen«, »Hanni und Nanni schmieden neue Pläne«: Diese Kinderbuchbestseller der englischen Schriftstellerin Enid Blyton ziehen ab 1965 unzählige Kinder in ihren Bann. Lustig sein wie Hanni und Nanni: Das kann Margot auch auf Faschingsfeiern.
Auch das Kino lockt mit wundervollen Geschichten. 1964, im Jahr der Einschulung also, darf Margot zum ersten Mal ins Kino Stadtallendorf gehen. Die Schlange, in der sie mit ihrer Schwester Ursula ansteht, ist lang. Es läuft ein Kassenschlager: »Der Schatz im Silbersee«, die erste Verfilmung eines Karl-May-Buches, freigegeben ab sechs Jahren. Margot ist hin und weg. Old Shatterhand und Winnetou, gespielt von Lex Barker und Pierre Brice, was für tolle Männer! Der Film strotzt nur so von überwältigend schöner Natur, von Kriegsbeilen und Friedenspfeifen. »Es ging um Gerechtigkeit und Frieden, das Ringen um das Gute, Respekt vor Menschen anderer Herkunft, Freundschaft, Liebe und – Pferde!«, erinnert sie sich fast 50 Jahre später, als sie von der Deutschen Filmakademie nach ihrem Lieblingsfilm gefragt wird. »Ich war schlicht begeistert und sah mich schon für all das kämpfen.« Im September 2012 sitzt sie bei einer Veranstaltung, bei der sie eine Rede halten soll, im Berliner Astor-Kino am Ku’damm neben einem der Darsteller von damals: Ralf Wolter, der den Trapper Sam Hawkens spielte, den skalpierten treuen Freund der beiden Helden, der stets sagte »… wenn ich mich nicht irre, hihihi«. »Letzen Endes ging es um die ganz großen Themen des Lebens«, erklärt sie dem Kinopublikum, »ein bisschen schon wie in der Bibel: Gut und Böse, Gerechtigkeit und Respekt, Mut und Versagen. Das habe ich damals nicht so gesehen, aber ich denke, das hat mich mitgerissen.« Und sie erinnert natürlich auch an die selbstbewussten Frauen in dem Film, »die sich zu verteidigen wissen«, allen voran Karin Dor und Marianne Hoppe.
So angetan ist die sechsjährige Margot, dass sie in den folgenden Jahren fast alle Bücher von Karl May liest. Ihre Mutter unterstützt diese Leselust, das schult den Verstand und bildet, meint sie. Weihnachten legt sie Margot Walt-Disney-Bücher unter den Baum. Die Mutter möchte auch, dass Margot ein Instrument lernt. Blockflöte kann sie, ein bisschen Klavier auch, nun folgt: Geige. Wie die Kultur im Krieg zum Überleben beitrug, so will die Mutter sie auch den Kindern vermitteln: Jedes Kind lernt ein Instrument. Ein Ausflug ins Staatstheater nach Kassel zum Besuch des Weihnachtsmärchens, Urlaub auf Wyk/Föhr mit kulturellem Programm für Kinder – all das war Gertraut Schulze wichtig zu vermitteln, obwohl der Steuerberater mahnte, das würde die finanziellen Verhältnisse der Familie übersteigen.
© Archiv Margot KäßmannFasching 1967
Margots Leben spielt sich zwischen zwei Polen ab: In der Werkstatt war immer eine gelassene Stimmung, »mein Vater war sehr lebenslustig, ließ auch mal fünfe gerade sein«. Zu Hause bei der Mutter dagegen herrscht Disziplin. »Meine Mutter habe ich streng in Erinnerung«, erzählt sie. Am Sonntag oder in den Ferien lange im Bett bleiben oder die Zeit verbummeln, das gibt es nicht. Auch in der Ferienzeit haben die Kinder ihren Pflichten nachzukommen. »Damals rebellierte ich manchmal. Heute würde ich allerdings sagen, es hat mir viel geholfen«, blickt Margot Käßmann zurück. So habe sie gelernt, »diszipliniert zu sein und zu sagen: ›Das schaffe ich schon.‹« Ganz nach der Lebensmaxime ihrer Mutter: »›Wenn du dich zusammenreißt, dann schaffst du das schon!‹« Wenn im Leben nicht alles so läuft, wie sie es sich vorstellt, erinnere sie sich noch heute an diesen Spruch. Trotzdem, der Vater ist ihr liebevoller in Erinnerung, auch wenn die Mutter sie wohl stärker geprägt hat.
© Archiv Margot KäßmannAuf Fehmarn 1970
Veränderungen
Der zehnte Geburtstag bedeutet Margot viel. Immer mehr versteht sie von der Welt, in der gerade so viel passiert. Sie bekommt ein Notizbuch geschenkt und macht es zu ihrem Tagebuch. Am 16. Juli schreibt sie stolz ihren ersten Eintrag hinein: »Heute brachte ich zum letzten Mal aus der Volksschule ein Zeugnis mit. Gisela ist Klassenbeste. Ich habe 6 mal eine 1, 6 mal eine Zwei, eine 3 in Zeichnen, eine 4 in Turnen.« Am 20. August der zweite Eintrag, diesmal ist die Zehnjährige von den politischen Ereignissen verunsichert. »Heute sind die Russen in die Tschechoslowakei einmarschiert. Was man hört, ist schrecklich. In Biafra gibt es Hungersnot und Krieg. In Vietnam auch Krieg. Ägypten ist gegen Israel im Krieg. Unsere Soldaten stehen auf jeden Fall in Alarmbereitschaft.«
»Die Russen« sind ein großes Thema in der Familie Schulze. Die Amerikaner sind die Retter, die Guten – die Russen die Bösen, so das Weltbild. Kein Wunder nach dem Leid, das die sowjetischen Besatzer der Großmutter und Tante zugefügt hatten. Nun kam »der Russe« erneut immer näher. Stadtallendorf–Prag, das sind gerade mal 400 Kilometer. Beängstigend. Ob die Amerikaner wieder helfen würden, so wie damals?
Die Schatten der Vergangenheit werden wach. Die Angst, wieder alles zu verlieren, wie einst in Pommern. Margot hört mit, wie die Mutter mit Verwandten über die Vergewaltigungen spricht. »Das hat mich zur vehementen Kriegsgegnerin gemacht«, mutmaßt Margot Käßmann heute.
Dann kommt der große Bruch.
Neue Wege
Nach der vierten Klasse soll Margot auf die Schule, die ihre Schwestern schon besuchen. Aufs Elisabethgymnasium nach Marburg. Das ist weiter weg als Kirchhain, wohin die meisten Oberschülerinnen aus Allendorf fahren. Warum Marburg? Das hängt mit Gisela zusammen. Sie ist schwerhörig, eine erblich bedingte Einschränkung, unter der auch die Mutter und deren Vater litten, erkennbar z. B. am angestrengten Hinhören mit meist ernstem Gesichtsausdruck und am Vermeiden von geselligen Runden. Als der Hörausfall bei der Einschulung diagnostiziert wurde, empfahl der Chefarzt der Uniklinik (Selbstständige waren privat versichert), Gisela in eine Mädchenschule zu schicken. Die gab es nur in Marburg. Klar, dass Schwester Ursula und nun auch Margot ebenfalls dorthin gehen. Die Schwestern sollen zusammenhalten und einen guten Beruf erlernen, das ist der große Wunsch der Mutter. Ihre Kinder sollen später nicht auf einer Tankstelle arbeiten. Sie sollen es mal besser haben – studieren, auf eigenen Beinen stehen und nicht von Männern abhängig sein.
© Archiv Margot KäßmannMargot, 1972