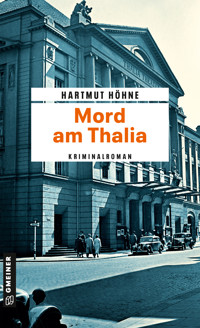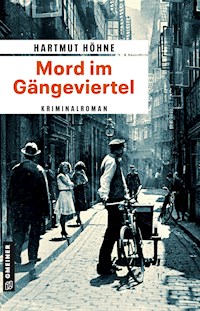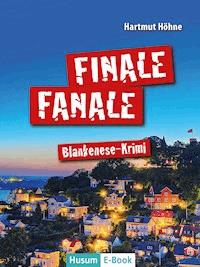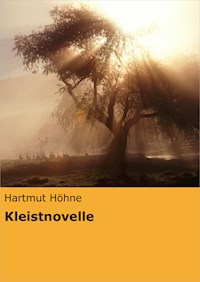
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wieland Grimm verschlägt es nach Frankfurt an der Oder. Als Kleist-Beauftragter soll er das üppig bedachte Gedenkjahr zum 200. Todesjahr des berühmten Sohnes der Stadt planen und organisieren. Fortan begleitet ihn die kritische Auseinandersetzung mit Heinrich. Dabei steht ihm Jette Friedeborn zur Seite, eine Mitarbeiterin des Kulturreferats. Zunächst läuft alles zur vollen Zufriedenheit, doch nach und nach verändert sich sein Leben in einer unvorhergesehenen Weise. Eine Liebesbeziehung mit Jette war eigentlich nicht eingeplant, Wieland schwankt in seinen Gefühlen zu ihr. Der Tod seines Vaters bereitet ihm eine Lebenskrise. Er stellt seine bisherige Lebensform auf den Prüfstand, die im Privaten eher auf Unverbindlichkeit gegründet ist und darauf, sich nicht an einem Ort sesshaft zu machen. Das Kleistjahr wird ein voller Erfolg, die intensive Arbeit an diesem Projekt hat sich gelohnt. Doch dann ist da noch die letzte Großveranstaltung des Gedenkjahres, ein internationales Symposium, das er moderiert. Ein unerwarteter Eklat bringt ihn ins Abseits. Bleibt Wieland in Frankfurt, bleibt er bei Jette?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hartmut Höhne
Kleistnovelle
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
"Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein."
Kleistnovelle
Impressum
"Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein."
Heinrich von Kleist, in: Prinz Friedrich von Homburg, Inschrift auf Kleists Grab
Kleistnovelle
Nicht, dass ich noch am Stadtrand erschossen werde, wenn man mich hier mit Zigarette sieht. Schließlich bin ich hergekommen, um die nächsten vier Wochen in dieser Kurklinik zu verbringen. Nicht mal auf seinem Balkon ist man vor abschätzigen Blicken sicher. Die Klinik ist so schön idyllisch an einem dieser vielen Havelseen rund um Potsdam gelegen, also Stadtrand gibt es hier genug.
Eigentlich ist die Luft viel zu schade um sie zu verqualmen, und eigentlich bin ich mit allerhand guten Vorsätzen angereist, aber eigentlich mag ich das Wort `eigentlich´ nicht und jetzt ist es mir auch egal. Diese wunderbare Giftzigarette wird zu Ende geraucht, so wahr ich Wieland Grimm heiße.
Mit Mitte vierzig sollte man langsam Vernunft annehmen, hat mir Jette noch vor kurzem ins Gewissen geredet, auf das Gift verzichten solle ich, das könne doch nicht so schwer sein. Doch, Jette, das ist es, habe ich geantwortet und ihr Unverständnis in Kauf genommen. Ich kann ihr nicht jeden Wunsch erfüllen, denn wenn ich das Rauchen aufgeben würde, dann nur für sie. So weit bin ich noch nicht. Noch immer nicht.
Auf der Klinikhomepage wird mit einem ganzheitlichen Ansatz geworben, wie auf den Internetseiten aller Kurkliniken. Eine dieser unvermeidlichen, esoterisch anmutenden, Standardphrasen. Natürlich darf auch die Nachhaltigkeit nicht fehlen und der Hinweis, dass bei ihnen der Mensch im Mittelpunkt stehe. Na so was, wer hätte das für möglich gehalten?
Schließlich hatten der Wellnessbereich und vor allem die Aussicht auf Hotelkomfort doch etwas für sich, sodass ich kurzfristig gebucht habe.
„Nicht schlecht“, hatte Jette bemerkt, wobei sie mit der Hand durch mein, noch immer, volles, dunkles Haar fuhr. Eine Geste, die wahrscheinlich die nachfolgende Bevormundung abmildern sollte.
„Reha auf Staatskosten, genieße es, aber vergiss die therapeutischen Anwendungen nicht.“
Die liebe Jette, sie weiß einfach, was gut für mich ist.
In der Tat, es muss etwas geschehen. In den letzten Monaten haben sich einige Symptome angehäuft, die sich wechselseitig verstärken: Schlaflosigkeit trotz Müdigkeit, Essstörungen, rebellischer Magen, Gewichtsverlust, Gereiztheit, das zehrt inzwischen reichlich an der Substanz.
Als der Bürgermeister mir dann mit väterlichem Gestus zur Kur riet, habe ich mich nicht lange geziert, zumal auch Jette dabei stand und mir vorsorglich ihren Ellenbogen in die Seite stieß. Ja, gute Fee, ich habe verstanden. Über die Kosten solle ich mir mal keine Sorgen machen.
Na bitte, Vater Staat sorgt für seine Schäfchen. Und ein Schäfchen war ich zweifellos, als ich den befristeten Vertrag als Kleistjahr-Koordinator unterschrieben habe, das heißt, eher schon ein ausgewachsenes Schaf. Es hat aber nicht primär etwas mit dem Job als solchem zu tun, sondern mit mir selbst. Nun ist der Endpunkt des Gedenkjahres zugleich der Beginn meines Kuraufenthalts.
Eine Evaluation des Kleistjahres 2011 steht zwar noch aus, aber da sehe ich keine Probleme, schließlich war ich bienenfleißig und habe beizeiten jede Kleinigkeit dokumentiert. Im Übrigen kann ich auch auf Jettes Aufzeichnungen zurückgreifen.
Da bereitet mir die Aufarbeitung meiner persönlichen Erlebnisse der letzten zwei Jahre als Kleistjahr-Koordinator schon mehr Kopfzerbrechen, vielleicht bin ich zeitlich noch zu dicht dran. Das hätte ich dem Therapeuten gestern auch gleich sagen können, als er mir riet, noch einmal – speziell das letzte Jahr – Revue passieren zu lassen und alles aufzuschreiben, „... frei von der Leber weg.“ Als ob sie Tagebuch schrieben, meinte er, oder ein Gedächtnisprotokoll.
Kein schlechter Gedanke.
Tatsächlich könnte ich mithilfe meines buchdicken Terminplaners meine jüngsten Erlebnisse rekonstruieren, wobei eine strikte Trennung zwischen beruflich und privat weder möglich noch sinnvoll wäre. Schließlich hat sich der von mir verursachte Eklat erheblich auf meine persönliche Situation ausgewirkt, und ob ich beruflich noch mal im Kulturbereich Fuß fassen kann, ist fraglich. Durch den Kuraufenthalt hat mich der Bürgermeister erst mal aus der Schusslinie genommen, statt mich gleich zu suspendieren, was auch im Sinne der Stadt ist. Außerdem war er mir noch etwas schuldig. Aber was kommt danach?
Ja, doch, es ist Zeit für eine Bilanz.
Der Speisesaal kann sich sehen lassen. Hier spricht alles den Durchschnittsgeschmack an, die dezenten Tapeten, die hell gehaltene Einrichtung, viel Holz, die überwiegend indirekte Beleuchtung, das in professionellem Walmart-Servicesmile unterwiesene Personal. Aschenbecher kann man hier natürlich nicht erwarten. Zum Rauchen geht man in einen kleinen Raum, der an den Innenhof grenzt und der gut zu belüften ist.
Hier war es auch, wo ich gestern zum ersten Mal gefragt wurde, wo ich denn herkäme und was ich beruflich so mache. Da fiel mir auf, dass ich mir noch gar keine Kommunikationsstrategie ausgedacht habe. Ich verspürte wirklich keine Lust, mich über meine berufliche Tätigkeit ausfragen zu lassen, das fehlt noch. Also werde ich versuchen, allgemein zu bleiben: städtischer Angestellter in Frankfurt an der Oder, die übliche Büroarbeit, Sachbearbeitung eben. Das muss reichen.
Auf den ersten Eindruck hin scheinen meine neuen „Mitbewohner“ nicht so interessant zu sein, dass es sich lohnen würde, groß in soziale Kontakte zu investieren, schließlich will ich nur knapp vier Wochen bleiben und zu Silvester wieder zu Hause sein. Außerdem habe ich mit meinem persönlichen Rechenschaftsbericht in nächster Zeit genug zu tun. Ich kann Jette richtig in Gedanken vor mir sehen, wie sie – als meine oberste Gewissensinstanz – leicht den Kopf schüttelt und mir Snobismus vorwirft.
So weit ist es also schon gekommen, dass meine Kollegin, die, obwohl physisch gar nicht anwesend, in den Strom meiner Gedanken eingreift. Seit zwei Jahren kennen wir uns erst, doch manchmal erscheint es mir, als wären wir wie ein alltagserprobtes Ehepaar. Na ja, wir sind schon mehr als nur Kollegen. Viel mehr. Auch hierüber muss ich mir dringend einmal Klarheit verschaffen, das bin ich mir und vor allem Jette schuldig.
Ich bin es gewohnt, Texte direkt in den Laptop einzugeben. Handschriftliche Notizen und Aufzeichnungen machen bei mir höchstens noch einen Anteil von fünfundzwanzig Prozent aus. Es steht zu befürchten, dass ich eines Tages aufwachen werde und feststelle, es geht nicht mehr, seit heute habe ich die alte Kulturtechnik des Schreibens einfach verlernt. So wie ich das Dividieren mit Stift und Zettel bereits vergessen habe, könnte ich möglicherweise auch das Schreiben verlernen. Das Schreiben müsste ich dann komplett durch die neue Kulturtechnik des Tippens ersetzen. Ich bin davon überzeugt, mein Schriftbild hat sich bereits negativ verändert. Für mich, als Literaturmensch, ist dies eine grausliche Erkenntnis.
Es ist also an der Zeit, an einem kultivierten Schriftbild zu arbeiten. Ich werde meinen Bericht mit einem Füllfederhalter schreiben. Mit einem besonderen Füllfederhalter, einem Geschenk der Eltern zur bestandenen Magisterprüfung. So viele Jahre besitze ich das gute Schreibgerät schon, doch ist es lange Zeit nur selten zum Einsatz gekommen, eigentlich erst, seitdem ich meine neue Stelle angetreten habe.
In der Retrospektive ein Ereignis wie aus einer anderen Welt. Ein Universitätsabschluss, der erste und bislang einzige in der Familie. Ihr Sohn, der Literaturwissenschaftler. Es war mir nie so richtig gelungen den Eltern zu vermitteln, worum es in dieser Disziplin überhaupt geht, welches die Aufgaben und Funktionen eines Literaturwissenschaftlers sind, oder gar, dass es ein echter Beruf ist, mit dem man seinen Unterhalt verdienen kann.
Als es dann aber soweit war, ich stolz mein Magisterzeugnis präsentierte, hatte sich wohl jeder Zweifel von selbst erübrigt. Selten habe ich die Eltern so glücklich gesehen. Der Vater tat etwas geheimnisvoll, tuschelte Mutter etwas zu und lief kurz ins Schlafzimmer. Als er mit einem festlich verpackten Geschenk zurückkehrte, reichte er es zunächst an Mutter weiter, die es mir dann, leicht irritiert, übergab. Dann drückte sie mich fest an sich. Eine Szene, die sich mir fest eingeprägt hat.
Ebenso rührend war das Geschenk. Es handelte sich um eine Schmuckkassette mit einem Pelikan-Füller, nichts Pompöses, schlichtes Design, mittlere Preislage, wie es den Eltern entsprach und möglich war. Auf der Kappe war in goldfarbenen Lettern mein Monogramm eingraviert.
Sie hatten genau die richtige Wahl getroffen, fand ich, das perfekte Geschenk. Ich würde es in Ehren halten. Am Anfang bewahrte ich die Kassette wie eine Reliquie auf meinem Schreibtisch auf. Sie hatte für mich eher einen symbolischen als einen Gebrauchswert, bis ich mich schließlich dazu durchringen konnte, das gute Stück immer öfter auch in Gebrauch zu nehmen. Ein frisches Glas schwarzer Tinte habe ich besorgt.
Also. Wie fängt man an?
FRAGMENTE. KLEISTJAHR-KOORDINATOR.
HERBST 2009 – ENDE 2011
Da hatte ich mich so richtig gut vorbereitet und dann kam kaum einmal eine inhaltliche, werkbezogene Frage zu Heinrich von Kleist. Im Antizipieren von Vorstellungsgesprächen war ich noch nie gut, aber diesmal lag ich völlig daneben. Ich hatte den Eindruck gehabt, es ginge nur noch darum, meine Unterschrift unter den Vertrag zu setzen.
Meine Bewerbungsunterlagen konnten sich sehen lassen, da musste ich mich nicht verstecken. Erfahrungen in Veranstaltungsorganisation, Eventmarketing, Moderation, Fundraising et cetera hatte ich inzwischen genug vorzuweisen, dazu gute Arbeitszeugnisse und Referenzen und eine gewisse Bekanntheit in der Szene. Passenderweise bin ich auf den Literatursektor spezialisiert, habe hier recht gute persönliche Kontakte sowohl zu Literaten, als auch in den literaturwissenschaftlichen Bereich hinein. Möglicherweise war das auch der ausschlaggebende Aspekt gewesen.
Fast wäre ich ein wenig misstrauisch geworden, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich um diese Stelle nicht zu kämpfen brauchte. Wo war der Haken an der Sache? Ich hatte mich auf ein längeres Selektionsverfahren eingestellt, schließlich ging es darum, die Stadt Frankfurt im Jubiläumsjahr in strahlendem Glanz erscheinen zu lassen, da sichert man sich doch ab!
Die Kleiststadt Frankfurt/Oder, wie sie sich selbst nennt, war für den großen Sohn der Stadt von zentraler Bedeutung gewesen. Hier geboren, studierte er später auch einige Semester an der Universität Viadrina. Auch aus familiären Gründen kehrte er immer wieder nach Frankfurt zurück. Auch Berlin ist ein zentraler Kleistort. Es war also naheliegend gewesen, die Organisation des Gedenkjahres an das Frankfurter Kleist Museum und an die Berliner Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft zu vergeben. Ein Kleistjahr-Koordinator sollte her.
Wahrscheinlich hatten die Verantwortlichen schon vorher alle relevanten Informationen eingeholt, meine bisherigen beruflichen Stationen haben ja durchaus überprüfbare Spuren hinterlassen.
Herr Roeder, der Personalreferent, schien sich jedenfalls mehr für die praktischen Seiten meiner Anstellung zu interessieren. Eine Fürsorglichkeit, die ich ihm sehr zugutehielt. Ob ich denn jemanden kenne in der Stadt, bei dem ich unterkäme, oder ob man mir bei der Wohnungssuche behilflich sein könne? Freien Wohnraum gebe es hier genug, wahrscheinlich wolle ich aber nicht unbedingt in der Platte hausen, oder? Ich nickte noch, währenddessen er schon den Telefonhörer in der Hand hielt und eine Nummer wählte.
Kurz darauf betrat eine zierliche Frau in einem etwas zu groß geratenen Herrensakko den Raum. Bis auf eine lange, kastanienbraune Strähne verschwand ihr Haar unter der Jacke, was ich schade fand.
Von Anfang an übernahm sie die Initiative. Herr Roeder setzte gerade an, uns einander vorzustellen, da stand sie auch schon vor mir und hielt mir ihre Hand hin.
„Friedeborn, hallo“, waren die ersten Worte, die ich aus ihrem Mund hörte. Ich stand auf, nahm ihre Hand entgegen, erwiderte Lächeln und Gruß.
„Grimm, angenehm.“
Nun kam auch Herr Roeder zum Zug, indem er sich an mich wandte.
„Frau Friedeborn arbeitet normalerweise im Kulturreferat, sie wird sie aber ab sofort als Assistentin tatkräftig unterstützen, nicht wahr, Frau Friedeborn?“
Sie nickte kaum merklich, während ihre grünbraunen Augen mich unentwegt fixierten. Es gelang mir nicht, ihren Gesichtsausdruck zu deuten, gleichwohl war ich fest entschlossen, ihrem Blick standzuhalten. Ich dachte noch: Hoffentlich gibt es da keine intrigante Vorgeschichte, in die ich da hineingerate.
Wie alt mochte sie sein? Ende dreißig vielleicht, da hatten sich genug Erfahrungen abgelagert, um ein eigenes größeres Projekt zu verfolgen, und Frau Friedeborn machte einen überaus zielstrebigen Eindruck. Da will man sich doch nicht einen Auswärtigen vor die Nase setzen lassen, wo man doch selbst vom Fach ist. Einen Eindringling ohne jeden Stallgeruch und ohne lokale Kenntnisse.
Einen Moment lang erfasste mich eine Ernüchterung, wie ich sie oft verspüre, wenn ich eine Situation nicht kontrollieren kann.
„Herr Grimm braucht eine vernünftige Unterkunft. Sie haben sich doch schon mal etwas umgetan, Frau Friedeborn, stimmts?“
Sie nickte, diesmal etwas bestimmter.
„Na, dann kommen Sie mal am besten gleich mit, schlage ich vor. Wohnung besichtigen. Ist nicht weit.“
Mit der Gedenkkultur ist es ja so eine Sache. Bei Lichte betrachtet bedarf es keines bestimmten Tages oder Jahres, um einer verdienten historischen Person, sei sie Forscher, Sänger, Politiker oder Dichter, zu gedenken. Ein Tag ist da so gut wie jeder andere. Und wozu überhaupt sollte man einen Toten inszenieren, der doch gar nichts mehr davon hat? Wäre es da nicht besser, man würde dielebendenPersönlichkeiten mehr wahrnehmen und öffentlich ehren, ihnen Aufmerksamkeit, Medaillen und den einen oder anderen Verrechnungsscheck überreichen? Ja, das wäre sicher am besten, aber oft wird die Bedeutung eines Künstlers zu seinen Lebzeiten gar nicht erkannt.
Heinrich von Kleist zum Beispiel stand in den Augen seiner Zeitgenossen nicht besonders hoch im Ansehen. Mehr als einige kleine Achtungserfolge hatte er nicht aufzuweisen. Erst Jahrzehnte nach dem Tod kam seinem Werk die Bedeutung zu, die es verdiente. Und heute gehört Kleist auf jeder Sprechbühne zum Standardprogramm.
Ein anderer Dichter seiner Zeit, Johann Wolfgang von Goethe, hatte es dagegen schon auf Erden zum Dichterfürst gebracht, verdientermaßen. Hätte HvK wenigstens halb so viel Erfolg gehabt, hätte er, der Vierunddreißigjährige, sich womöglich 1811 auch keine Kugel in den Mund geschossen. Obwohl ... bei ihm konnte man nie wissen!
Von Beginn an hatte ich gegenüber Gedenkjahren eine zwiespältige Grundhaltung. Einerseits kann ich damit nicht viel anfangen, andererseits lebe ich davon. Gedenkkultur schafft außer Ambivalenzen auch Arbeitsplätze. Ein Markt entsteht, ich habe, wenn auch absichtslos, meinen Beitrag dazu geleistet.
Schnapsbrenner kreieren einen hochprozentigen „Kleistgeist“, Berliner Busunternehmer organisieren einen Grabshuttle zum Kleinen Wannsee, wo der Dichter und seine Todesgefährtin Henriette Vogel ihre letzte Ruhe fanden, Süßwarenhersteller produzieren, in Anlehnung an die Mozartkugeln, Kleistkugeln, also Marzipanpralinen in Patronenform. Die zarteste Versuchung, seit es Selbstmord gibt?
Manchmal ist auch von der Magie der runden Zahl die Rede. Anscheinend symbolisiert die runde Zahl in besonderer Weise den Abschluss eines bestimmten Zeitraums. Die Zahl 50 wird als jubiläumswürdiger angesehen als etwa die 49. Die 50 markiert den klareren Einschnitt, schließlich ist das Dezimalsystem fest in unseren Köpfen installiert.
Das Kleistjahr 2011 markierte den 200sten Todestag am 21. November. Das ganze Jahr über hat man mit zahlreichen Veranstaltungen des toten Dramatikers gedacht.
Praktischerweise verfügt die tote Prominenz ja nicht nur über ein Todes-, sondern auch über ein Geburtsjahr. So kann man bereits im Jahr 2027 Kleists 250stenGeburtstag begehen. Wer weiß, was sich die Gedenkindustrie dann einfallen lassen wird.
Gerne wird einem Gedenktag auch eine identitätsstiftende Bedeutung beigemessen. Worin die besteht, hat sich mir noch nicht erschlossen. Generell ist das Interesse an Heinrich von Kleist in breiten Bevölkerungsteilen eher gering, seine Werke sind kaum bekannt. Allenfalls hat man den einen oder anderen Titel seiner Stücke schon mal gehört, das „Käthchen“ vielleicht und den „Zerbrochenen Krug“. Mag sein, dass man sich aus der Schulzeit noch an den Namen „Michael Kohlhaas“ erinnert, aber das wäre schon viel.
Und die kleine Schar aufgeklärter, kulturbeflissener Theatergänger benötigt keine Identitätsstiftungsrituale, die kreist um sich selbst.
Ist es möglich, den Nachwuchs an Kleist heranzuführen? Wenn ja, warum? Selbstzweck, also Bildung um ihrer selbst willen? Was hat er heutigen Jugendlichen mitzuteilen?Was ist cool an HvK?Wie beantworten Theaterleute und Lehrer diese Frage?
Mein Büro.
Es liegt im schönen alten Rathaus und es gefiel mir gleich. Formal ist es ja noch mein Büro, wenn auch nur noch für kurze Zeit. Im Grunde habe ich mich schon von ihm verabschiedet. Frau Friedeborn war im Zimmer neben mir angesiedelt. Ja,siedelnist wahrscheinlich ein treffender Ausdruck, so heimelig, wie sie ihr Amtszimmer eingerichtet hat. Keine Spur von Arbeitsatmosphäre, also ich würde da nichts zustande bringen.
Mein Zimmer war eher spartanisch gehalten, ohne viel Schnickschnack, ich lasse mich sonst zu sehr ablenken. An der Wand gegenüber dem Schreibtisch blickte ich auf ein Poster mit Kleists Konterfei. Ich konnte mich so besser in ihn hinein versetzen. Das Bild war aus vielen, vielen Punkten zusammengesetzt, die in unterschiedlicher Verdichtung die Konturen seines Gesichts herausplastilierten. Es steckte in einem nicht entspiegelten Glasrahmen und mein Blick war direkt darauf gerichtet. Fiel das Sonnenlicht darauf, war ich geblendet.
Wie ein Kommissar, der sich ein Foto des Schurken auf den Schreibtisch stellt, lästerte Frau Friedeborn. War das etwa sarkastisch gemeint? Ihr verschmitztes Lächeln deutete ganz darauf hin.
Ihr Büro glich eher der Bude einer Biologiestudentin. Hohe IKEA-Regale, vollgestellt mit unnützem Krimskrams, einer privaten Bibliothek, Fotohalter mit fröhlichen Grinsegesichtern, davor ein Korbsessel und ein kleiner, runder Holztisch, auf dem einige Teelichte, ein Stövchen und ein paar umgedrehte Trinkbecher standen. Das Ganze integriert in eine grüne Hölle aus Zimmerpflanzen. Ihr PC war auf dem Schreibtisch kaum noch zu erkennen. Der Hausmeister hatte sie bereits mehrfach mit strengem Blick ermahnt, aber die Wirkung hielt nicht lange an. Auch die Reinigungsfirma war nicht gut auf Frau Friedeborn zu sprechen, da die Mitarbeiter für ihr Zimmer doppelt so lang brauchten.
Na toll, dachte ich, eine Schwererziehbare im Regenwald.
„Gibts hier auch Schlangen?“, fragte ich, als ich das erste Mal ihr Zimmer betrat. Sie ließ meine Bemerkung mit einem amüsierten Lächeln abtropfen und bot mir einen Becher Tee an.
Da gab es eine verschlossene Verbindungstür zwischen unseren Büros, auf die sie mit spitzem Finger deutete.
„Der Hausmeister sucht den Schlüssel raus“, teilte sie mir mit, „ich hoffe, Sie sind einverstanden, dass die Tür geöffnet wird. Wir haben dann einen ganz kurzen Weg.“