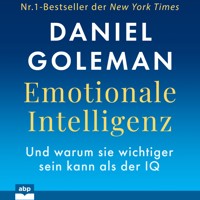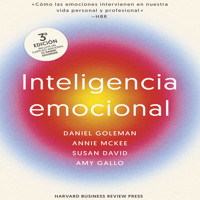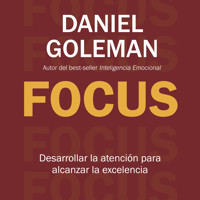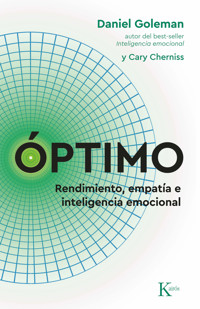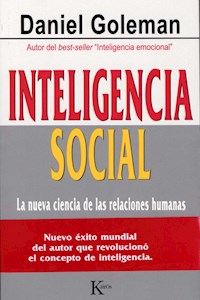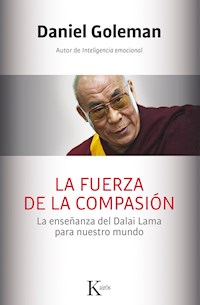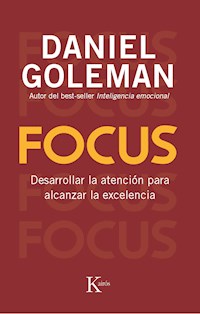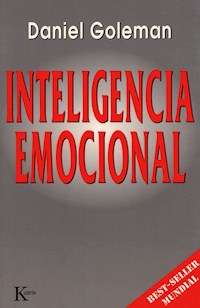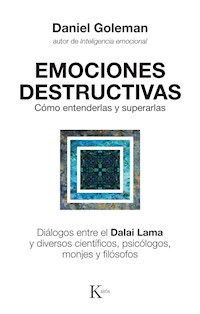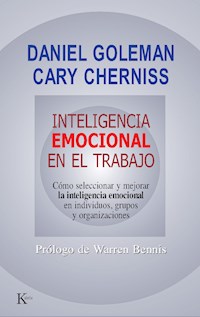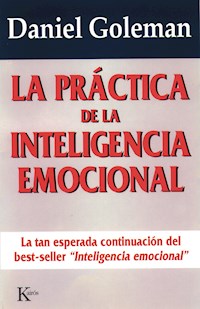10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Handy klingelt, ständig wird uns der Eingang neuer E-Mails angezeigt – auf allen Kanälen stürzen neue Informationen und Reize auf uns ein. Wie oft haben wir das Gefühl, uneffektiv zwischen den Dingen hin und her zu springen und nichts hundertprozentig zu machen. Doch um Leistung zu erbringen und erfolgreich zu sein, müssen wir, wie Daniel Goleman zeigt, unsere Aufmerksamkeit bündeln – sei es im Job, bei der Gestaltung unseres Privatlebens, beim Sport oder in der Politik. Goleman beschreibt anhand zahlreicher Studien und anschaulicher Fallbeispiele die neuesten neurobiologischen Erkenntnisse über Konzentrationsfähigkeit und wie sie jeder verbessern und damit souveräner seine Ziele im Leben verwirklichen kann. So müssen wir nicht länger Getriebene einer reizüberfluteten Zeit sein, sondern können das Bestmögliche aus uns herausholen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Dem Wohlergehen der kommenden Generationen gewidmet.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-492-96650-4
© 2013 by Daniel Goleman. All rights reserved. Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Focus. The Hidden Driver of Excellence« bei HarperCollins, New York. Deutschsprachige Ausgabe: © 2014 Piper Verlag GmbH, München Covergestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg Covermotiv: fotolia Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
DIE SUBTILE FÄHIGKEIT
Zuzusehen, wie der Hausdetektiv John Berger im Erdgeschoss eines Warenhauses an der Upper East Side in Manhattan mit seinen Blicken die Kunden verfolgt, heißt, Aufmerksamkeit aus nächster Nähe zu erleben. In seinem unauffälligen schwarzen Anzug, weißen Hemd und roter Krawatte, das Walkie-Talkie in der Hand, ist John ununterbrochen in Bewegung. Ständig kreist seine Konzentration um diesen oder jenen Kunden. Man kann ihn als Auge des Kaufhauses bezeichnen.
Es ist eine schwierige Aufgabe. Immer sind mehr als 50Kunden auf seiner Etage: Sie schlendern von einem Schmuckstand zum nächsten, probieren die Valentino-Schals an, sehen sich bei den Prada-Taschen um. Und während sie die Waren begutachten, werden sie von John begutachtet.
John wandert zwischen den Kunden hin und her – eine Studie in Brown’scher Bewegung. Ein paar Sekunden steht er, den Blick auf einen Kunden geheftet, hinter einem Stand mit Handtaschen, dann schlendert er zu einer Tür, von der aus er gute Sicht hat, nur um sich im nächsten Augenblick in eine Ecke zu bewegen, wo er von einem erhöhten Punkt aus ein potenziell verdächtiges Trio unauffällig im Auge behalten kann. Während die Kunden sich nur für die Waren interessieren und Johns aufmerksame Blicke nicht bemerken, überprüft er sie alle.
In Indien sagt man: »Wenn ein Taschendieb einen Heiligen trifft, sieht er nur die Taschen.« John würde in jeder Menschenmenge die Taschendiebe sehen. Sein Blick wandert hin und her wie ein Suchscheinwerfer. Ich kann mir vorstellen, wie sein Gesicht sich scheinbar zu einem einzigen großen Auge verengt, das an den einäugigen Zyklopen denken lässt. John ist verkörperte Konzentration.
Wonach sucht er? »Es ist die Art, wie sich ihre Augen bewegen, oder eine Bewegung in ihrem Körper«, die ihm die Absicht zum Klauen verrät, erzählte er mir. Oder diese Kunden, die dicht zusammenstehen, oder der eine, der sich verstohlen umsieht. »Ich mache das schon so lange, ich kenne die Anzeichen.«
Wenn John einen unter den 50Kunden aufs Korn nimmt, gelingt es ihm, die restlichen 49 und auch alles andere auszublenden – eine Konzentrationsleistung inmitten der ganzen Ablenkungen.
Eine solche Panoramawahrnehmung, die mit der ständigen Wachsamkeit für aufschlussreiche, aber seltene Signale abwechselt, erfordert mehrere Formen der Aufmerksamkeit: ständige Konzentration, Alarmbereitschaft, Orientierung und die Koordination von alledem. Jede davon stützt sich auf ihr eigenes Netz von Gehirnschaltkreisen, und jede ist ein unentbehrliches mentales Werkzeug.1
Johns ständige Suche nach einem seltenen Ereignis repräsentiert einen der ersten Aspekte der Aufmerksamkeit, die man wissenschaftlich untersuchte. Die Erforschung der Frage, was uns hilft, wachsam zu bleiben, begann im Zweiten Weltkrieg. Dahinter stand eine militärische Notwendigkeit: Man brauchte Radarbeobachter, die stundenlang höchste Wachsamkeit aufbringen konnten – und man stellte fest, dass sie gegen Ende ihrer Schicht, wenn die Aufmerksamkeit nachließ, mehr Signale übersahen.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges einen Wissenschaftler besuchte, der im Auftrag des Pentagon das Aufmerksamkeitsniveau bei drei- bis fünftägigem Schlafmangel untersuchte – ungefähr so lange mussten Offiziere den Schätzungen zufolge während eines Dritten Weltkriegs im Bunker wach bleiben. Glücklicherweise musste das Experiment nie in der harten Realität überprüft werden, aber er gelangte zu einem ermutigenden Befund: Selbst nach drei oder mehr schlaflosen Nächten können Menschen noch hohe Konzentration aufbringen, wenn die Motivation stark genug ist (aber wenn sie nicht aufpassen, nicken sie augenblicklich ein).
In den letzten Jahren ist die Aufmerksamkeit zum Gegenstand einer umfangreichen Forschung geworden, die weit über die Wachsamkeit hinausgeht. Die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, so die Erkenntnis, bestimmt darüber, wie wir beliebige Aufgaben bewältigen. Ist sie eingeschränkt, schneiden wir schlecht ab; ist sie besser ausgebildet, erbringen wir gute Leistungen. Unsere Lebensgewandtheit hängt von dieser subtilen Fähigkeit ab. Meist bleibt der Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und hervorragenden Leistungen zwar im Verborgenen, aber er wirkt sich auf fast alles aus, was wir zuwege bringen wollen.
Dieses vielseitige Werkzeug klinkt sich in unzählige mentale Tätigkeiten ein. Eine kurze Liste einiger grundlegender Operationen umfasst Auffassungsgabe, Gedächtnis, Lernen, das Gespür dafür, wie wir uns fühlen und warum, die Deutung der Gefühle anderer und eine reibungslose Kommunikation. Wenn wir diesen unsichtbaren Leistungsfaktor ans Licht holen, erkennen wir besser, wie nützlich die Verbesserung solcher geistigen Fähigkeiten ist, und wir verstehen auch, wie man das macht.
Durch eine optische Täuschung des Geistes bemerken wir in der Regel nur die Endprodukte der Aufmerksamkeit: unsere guten und schlechten Ideen, eine aufschlussreiche Bewegung, ein einladendes Lächeln, den morgendlichen Kaffeeduft. Vom Strahl der Wahrnehmung selbst dagegen nehmen wir keine Notiz.
Obwohl die Aufmerksamkeit ungeheuer wichtig dafür ist, wie wir uns im Leben zurechtfinden, stellt sie eine kaum beachtete und unterschätzte mentale Gabe dar. Ich verfolge hier das Ziel, diese schwer fassbare, unterbewertete geistige Fähigkeit, ihre Bedeutung für das Wirken des Geistes und ihre Rolle für ein erfülltes Leben ins Rampenlicht zu holen.
Zu Anfang wollen wir einige grundlegende Aspekte der Aufmerksamkeit untersuchen; Johns wachsame Alarmbereitschaft ist nur einer davon. Die Kognitionsforschung beschäftigt sich mit einem breiten Spektrum verschiedener Phänomene wie Konzentration, selektive Aufmerksamkeit und Aufgeschlossenheit, aber auch mit der Frage, wie unser Geist die Aufmerksamkeit nach innen richtet und so seine eigene Tätigkeit beaufsichtigt.
Auf solchen grundlegenden Mechanismen unseres Geisteslebens bauen lebenswichtige Fähigkeiten auf. Zum einen ist da die Selbstwahrnehmung, die das Selbstmanagement ermöglicht. Dann gibt es die Empathie als Grundlage der Beziehungsfähigkeit. Das alles sind fundamentale Elemente der emotionalen Intelligenz. Und wie wir noch genauer erfahren werden, kann eine Schwäche in solchen Bereichen ein Leben oder eine Karriere untergraben, während entsprechende Stärken das Gefühl von Erfüllung und Erfolg begünstigen.
Über solche Bereiche hinaus führt uns die Systemforschung in ein weiteres Feld der Konzentration, wenn wir die Welt um uns herum betrachten und uns auf die komplexen Systeme einstellen, die unsere Umwelt definieren und einschränken.2 Einer solchen nach außen gerichteten Konzentration steht die verborgene Schwierigkeit gegenüber, uns an derart lebenswichtige Systeme anzupassen: Unser Gehirn wurde nicht für eine solche Aufgabe konstruiert, und deshalb geraten wir ins Straucheln. Aber durch die Wahrnehmung von Systemen begreifen wir die Funktionsweise eines Unternehmens, einer Wirtschaftsordnung oder der globalen Prozesse, die das Leben auf unserem Planeten möglich machen.
All das lässt sich auf eine Dreiheit reduzieren: Konzentration nach innen, auf andere und nach außen. Unser Leben können wir nur dann gut führen, wenn wir alle drei beherrschen. Eine gute Nachricht über die Aufmerksamkeit kommt aus den Laboren der Neurowissenschaftler und den Klassenzimmern der Schulen: Befunde dort weisen darauf hin, wie wir diesen unentbehrlichen geistigen Muskel stärken können. Aufmerksamkeit funktioniert tatsächlich fast wie ein Muskel: Wird sie wenig gefordert, schwindet sie dahin; wenn wir sie aber trainieren, wächst sie. Wir werden erfahren, wie wir mit klugen Übungen den Muskel unserer Aufmerksamkeit weiterentwickeln und verfeinern, ja sogar ein konzentrationsmüdes Gehirn wieder auf Vordermann bringen können.
Damit Führungskräfte zu guten Ergebnissen gelangen, brauchen sie alle drei Formen der Konzentration. Die Konzentration nach innen stimmt uns auf unsere Intuitionen, Wertvorstellungen und bessere Entscheidungen ein. Die Konzentration auf andere sorgt für reibungslose Verbindungen zu den Menschen in unserem Leben. Und mit der Konzentration nach außen finden wir uns in unserer größeren Umwelt zurecht. Eine Führungskraft, die nicht auf ihre innere Welt hört, hat keinen Kompass; ist sie blind für die Welt der anderen, erhält sie keine Anhaltspunkte; und wer den größeren Systemen, in denen wir tätig sind, gleichgültig gegenübersteht, wird von Entwicklungen wie aus heiterem Himmel überrascht.
Aber nicht nur Führungspersonen profitieren von einem Gleichgewicht zwischen diesen drei Formen der Konzentration. Wir alle leben in einer anstrengenden Umwelt, die voller Spannungen, konkurrierender Ziele und Verlockungen des modernen Lebens ist. Jede der drei Formen von Aufmerksamkeit kann uns helfen, ein Gleichgewicht zu finden, mit dem wir sowohl glücklich als auch produktiv sind.
Aufmerksamkeit stellt Verbindungen zwischen uns und der Welt her, prägt und definiert unsere Erfahrungen. »Aufmerksamkeit«, so schrieben die Kognitionsforscher Michael Posner und Mary Rothbart, liefere die Mechanismen, »die unserer Wahrnehmung der Welt sowie der willkürlichen Steuerung unserer Gedanken und Gefühle zugrunde liegen.«3
Anne Treisman, eine führende Vertreterin des Forschungsgebiets, machte noch auf etwas anderes aufmerksam: Was wir sehen, hängt davon ab, wie wir unsere Aufmerksamkeit einsetzen.4 Oder wie Yoda sagte: »Deine Konzentration ist deine Realität.«
Der gefährdete menschliche Augenblick
Das kleine Mädchen reichte der Mutter gerade bis zur Taille. Die Kleine schlang die Arme um ihre Mama und klammerte sich fest, während sie mit der Fähre zur Ferieninsel übersetzten. Aber die Mutter reagierte nicht, ja sie schien das Mädchen überhaupt nicht wahrzunehmen: Sie war die ganze Zeit mit ihrem iPad beschäftigt.
Ein ähnlicher Vorgang wiederholte sich ein paar Minuten später, als ich mich zusammen mit neun Verbindungsstudentinnen, die an diesem Abend auf ihrem Wochenendausflug waren, in ein Sammeltaxi zwängte. Nachdem sie ihre Sitze in dem dunklen Kleinbus eingenommen hatten, flackerte innerhalb einer Minute überall fahles Licht auf: Jede der jungen Frauen hatte ein iPhone oder ein Tablet eingeschaltet. Während sie simsten oder durch Facebook scrollten, flogen vereinzelte Gesprächsfetzen hin und her. Meist aber herrschte Schweigen.
Die Gleichgültigkeit der Mutter und das Schweigen unter den Studentinnen sind Beispiele dafür, wie die Technologie unsere Aufmerksamkeit beansprucht und unsere Bindungen beeinträchtigt. Im Jahr 2006 ging das Wort pizzled in den englischen Wortschatz ein. Die Kombination aus puzzled (verblüfft) und pissed (beleidigt) fängt das Gefühl von Menschen ein, deren Begleitung plötzlich ein Blackberry zückt und mit jemand anderem zu sprechen beginnt. Damals fühlten sich Menschen in solchen Augenblicken noch verletzt und verärgert. Heute ist es die Norm.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Teenager, die Vorreiter unserer Zukunft. In den ersten Jahren dieses Jahrzehnts war die Zahl ihrer monatlichen SMS auf 3017 gestiegen, das Doppelte der Zahl ein paar Jahre früher. Inzwischen verbringen sie wieder weniger Zeit am Handy.5 Der durchschnittliche amerikanische Teenager versendet und empfängt täglich mehr als 100 SMS, zehn in jeder wachen Stunde. Ich habe schon Jugendliche gesehen, die Rad fahren und gleichzeitig Textnachrichten tippen.
Ein Bekannter berichtete: »Kürzlich habe ich ein paar Cousins in New Jersey besucht. Ihre Kinder hatten alle elektronischen Apparätchen, die der Mensch kennt. Ich habe immer nur ihre Hinterköpfe zu Gesicht bekommen. Sie haben ständig auf ihren iPhones nachgesehen, wer ihnen eine SMS geschickt hat und was es auf Facebook Neues gibt, oder sie waren in ein Videospiel vertieft. Dafür haben sie überhaupt nicht wahrgenommen, was um sie herum vorgeht, und hatten keine Ahnung, wie man längere Zeit mit anderen interagiert.«
Kinder wachsen heute in einer neuen Realität auf, in der sie sich mehr auf Maschinen und weniger auf Menschen einstellen als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das ist aus mehreren Gründen beunruhigend. Erstens lernen die sozialen und emotionalen Schaltkreise eines Kindergehirns durch Kontakte und Gespräche mit allen, denen das Kind im Lauf des Tages begegnet. Solche Interaktionen formen die Gehirnschaltkreise; dass Kinder weniger Zeit mit Menschen verbringen – und entsprechend länger auf digitale Bildschirme starren –, deutet auf Defizite hin.
Für die Beschäftigung mit der digitalen Welt bezahlen wir den Preis einer kürzeren Zeit mit echten Menschen – mit dem Medium, durch das wir nonverbale Äußerungen »lesen« lernen. Der neue Stamm der Eingeborenen in dieser digitalen Welt mag an der Tastatur versiert sein, aber wenn es darum geht, Verhalten von Angesicht zu Angesicht und in Echtzeit zu deuten, stehen sie auf dem Schlauch; insbesondere spüren sie nicht das Unbehagen des anderen, wenn sie mitten im Gespräch innehalten, um eine SMS zu lesen.6
Ein Collegestudent bemerkte, welche Einsamkeit und Isolation es mit sich bringt, wenn man in der virtuellen Welt der Tweets, Statusaktualisierungen und »geposteten Bilder vom Abendessen« lebt. Er stellte fest, dass seine Klassenkameraden die Fähigkeit zu Gesprächen verloren, ganz zu schweigen von den tiefsinnigen Diskussionen, die das Collegeleben bereichern können. Und er sagte: »Geburtstag, Konzert, Kneipenbesuch, Party – anscheinend macht nichts mehr Spaß, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, sich von dem, was man tut, zu distanzieren« – und dafür sorgt, dass die Bekannten aus der digitalen Welt sofort wissen, wie viel Spaß man hat.
Dann gibt es die Grundlagen der Aufmerksamkeit, jenes kognitiven Muskels, mit dem wir einer Erzählung folgen, ein Thema bis zum Ende durchdenken, lernen oder kreativ sind. Wie wir noch genauer erfahren werden, trägt die endlose Beschäftigung junger Leute mit ihren elektronischen Apparaten in gewisser Weise dazu bei, dass sie ganz bestimmte kognitive Fähigkeiten erwerben. Es gibt aber auch Bedenken; unter anderem stellt sich die Frage, inwieweit sich gleichzeitig Defizite in geistigen Kernkompetenzen herausbilden.
Eine Lehrerin einer achten Klasse erzählte mir, sie habe seit vielen Jahren mit ihren aufeinanderfolgenden Schülergenerationen dasselbe Buch gelesen: Mythology von Edith Hamilton. Es habe den Schülern gut gefallen – jedenfalls bis vor etwa fünf Jahren. »Dann habe ich plötzlich beobachtet, dass die Kinder es nicht mehr so spannend fanden – selbst Gruppen mit guten Leistungen konnten keine Beziehung dazu herstellen«, erzählte sie mir. »Sie sagten, es sei zu schwierig zu lesen; die Sätze seien zu kompliziert, und es dauere zu lange, eine Seite zu lesen.«
Sie fragte sich, ob vielleicht die Lesefähigkeit ihrer Schüler unter den kurzen, abgehackten Nachrichten, die sie als SMS empfangen, gelitten habe. Ein Schüler gestand, er habe im letzten Jahr 2000 Stunden lang Videospiele gespielt. Und sie fügte hinzu: »Es ist schwierig, Kommaregeln zu lehren, wenn man dabei World of Warcraft als Konkurrenz hat.«
Ein Extremfall sind asiatische Staaten wie Taiwan, Korea und andere, die in der Internetsucht – der Sucht nach Spielen, sozialen Medien und virtueller Realität – eine nationale Gesundheitsgefahr sehen, weil junge Leute isoliert werden. Ungefähr acht Prozent aller amerikanischen Computerspieler im Alter zwischen acht und 18Jahren entsprechen den psychiatrischen Diagnosekriterien für Suchterkrankungen; Untersuchungen am Gehirn zeigen, dass es in ihrem neuronalen Belohnungssystem durch das Spielen zu ähnlichen Veränderungen kommt wie bei Alkoholikern und Drogensüchtigen.7 Gelegentlich hört man auch Horrorgeschichten von Spielsüchtigen, die den ganzen Tag über schlafen und nachts spielen, kaum einmal etwas essen, sich nicht waschen und sogar gewalttätig werden, wenn Angehörige sie zu bremsen versuchen.
Harmonische Beziehungen setzen Aufmerksamkeit voraus – gegenseitige Konzentration. Die Notwendigkeit, uns um solche menschlichen Augenblicke zu bemühen, war angesichts eines Ozeans der Ablenkungen, auf dem wir alle uns täglich orientieren müssen, nie größer als heute.
Die Verelendung der Aufmerksamkeit
Die Verminderung der Aufmerksamkeit bei Erwachsenen hat ihren Preis. In Mexiko klagte ein Werbemanager eines großen Rundfunksenders: »Vor ein paar Jahren konnte man für die Präsentation bei einer Werbeagentur noch ein Fünf-Minuten-Video aufnehmen. Heute muss man es auf eineinhalb Minuten beschränken. Wenn man sie bis dahin nicht gefesselt hat, fangen alle an, nach ihren SMS zu sehen.«
Ein Collegedozent für Filmwissenschaft erzählte mir, er habe die Biografie eines seiner großen Vorbilder gelesen, des legendären französischen Regisseurs François Truffaut. Aber, so stellte er fest, »ich kann nicht mehr als zwei Seiten hintereinander lesen. Dann überfällt mich dieser überwältigende Drang, online zu gehen und nachzusehen, ob ich eine neue E-Mail bekommen habe. Ich glaube, ich verliere die Fähigkeit, die Konzentration auf etwas Ernsthaftes aufrechtzuerhalten.«
Die Unfähigkeit, auf die Prüfung von E-Mails oder Facebook zu verzichten, statt sich auf die Person zu konzentrieren, mit der wir gerade reden, führt zu einem »Abwesendsein«, wie der Soziologe Erving Goffman, ein meisterhafter Beobachter zwischenmenschlicher Interaktionen, es nennt – zu einer Attitüde, mit der man den anderen wissen lässt, man sei an dem, was hier und jetzt geschieht, nicht interessiert.
Schon 2005 schalteten die Veranstalter der dritten »All Things D(igital)«-Tagung im größten Saal der Veranstaltung die drahtlose Internetverbindung aus, weil das Glimmen der Laptop-Monitore darauf hindeutete, dass die Zuhörer nicht auf das achteten, was auf dem Podium vorging. Sie waren abwesend und in einem Zustand, den ein Teilnehmer als »ständige Teilaufmerksamkeit« bezeichnete – eine mentale Verschwommenheit, die durch eine Überfrachtung mit Informationen von Vortragenden, anderen Menschen im Raum und der Beschäftigung mit den Laptops verursacht wurde.8 Um eine solche Teilaufmerksamkeit zu bekämpfen, haben manche Unternehmen im Silicon Valley mittlerweile Laptops, Mobiltelefone und andere digitale Hilfsmittel bei ihren Besprechungen verboten.
Nachdem eine Verlagsmanagerin einige Zeit lang nicht auf ihr Smartphone gesehen hatte, gestand sie ein, sie habe »ein ungutes Gefühl. Man vermisst diesen Kick, den man bekommt, wenn eine SMS da ist. Man weiß, dass es nicht richtig ist, auf das Smartphone zu sehen, wenn man mit jemandem spricht, aber es ist wie eine Sucht.« Deshalb habe sie mit ihrem Mann ein Abkommen geschlossen: »Wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, legen wir unsere Handys in eine Schublade. Wenn es vor mir liegt, werde ich nervös; ich muss einfach nachsehen. Aber jetzt geben wir uns Mühe, mehr füreinander da zu sein. Wir reden miteinander.«
Unsere Konzentration kämpft ständig gegen Ablenkungen von innen und außen. Die Frage lautet: Was kosten uns die Dinge, die uns ablenken? Ein Manager eines Finanzunternehmens sagte mir: »Wenn ich merke, dass ich bei einer Besprechung mit meinen Gedanken woanders bin, frage ich mich, welche Gelegenheiten ich gerade eben verpasst habe.«
Einem Arzt aus meinem Bekanntenkreis erzählten die Patienten, sie würden »Selbstmedikation« betreiben und Präparate gegen Aufmerksamkeitsstörungen oder Narkolepsie nehmen, um mit ihrer Arbeit zurechtzukommen. Ein Anwalt sagte zu ihm: »Wenn ich das nicht nehmen würde, könnte ich keine Verträge lesen.« Früher brauchten Patienten für die Verschreibung solcher Medikamente eine Diagnose; heute sind sie vielfach zu routinemäßig eingenommenen leistungssteigernden Mitteln geworden. Eine wachsende Zahl von Teenagern täuscht Aufmerksamkeitsstörungen vor, um Rezepte für Aufputschmittel zu bekommen – der chemische Weg zur Aufmerksamkeit.
Und Tony Schwartz, ein Berater, der Führungskräften beibringt, wie man mit seiner Energie am besten haushaltet, erzählte mir: »Wir bringen die Leute dazu, ein besseres Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie sie ihre Aufmerksamkeit nutzen – nämlich immer schlecht. Aufmerksamkeit ist heute in den Köpfen unserer Klienten das Thema Nummer eins.«
Die auf uns einstürzende Datenflut führt zu nachlässigen Abkürzungen: Wir sortieren E-Mails nach dem Betreff, übergehen viele Sprachnachrichten, lesen SMS und Notizen nur noch quer. Wir haben also nicht nur Aufmerksamkeitsgewohnheiten entwickelt, die uns weniger leistungsfähig machen, sondern die Fülle der Nachrichten lässt uns einfach zu wenig Zeit, um noch darüber nachzudenken, was sie eigentlich bedeuten.
Das alles sah der Wirtschaftsnobelpreisträger Herbert Simon schon 1977 voraus. In einem Buch über die bevorstehende Welt voller Informationen warnte er: »Die Information verbraucht die Aufmerksamkeit ihrer Empfänger. Deshalb schafft ein Reichtum an Informationen eine Armut an Aufmerksamkeit.«9
GRUNDLAGEN
Als Teenager hatte ich die Gewohnheit, während der Hausaufgaben die Streichquartette von Béla Bartók zu hören – ich fand sie zwar ein wenig misstönend, hatte aber dennoch Spaß daran. Mich auf die dissonanten Klänge einzustellen half mir aus irgendeinem Grund, mich beispielsweise auf die chemische Gleichung für Ammoniumhydroxid zu konzentrieren.
Als ich viele Jahre später für die New York Times termingerecht Artikel abliefern musste, erinnerte ich mich an jene frühzeitige Übung im Ignorieren von Bartók. Bei der Zeitung schuftete ich inmitten der Wissenschaftsredaktion, die in jenen Jahren eine Höhle von der Größe eines Klassenzimmers belegte. Darin standen dicht gedrängt die Schreibtische für rund ein Dutzend Wissenschaftsjournalisten und ein halbes Dutzend Redakteure.
Eine Bartók-artige Kakophonie herrschte dort ständig. In der Nähe unterhielten sich vielleicht drei oder vier Personen; man bekam mit, was andere – manchmal auch mehrere – am Telefon sagten, wenn Reporter ihre Informanten befragten; Redakteure erkundigten sich lautstark quer durch den Raum, wann ein Artikel fertig sei. Selten, wenn überhaupt, herrschte Stille.
Und doch lieferten wir Wissenschaftsautoren, darunter auch ich, Tag für Tag zuverlässig unsere redaktionsfertigen Texte ab. Nie bat jemand: »Nun seid doch mal still«, damit wir uns konzentrieren konnten. Wir alle verdoppelten einfach unsere Konzentration und blendeten das Getöse aus.
Eine solche Konzentration inmitten des Krachs ist ein Zeichen für selektive Aufmerksamkeit, jene nervliche Fähigkeit, seinen Geist nur auf ein einziges Ziel zu richten und gleichzeitig eine Flut anderer Reize zu ignorieren, von denen jeder potenziell ein Gegenstand der Aufmerksamkeit sein könnte. Das meinte William James, der Begründer der modernen Psychologie, als er Aufmerksamkeit als »die plötzliche, eindeutige, lebhafte Inbesitznahme des Geistes durch einen von scheinbar mehreren möglichen Gegenständen oder Gedankengängen« definierte.1
Es gibt zwei wichtige Formen der Ablenkung: die sensorische und die emotionale. Sensorische Ablenkungen sind einfach: Während Sie diese Worte lesen, blenden Sie die leeren Seitenränder rund um den Text aus. Oder spüren Sie einmal einen Augenblick lang dem Gefühl der Zunge am Gaumen nach – dies ist nur einer aus einem endlosen Strom an Reizen, die unser Gehirn aus dem ständigen Schwall von Hintergrundgeräuschen, Formen und Farben, Geschmacksrichtungen, Gerüchen, Empfindungen und vielem anderen herauspickt.
Beängstigender ist die zweite Variante der Verlockungen: die emotional aufgeladenen Signale. Es fällt uns vielleicht nicht schwer, im Durcheinander eines Cafés eine E-Mail zu beantworten, aber wenn wir zufällig hören, wie jemand unseren Namen erwähnt (ein sehr wirksamer emotionaler Köder), ist es fast unmöglich, die Stimme, die ihn ausspricht, zu ignorieren – unsere Aufmerksamkeit veranlasst uns reflexhaft zuzuhören, was über uns gesagt wird. Die E-Mail können wir dann vergessen.
Die größte Herausforderung selbst für hoch konzentrierte Menschen erwächst jedoch aus dem emotionalen Drunter und Drüber unseres Lebens, beispielsweise wenn kürzlich eine enge Beziehung in die Brüche gegangen ist und uns das Thema nun ständig durch den Kopf geht. Solche Gedanken drängen sich aus gutem Grund in den Vordergrund: Es bringt uns dazu, darüber nachzudenken, was wir in der Angelegenheit, die uns unglücklich macht, tun können. Die Trennlinie zwischen unfruchtbarem Grübeln und produktiver Reflexion liegt darin, ob wir zu einer vorläufigen Lösung oder Erkenntnis gelangen – ist das der Fall, können wir die quälenden Gedanken loslassen; wenn nicht, drehen wir uns wie versessen mit unserem Kummer im Kreis.
Je stärker unsere Konzentration gestört wird, desto schlechter werden unsere Leistungen. Als beispielsweise untersucht wurde, wie stark Collegesportler sich in ihrer Konzentration durch Angstgefühle stören lassen, stand dies in einem signifikanten Zusammenhang mit ihrer guten oder schlechten Leistung in der bevorstehenden Saison.2
Die Fähigkeit, an einem Ziel festzuhalten und alles andere außer Acht zu lassen, ist in den präfrontalen Regionen des Gehirns angesiedelt. Spezialisierte Nervenschaltkreise in diesem Bereich verstärken eintreffende Signale, auf die wir uns konzentrieren wollen (diese E-Mail), und dämpfen andere, die wir ignorieren wollen (die Leute, die am Nachbartisch plappern).
Da Konzentration voraussetzt, dass wir emotionale Ablenkungen ausblenden, umfasst unsere neuronale Verdrahtung für selektive Aufmerksamkeit auch Mechanismen zur Hemmung von Gefühlen. Diejenigen, die sich am besten konzentrieren können, sind relativ immun gegen emotionale Turbulenzen, lassen sich in einer Krise nicht so leicht erschüttern und bleiben trotz der emotionalen Wellen des Lebens in ruhigem Fahrwasser.3
Wem es nicht gelingt, sich von einem Objekt der Aufmerksamkeit ab- und anderen zuzuwenden, kann beispielsweise mental in einer Endlosschleife der chronischen Angst gefangen bleiben. Im klinischen Extrem bedeutet das, dass jemand in den Hilflosigkeitsgefühlen, der Hoffnungslosigkeit und dem Selbstmitleid einer Depression versinkt; oder dass sich eine Angststörung mit Panikattacken und Katastrophengefühlen einstellt; oder dass bei einer Zwangsneurose unzählige Male die gleichen ritualisierten Gedanken oder Handlungen ablaufen (fasse 50-mal die Tür an, bevor du aus dem Haus gehst). Die Fähigkeit, unsere Konzentration von einem Gegenstand zu lösen und einem anderen zuzuwenden, ist für unser Wohlbefinden unentbehrlich.
Je stärker unsere selektive Aufmerksamkeit ist, desto besser können wir uns in das vertiefen, was wir gerade tun wollen: Wir lassen uns von einer berührenden Szene in einem Film mitreißen oder finden einen kraftvollen Absatz in einem Gedicht erhebend. Starke Konzentration führt dazu, dass Menschen sich in YouTube oder ihre Hausarbeiten vertiefen, bis sie auch den größten Tumult in ihrer Umgebung nicht mehr bemerken – oder auch ihre Eltern, die zum Abendessen rufen.
Derart konzentrierte Menschen kann man auf einer Party leicht ausmachen: Sie vertiefen sich in ein Gespräch, ihre Blicke kleben an ihrem Gegenüber, und sie sind vollkommen von ihren Worten erfüllt, selbst wenn die Person neben ihnen lautstark über die Beastie Boys schwadroniert. Die Unkonzentrierten dagegen sind ständig im Spiel – ihre Blicke heften sich auf alles, was sie interessieren könnte, und ihre Aufmerksamkeit driftet davon.
Der Neurowissenschaftler Richard Davidson von der University of Wisconsin zählt die Konzentration zu den wenigen unentbehrlichen Fähigkeiten im Leben; jede davon stützt sich auf ein eigenes neuronales System, und gemeinsam leiten sie uns durch die Turbulenzen unseres Innenlebens, unserer Beziehungen und aller Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt.4
Bei starker Konzentration gehen nach Davidsons Befunden wichtige Schaltkreise im präfrontalen Cortex in einen synchronisierten Zustand mit dem Objekt des Bewusstseinsstrahls über, ein Phänomen, das er als phase locking (»Phasenarretierung«) bezeichnet.5 Wenn Menschen sich darauf konzentrieren, jedes Mal einen Knopf zu drücken, wenn sie einen bestimmten Ton hören, feuern die elektrischen Signale in ihrem Präfrontalbereich genau synchron mit dem anvisierten Ton.
Je besser die Konzentration ist, desto stärker ist die neuronale Arretierung. Liegt dagegen nur ein Durcheinander von Gedanken vor, verschwindet die Synchronisierung.6 Ein solcher Rückgang der Synchronisierung ist auch charakteristisch für Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit.7
Am besten lernen wir mit konzentrierter Aufmerksamkeit. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir lernen, kartiert das Gehirn die Informationen über die bisherigen Kenntnisse und stellt neue neuronale Verknüpfungen her. Wenn ein Erwachsener und ein Kleinkind ihre Aufmerksamkeit gleichermaßen auf etwas richten, das der Erwachsene benennt, lernt das Kleinkind den Namen; schweift seine Aufmerksamkeit ab, während der Name gesagt wird, lernt es ihn nicht.
Wenn unsere Gedanken abschweifen, aktiviert das Gehirn eine Fülle von Schaltkreisen, die sich mit Dingen beschäftigen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir lernen wollen. Ohne Konzentration speichern wir keine prägnanten Erinnerungen an das Gelernte.
Abschalten
Jetzt ist es an der Zeit für ein kleines Fragespiel:
1. Wie lautet der Fachbegriff für die Synchronisierung der Gehirnwellen mit einem Geräusch, das man hört?
2. Welches sind die beiden wichtigsten Varianten der Ablenkung?
3. Welcher Aspekt der Aufmerksamkeit erlaubt eine Voraussage über die Leistung von Collegesportlern?
Wenn Sie diese Fragen wie aus der Pistole geschossen beantworten können, haben Sie beim Lesen nachhaltige Aufmerksamkeit aufrechterhalten – die Antworten standen auf den letzten paar Seiten dieses Buches (und sind auch in der Fußnote auf dieser Seite zu finden).* [* Antworten: 1. Phasenarretierung; 2. sensorische und emotionale; 3. Wie gut die Sportler sich konzentrieren und Ablenkungen ausblenden können.]
Wenn Sie sich nicht mehr an die Antworten erinnern können, haben Sie beim Lesen vielleicht von Zeit zu Zeit abgeschaltet. Damit sind Sie nicht allein.
Die Gedanken eines Lesers schweifen in der Regel, während er einen Text durchgeht, zwischen 20 bis 40Prozent der Zeit ab. Dass Studierende dafür einen Preis zahlen, ist nicht verwunderlich: Je häufiger sie abschweifen, desto schlechter ist ihre Verständnisfähigkeit.8
Selbst wenn unsere Gedanken nicht auf Wanderschaft gehen, setzen Leser in 30Prozent der Fälle, in denen der Text sich in Unsinn verwandelt – wie beispielsweise Wir müssen Zirkus für das Geld verdienen statt Wir müssen Geld für den Zirkus verdienen –, die Lektüre noch ein nennenswertes Stück fort (nämlich im Durchschnitt 17Wörter), bis es ihnen auffällt.
Wenn wir ein Buch, einen Blog oder irgendeine Erzählung lesen, konstruiert unser Verstand ein mentales Modell, mit dessen Hilfe wir den Sinn des Gelesenen erkennen, und er verbindet es mit dem Universum anderer Modelle, über die wir bereits verfügen und die das gleiche Thema betreffen. Dieses sich ständig erweiternde Verständnisnetzwerk ist das Kernstück des Lernens. Je mehr wir abschweifen, während wir das Netz knüpfen, und je schneller wir nach Beginn der Lektüre abschalten, desto mehr Löcher enthält es.
Bei der Lektüre eines Buches konstruiert unser Gehirn ein Netzwerk von Leitungsbahnen, in denen sich das betreffende System von Ideen und Erfahrungen verkörpert. Im Gegensatz zu diesem tiefen Verständnis stehen die Unterbrechungen und Ablenkungen, die für das stets verführerische Internet typisch sind.
Das Trommelfeuer aus Texten, Videos, Bildern und den verschiedensten Nachrichten, die wir online empfangen, scheint geradezu der Feind jedes vollkommeneren Verständnisses zu sein, das sich aus dem »tiefen Lesen« ergibt, wie Nicholas Carr es nennt: Ein solches Verständnis erfordert anhaltende Konzentration und die Vertiefung in ein Thema anstelle des sprunghaften Wechsels vom einen zum anderen, bei dem wir zusammenhanglose Halbwahrheiten aufschnappen.9
Wenn auch Erziehung und Ausbildung sich in Richtung webbasierter Formate verlagern, lauert die Gefahr, dass die multimediale Masse der Ablenkungen, die wir Internet nennen, das Lernen behindert. Schon in den 1950er-Jahren warnte der Philosoph Martin Heidegger, dass eine »anrollende Revolution der Technik den Menschen auf eine Weise fesseln, behexen, blenden und verblenden könnte, dass eines Tages das rechnende Denken als das einzige in Geltung und Übung bliebe“.«10; dies, so Heidegger, geschehe um den Preis eines Verlusts des »besinnlichen Denkens«, das heißt einer Form der Reflexion, die er für das Wesen unseres Menschseins hielt.
Für mich warnt Heidegger damit vor der Erosion einer Fähigkeit, die ein Kernstück unseres Denkens darstellt: der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit anhaltend auf einen laufenden Vorgang zu richten. Dieses Denken setzt einen nachhaltig konzentrierten Geist voraus. Je stärker wir abgelenkt sind, desto seichter werden unsere Gedanken; und je kürzer unsere Überlegungen sind, desto trivialer werden sie wahrscheinlich auch. Würde Heidegger heute noch leben, er wäre entsetzt, wenn er twittern sollte.
Hat sich die Aufmerksamkeit vermindert?
Eine Swingband aus Schanghai spielt Loungemusik in einer überfüllten Schweizer Kongresshalle, in der Hunderte von Menschen herumlaufen. Inmitten des hektischen Trubels steht Clay Shirky seelenruhig an einem kleinen runden Stehtisch. Er konzentriert sich auf seinen Laptop und tippt eifrig. Ich habe Clay, einen in New York ansässigen Experten für soziale Medien, schon vor ein paar Jahren kennengelernt, hatte aber nur selten Gelegenheit, ihm persönlich zu begegnen. Ein paar Minuten stehe ich rechts von ihm, ungefähr einen Meter entfernt, und sehe ihm zu. Ich befinde mich im Blickfeld seiner Augenwinkel – wenn er ein wenig Aufmerksamkeitsbandbreite übrig hätte. Aber Clay nimmt keine Notiz von mir, bis ich seinen Namen ausspreche. Dann blickt er verblüfft auf, und wir beginnen eine Unterhaltung.
Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Fähigkeit; Clays andächtige Konzentration füllt die Grenzen völlig aus, bis er sich mir zuwendet.
»Sieben plus/minus zwei« Informationseinheiten gelten als Obergrenze für den Strahl der Aufmerksamkeit, seit George Miller in den 1950er-Jahren diese »magische Zahl«, wie er sie nannte, in einem der einflussreichsten Aufsätze der Psychologie erstmals veröffentlichte.11
In jüngerer Zeit vertraten allerdings manche Kognitionsforscher die Ansicht, die Obergrenze liege bei vier Informationseinheiten.12 Dies fesselte (jedenfalls für kurze Zeit) die begrenzte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, und das neue Mem, die mentale Kapazität sei von sieben auf vier Informationseinheiten gesunken, verbreitete sich. »Grenzen des Verstands gefunden: vier Informationseinheiten«, verkündete eine Website für Wissenschaftsnachrichten.13
Einige hielten die angebliche Schrumpfung der geistigen Kapazität für einen Beleg, dass wir im Alltagsleben des 21.Jahrhunderts zu stark abgelenkt sind, und klagten lautstark darüber. Aber damit interpretiert man die Daten falsch.
»Das Arbeitsgedächtnis ist nicht kleiner geworden«, sagte der Kognitionsforscher Justin Halberda von der Johns Hopkins University. »Es stimmt nicht, dass das Fernsehen unser Arbeitsgedächtnis schrumpfen lässt« – dass wir also in den 1950er-Jahren eine Obergrenze von sieben plus/minus zwei Informationsbits hatten, während es jetzt nur noch vier sind.
»Der Geist gibt sich alle Mühe, das Beste aus seinen begrenzten Ressourcen zu machen«, erklärte Halberda. »Wir bedienen uns hilfreicher Gedächtnisstrategien« – beispielsweise setzen wir Einzelelemente wie 4, 1 und 5 zu einem einzigen Informationsbaustein zusammen, in diesem Fall zu der Vorwahlnummer 415. »Wenn wir unser Gedächtnis benutzen, kann das Ergebnis durchaus sieben plus/minus zwei Bits lauten. Aber das dröselt sich auf in eine feste Grenze von vier, und dann kommen noch einmal drei oder vier durch die Gedächtnisstrategien hinzu. Die Angaben von vier und sieben sind also beide richtig; es kommt darauf an, wie man es misst.«
Dann gibt es das, was viele Menschen für eine »Aufteilung« der Aufmerksamkeit auf verschiedene Aufgaben halten; aus der Kognitionsforschung wissen wir, dass auch ein solches »Multitasking« eine Fiktion ist. Wir haben keinen dehnbaren Aufmerksamkeitsballon, den wir mehrfach einsetzen können, sondern eine enge, feste Pipeline. Wir teilen nicht auf, sondern schalten schnell um. Und ständiges Umschalten schwächt die vollständige, konzentrierte Aufmerksamkeit.
»Die kostbarste Ressource in einem Computersystem ist heute nicht mehr der Prozessor, der Speicher, die Festplatte oder das Netzwerk, sondern die Aufmerksamkeit des Menschen«, stellte eine Forschergruppe an der Carnegie Mellon University fest.14 Zur Beseitigung dieses menschlichen Nadelöhrs schlugen die Wissenschaftler vor, Ablenkungen so gering wie möglich zu halten: Im »Projekt Aura« hat man sich vorgenommen, lästige kleine Systemfehler zu beseitigen, damit wir keine Zeit mit Scherereien verschwenden.
Das Ziel, einfach zu bedienende Computersysteme zu schaffen, ist lobenswert. Sehr weit werden wir allerdings mit einer solchen Lösung nicht kommen: Wir brauchen keine technische, sondern eine kognitive Fehlerbehebung. Der Ursprung der Ablenkung liegt weniger in der verwendeten Technik als vielmehr in dem Frontalangriff einer wachsenden Welle von Ablenkungen auf unsere Konzentrationsfähigkeit.
Damit bin ich wieder bei Clay Shirky und insbesondere bei seiner Erforschung der sozialen Medien.15 Keiner von uns kann sich auf alles gleichzeitig konzentrieren, aber wir alle gemeinsam schaffen eine Aufmerksamkeitsbandbreite, auf die jeder von uns bei Bedarf zurückgreifen kann. Dafür ist Wikipedia der beste Beleg.
Wie Shirky in seinem Buch Here Comes Everybody erklärt, kann man Aufmerksamkeit ebenso wie Erinnerungen oder jede andere kognitive Kompetenz als Fähigkeit betrachten, die sich auf viele Menschen verteilt. Was »im Trend liegt«, deutet darauf hin, worauf wir unsere kollektive Aufmerksamkeit richten. Manchmal wird zwar die Ansicht vertreten, unser technisch erleichtertes Lernen und Erinnern mache uns dumm, man kann aber auch argumentieren, dass sie eine mentale Prothese darstellen, die der individuellen Wachsamkeit mehr Kraft verleiht.
Unser soziales Kapital und unser Aufmerksamkeitsbereich wachsen, wenn wir die Zahl der sozialen Verknüpfungen steigern, durch die wir entscheidende Informationen erhalten – beispielsweise das stillschweigende Wissen, »wie das hier so läuft«, sei es in einer neuen Firma oder einer neuen Wohnumgebung. Gelegenheitsbekanntschaften können zu zusätzlichen Augen und Ohren in der Welt werden, zu entscheidenden Quellen für die Orientierung, die wir brauchen, um uns in komplizierten sozialen und informationellen Ökosystemen zurechtzufinden. Meist haben wir eine Handvoll enge Beziehungen – gute Freunde, denen wir vertrauen –, aber wir können auch Hunderte sogenannte schwache Beziehungen haben (zum Beispiel unsere »Freunde« bei Facebook). Schwache Beziehungen sind von hohem Wert als Verstärker unserer Aufmerksamkeitsfähigkeit und als Quelle für Hinweise auf Sonderangebote, freie Stellen oder potenzielle Lebenspartner.16
Wenn wir gemeinsam alles koordinieren, was wir sehen und wissen, vervielfachen solche Bemühungen unseren kognitiven Reichtum. Auch wenn unser eigener Beitrag zum kollektiven Arbeitsgedächtnis zu jedem beliebigen Zeitpunkt gering ist, können wir insgesamt durch diese enge Bandbreite eine ungeheure Datenmenge beziehen. Eine solche kollektive Intelligenz, die Summe dessen, was alle in einer dezentralen Gruppe beisteuern können, verspricht maximale Konzentration, die Gesamtheit von allem, was viele Augen wahrnehmen können.
Ein Forschungszentrum für kollektive Intelligenz am Massachusetts Institute of Technology ist der Ansicht, dass diese emergente Fähigkeit durch das Teilen von Informationen im Internet begünstigt wird. Das klassische Beispiel: Millionen Websites richten ihren Scheinwerferkegel auf schmale Nischenbereiche – und eine Websuche wählt aus und lenkt unsere Aufmerksamkeit so, dass wir all diese kognitiven Anstrengungen effizient nutzen können.17
Die Gruppe am MIT stellt eine grundsätzliche Frage: »Wie können wir Menschen und Computer so verknüpfen, dass wir kollektiv mit größerer Intelligenz handeln als jede einzelne Person oder Gruppe?«
Oder wie die Japaner sagen: »Wir alle sind klüger als jeder von uns.«
Gefällt Ihnen, was Sie tun?
Die große Frage: Freuen Sie sich morgens beim Aufstehen darauf zu arbeiten, zur Schule zu gehen oder was Sie sonst am Tag vorhaben?
Howard Gardner von der Harvard University, William Damon von der Stanford University und Mihaly Csikszentmihalyi von der Claremont Graduate University beschäftigten sich im Rahmen ihrer Forschung mit der »guten Arbeit«, wie sie es nennen: mit einer machtvollen Mischung aus dem, was Menschen gut können, wofür sie sich engagieren und was ihrer Ethik entspricht – was also nach ihrer Ansicht wichtig ist.18 Meist handelt es sich dabei um sehr erfüllende Berufe: Den Menschen gefällt, was sie tun. Eine erfüllende Tätigkeit fühlt sich gut an, und Freude ist das emotionale Kennzeichen für einen Schaffensrausch oder »Flow«.
Im Alltagsleben kommt ein solcher Schaffensrausch relativ selten vor.19 Ermittelt man nach dem Zufallsprinzip die Stimmungslage, so stellt sich heraus, dass die Menschen zu den meisten Zeiten entweder gestresst oder gelangweilt sind; der Flow stellt sich nur selten ein. Nur rund 20Prozent der Menschen erleben mindestens einmal am Tag einen solchen Augenblick. Rund 15Prozent erleben an einem typischen Tag nie einen solchen Zustand.
Mehr Flow im Leben stellt sich ein, wenn wir das, was wir tun, in Übereinstimmung mit dem bringen, was uns Spaß macht; so etwas gelingt jenen Glücklichen, die an ihrem Beruf große Freude haben. Die Leistungsträger auf allen Gebieten – die ohnehin die Glücklichen sind – haben diese Kombination verwirklicht.
Neben dem beruflichen Wechsel gibt es noch mehrere andere Wege, um einen Schaffensrausch zu erleben. Ein solcher Weg eröffnet sich, wenn wir eine Aufgabe in Angriff nehmen, die unsere Fähigkeiten bis zum Äußersten fordert – wenn eine »gerade noch machbare« Anforderung an unser Können gestellt wird. Eine andere Route führt über Tätigkeiten, die unsere Leidenschaft sind; dann treibt uns die Motivation manchmal in den Schaffensrausch. Der eigentliche gemeinsame Weg ist aber in beiden Fällen die volle Konzentration: Beide Prozesse steigern die Aufmerksamkeit. Ganz gleich, wie man dorthin gelangt: Scharfe Konzentration setzt den Schaffensrausch in Gang.
Dieser optimale Gehirnzustand für gute Arbeit ist durch größere neuronale Harmonie gekennzeichnet – durch eine reichhaltige, zeitlich gut koordinierte Verknüpfung verschiedener Gehirnareale.20 Im Idealfall sind dabei die Schaltkreise, die für die jeweilige Aufgabe gebraucht werden, sehr aktiv, während andere, unnötige, ruhiggestellt werden, sodass das Gehirn sich präzise auf die augenblicklichen Anforderungen einstellt. Wenn unser Gehirn sich in diesem Zustand befindet, erbringen wir mit größter Wahrscheinlichkeit unsere persönliche Bestleistung, ganz gleich, um was für eine Aufgabe es sich handelt.
In Umfragen unter Arbeitnehmern findet man dagegen zahlreiche Menschen mit einem ganz anderen Gehirnzustand: Sie tagträumen, vergeuden Stunden mit dem Surfen im Web oder auf YouTube und tun nur das erforderliche Minimum. Ihre Aufmerksamkeit verzettelt sich. Eine solche Loslösung und Gleichgültigkeit ist insbesondere bei sich wiederholenden, anspruchslosen Tätigkeiten weit verbreitet. Um die nichtengagierten Arbeitskräfte wieder stärker in den Bereich der Konzentration zu führen, muss man Motivation und Enthusiasmus steigern, Zielbewusstsein wecken und auch einen gewissen Druck ausüben.
Eine andere große Gruppe steckt aber auch in einem Zustand, den Neurobiologen als »Ausfransen« bezeichnen: Ihr Nervensystem wird durch ständigen Stress von Cortisol und Adrenalin überschwemmt. Dann konzentriert sich die Aufmerksamkeit nicht auf den Beruf, sondern auf die Sorgen. Eine solche emotionale Erschöpfung kann zum Burn-out führen.
Vollständige Konzentration kann uns das Tor zum Schaffensrausch aufstoßen. Wenn wir uns aber entschließen, uns nur noch auf eine Sache zu konzentrieren und alles andere nicht zur Kenntnis zu nehmen, erschaffen wir eine – in der Regel unsichtbare – Spannung: die Spannung zwischen den beiden Seiten der großen neuronalen Wasserscheide. Der obere Teil des Gehirns rangelt mit dem unteren.
AUFMERKSAMKEIT OBEN UND UNTEN
»Später wandte ich mich dem Studium gewisser arithmetischer Fragen zu, anscheinend recht erfolglos«, schrieb der französische Mathematiker Henri Poincaré im 19.Jahrhundert. »Über meinen Misserfolg verstimmt, fuhr ich für ein paar Tage an die See, um auf andere Gedanken zu kommen.«1
Als er eines Morgens oberhalb des Meeres an einer Klippe entlangging, überkam ihn plötzlich die Erkenntnis, »dass die arithmetischen Transformationen der indefiniten ternären quadratischen Formen mit denen der nichteuklidischen Geometrie identisch seien«.
Die Einzelheiten seines Beweises brauchen uns hier nicht zu interessieren (zum Glück: Ich selbst verstehe die Mathematik nicht einmal ansatzweise). Faszinierend ist, wie Poincaré die Erleuchtung kam: mit »Kürze, Plötzlichkeit und unmittelbarer Gewissheit«. Sie war für ihn eine Überraschung.
Die überlieferte Geschichte der Kreativität ist voll von solchen Berichten. Der Mathematiker Carl Gauß, der im 18. und 19.Jahrhundert lebte, arbeitete jahrelang am Beweis für ein Theorem, ohne eine Lösung zu finden. Eines Tages fiel ihm dann die Antwort »wie ein plötzlicher Lichtblitz« ein. Er konnte aber nicht beschreiben, welcher gedankliche Faden seine jahrelange harte Arbeit mit diesem plötzlichen Geistesblitz verband.
Woher kommt die Verblüffung? Unser Gehirn verfügt über zwei teilweise unabhängige, im Wesentlichen getrennte mentale Systeme. Das eine besitzt eine große Rechenleistung und arbeitet ständig, surrt in aller Stille vor sich hin, um unsere Probleme zu bearbeiten, und überrascht uns mit einer plötzlichen Lösung für komplexe Grübeleien. Da es jenseits des Horizonts unserer bewussten Wahrnehmung tätig ist, sind wir für seine Arbeit blind. Dieses System präsentiert uns die Früchte seiner umfangreichen Bemühungen in Form von Gedanken, die aus dem Nichts zu kommen scheinen und vielfältige Formen annehmen, vom Leitfaden für die Syntax eines Satzes bis zur Konstruktion komplizierter, vollständiger mathematischer Beweise.
Diese Hinterkopf-Aufmerksamkeit rückt in der Regel nur dann in den Mittelpunkt der Konzentration, wenn das Unerwartete geschieht. Wir unterhalten uns beim Autofahren mit jemandem am Handy (das Fahren spielt sich dabei im Hinterkopf ab), und plötzlich macht uns ein Hupen darauf aufmerksam, dass die Ampel auf Grün geschaltet hat.
Die neuronale Verdrahtung dieses Systems liegt zum größten Teil in den unteren Gehirnteilen, das heißt in subkortikalen Schaltkreisen; seine Bemühungen machen sich jedoch im Bewusstsein bemerkbar, weil es von unten her den Neocortex in Kenntnis setzt, die oberste Schicht des Gehirns. Durch ihre Grübeleien profitierten Poincaré und Gauß von Durchbrüchen aus den unteren Gehirnschichten.
Für diese von unten nach oben gerichtete Wirkungsweise des neuronalen Apparats aus den tieferen Gehirnschichten hat sich in der Kognitionsforschung die Formulierung »Bottom-up« eingebürgert.2 Entsprechend gibt es auch eine von oben nach unten gerichtete »Top-down«-Aktivität, die sich vorwiegend im Neocortex abspielt, die tiefer liegenden Vorgänge überwacht und ihnen ihre Ziele aufzwingen kann. Es ist, als wären zwei geistige Apparate tätig.
Der Bottom-up-Mechanismus ist
•die schnellere Gehirntätigkeit, die sich in Millisekunden bemisst;
•unwillkürlich, automatisch und ständig aktiv;
•intuitiv, weil er durch Assoziationsnetzwerke funktioniert;
•impulsiv und von Gefühlen getrieben;
•zuständig für die Ausführung gewohnter Routinetätigkeiten und Leitfaden für Handlungen;
•der Verwalter unserer mentalen Weltmodelle.
Dagegen ist der Top-down-Mechanismus
•langsamer;
•willentlich;
•anstrengend;
•der Ort der Selbstbeherrschung, die (manchmal) die Oberhand über automatische Routinetätigkeiten gewinnt und emotional bedingte Impulse zum Schweigen bringen kann;
•in der Lage, neue Modelle zu erlernen, neue Pläne zu schmieden und – bis zu einem gewissen Grad – die Verantwortung für unser automatisches Handlungsrepertoire zu übernehmen.
Willentliche Aufmerksamkeit, Willenskraft und absichtliche Entscheidungen laufen von oben nach unten ab; reflexhafte Aufmerksamkeit, Impulse und erlernte Gewohnheiten (beispielsweise die Aufmerksamkeit, die durch schicke Kleidung oder raffinierte Werbung geweckt wird) kommen von unten. Wenn wir uns entschließen, uns auf die Schönheit eines Sonnenuntergangs einzulassen, uns auf unsere Lektüre zu konzentrieren oder mit jemandem ein tiefgründiges Gespräch zu führen, findet eine Verlagerung von oben nach unten statt. Unser geistiges Auge vollführt einen ständigen Tanz zwischen der reizgetriebenen Fesselung von Aufmerksamkeit und der absichtlichen Konzentration.
Das Bottom-up-System kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen: Es mustert parallel eine Fülle verschiedener Inputs, darunter Aspekte unserer Umgebung, die noch nicht in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind; es analysiert die Inhalte unseres Wahrnehmungsfeldes, bevor es uns darüber in Kenntnis setzt, was es für uns als relevante Inhalte ausgewählt hat. Das Top-down-System dagegen braucht mehr Zeit, um sich auf das einzustellen, was ihm präsentiert wird; es arbeitet die Dinge nacheinander ab und stellt sorgfältigere Analysen an.
Insgesamt ergibt sich eine optische Täuschung des Geistes: Wir setzen den Inhalt unseres Bewusstseins mit der gesamten Tätigkeit unseres Geistes gleich. In Wirklichkeit findet die große Mehrzahl der geistigen Abläufe im Hinterzimmer des Geistes und im Getümmel der Bottom-up-Systeme statt.
Vieles (manche sagen sogar: alles), von dem das Top-down-System glaubt, es würde sich nach eigener Entscheidung darauf konzentrieren oder darüber nachdenken, sind in Wirklichkeit Pläne, die von unten nach oben diktiert werden. Wäre das Ganze ein Film, so meinte der Psychologe David Kahneman mit trockenem Humor, dann wäre das Top-down-System »ein Nebendarsteller, der sich für den Filmhelden hält«.3
Die reflexhaft und schnell handelnden Bottom-up-Schaltkreise gehen in der Evolution Millionen von Jahren weit zurück und begünstigen kurzfristiges Denken, Impulse und schnelle Entscheidungen. Die Top-down-Mechanismen im vorderen und oberen Teil des Gehirns kamen später hinzu; vollständig ausgereift sind sie erst seit einigen Hunderttausend Jahren.
Durch die Top-down-Verdrahtung erweitert sich unser geistiges Repertoire um Fähigkeiten wie Selbstwahrnehmung und Reflexion, bewusste Entscheidungen und Planung. Die willentliche, von oben nach unten gerichtete Konzentration verschafft dem Geist ein Mittel, um das Gehirn zu verwalten. Wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit von einer Aufgabe, einem Plan, einer Sinneswahrnehmung oder Ähnlichem zu einer anderen wechseln, werden die zugehörigen Gehirnschaltkreise aktiv. Rufen wir uns eine schöne Erinnerung an einen Tanz ins Bewusstsein, erwachen die Neuronen für Freude und Bewegung zum Leben. Die Erinnerung an die Bestattung eines Angehörigen aktiviert die Schaltkreise für Traurigkeit. Üben wir mental einen Golfschlag, werden die Axone und Dendriten, die eine solche Bewegung koordinieren, ein wenig enger verknüpft.
Das Gehirn gehört zu jenen evolutionären Konstruktionen, die zwar »gut genug«, aber keineswegs perfekt sind.4 Seine älteren Bottom-up-Systeme waren offenbar für das schiere Überleben im größten Teil unserer Vorgeschichte ausreichend und nützlich, aber heute führt ihr Aufbau zu gewissen Problemen. In sehr vielen Lebensbereichen dominieren nach wie vor die älteren Systeme – in der Regel zu unserem Vorteil, manchmal aber auch zu unserem Schaden: Verschwendung, Suchterkrankungen und rücksichtslose Raserei auf den Straßen sind Anzeichen, dass das System aus dem Tritt geraten ist.
Die Überlebenserfordernisse in der Frühzeit unserer Evolution haben unser Gehirn mit voreingestellten, von unten nach oben funktionierenden Programmen vollgepackt: Sie sagen uns, wie wir Kinder zeugen und großziehen können, was angenehm und was ekelhaft ist, wann wir vor einer Gefahr weglaufen und zum Essen hinlaufen sollen und so weiter. Und dann sind wir plötzlich in unserer heutigen, ganz anders gearteten Welt: Jetzt müssen wir uns trotz des ständigen Sogs der Bottom-up-Systeme einschließlich all ihrer Launen und Triebe im Leben zurechtfinden, indem wir von oben nach unten entscheiden.
Ein überraschender Faktor verschiebt das Gleichgewicht ständig in Richtung der Bottom-up-Vorgänge: Das Gehirn geht sparsam mit Energie um. Kognitive Anstrengungen wie das Erlernen von technischen Neuerungen erfordern jedoch aktive Aufmerksamkeit, und die kostet Energie. Aber je öfter wir eine anfangs neue Tätigkeit ausführen, desto stärker verwandelt sie sich in eine automatische Gewohnheit; dann wird sie von den Bottom-up-Schaltkreisen übernommen, insbesondere von den Basalganglien, einer golfballgroßen Masse, die an der Gehirnunterseite unmittelbar über dem Rückenmark liegt. Je häufiger wir eine Tätigkeit üben, desto stärker übernehmen die Basalganglien sie von anderen Gehirnteilen.
Die Bottom-up- und Top-down-Systeme teilen die Tätigkeiten so unter sich auf, dass wir mit der geringstmöglichen Anstrengung die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Wenn eine Tätigkeit vertrauter und damit einfacher wird, verlagert sie sich von oben nach unten. Die neuronale Übertragung macht sich dadurch bemerkbar, dass wir ihr immer weniger und schließlich überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr widmen müssen – sie läuft automatisch ab.
Die Krönung der Automatisierung erfahren wir dann, wenn wir durch andauernde Übung anspruchsvolle Aufgaben mit geringer Aufmerksamkeit bewältigen können, sei es bei einem Schachturnier, einem Autorennen oder der Schaffung eines Ölgemäldes. Wenn wir nicht genug geübt haben, erfordert all dies bewusste Konzentration. Haben wir aber die erforderlichen Fähigkeiten so weit beherrschen gelernt, dass sie den Anforderungen entsprechen, erfordern sie keine zusätzliche kognitive Anstrengung mehr – unsere Aufmerksamkeit wird frei für jene Dinge, die nur Spitzenkönner sehen.
Weltklassechampions können es bestätigen: Auf dem allerobersten Niveau, auf dem die Gegner ebenso viele tausend Stunden geübt haben wie man selbst, wird jeder Wettbewerb zu einem mentalen Spiel: Der Geisteszustand bestimmt darüber, wie gut man sich konzentrieren kann und welche Leistungen man erbringt. Je mehr man sich entspannen und sich auf die Bottom-up-Vorgänge verlassen kann, desto stärker wird der Geist befreit, und desto beweglicher kann er sein.
Nehmen wir beispielsweise Footballstars, die als Quarterback »einen guten Spielüberblick« haben, wie Sportanalytiker es nennen: Sie erkennen die Verteidigungsformation des Gegners, spüren seine beabsichtigten Spielzüge, stellen sich sofort darauf ein und gewinnen so die kostbaren ein oder zwei Sekunden, in denen ein Mitspieler ungedeckt ist und einen Pass annehmen kann. So etwas zu »sehen« erfordert ungeheuer viel Übung, damit das, was anfangs die Aufmerksamkeit bindet – weiche dem Angreifer aus –, automatisch abläuft.
Unter dem Gesichtspunkt des mentalen Rechenaufwands ist es keine geringe Leistung, einen frei stehenden Mitspieler zu erkennen, wenn mehrere 100-Kilo-Athleten aus verschiedenen Winkeln auf einen zustürmen. Der Quarterback muss die Laufrichtungen mehrerer potenzieller Anspielpartner im Kopf behalten, während er gleichzeitig die Bewegungen aller elf Gegenspieler auswertet und darauf reagiert – eine Herausforderung, der man am besten mit gut geübten Bottom-up-Schaltkreisen gerecht wird (und mit der jemand, der bewusst über jede Bewegung nachdenken muss, völlig überfordert wäre).
Rezept zum Vermasseln
Lolo Jones stand im Begriff, den 100-Meter-Hürdenlauf der Damen zu gewinnen, und damit war sie bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking auf dem Weg zur Goldmedaille. Sie lag in Führung und überwand die Hürden mit mühelosem Rhythmus – aber dann ging etwas schief.
Zuerst war es nur das schwache Gefühl, die Hürden kämen zu schnell auf sie zu. Währenddessen hatte Jones den Gedanken: Pass auf, dass du in deiner Technik nicht nachlässig wirst … Pass auf, dass deine Beine richtig ausgreifen.
Mit solchen Gedanken im Kopf übertrieb sie es. Sie zog das Tempo ein wenig zu stark an – und strauchelte an der neunten der zehn Hürden. Jones wurde nicht Erste, sondern Siebte und brach tränenüberströmt auf der Aschenbahn zusammen.5
Als sie es bei den Olympischen Spielen 2012 in London (wo sie im 100-Meter-Lauf am Ende Vierte wurde) noch einmal versuchte, konnte Jones sich im Rückblick an den Augenblick ihrer früheren Niederlage kristallklar erinnern. Und wenn man Neurowissenschaftler fragt, können sie den Fehler mit gleicher Klarheit diagnostizieren: Als sie anfing, über die Einzelheiten ihrer Technik nachzudenken, statt die Aufgabe einfach den motorischen Schaltkreisen zu überlassen, die diese Bewegungen geübt hatten und meisterhaft beherrschten, verließ Jones sich nicht mehr auf ihre Bottom-up-Systeme, sondern sie ließ zu, dass diese von oben gestört wurden.
Die Gehirnforschung bestätigt es: Während des Wettbewerbs über die eigene Technik nachzudenken ist für einen Spitzensportler ein sicheres Rezept, um den Sieg zu vermasseln. Wenn ein Spitzenfußballer einen Ball im Zickzack durch eine Linie von Verkehrsbaustellenkegeln dribbelt und dabei aufpassen muss, mit welcher Seite des Fußes er den Ball kontrolliert, macht er mehr Fehler.6 Das Gleiche geschieht, wenn Baseballspieler darauf achten, ob sich der Schläger während des Ausholens vor einem Schlag aufwärts oder abwärts bewegt.
Der motorische Cortex, in dessen Schaltkreise solche Bewegungen bei einem gestandenen Sportler nach Tausenden von Trainingsstunden tief eingegraben sind, funktioniert am besten, wenn man ihn in Ruhe lässt. Wenn dagegen der präfrontale Cortex aktiv wird und wir darüber nachdenken, was wir tun und wie wir es tun – oder, noch schlimmer, was wir nicht tun dürfen –, überträgt das Gehirn die Kontrolle zum Teil an Schaltkreise, die zwar wissen, wie man denkt und sich Sorgen macht, aber nicht, wie man die Bewegung als solche ausführt.
Ob 100-Meter-Lauf, Fußball oder Baseball: Überall ist es das Rezept, um sich selbst ein Bein zu stellen.
Aus dem gleichen Grund sagte Rick Aberman, der bei den Spitzenleistungen der Baseballmannschaft der Minnesota Twins die Regie führt: »Wenn der Trainer sich Aufnahmen eines Spiels ansieht und sich dabei nur auf das konzentriert, was man beim nächsten Mal nicht tun darf, ist das für die Spieler ein Rezept zum Versagen.«
Das gilt nicht nur im Sport. Als eine weitere Tätigkeit, bei der uns zu viel analytisches Denken und Selbstkritik in die Quere kommen können, fällt einem die Sexualität ein. Auf eine dritte weist ein Zeitschriftenartikel über die »paradoxen Effekte des Versuchs, sich unter Stress zu entspannen«, hin.7
Entspannung und Sex funktionieren am besten, wenn man nichts zu erzwingen versucht, sondern es einfach geschehen lässt. Das parasympathische Nervensystem, das während solcher Tätigkeiten eingreift, wirkt in der Regel unabhängig von der Exekutive unseres Gehirns, die darüber nachdenkt.
Edgar Allan Poe bezeichnete die unglückselige mentale Tendenz, ein heikles Thema anzusprechen, das man eigentlich nicht erwähnen wollte, als »Imperativ des Perversen«. Den kognitiven Mechanismus, der diesen Imperativ antreibt, beschreibt ein Artikel des Psychologen Daniel Wegner von der Harvard University mit dem passenden Titel »Wie man bei jeder Gelegenheit genau das Schlechteste denkt, sagt oder tut«.8
Nach Wegners Erkenntnissen eskalieren Schnitzer gerade in dem Maße, in dem wir abgelenkt, gestresst oder auf andere Weise mental belastet sind. Unter solchen Umständen wirkt ein kognitives Kontrollsystem, das normalerweise mögliche Fehler überwacht (und beispielsweise Sprich das Thema nicht an sagt), unabsichtlich als Auslöser, der genau die Wahrscheinlichkeit dieses Fehlers steigert (Erwähne das Thema).
Ende der Leseprobe