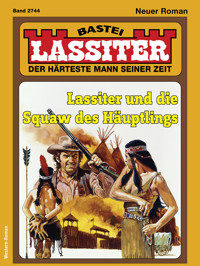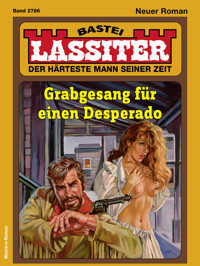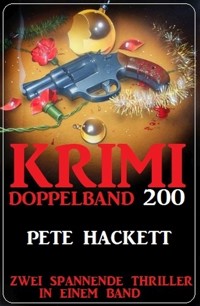
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: Trevellian und das Geschäft mit dem Tod (Pete Hackett) Todesgruß an Jesse Trevellian (Pete Hackett) Professor Jefferson hat in seiner Privatklinik nach einem Weg zur Heilung von Querschnittslähmungen geforscht. Nach einem schweren Unfall liegt er jedoch selbst als Patient in seiner Klinik und ist ab dem Hals gelähmt. Als seine Frau entführt wird, glaubt jeder, dass es um eine Lösegeldforderung geht, aber dann wird einer der Ärzte ermordet. Nachdem ein zweiter Arzt ermordet wird, steht nicht mehr die Entführte, sondern die Klinik im Mittelpunkt der Ermittlungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett
Krimi Doppelband 200
Inhaltsverzeichnis
Krimi Doppelband 200
Copyright
Trevellian und das Geschäft mit dem Tod: Action Krimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Todesgruß an Jesse Trevellian
Krimi Doppelband 200
Pete Hackett
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Trevellian und das Geschäft mit dem Tod (Pete Hackett)
Todesgruß an Jesse Trevellian (Pete Hackett)
Professor Jefferson hat in seiner Privatklinik nach einem Weg zur Heilung von Querschnittslähmungen geforscht. Nach einem schweren Unfall liegt er jedoch selbst als Patient in seiner Klinik und ist ab dem Hals gelähmt. Als seine Frau entführt wird, glaubt jeder, dass es um eine Lösegeldforderung geht, aber dann wird einer der Ärzte ermordet. Nachdem ein zweiter Arzt ermordet wird, steht nicht mehr die Entführte, sondern die Klinik im Mittelpunkt der Ermittlungen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER TONY MASERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian und das Geschäft mit dem Tod: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 118 Taschenbuchseiten.
Zunächst sind es nur breit gestreute Aktienmanipulationen, die das FBI auf den Plan rufen. Doch dann werden Leute ermordet. Die FBI-Agents Trevellian und Tucker glauben, dass es sich um Mitwisser handelt, die man ausschalten will. Die Nachforschungen laufen zunächst ins Leere, denn Broker sind genauso verschwiegen wie Banker.
1
Die Sache war ganz einfach. Per Internet wurde eine Pressmitteilung veröffentlicht, wonach die Concorde New York, eine Leiharbeitsfirma, die weltweit agierte, in Europa 150.000 neue Arbeitsplätze schaffen wollte. Der Kurs der Aktie des Unternehmens stieg innerhalb weniger Stunden von 3,45 Dollar auf 5,35 Dollar, und schon am darauffolgenden Tag betrug der Wert 7,55 Dollar.
Der Presseveröffentlichung im Internet erfolgte am 2. Juli. Am 5. Juli, also drei Tage später, gab es eine weitere Pressemitteilung, der zufolge die Concorde New York klar stellte, dass es sich bei der vorausgegangenen Mitteilung um eine Falschmeldung handelte. Der Aktienkurs fiel daraufhin auf 2,57 Dollar zurück.
Niemand kaufte die wertlose Aktie. Die Anleger hatten sich von den Wertpapieren getrennt, als sie mit 7,55 Dollar einen Höchststand erreicht hatte.
Die Concorde New York stand vor dem Ruin …
Damit ist zusammenfassend alles gesagt, was mir soeben Detective Lieutenant John McDermitt vom Police Department telefonisch mitgeteilt hatte.
Ich lauschte den weiteren Ausführungen McDermitts. Bis jetzt hatte ich ihn noch kein einziges Mal unterbrochen. Er sagte: »Die Aufsichtsratsmitglieder von Concorde New York bestreiten, etwas mit mit der Pumping-Operation zu tun zu haben. Sie waren selbst wie vor den Kopf gestoßen, als die Aktien am zweiten Juli auf fünf Dollar fünfunddreißig das Stück kletterten und am dritten auf satte sieben Dollar fünfundfünfzig.«
»Wer sitzt im Aufsichtsrat von Concorde New York?«, fragte ich.
»Trevor Armstrong, George Henderson, Max Morton, Calem Banks und Stanwell Jackson. Sie sitzen jetzt auf dem Berg fast wertloser Aktien. Und viele Anleger verkaufen trotz des Tiefstandes von zwei Dollar siebenundfünfzig, weil sie befürchten, dass der Wert noch weiter nach unten fällt.«
»Wurden die Gesellschafter schon einvernommen?«
»Nein. Nachdem ein Vertreter der Concorde New York bei uns Anzeige erstattete, war uns sofort klar, dass die Sache in die Zuständigkeit des FBI fällt.«
»Ich verstehe.«
Nachdem das Gespräch beendet war, sagte Milo, der alles gehört hatte, da der Lautsprecher des Telefonapparates aktiviert war: »Aktienbetrug. Ich hab vor Kurzem eine Studie gelesen, wonach diese Art von Verbrechen immer weiter auf dem Vormarsch ist. Kriminelle kaufen Aktien relativ unbekannter Firmen und veröffentlichen dann erfundene beziehungsweise gefälschte Informationen über dieses Unternehmen mit dem Ziel, den Aktienkurs in die Höhe zu treiben und die Aktien dann zu dem hochgepuschten Preis zu verkaufen.«
»Pump and Dump-Operationen«, erwiderte ich und nickte. »Ich weiß.«
»Diese Cybermafias operieren weltweit von einer Vielzahl von Standorten aus«, fügte Milo hinzu. »Die Aktienkurse werden durch falsche Informationen auf Anlegerwebsites künstlich in die Höhe getrieben …« Milo brach ab, denn er hätte sich wiederholt. »Wir sollten uns vielleicht mal die Gesellschafter der Concorde zu Gemüte führen«, schlug er vor.
»Ja, das sollten wir in der Tat«, stimmte ich zu, holte das elektronische Telefonbuch auf den Bildschirm und suchte die Telefonnummer der Concorde New York heraus. Und schon eine Minute später hatte ich Stanwell Jackson, einen der Aufsichtsräte, an der Strippe.
»Wir waren ein gesundes Unternehmen«, erklärte mir der Mann mit rauer Stimme. »Nun aber laufen uns die Aktionäre in hellen Scharen davon, weil zu befürchten ist, dass die Aktie auf einen Wert von unter zwei Dollar fällt und sich nicht wieder erholt. Für uns bedeutet das, dass eine Menge Geld aus dem Unternehmen genommen wird – Geld, das uns fehlt, um investieren zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben.«
»Wir hätten Sie gerne persönlich gesprochen, Mr. Jackson«, sagte ich. »Sind Sie in der Verwaltung der Concorde New York zu erreichen?«
»Ja. Bis um siebzehn Uhr. Dann mache ich Feierabend.«
Das Unternehmen hatte seinen Sitz in der Warren Street, die sich zwischen Nelson A. Rockefeller Park und dem Broadway erstreckt. Es war ein fünfstöckiges Verwaltungsgebäude. Der Hof war mit einem Schlagbaum gesichert. Wir wiesen uns dem Pförtner gegenüber aus und er ließ uns passieren.
In dem Hof parkten wohl an die 150 Pkws. Nicht ein einziger Parkplatz war mehr frei. Ich stellte den Wagen einfach quer hinter zwei parkenden Fahrzeugen ab und sagte dem Pförtner Bescheid, dass er mich im Büro Stanwell Jacksons erreichen konnte, falls es notwendig wurde, den Wagen wegzufahren.
Jackson war ein Mann Ende der vierzig, dunkelhaarig, er wirkte drahtig und sportlich, und ich redete mir ein, dass er wohl zu der Sorte von Zeitgenossen gehörte, die jeden Morgen vor der Arbeit fünf oder zehn Kilometer durch die Botanik hetzten, um sich für den Tag anzutörnen.
Er bot uns Sitzplätze an, und wir ließen uns an dem kleinen, runden Besuchertisch nieder.
»Wir beschäftigen rund um den Globus fast zweihunderttausend Arbeiter, die wir an alle erdenklichen Firmen verleihen«, begann Jackson. »Das Geschäft geht nicht mehr so gut. Wir mussten in den vergangenen Monaten an die hunderttausend Arbeiter entlassen. Die Weltwirtschaft stagniert. Die Firmen in Europa greifen nach der EU-Erweiterung auf billige Arbeitskräfte aus den ehemaligen Ostblockstaaten zurück. In Amerika sind es die Einwanderer und illegal Beschäftigten, die die in Frage kommenden Arbeitsplätze blockieren.«
»Vielleicht sind Sie ganz einfach nur zu teuer«, warf Milo dazwischen.
Irritiert schaute ihn Jackson an. Dann antwortete er: »Wir wollen natürlich Gewinne machen, und die Ausgaben, die eine Firma wie unsere zu tragen hat, sind immens. Davon haben Sie wahrscheinlich keine Vorstellung. Aber selbst wenn wir nur zwanzig Dollar die Stunde pro ausgeliehenem Arbeiter verlangen würden: Wenn jemand für zehn Dollar arbeitet, bekommt er den Vorzug.«
»Wieso beschäftigt dann überhaupt jemand Leiharbeiter?«, fragte ich. »Wo ist der Vorteil? Sie sind immer teurer als ein regulär Beschäftigter.«
»Die Firmen haben den Beschäftigten gegenüber keinerlei Verpflichtungen. Sie werden für eine bestimmte Arbeit angefordert, und wenn der Job erledigt ist, ist die Firma dieses Arbeitskräfte wieder los. Es gibt keine Kündigungsfristen, die einzuhalten wären, keinen Ärger mit der Gewerkschaft, keine gerichtlichen Auseinandersetzungen. Außerdem brauchen sich die Firmen nicht um die Sozialversicherung der Arbeiter kümmern, denn das übernehmen wir und es ist im Preis bereits enthalten.«
»Die Pressemitteilung, die den Wert Ihrer Aktien derart in die Höhe katapultierte, erfolgte im Internet.«
»Ja, bei Redsheets. Die Aktien wurden auf Websites wie Winningstockpicks und Lunchparty angeboten.«
»Haben Sie mit Ihren Aufsichtsrat-Kollegen darüber gesprochen?«
»Natürlich. Der Bestand unseres Unternehmens steht auf der Kippe.«
Kurz und gut, Stanwell Jackson konnte uns nicht weiterhelfen. Er erging sich in Selbstmitleid, jammerte uns vor, dass das Unternehmen auf dem Altar der immer größere Dimensionen annehmenden Computerkriminalität geopfert werden sollte und dass alles, was er und seine Kompagnons aufgebaut hätten, in den unausweichlichen Ruin trieb.
Wir verließen den Betrieb. Zurück im Federal Building meldeten wir uns bei Mr. McKee an, um mit ihm den Fall zu besprechen.
2
Trevor Armstrong war ein Mann von 48 Jahren, glatzköpfig, korpulent, und er schien ständig zu schwitzen. Er war verheiratet, lebte mit seiner Frau unter einem Dach in Queens, das Ehepaar hatte sich aber auseinandergelebt und jeder ging seine eigenen Wege.
Armstrong war auf dem Weg zu einem Massagestudio, in dem auch Sonderwünsche erfüllt wurden. Er fuhr einen Porsche. Das Studio befand sich in West 21st Street. Armstrongs Favoritin war eine junge Japanerin. Er wusste nicht mal ihren Namen. Er nannte sie nur Honey.
Armstrong hatte den Queens-Midtown-Tunnel genommen, um nach Manhattan zu gelangen. Jetzt fuhr er auf der Park Avenue nach Süden, um sich in der 21st nach Westen zu wenden. Immer wieder stockte der Verkehrsfluss. Es nieselte leicht. Armstrong hatte den Scheibenwischer auf Intervall geschaltet. Einige Schlieren auf der Windschutzscheibe behinderten geringfügig die Sicht.
Armstrong hatte das Autoradio angestellt. Soeben wurde ein alter Elvis-Song gespielt. Das Hupkonzert auf der Straße erreichte nur noch den Rand seines Bewusstseins. Er hatte sich im Laufe der Zeit an die chaotischen Verhältnisse auf New Yorks Straßen gewöhnt.
Die Ampel an der 34th schaltete um auf Rot. Armstrong bremste und schaute in den Rückspiegel. Hinter ihm fuhr ein schwerer Lexus. Jetzt setzte er den Blinker, scherte aus, schnitt ein anderes Fahrzeug und rollte auf der linken Fahrspur langsam neben den Porsche. Ein wütendes Hupkonzert setzte ein.
Armstrong achtete nicht weiter drauf. Das Lied im Radio endete, der Moderator sagte etwas, dann wurde ein alter Song gespielt, an den sich Armstrong schon gar nicht mehr erinnern konnte. Die Musik gefiel ihm nicht, er drückte auf den Knopf für die automatische Programmsuche. Mit seinen Gedanken weilte er schon bei der kleinen Japanerin. Er verspürte ein Kribbeln. Schon der Gedanke an sie erregte ihn.
Als sein Blick zufällig nach links schweifte, sah er den Fahrer des Lexus herüber starren – und zwar über die Zieleinrichtung einer Pistole hinweg. Armstrong begriff nicht sofort. Innerhalb des kurzen Zeitraumes zwischen Erkennen und Reagieren drückte der Lexus-Fahrer ab. Die Kugel zerschlug die Seitenscheibe des Porsche und traf Armstrong in den Kopf. Blut spritzte, Armstrong kippte zur Seite. Der Porsche vollführte einen Satz, als Armstrongs Fuß von der Kupplung rutschte, dann wurde der Motor abgewürgt.
In diesem Moment zeigte die Ampel an der Kreuzung Gelb, und im nächsten Moment Grün. Die Fahrzeugkolonne begann wieder zu rollen. Hinter dem Porsche stauten sich die Autos. Der Lexus fuhr bereits über die Kreuzung, hatte sich auf der Linksabbiegerspur eingeordnet und bog in die 34th ab.
Aus einigen Fahrzeug sprangen die Fahrer und eilten zu dem Porsche hin. Dem Mann, der den Wagen zuerst erreichte und einen Blick hineinwarf, entfuhr ein gehetzter Ton, sein Gesicht verlor die Farbe, er wandte sich ab und ächzte: »Ihm fehlt der halbe Kopf. Großer Gott …« Seine Stimme brach. Er presste die linke Hand auf den Leib und wankte zur Seite. Übelkeit würgte ihn, die Augen quollen ihm aus den Höhlen.
3
Detective Lieutenant Harry Easton von der Mordkommission Manhattan verständigte uns. Er hatte meine Nummer gewählt. »Ich weiß, dass ihr wegen Aktienbetrugs zu Lasten der Firma Concorde New York ermittelt«, sagte Cleary. »Heute wurde am hellen Nachmittag auf der Park Avenue Trevor Armstrong erschossen.«
Ich war wie elektrisiert. Meine Kehle war schlagartig trocken. »Sprichst du von Trevor Armstrong, der bei der Concorde New York im Aufsichtsrat sitzt?«
»Ja. Genau von dem ist die Rede.«
»Weiß man, wer ihn erschossen hat?«
»Ein Mann konnte sich erinnern, dass neben dem Porsche Armstrongs ein Lexus angehalten hatte, weil die Ampel zur 34th auf Rot stand. Von dem Mord bekam niemand etwas mit. Wahrscheinlich hat der Mörder einen Schalldämpfer benutzt. Die Nummer des Lexus hat sich der Mann natürlich nicht gemerkt. Er erinnert sich lediglich daran, dass der Wagen anthrazitfarben war.«
»Das ist nicht viel.«
»Ich weiß. Es tut mir Leid. Die Staatsanwaltschaft hat den Porsche und die Leiche beschlagnahmt. Der Coroner hat den Toten ins Gerichtsmedizinische Institut gebracht. Die Kollegen von der Spurensicherung werden sich an euch wenden, wenn Ermittlungsergebnisse vorliegen.«
»Vielen Dank, Harry«, sagte ich, dann war die Leitung tot, ich drapierte den Hörer auf den Apparat und schaute Milo an. »Das ist kein Zufall. Zwischen dem Aktienbetrug und dem Mord an Armstrong besteht ein Zusammenhang.«
Milo wiegte den Kopf. »Sieht ganz so aus. Um herauszufinden, welche Rolle Armstrong gegebenenfalls spielte, sollten wir uns vielleicht etwas in seiner Wohnung umsehen. Eventuell weiß seine Frau etwas. Möglicherweise gibt sein Computer etwas her. Ein Mann wie Armstrong verfügt sicher über ein häusliches Arbeitszimmer. Warum sollten wir nicht auf irgendeinen Hinweis stoßen?«
»Worauf warten wir noch?«
Armstrong wohnte in Queens, Ketcham Street.
Ich sagte Mandy Bescheid, dann verließen wir unser Büro und fuhren hinunter in die Tiefgarage. Eine Minute später rollte der Wagen in Richtung Brooklyn Bridge, auf der ich den East River überqueren wollte.
Es dauerte fast eine Stunde, bis ich vor der Villa Armstrongs parkte. Ja, es war eine Villa, die in einem großen, parkähnlichen Garten lag. Eine geteerte Zufahrt führte vom Tor zur Doppelgarage, die etwa zwanzig Schritte vom Haus errichtet worden war, und die ein flacher Zwischenbau mit dem luxuriösen Gebäude verband. Die Außenwände waren weiß getüncht, das Dach mit dunkelgrauen, fast schwarzen Ziegeln gedeckt. Vor dem Haus gab es ein Rondell, das mit Blumen bepflanzt war und dessen Mitte ein Springbrunnen zierte.
Das schmiedeeiserne Tor war geschlossen. Daneben gab es eine Pforte, hinter der ein gepflasterter Fußweg begann, der ebenfalls zum Wohnhaus führte. Auch sie war verschlossen, aber es gab eine Klingel an einer der mächtigen Granitsäulen, an denen die Tür und das doppelflügelige Tor verankert waren, und Milo legte den Daumen auf den Klingelknopf.
Sicher wurde das Grundstück videoüberwacht. Mein Blick suchte nach einer entsprechenden Kamera, konnte aber keine entdecken.
»Wer ist da?«, tönte eine männliche Stimme aus dem Lautsprecher der Gegensprechanlage.
»FBI! Die Special Agents Trevellian und Tucker.«
Ein leises Summen ertönte, die Pforte öffnete sich wie von Geisterhand gesteuert, Milo versetzte ihr einen leichten Stoß, und sie schwang lautlos auf. Wir betraten das Grundstück, schritten auf dem gepflasterten Gehweg zum Haus und wurden an der Haustür schon erwartet. Es war ein livrierter Mann um die Fünfzig, der im Türrahmen stand und uns entgegenblickte. Ein grauer Haarkranz umgab seinen Kopf. Die Schädeldecke war kahl und erinnerte an eine Tonsur.
»Ich nehme an, Sie kommen wegen der schrecklichen Sache, die Mr. Armstrong widerfahren ist. Wir sind alle zutiefst betroffen. Mrs. Armstrong hatte einen Nervenzusammenbruch und befindet sich im Krankenhaus.«
»Wir würden uns gerne mal im Haus umsehen«, erklärte ich.
Die linke Braue des Hausdieners hob sich. »Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?«
»Den können wir innerhalb kürzester Zeit besorgen und wiederkommen«, knurrte Milo. »Hat Mr. Armstrong etwas zu verbergen?«
Der uniformierte Mann schüttelte den Kopf. »Er war ein ehrenwerter Mann, geachtet und respektiert. Bitte, kommen Sie herein.«
Er vollführte eine einladende Handbewegung und trat zur Seite.
Wir schritten an ihm vorbei und standen in einer Halle, in deren Mitte eine schwere Polstergarnitur um einen niedrigen Tisch gruppiert war. An den Wänden standen einige Vitrinen, eine Treppe führte hinauf zu einer Galerie, von der aus Türen in die verschiedenen Räume im Obergeschoss führten.
Hier war alles teuer und prunkvoll. Als Aufsichtsratsmitglied der Concorde New York musste Armstrong ganz gut verdient haben.
»Führen Sie uns ins Arbeitszimmer Armstrongs«, forderte ich den Mann im Livree auf.
Im Gesicht des Burschen zuckte kein Muskel. »Folgen Sie mir.« Er stieg vor uns die Treppe hinauf, die mit einem dicken Teppich ausgelegt war. Oben öffnete der Diener eine Tür. »Das Arbeitszimmer Mr. Armstrongs.«
»Vielen Dank.« Ich ging an dem Diener vorbei, Milo folgte mir auf dem Fuß. Es gab hier einen Schreibtisch mit einer Computeranlage, einige Regale mit Büchern, die bis unter die Decke reichten, an den Wänden zwischen den Regalen hingen einige Bilder, unter anderem ein Kandinsky. Ich konnte jedoch nicht beurteilen, ob er echt war oder ob es sich nur um einen Kunstdruck handelte.
»Ich darf Sie bitten, nichts durcheinander zu bringen«, sagte der Diener und schaute pikiert. »In diesem Büro hat Mr. Armstrong auch seine persönlichen Unterlagen aufbewahrt. Versicherungspolicen, Verträge, Wertpapiere …«
»Aktien?«, fragte ich.
»Aktien der Concorde New York etwa?«, ergänzte Milo.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gab keinen Grund für Mr. Armstrong, mir Einblick in seine persönlichen Angelegenheiten zu gewähren.«
Wir machten uns daran, das Büro zu durchsuchen. Ich fuhr den PC hoch. Das Betriebsprogramm war nicht kennwortgeschützt, und so hatte ich kein Problem. Der Computer war vernetzt. Zunächst einmal durchforstete ich die Dateien im Explorer. Ich stieß auf einige gespeicherte Briefe, die Armstrong in eigener Angelegenheit verfasst hatte. Nichts von Bedeutung. Dann verschaffte ich mir Zugang zum Internet und ging in der Historie die Web-Adressen durch, die Armstrong kontaktiert hatte. Ich stieß auf Adressen wie redsheets.com, winningstockpicks.net und lunchparty.com. Web-Adressen, die sich mit dem Handel von Aktien befassten.
Wenn ich mich richtig erinnerte, waren bei winningstockpicks.net und lunchparty.com die hochgepuschten Aktien der Concorde New York angeboten worden.
Ich schaute mir das elektronische Telefonbuch des E-Mail-Programms an und stieß auf einige Adressen, die ich mir notierte. Unter anderem waren es die E-Mail-Adressen der anderen Aufsichtsratsmitglieder der Concorde New York, da waren aber auch einige andere Namen.
Der elektronische Briefkasten war leer. Einige E-Mails waren gespeichert, aber sie waren für uns bedeutungslos.
Der Zugriff auf Online-Banking wurde mir verwehrt. Das erforderliche Kennwort kannte ich nicht. Aber selbst wenn es mir bekannt gewesen wäre, es hätte mir kaum etwas genutzt, weil ich die notwendige Pin-Nummer nicht hatte.
Ich richtete meinen Blick auf den Diener, der mit versteinert wirkendem Gesicht dastand und uns beobachtete. »Wir werden den PC beschlagnahmen«, gab ich zu verstehen. »Wissen Sie, bei welcher Bank Armstrong sein Privatkonto unterhielt?«
»Ich habe keine Ahnung«, erwiderte der Bursche.
Ich zuckte mit den Schultern. »Wie sieht es aus, Milo?«
»Ich habe ein ganzes Aktienpaket gefunden. Wertpapiere der Concorde New York sind nicht darunter. Es gibt einen Stapel Aktien der South Manhattan Oil Company und von ComTec Industries. Außerdem habe ich einige Policen gefunden. Lebensversicherungen. Überschlägig etwa zwei Millionen Dollar, die Mrs. Armstrong im Falle des Ablebens ihres Mannes erhält.«
Ich wandte mich wieder dem Diener zu. »Wie war das Verhältnis zwischen Mrs. und Mr. Armstrong?«
Das Gesicht des Burschen verschloss sich noch mehr. »Sie waren verheiratet und zeigten sich bei offiziellen Anlässen zusammen in der Öffentlichkeit. Wie das Verhältnis tatsächlich war, kann ich nicht beurteilen. Ich hatte keinen Einblick in die Privatsphäre der Ehegatten.«
»Das können Sie Ihrer Großmutter erzählen«, stieß Milo hervor. »Wahrscheinlich waren Sie Tag und Nacht hier anwesend. Es kann Ihnen gar nicht entgangen sein, in welcher Beziehung die Ehegatten zueinander standen.«
»Mein Dienst beginnt morgens um acht Uhr und endet abends um zwanzig Uhr. Nur wenn Mrs. und Mr. Armstrong Gäste zu sich eingeladen hatten, musste ich über zwanzig Uhr hinaus zur Verfügung stehen. Ich stecke meine Nase nicht in Dinge, die mich nichts angehen.«
Zuletzt hatte die Stimme etwas ungeduldig und genervt geklungen.
»In welchem Krankenhaus liegt Mrs. Armstrong?«
»Im Bellevue Hospital.«
Ich hatte angefangen, die Kabel vom Tower des PCs zu lösen; die Verbindung zum Monitor, zur Tastatur, zum Drucker …
Als wir das Haus verließen, trug ich den Tower unter dem Arm. Unser Computerspezialist Craig E. Smith würde sich mit der Festplatte des PC befassen. Er war sogar in der Lage, gelöschte Dateien wieder herzustellen.
4
Eine der E-Mail Adressen, die Armstrong gespeichert hatte, war für uns von Interesse. Es war die Adresse eines Mannes, dessen Namen Owen McAllister war. Und dieser Bursche war polizeibekannt. Vorbestraft wegen Computerkriminalität. Er hatte zusammen mit einigen anderen Freaks Viren programmiert, sie ins Netz gestellt und immensen Schaden angerichtet. Dazu kam Scheckkartenbetrug. McAllister war deswegen zu einer Gesamtstrafe von fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, nach dreieinhalb Jahren wurde er jedoch wegen guter Führung entlassen.
Es war eine interessante Eröffnung unsere Kollegen Craig E. Smith.
McAllister wohnte in der Greene Street, SoHo. Obwohl die Greene Street nur einen Katzensprung vom Federal Building entfernt war, fuhren wir mit dem Sportwagen. Das Gebäude, in dem McAllister wohnte, fanden wir auf Anhieb. Es war ein Hochhaus, in dem auch einige Firmen untergebracht waren. Ich fand einen Parkplatz und rangierte den Wagen hinein. Vom Portier erfuhren wir, dass das Apartment McAllisters in der fünften Etage lag. Wir nahmen den Aufzug.
Ich putzte die Klingel. Aber auch nach dem dritten Läuten blieb es in der Wohnung ruhig. Wie es schien, war McAllister nicht zu Hause. Ich klingelte bei einem Nachbarn. Er rief durch die geschlossene Tür, nachdem er mein Gesicht durch den Spion begutachtet und sich wahrscheinlich ein Bild gemacht hatte: »Wenn Sie von irgendeiner Versicherung sind oder …«
»FBI!«, unterbrach ich ihn. »Öffnen Sie, wir haben eine Frage.«
Jetzt ging die Tür einen Spaltbreit auf, gerade so weit, wie es die Sicherungskette zuließ. Der Teil eines männlichen Gesichts wurde sichtbar. »Sagten Sie FBI?«
»Mein Name ist Trevellian. Wir wollten zu Owen McAllister, wie es aber scheint, ist er nicht zu Hause.«
»Er geht keiner Arbeit nach. Keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht einkaufen.«
»Wie kann er sich hier in SoHo eine Wohnung leisten, wenn er nicht arbeitet?«
»Das weiß ich doch nicht. Das müssen Sie ihn schon selber fragen.«
»Bekommt McAllister öfter mal Besuch?«
»Ich kümmere mich kaum um die Leute, die hier wohnen. Manchmal treffe ich McAllister auf der Treppe oder im Aufzug. Ich hab mir auch schon Gedanken gemacht, womit er diese Wohnung finanziert.«
»Schönen Dank«, sagte ich.
Die Tür wurde ins Schloss gedrückt.
In dem Moment vernahm ich das leise Rumpeln, mit dem der Aufzug in der Etage anhielt, in der wir uns befanden. Die Tür fuhr lautlos auf, ein Mann, etwa Ende der Zwanzig, wollte aus dem Aufzug treten. Er stockte jedoch im Schritt, als er uns sah. In seinem Gesicht drückte sich jähes Erschrecken aus, seine Hand zuckte zur Schalttafel mit den Knöpfen, die den Aufzug steuerten.
Ich schaltete sofort und setzte mich in Bewegung. »Bleiben Sie stehen!«, rief ich. »FBI!«
Vor meiner Nase schloss sich die Tür der Kabine. Wieder erklang das leise Rumpeln, mit dem der Aufzug in Gang gesetzt wurde. Es gab an der Wand über der Aufzugtür keine Stockwerksanzeige, lediglich einer von zwei Pfeilen zeigte an, ob der Aufzug nach oben oder nach unten fuhr.
Jetzt fuhr er nach unten.
Milo rannte zur Treppe und stürmte sie, immer drei Stufen auf einmal nehmen, nach unten. Er verschwand um den Treppenabsatz, ich hörte nur noch das Trampeln seiner Schritte, und auch das wurde schnell leiser.
Ich drückte den Knopf neben der Aufzugtür, mit dem man den Lift in die fünfte Etage holte, und presste das Ohr gegen die Tür aus Edelstahl. An den Geräuschen erkannte ich, dass der Aufzug anhielt. Es dauerte nicht lange, dann setzte er sich wieder in Bewegung. Ich schaute auf die Fahrtrichtungsanzeige über der Tür. Der Pfeil, der nach oben wies, war erleuchtet. Der Aufzug kam, die Tür fuhr auf – die Kabine war leer.
Ich ahnte, dass McAllister – dass er es gewesen war, davon war ich überzeugt – irgendwo zwischen der fünften Etage und dem Erdgeschoss ausgestiegen war.
Warum war er geflohen? Hatte er Dreck am Stecken?
Die andere Frage war, woran er uns als Polizisten erkannt hatte. Hatten wir etwas an uns, das uns verriet? Oder war es einfach nur das schlechte Gewissen, das McAllister in die Flucht trieb, als er uns sah?
Ich ging zur Treppe und stieg sie hinunter, warf in jeden der Flure der verschiedenen Stockwerke einen Blick, konnte aber McAllister nirgends entdecken. Dann kam ich unten an. In der Halle, bei der Rezeption, wartete Milo. »Er ist nicht unten angekommen«, empfing mich mein Kollege.
Der Portier hinter der Rezeption schüttelte zu den Worten Milos den Kopf. »Nein, ist er nicht«, pflichtete er bei. »Was hat er denn ausgefressen, dass sich das FBI für ihn interessiert?«
»Nichts. Wir wollten ihm nur eine Frage stellen.« Ich griff in die Innentasche der Jacke, holte meine Brieftasche hervor und fingerte eine von meinen Visitenkarten heraus. »Falls er sich bei Ihnen blicken lässt, bestellen Sie ihm, dass er mich anrufen soll«, sagte ich.
»Mach ich«, versprach der Portier und nahm das Kärtchen.
Wir verließen das Gebäude.
Doch wir fuhren nicht weg. Ich setzte mich in den Wagen und beobachtete den Eingang, Milo postierte sich auf der anderen Straßenseite in einer Reinigung.
Irgendwann, so sagten wir uns, würde McAllister das Gebäude wieder verlassen. Und dann wollten wir uns den Knaben greifen. Seine Flucht war Beweis dafür, dass er etwas zu verbergen hatte. Und sein Name war in einem Mordfall aufgetaucht.
5
McAllister war in der zweiten Etage ausgestiegen und hatte sich in der Besenkammer versteckt, die es in jedem Stockwerk gab, und in der die Putzfrauen, die das Treppenhaus und die Flure reinigten, ihre Utensilien und Werkzeuge aufbewahrten.
McAllisters Gedanken wirbelten. Er mahnte sich zur Ruhe. Es gelang ihm jedoch nicht, das innerliche Zittern, das ihn erfüllte, zu unterdrücken. Er atmete stoßweise, sein Puls raste.
Nach einer Viertelstunde etwa wagte er es, sein Versteck zu verlassen. Er schlich die Treppe hinauf, die Luft war rein, er sperrte die Tür zu seiner Wohnung auf und betrat sie. Nachdem er die Tür wieder zugedrückt hatte, lehnte er sich mit dem Rücken dagegen und atmete tief durch. Es gelang ihm nicht, die Rebellion in seinem Innern in den Griff zu bekommen. Immer wieder hallten die drei magischen Buchstaben in ihm nach. F – B – I!
Vor seinem Blick lag das Wohnzimmer seines Apartments. Es war nicht billig eingerichtet. McAllister ging zum Fenster und schaute auf die Straße hinunter, sah jedoch nichts, was seine Unruhe hätte schüren müssen.
Da läutete es an der Tür.
McAllister zuckte zusammen wie unter einem Peitschenhieb. Seine Schultern hatten sich gehoben, wie sprungbereit stand er da, in seinem Gesicht zuckte es. Atmung und Herzschlag hatten sich erneut beschleunigt.
Mit weichen Knien ging er zur Tür und schaute durch den Spion. Zischend entwich die verbrauchte Luft seinen Lungen. Es war sein Nachbar. McAllister öffnete die Tür.
»Vorhin waren zwei Gentlemen vom FBI hier«, sagte der Nachbar.
McAllister war bemüht, seiner Stimme einen ruhigen Klang zu verleihen, als er fragte: »Was wollten sie? Stellten sie Fragen? Sagten sie sonst etwas?«
»Sie wollten wissen, womit Sie Ihre Wohnung finanzieren, McAllister.« Und etwas zynisch fügte der Nachbar hinzu: »Dieselbe Frage, die ich mir auch schon seit einiger Zeit stelle.«
McAllister wollte schon zu einer scharfen Antwort ansetzen, schluckte aber seinen Ärger hinunter und knurrte: »War das alles?«
»Ja. Ich wollte Ihnen nur Bescheid gesagt haben. Sicher kommen die beiden wieder.«
Der Nachbar tippte sich wie zum Gruß mit Zeige- und Mittelfinger gegen die Stirn, wandte sich ab und ging zu seiner Wohnungstür. McAllister schluckte würgend und drückte die Tür zu. Er hatte das Gefühl, als läge eine Schlinge um seinen Hals, die sich immer enger zusammenzog.
Er bemühte sich, dieses Gefühl der dumpfen, wühlenden Angst abzuschütteln, zog das Handy aus der Tasche des Anoraks, den er trug, holte eine eingespeicherte Nummer auf das Display und drückte den grünen Knopf. Dreimal tutete das Freizeichen, dann erklang eine Stimme: »Was willst du?«
»Bei mir waren die Bullen.« Die Stimme McAllisters lag belegt.
»Und?«
»Ich bin ihnen entkommen. Jetzt befinde ich mich in meiner Wohnung, denke aber, dass diese observiert wird. Was soll ich tun?«
»Es gibt nichts, womit sie dich festnageln können. Warum bist du Dummkopf abgehauen? Damit hast du erst zum Ausdruck gebracht, dass du etwas zu verbergen hast.«
»Ich war in Panik, als ich die beiden sah. Ich habe einen von ihnen auf Anhieb erkannt. Sein Konterfei war schon des Öfteren in der Zeitung und im Fernsehen zu sehen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Name Trevellian.«
»Ist der nicht vom FBI?«
»Richtig.«
»Verdammt!«
»Was soll ich tun?«
»Ich schick jemand zu deiner Wohnung, der dich abholt. Du wirst für einige Zeit von der Bildfläche verschwinden. Mein Mann ist in einer halben Stunde bei dir. Er bringt dich zu einer leerstehenden Wohnung in Westchester County, wo du dich verkriechst.«
»Was kann die Bullen auf meine Spur geführt haben?«
»Ich weiß es nicht, und es spielt auch gar keine Rolle. Maßgeblich ist, dass sie dich ins Auge gefasst haben.«
»Ich will nicht mehr ins Gefängnis. Eher bringe ich mich um. Himmel, hätte ich mich bloß nicht auf die Sache eingelassen.« Die Stimme McAllisters hatte zuletzt fast weinerlich geklungen.
»Du hast dich darauf eingelassen, und du hast eine Menge Geld kassiert. Fang jetzt bloß nicht zu weinen an. Du hast genau gewusst, worauf du dich einlässt. Bis in einer halben Stunde also.«
»Warte …«
»Was ist noch?«
»Dein Mann soll dreimal läuten, damit ich weiß, dass er es ist.«
»In Ordnung.« Danach herrschte im Äther Stille. Der andere hatte das Gespräch beendet. McAllister schaltete sein Handy aus und steckte es in die Tasche. Die zitternde Anspannung seiner Nerven entlud sich in einem kehligen Laut, der sich anhörte wie trockenes Schluchzen. Er begab sich wieder zum Fenster und schaute auf die Straße hinunter.
Da dudelte das Telefon. McAllisters Herz übersprang einen Schlag. Dreimal zog er die Hand wieder zurück, dann ergriff er den Hörer und hob ihn vor sein Gesicht. »McAllister.«
Es war der Portier. Er sagte: »Da sind Sie ja. Ich versuche schon seit einer ganzen Weile, Sie telefonisch zu erreichen. Warum haben Sie vor den beiden FBI-Agenten die Flucht ergriffen? Sie wollten Ihnen lediglich eine Frage stellen. Ich hab die Visitenkarte eines der Agents. Sein Name ist Trevellian. Soll ich Ihnen seine Telefonnummer geben, damit Sie ihn anrufen können?«
»Ich hole mir nur etwas zum Schreiben. Augenblick …« McAllister legte den Hörer ab, holte sich einen Notizblock und einen Kugelschreiber, dann klemmte er sich den Hörer zwischen Schulter und Kinn. »Sagen Sie mir die Nummer.«
Der Portier diktierte sie ihm, McAllister schrieb mit. Dann wiederholte er die Nummer, bedankte sich und legte auf.
Er zog den Anorak aus und warf ihn über die Lehne eines Sessels.
Was war das für eine Frage, die ihm die FBI-Agenten stellen wollten? Die Angst rumorte in seinen Eingeweiden.
Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, war man an ihn herangetreten. Er war einer der besten seines Fachs. Als Hacker, der das eine oder andere Sicherheitssystem im Netzwerk überwand und sich sogar Zugriff zu den Konten seiner Opfer verschaffte, hatte er vor einigen Jahren begonnen. Das Angebot, das ihm unterbreitet worden war, war viel zu lukrativ gewesen, als dass er es hätte ablehnen können. Nach fünf Jahren hinter Gittern hatte er sozusagen vor dem Nichts gestanden.
Leute wie er wurden als IT-Söldner bezeichnet. Sie stellten gegen eine gewisse Summe ihr Können und ihre Fähigkeiten zur Verfügung …
Was für eine Frage? Es nagte und fraß in ihm.
Die Zeit schien stillzustehen. Es juckte McAllister in den Fingern, den Telefonhörer zu nehmen und Trevellian anzurufen. Und schließlich überwältigte ihn dieses Verlangen. Er wählte die Nummer, die ihm der Portier durchgegeben hatte. Doch niemand nahm ab, was McAllister sagte, dass Trevellian nicht in seinem Büro war.
McAllister zerkaute einen Fluch und legte den Hörer auf den Apparat.
Als es dreimal klingelte, schrak er zusammen. Er atmete tief durch. Dann ging er zur Tür. Durch den Spion sah er ein ihm unbekanntes Gesicht. Er öffnete. »Bist du fertig?«, fragte der Mann vor der Tür.
»Ich ziehe nur meine Jacke an.«
McAllister schwang mit dem letzten Wort herum, ging zum Sessel und griff nach dem Anorak. Als er sich wieder der Tür zuwandte, blickte er in die Mündung eines Schalldämpfers, der auf eine großkalibrige Beretta aufgeschraubt war.
»Was …«
Es gab ein Geräusch, wie wenn man den Korken aus einer Champagnerflasche zieht. McAllister spürte den Einschlag, die Wucht des Treffers ließ ihn rückwärts taumeln, er fiel in einen der Sessel. Der Anorak war ihm aus der Hand geglitten und zu Boden gefallen. Vor seinen Augen verschwamm die unmittelbare Umgebung wie in dichtem Nebel. Dann versank alles in undurchdringlicher Schwärze. Der Tod griff mit gebieterischer Hand nach ihm.
Der Killer hatte die Tür geschlossen. Jetzt schoss er noch einmal. Er wollte ganz sicher gehen, dass McAllister nicht mehr reden konnte. Dann verstaute er die Waffe unter der Jacke in seinem Hosenbund, holte dünne Latexhandschuhe aus der Tasche und streifte sie sich über die Hände, bückte sich und hob McAllisters Anorak auf, griff ihn ab und fand, was er suchte – das Handy McAllisters. Er schob es in seine Jackentasche, dann ging er zum Computer McAllisters, der auf einem Schreibtisch an der Wand stand, fuhr ihn hoch und – presste die Lippen zusammen, als das Betriebssystem ein Kennwort verlangte.
Ohne lange zu überlegen, schaltete er den Computer wieder aus, zog den Tower unter dem Schreibtisch hervor, entfernte die Anschlüsse, holte ein Schweizer Messer aus der Jacke und klappte einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher heraus.
6
Menschen gingen in das Gebäude oder verließen es. Ich hatte McAllister nur kurz gesehen, als er aus dem Aufzug steigen wollte, war mir aber sicher, dass ich ihn erkennen würde. Aber er zeigte sich nicht.
Autos rollten an mir vorbei. Der Himmel über den Wolkenkratzern war bleigrau, die Wolken hingen tief, leichter Nieselregen hatte wieder eingesetzt. Mit Milo stand ich per Handy in Kontakt.
Jetzt hatte ich ihn wieder an der Strippe. »Während wir hier warten«, meinte Milo, »liegt der Knabe wahrscheinlich bequem auf seiner Couch und zieht sich irgendeinen Film rein. Vielleicht trinkt er sogar Bier und isst Chips. Wir sollten es noch einmal versuchen. Sonst stehen wir morgen früh noch da und starren die Haustür an.«
»Ich gebe dir Recht«, erwiderte ich. »Nachdem er das Haus nicht verlassen hat, muss er noch drin sein. Und da er sicher davon ausgeht, dass wir längst wieder in der Dienststelle sind, ist es nicht auszuschließen, dass er in aller Seelenruhe seine Wohnung aufgesucht hat.«
Milo lachte. »Ein scharfsinniger Schluss, Kollege. Nachdem er das Haus nicht verlassen hat, muss er noch drin sein. Darauf wäre ich wohl nie gekommen.«
»Ha, ha«, machte ich. »Freut mich, dass du wieder was gefunden hast, um mich auf den Arm zu nehmen. – Aber Spaß beiseite. Wir gehen noch einmal hinauf. Treffen wir uns vor der Haustür.«
Wenig später betraten wir gemeinsam das Haus. Vor uns war ein Mann hineingegangen. Soeben verließ ein Paar den Aufzug. Der Portier schaute überrascht, als er uns sah. »Ich habe McAllister Bescheid gegeben«, rief er. »Hat er Sie angerufen?«
»War er in seiner Wohnung?«, kam meine Gegenfrage.
»Ja. Ich versuchte es mehrere Male, bis er etwa zwanzig Minuten, nachdem Sie das Gebäude verlassen hatten, an den Apparat ging.«
Ich wechselte mit Milo einen viel sagenden Blick, der in etwa zum Ausdruck bringen sollte, dass er mit seiner Vermutung wahrscheinlich Recht hatte, wonach McAllister Bier trinkend und Chips essend auf seiner Couch lag und auf die Mattscheibe glotzte.
Der Mann, der vor uns das Gebäude betreten hatte, war mit dem Aufzug nach oben gefahren. Wir mussten also warten, bis der Lift wieder unten ankam. Ich verspürte so etwas wie Ungeduld in mir. Der Grund hierfür entzog sich meinem Verstand. War es ein sechster Sinn, der sich meldete, den ich aber nicht zu analysieren vermochte und der mir nicht verriet, was die Unruhe in mir schürte?
Der Lift kam unten an und wir stiegen ein, Milo drückte auf den Knopf mit der Nummer fünf, dann trug uns der Aufzug nach oben. Wenig später läutete ich an McAllisters Apartmenttür.
Wenn ich erwartet hatte, dass uns McAllister nun öffnete, sah ich mich getäuscht. In der Wohnung blieb es ruhig. Die kleine Öffnung des Spions verdunkelte sich nicht, was ein Zeichen dafür gewesen wäre, dass jemand von der anderen Seite durch die Linse schaute.
»Warte hier«, sagte Milo. »Ich fahre noch einmal hinunter und lasse den Portier anrufen.« Er ging zum Aufzug, drückte den Knopf, damit sich die Tür öffnete, dann verschwand er.
Die Tür zur Nachbarwohnung öffnete sich. »Ich habe McAllister Bescheid gesagt, dass Sie ihn sprechen wollten. Er war ziemlich kurz angebunden.«
»Hat er seine Wohnung wieder verlassen?«, wollte ich wissen.
»Nein. Aber ich habe gehört, dass jemand an seiner Tür klingelte. Sie müssen wissen, die Wände in dem Gebäude sind ziemlich dünn und …«
»Jemand läutete an seiner Tür?«
»Ja. Aber ich weiß nicht, wer. Wie ich schon sagte: Ich kümmere mich kaum um meine Nachbarn. Die meisten kenne ich gar nicht. Einige nur vom Sehen.«
Ein schrecklicher Verdacht durchfuhr mich, und ich handelte kurz entschlossen. Mit der Schulter warf ich mich gegen die Tür. Sie hielt meinem ersten Anprall stand. Ich versuchte es erneut, und setzte diesmal mein gesamtes Gewicht ein. Krachend flog die Tür auf. Das Schloss war regelrecht aus dem Futter in der Tür gefetzt worden.
Im Sessel lag ein Mann. Owen McAllister. Ich erkannte ihn sofort. Am Boden lag sein Anorak. Die Haltung, die er einnahm, verriet mir, dass er sich nicht freiwillig so hingesetzt hatte. Sein Kinn war auf die Brust gesunken. Seine Arme baumelten zu beiden Seiten über die Lehnen. Sein Hemd war dunkel und feucht vom Blut.
Sekundenlang setzte mein Verstand aus. Während wir vor dem Haus auf ihn warteten, war sein Mörder in aller Ruhe an uns vorbeispaziert, in den fünften Stock gefahren und hatte McAllisters Leben ein Ende gesetzt.
Meine Gedanken rotierten. Sofort sah ich einen Zusammenhang zwischen dem Mord an Trevor Armstrong, einem der Aufsichtsräte von Concorde New York, und dem brutalen Ende McAllisters.
»Großer Gott!«
Die beiden Wort hieben in mein Denken wie ein Schlag mit einem Beil. Es war der Nachbar. Ich drehte den Kopf herum und sagte: »Gehen Sie in Ihre Wohnung. Los, gehen Sie! Und bleiben Sie, wo Sie sind.«
»Ich – ich verständige die Polizei«, stammelte der entsetzte Mann.
»Das mache ich schon«, knurrte ich. »Gehen Sie jetzt.«
Er verschwand, im nächsten Moment hörte ich die Tür der Nachbarwohnung zuschlagen.
Ich schaute mich um. Auf dem Schreibtisch stand der Computer. Das Gehäuse war vom Turm gezogen worden. Ich schaute mir den Tower aus der Nähe an. Die Festplatte fehlte.
Da läutete das Telefon. Ich rührte den Hörer jedoch nicht an, um eventuelle Fingerabdrücke nicht zu verwischen. Ich ahnte, dass es der Portier war, der anrief. Nach viermaligem Läuten gab er auf. Nun nahm ich mein Mobiltelefon zur Hand, tippte Milos Nummer her und drückte den Wahlknopf. Im nächsten Moment hatte ich Milo am Apparat.
»McAllister rührt sich nicht«, sagte mein Kollege. »Wir werden wohl in die Wohnung eindringen …«
»Ich bin schon drin«, so schnitt ich Milo das Wort ab. »McAllister ist tot. Wie es aussieht, wurde er erschossen.«
»O verdammt!« Mehr kam zunächst nicht von Milo. Nach einigen Sekunden, in denen er die Hiobsbotschaft wahrscheinlich verarbeitete, stieß er hervor: »Sieht aus, als hätten wir eine Spur aufgenommen. Sie führt von Armstrong zu McAllister …«
»… und bei diesem endet sie zunächst einmal«, vollendete ich. »Da war ein Profi am Werk. Er hat sogar die Festplatte aus McAllisters Computer mitgenommen.«
»Ich komme hinauf.«
Nachdem das Gespräch mit Milo beendet war, rief ich beim Police Department an und ließ mich Harry Easton von der Mordkommission verbinden. Er versprach mir, sofort ein Team in die Greene Street zu schicken.
7
Am darauffolgenden Tag erhielten wir erste Ergebnisse. Die ballistische Analyse hatte ergeben, dass Trevor Armstrong und Owen McAllister mit derselben Waffe getötet worden waren. Die Waffe war polizeilich nicht registriert. Spuren vom Mörder waren in der Wohnung McAllisters nicht gefunden worden. Der Bursche musste mit akribischer Vorsicht vorgegangen sein.
Alles, was wir wussten, war, dass der Killer einen anthrazitfarbenen Lexus fuhr. Von diesen Fahrzeugen gab es in New York wahrscheinlich hunderte.
»Eines ist jedenfalls klar«, meinte Mr. McKee, in dessen Büro wir uns befanden. Wir saßen an dem kleinen Konferenztisch. »Zwischen den beiden Morden besteht ein Zusammenhang. Die Frage ist, welcher.«
»Ein Hacker und ein Aufsichtsratsmitglied«, murmelte Milo. »Ein seltsames Gespann. Eine Verbindung muss aber bestanden haben, warum sollte sonst Armstrong die E-Mail-Adresse McAllisters in sein elektronisches Telefonbuch aufgenommen haben?«
»Wir haben es mit Aktienbetrug zu tun«, sagte ich. »Verbrechen per Internet sind im Vormarsch. Um entsprechend agieren zu können, bedarf es eines Spezialisten, der sich Zugang zu allen möglichen Websites verschaffen kann und sie zu manipulieren versteht. McAllister war ein solcher Spezialist.«
»Wenn man diesen Faden weiterspinnt«, meinte Mr. McKee, »dann hieße das, dass Armstrong den Wertzuwachs der Concorde New York-Aktie forcierte und sich auf diese Weise persönlich bereicherte.«
»Können wir es ausschließen?«, fragte ich.
»Aber wer hat ihn dann umgebracht? Und warum musste McAllister sterben?« Der Assistant Director schaute skeptisch.
»Das kann verschiedene Gründe haben«, erwiderte ich. »Wobei die Beweggründe für den Mord an Armstrong ganz andere gewesen sein können als die für den Mord an McAllister.«
»Alles in allem stehen wir vor einem Rätsel, Gentlemen«, erklärte Mr. McKee. »Wir haben ein Unternehmen, dessen Aktien künstlich in die Höhe getrieben wurden, und wir haben zwei Tote, von denen einer in enger Beziehung zu dem Unternehmen stand, der aber auch Kontakt zu McAllister unterhielt. Bringen Sie Licht in das Dunkel, Jesse, Milo. Wie Sie schon sagten, Jesse: Die Cyberkriminalität ist auf dem Vormarsch. Es ist wie Krieg. Und jede Schlacht, die wir gegen diese Banden gewinnen, bringt uns dem Endsieg einen kleinen Schritt näher.«
»Wir tun unser Möglichstes«, versicherte ich, dann ließen wir Mr. McKee allein und kehrten in unser Büro zurück.
»Fahren wir zu Mrs. Armstrong ins Bellevue Hospital. Vielleicht kann sie uns weiterhelfen.«
Das Bellevue Hospital liegt in der First Avenue. Ich stellte den Wagen auf dem Krankenhausparkplatz ab. An der Rezeption in der Halle des Krankenhauses erkundigten wir uns, auf welcher Station und in welchem Zimmer Mrs. Armstrong lag. Das Mädchen hinter der Anmeldung tippte den Namen Armstrong in den Computer, dann schaute es mich fragend an: »Mrs. Jane Armstrong?«
»Gibt es sonst noch eine Mrs. Armstrong, die stationär behandelt wird?«, fragte ich.
»Nein.« Das Girl schüttelte den Kopf, dann nannte es uns die Station und die Zimmernummer, ich bedankte mich, dann machten wir uns auf den Weg durch diesen Irrgarten von Gängen und Zimmern. Nun, wir wären schlechte Kriminalbeamte gewesen, wenn wir die Station und das Zimmer nicht gefunden hätten. Ich klopfte gegen die Tür. Da trat aus dem Stationsbüro eine Frau in Schwesterntracht. Einige Strähnen roten Haares fielen ihr in die Stirn. Sie war nicht sehr groß, dafür aber ziemlich gut genährt. »Wohin möchten Sie denn?«
»Zu Mrs. Armstrong. Mein Name ist Trevellian. Mein Kollege Tucker. Wir kommen vom FBI.«
»Hat das nicht Zeit? Mrs. Armstrong bedarf der absoluten Ruhe. Dr. Benedikt hat angeordnet, dass sie keinen Besuch empfangen darf.«
Das hatte ziemlich resolut geklungen.
»Können wir mit Dr. Benedikt sprechen?«
Die Lady funkelte uns an. »Wenn ich Ihnen sage, dass Sie nicht zu Mrs. Armstrong können, dann sage ich das sicher nicht von ungefähr. Die Gesundheit von Mrs. Armstrong ist nach dem schrecklichen …«
»Deswegen sind wir hier!« So unterbrach Milo die Schwester.
Da wurde die doppelflügelige Tür, die den Flur vom Treppenhaus trennte, aufgestoßen, und ein Mann in einem hellgrünen Kittel betrat die Station.
»Das ist Dr. Benedikt«, gab die resolute Schwester zu verstehen. »Fragen Sie ihn selbst.«
Der Arzt wandte sich uns zu. Erwartungsvoll-fragend fixierte er erst mich, dann Milo, und dieser fühlte sich dadurch aufgefordert, zu sprechen. »Wir sind die Special Agents Trevellian und Tucker vom FBI New York und wollten zu Mrs. Armstrong, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Dagegen dürfte doch nichts einzuwenden sein.«
»Nach dem furchtbaren Schicksalsschlag ist sie ziemlich am Ende«, erklärte der Arzt. »Sie braucht Ruhe. Es war ein herber Zusammenbruch, den sie erlitten hat. Ihr Kreislauf ist ziemlich instabil.«
»Nur ein paar Fragen, Doc«, sagte Milo. »Wir werden Mrs. Armstrong nicht über die Gebühr beanspruchen. Mein Wort drauf.«
Nach kurzer Überlegung stimmte der Arzt zu. »Ich gebe Ihnen fünf Minuten«, murmelte er. »Sie, Schwester, wachen darüber, dass die Zeit eingehalten wird.«
Der Arzt nickte uns zu und ging weiter.
»Die Zeit läuft«, stieß die Lady hervor. Offensichtlich war sie nicht erfreut darüber, dass der Doktor ihr in den Rücken gefallen war, als er uns fünf Minuten mit Mrs. Armstrong zubilligte. Ihre Augen funkelten kriegerisch.
Wir gingen in das Zimmer.
Bleich lag Mrs. Armstrong im Bett. An einem verchromten Gestell hing eine Flasche, von der aus ein dünner, durchsichtiger Schlauch zum Handrücken der Patientin führte. Wahrscheinlich ein kreislaufstabilisierendes Mittel, das ihr intravenös verabreicht wurde.
Die Lider Mrs. Armstrongs zuckten. Mit erloschenem Blick schaute sie uns an. »Wer sind Sie?«, fragte sie mit schwacher Stimme.
Ich stellte uns vor und fragte dann: »Können Sie uns einige Fragen beantworten, Mrs. Armstrong?«
»Fragen Sie.« Die Patientin schloss die Augen, als wäre sie jetzt schon überanstrengt. Ich hatte Zeit, ihr Gesicht zu studieren. Jane Armstrong mochte um die 35 Jahre alt sein. Sie war eine ausgesprochen attraktive Frau, die mit ihrer Ausstrahlung wahrscheinlich jeden Mann in ihren Bann zog.
Mir kam unwillkürlich eine Broadway-Aufführung in den Sinn, die von einer russischen Ballettgruppe dargeboten wurde. »Der sterbende Schwan« hieß das Stück. Warum mich Mrs. Armstrong daran erinnerte, wusste ich selbst nicht zu sagen. Der Vergleich geisterte jedenfalls durch meinen Kopf und ließ sich nicht verdrängen.
»Hatte Ihr Mann Feinde?«, begann Milo die Vernehmung.
»Nicht, dass ich wüsste. Wenn, dann hat er nicht mit mir darüber gesprochen.«
»Im Bekanntenkreis Ihres Gatten gibt es einen Mann namens Owen McAllister. Sagt Ihnen der Name etwas?«
»Nein«, hauchte sie. »Nie gehört.«
»Sie werden an die zwei Millionen Dollar ausgezahlt bekommen«, warf ich hin. »Lebensversicherungen, die Ihr Mann zu Ihren Gunsten abgeschlossen hat.«
Jetzt wurde ihr Blick starr und stechend und richtete sich auf mich. Sie wirkte plötzlich überhaupt nicht mehr krank und schwach. »Was wollen Sie damit zum Ausdruck bringen?«
»Verstehen Sie mich nicht falsch«, erwiderte ich. »Aber wir dürfen nichts außer Acht lassen.«
Das Glitzern in ihren Augen erlosch wieder. Sie senkte die Lider. »Ich – ich fühle mich nicht gut. Bitte, gehen Sie. Mit dem Tod meines Mannes habe ich nichts zu tun, falls Ihre Gedanken in diese Richtung führen.«
»Zwei Fragen noch, Mrs. Armstrong«, sagte ich. »War Ihre Ehe intakt?«
»Ja. Ich habe meinen Mann geliebt.«
»Bei welcher Bank unterhielt Ihr Mann sein Privatkonto?«
Ihre Lider zuckten wieder in die Höhe. »Warum wollen Sie das wissen?«
»Wir möchten die Kontobewegungen überprüfen.«
»Was hat das mit dem Mord an Trevor zu tun?«
Sie sprach mit klarer, präziser Stimme. Plötzlich erinnerte mich die Witwe nicht mehr an den sterbenden Schwan, sondern an eine Klapperschlange, die im nächsten Moment zustoßen würde, um den Giftzahn in das Fleisch ihres Opfers zu treiben.
»Bitte«, sagte ich, »beantworten Sie meine Frage.«
»Er hatte mehrere Konten. Bei der Citi Bank und der Bank of New York.«
»Hat er mit Ihnen über Concorde New York gesprochen? War das Unternehmen finanziell gesund?«
»Mein Mann trennte Job und Privatleben absolut akribisch. Warum lassen Sie sich nicht die Bilanzen des Unternehmens vorlegen?«
Die Tür ging auf und die Krankenschwester streckte ihren Kopf durch den Türspalt. »Die Zeit ist um, Gentlemen.«
»Wir sind schon draußen«, versetzte Milo und nahm mich am Oberarm. »Gehen wir, bevor wir …«, er rollte mit den Augen, »… Ärger kriegen.«
Wir verließen das Zimmer. Die Schwester überwachte unseren Abgang mit Argusaugen.
»Was hast du für einen Eindruck?«, fragte Milo, als wir im Wagen saßen und ich den Schlitten in Richtung Süden chauffierte.
»Sie ist bei Weitem nicht so krank, wie sie es darstellt. Ich verwette meinen rechten Arm, dass die Ehe längst nicht so intakt war, wie sie uns das glauben machen möchte.«
»Wie auch immer, Partner. Es bringt uns nicht weiter. Alles, was wir wissen, ist, dass Armstrong und McAllister mit einer Kugel vom Kaliber neun Millimeter Luger getötet wurden und dass beide irgendwie Kontakt zueinander hatten. Vielleicht reden wir mal mit den anderen Aufsichtsräten von Concorde New York.«
»Wer ist der nächste auf unserer Liste?«
Milo holte sein Notizbüchlein hervor und blätterte es auf. »George Henderson. East Village, East Second, Nummer zweihundertvierzehn.«
Ich musste also nicht die Richtung ändern.
Wir trafen George Henderson zu Hause an. Er bewohnte eine teure Penthouse-Wohnung in einem siebenstöckigen Gebäude. Seine Frau war ebenfalls anwesend.
»Das Unternehmen stand auf gesunden Beinen«, versicherte Henderson. »Jetzt allerdings, nach dieser niederträchtigen Pump and Dump-Aktion, und nachdem wir bekennen mussten, dass wir weltweit hunderttausend Arbeitskräfte entlassen mussten, sind die Aktien auf den tiefsten Wert gefallen, der in der Geschichte von Concorde New York zu verzeichnen war.«
»Ihr Aufsichtsratskollege Armstrong hatte Verbindung zu einem Hacker«, gab Milo zu verstehen.
»Einem Hacker? Sie meinen, einen dieser Computerfreaks?«
»Ja. Sein Name war Owen McAllister.«
»War?«
»Er wurde ebenfalls ermordet. Vom selben Täter wie Armstrong.«
George Henderson massierte sich mit Daumen und Zeigefinger den Nasenrücken. Er wirkte nachdenklich. »Ich glaube, Armstrong hatte zwei Gesichter. Das des biederen Mannes, integer, ehrsam und etabliert, und das des Lebemannes, der sich in einschlägigen Lokalen herumtrieb. Käuflicher Sex und orgiastische Partys. Ich glaube sogar, dass er bisexuell war. Vielleicht erklärt das seinen Kontakt zu diesem Hacker.«
»Armstrong war verheiratet«, wandte ich ein. »Seine Frau erklärte uns, dass die Ehe intakt war. Dazu passt nicht das Bild, das Sie von Armstrong zeichnen.«
Henderson zuckte mit den Schultern. »Mein Kontakt mit Armstrong beschränkte sich auf die rein berufliche Ebene. Stan Jackson hatte auch privaten Kontakt zu ihm. Vielleicht fragen Sie den mal. Ich kann Ihnen nur wiedergeben, was ich vom Hörensagen weiß.«
Stanwell Jackson war nicht im Betrieb. Er besaß ein Haus in Brooklyn, in der North Oxford Street. Dort trafen wir ihn an.