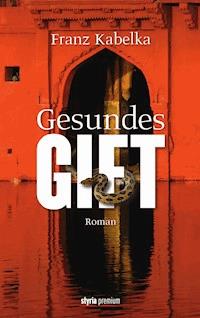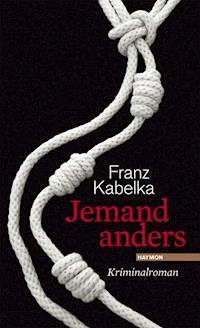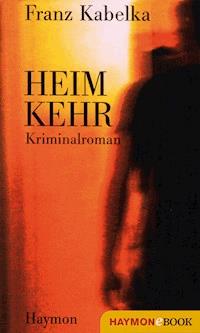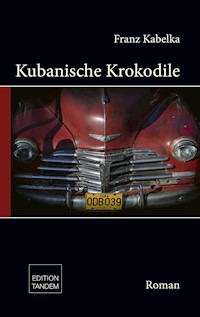
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Tandem
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kuba 2016. Die Wiener Journalistin Frieda Prohaska soll für die Wochenzeitschrift "opinion" eine Hintergrundreportage über die aktuelle Situation auf der Karibikinsel schreiben. Dabei kommt sie nicht nur rechtzeitig zu Fidel Castros Begräbnis und lernt unbekannte Facetten einer fremden Kultur kennen, sie gerät auch in den Strudel weltpolitischer Intrigen und einer lebensgefährlichen Entführung. Mit großer Kenntnis von Land und Leuten erzählt Franz Kabelka eine spannende Geschichte, angesiedelt zwischen Polit-Thriller, Reiseroman und Romanze, die ihre Leserschaft bis zuletzt in Atem hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Kabelka
Kubanische Krokodile
Roman
EDITION
TANDEM
Ich wurde schon so oft totgesagt.
Wenn ich wirklich gestorben bin, wird mir das niemand glauben.
Fidel Castro, zitiert nach Harald Dietl: Cuba
Wer hat gesagt, die Revolution ist ein Drachen?
Nein, nein, die Revolution ist eine Schlange,
die sich in den eigenen Schwanz beißt.
Tierno Monénembo: Kubas Hähne krähen um Mitternacht
Immerhin, zu wissen, dass wir keinem trauen können, ist ein beruhigendes Gefühl,
viel schlimmer ist es, wenn man nicht weiß,
wer die Guten sind und wer die Bösen.
Ángel Santiesteban: Wölfe in der Nacht
Prolog
Die Festung erhebt sich über der Bucht wie ein Monolith, den Außerirdische vor Jahrtausenden mit unbekannter Absicht hingeklotzt haben. Im zarten Rosa des anbrechenden Tages wirkt El Morro noch trutziger, noch mächtiger, als der von tausenden Sklavenhänden errichtete Bau im hellen Tageslicht erscheint. Abgesehen vom Pfeifen der Vögel, die vom Aufwind getragen den massiven Bau spielerisch umkreisen, ist nichts zu vernehmen. Nicht das Geknatter alter amerikanischer Karossen, die mit sechzig und mehr Jahren auf dem Buckel wundersamerweise noch immer brav ihr täglich Werk verrichten; und auch nicht der Lärm jenes LKW, auf dessen Ladefläche bald an die dreißig Angestellte herangekarrt werden, um hier als Billettverkäufer, Wächter oder Fremdenführer ihren Dienst anzutreten. Noch hat auch keiner der Kunsthandwerker draußen auf dem dafür reservierten Gelände seinen Stand aufgebaut, um Touristen seine Waren anzupreisen: aus schwarzem Tropenholz gedrechselte Tanzpaare; blütenweiße, gehäkelte Tischtücher oder handgefertigte Perkussionsinstrumente, allesamt ebenso gediegen wie preiswert. Frühestens in zwei Stunden werden die potenziellen Kunden anrollen, in Privattaxis oder taxis colectivos, je nach Größe des Geldbeutels.
Eine Tafel an der Mauer zeigt an, dass man sich hier vor einem Patrimonio de la Humanidad befindet: einem von der UNESCO ausgewiesenen Weltkulturerbe. El Morro de Santiago de Cuba beziehungsweise El Castillo San Pedro de la Roca – so lauten die beiden Namen für eines der besterhaltenen Beispiele spanisch-amerikanischer Militärarchitektur. Nachdem El Morro Ende des neunzehnten Jahrhunderts seinen militärischen Nutzen eingebüßt hatte, diente die ehemalige Festung während der Unabhängigkeitskriege als Gefängnis. Jetzt ist sie nur noch Museum und Touristenmagnet, mitunter auch märchenhafte Kulisse für die Fotoshootings von Hochzeitspaaren oder Mädchen, die hier an ihrem fünfzehnten Geburtstag, der fiesta de quinceañera, in kostbarer Robe fotografiert und gefilmt werden, ganz wie echte Bräute.
Im Halbdunkel bewegt sich ein Mann über die hölzerne Brücke, die über einen Graben zum Haupteingang führt. Federnd sind seine Schritte, voller Energie. Kurz hält der Mann inne, wirft einen Blick in den Abgrund unter sich. Rechts neben dem Tor sind Felsblöcke in die Mauer verbaut, und eben dort macht der Mann sich zu schaffen. Wieder in aufrechter Position, hält er einen großen Schlüsselbund in der Hand. Er wählt einen Schlüssel, steckt ihn in das rostige Schloss. Das Gekreische von Metall auf Metall und ein lang gezogenes Quietschen sprengen die morgendliche Ruhe.
Der Mann zieht das Tor hinter sich zu und durchquert den Raum, der sich unter einem fünfhundert Jahre alten Tonnengewölbe erstreckt. In Bälde werden hier Bedienstete Eintrittskarten ausstellen und den Besuchern versichern, leider über keinerlei Wechselgeld zu verfügen. Eine Etage tiefer findet sich das Modell der Festung, daneben Schautafeln zur Geschichte derselben. Einer langen, erfolgreichen Geschichte, denn niemals wurde diese Festung von Feinden erobert.
Sämtliche Türen werden von dem Mann routiniert geöffnet; kein Zweifel, er ist mit allem hier vertraut. Just als er in den Innenhof gelangt, fällt der erste Sonnenstrahl über die hohe, mit Zinnen bestückte Mauer. Der Mann durchmisst den Hof, dann steigt er eine steinerne Treppe hoch und sperrt eine letzte Tür auf. Hinter ihr liegt eine kleine quadratische Kammer, in der es kein Mobiliar gibt, keinerlei Dekor. Nur eine kleine Steintafel, eingelassen im gepflasterten Boden, erinnert an die ursprüngliche Bestimmung dieser fensterlosen Zelle: Hier wurde einst gefoltert. Gebrandmarkt, geblendet, gemordet.
Hinter Mauern, zu massiv, als dass je ein Schrei sie durchdrungen hätte.
Im Zentrum des Quadrats lässt der Mann sich nieder. Reglos, mit kerzengeradem Rücken, verharrt er eine Weile in dieser Position. Dann zückt er einen weiteren Schlüssel, mit dem er das Schloss einer schweren, eisernen Bodenklappe öffnet. Als er die Klappe anhebt, verrät deren grässliches Quietschen, dass die Scharniere seit einer Ewigkeit nicht geschmiert wurden.
Und noch etwas anderes ist zu vernehmen: Erstickte Hilferufe, aus modriger Tiefe. Auf Englisch und mit einem eindeutig amerikanischen Akzent.
Der Mann lässt sich davon nicht beeindrucken. Er nimmt den leinenen Sack von seinem Rücken, befestigt ein Seil daran und lässt den Sack hinab in das schwarze Loch. Ein unangenehmer Geruch liegt in der Luft, eine Mischung aus Moder und Exkrementen. Was soll’s!, ermahnt er sich, an ein bisschen Gestank ist noch keiner gestorben. Und endet nicht selbst das opulenteste Mahl über kurz oder lang als Scheiße?
Zwieback und ein Stück Käse hat er mitgebracht, außerdem eine große Flasche Mineralwasser. Letztere zu organisieren war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In diesem Land herrscht doch immerzu Mangel, zurzeit eben an Mineralwasser. Nicht, weil keines produziert würde, sondern weil die Vermieter von Privatwohnungen tonnenweise Mineralwasserflaschen hamstern, um sie ihren Gästen später zu völlig überhöhten Preisen verkaufen zu können. Gangster, Mafiosi allesamt, genau wie vor der Revolution! Weshalb sich ein einfacher Kubaner so schwer tut, seinen täglichen Flüssigkeitsbedarf zu decken.
Und den seines Gefangenen. Der schließlich nicht verdursten darf!
Sonst wäre wohl alles umsonst.
1
Erst als die Stewardess sie fragt, ob sie das leere Fläschchen und den Plastikbecher abräumen dürfe, man befinde sich nämlich bereits im Sinkflug, wird Frieda bewusst, dass dies gerade ihr erster Schnaps seit fast zwei Jahren war.
Vierzigprozentiger Alkohol aus einer karibischen Destillerie. Ein Prozent für jeden Jahresring einer gewissen Frieda Prohaska.
Die zwei Deziliter Rum hätte sie bei ihrem ersten Kubaflug locker weggesteckt. Aber sie ist das goldbraun schimmernde Zeug nicht mehr gewohnt. Wie auch! So clean, wie sie die ganze Schwangerschaft und das knappe Jahr danach hinter sich gebracht hat. Nun, da das Flugzeug in leichte Turbulenzen gerät, spürt sie, wie der Alkohol im Blut sie ein wenig abdriften lässt, geistig beziehungsweise seelisch. Wer will das schon so genau auseinanderhalten …
Keinen Monat ist es her, dass sich der kleine Erzengel davongemacht hat. Rafael, der geborene Flüchtling. Flüchtiger als die unbeständigste aller organischen Verbindungen. Der sie allein zurückließ in ihrem Waldviertler Exil, in windzerzauster Steinheide. Dabei hatte sie, die alte Abtreiberin, die Fremdgeherin, ihn so ins Herz geschlossen! Nach einer einzigen Nacht auf der Matte eines indischen Yogi war sie in den Fruchtgenuss gekommen, wie sie ihre ungeplante Schwangerschaft ironisch nannte. Und die sie, nach Wochen des Zweifelns und Mit-sich-Ringens, schließlich annahm; nicht zuletzt, weil Leo sie dabei unterstützte. Qué alegría – welche Freude! Hieß so nicht ein Album des John McLaughlin-Trios aus den frühen Neunzigerjahren, mit One Night Stand als dem Top-Track darauf? Eingespielt unter Mitwirkung von Trilok Gurtu, dem himmlischsten aller Perkussionisten. Auch ein Inder.
Ja, welche unglaublichen Glücksgefühle, welch nie gekannte Nähe! Der schiere Duft des Kleinen, sein Gluckern beim Wechseln der Windel. Hätte ihr vorher einer gesagt, dass Windelwechseln Spaß machen kann, sie hätte ihn ausgelacht. Aber mit einem Schlag befand sie sich selbst in der Schleife: Du du du du! oder Ja, was macht denn mein Putzi, ja was macht es denn? Zerfließend beim Genießen seiner ersten Silben, seiner ersten Gehversuche. Bis ihr dann, über Nacht, der große Knöcherne ein weiteres Mal seine dürre Rechte auf die Brust legt. Eine Metapher, die Jahr für Jahr auf dem Salzburger Domplatz zur Schau gestellt wird und doch nichts von ihrem Schrecken verloren hat: die archaische Geste, das tief verankerte Zeichen. Es vermag frau – egal, wie modern sie sich gebärdet – heute ebenso zu brandmarken wie den Jedermann im uralten Spiel vom Leben und Tod.
Rafi verschwand ebenso schnell, wie er auf diesem Planeten gelandet war. Als sei er herabgestiegen zu ihr, aus irgendwelchen Wolken direkt auf sie geplumpst, um selig nuckelnd an ihrer Brust zu liegen; für alle Zeiten, wenn es nach ihr gegangen wäre.
Aber es ging nicht nach ihr. Natürlich nicht.
Ging es das je?
Gerade einmal elfeinhalb Monate hat es gedauert, bis er zurückkehrte in seine Wolke.
Rafael, Wolkenkind!
Was genau es mit dem plötzlichen Kindstod auf sich hat, hat man ihr nie schlüssig erklären können. Aber selbst wenn: Was hätte es geändert? Was bringen rationale Begründungen, wenn es um dein Empfinden geht? Nimmt es dir nur ein Jota deiner Trauer?
Mangels klarer Erkenntnisse verwies man auf Statistiken und Listen von Risikofaktoren: das besonders gefährliche erste Lebensjahr; die Risikogruppe der Spätgebärenden und nicht stillenden Mütter; die besonders gefährliche Bauchlage und und und. Im Nachhinein kannst du dir alles herunterladen und dir ausmalen, was auf dich zutrifft …
Spätgebärende – durchaus.
Verzicht aufs Stillen – ganz und gar nicht.
Passivrauchen seitens des Säuglings – nein!
Schlafen im separaten Zimmer – zugegeben.
Aber wie all das berechnen, wie diese Mixtur von Zutreffendem und Nicht-Zutreffendem in eine Gesamtrechnung einspeisen? Ergibt es am Ende einen Quotienten, der die immer im Raum stehende Frage der Schuldzuweisung löst?
Wenn einen der Tod so verfolgt durch all die Jahrzehnte, musst du ihn als Partner akzeptieren lernen und ihm zuzwinkern, wie einem alten Freund. Hat sie sich das nicht schon mehrmals geschworen?
Es begann mit Mutters Suizid, ausgeführt mit dem eigenen Schnitzelmesser. Dann die Ermordung ihres Kollegen Lussnig in Indien. Und schließlich Leos Unfalltod, kurz nachdem er erklärt hatte, er werde sich wie ein Vater um das damals noch Ungeborene in ihrem Bauch kümmern, auch wenn es nicht von ihm sei. Was stammt schon originär von uns? Was zeugen wir tatsächlich mit unserem Samen? Das sagte er in seiner letzten Nacht, in ihren Armen. Bevor ein Betrunkener ihn auf einer gottverlassenen Landstraße im Waldviertel von der Straße abdrängte und Leos Hirn sich auf einem Baumstamm verteilte, der als einziger einer ganzen Allee nicht gefällt worden war. Absurd, unfassbar! Ähnlich unfassbar wie der Tod des Schriftstellers Horváth, der, mitten in der Großstadt Paris, von einem herabfallenden Ast erschlagen wurde.
Tragische Zufälle?
Nein: Nichts ist jemals zufällig …
Wo hat sie diesen Satz gelesen? Genau, in dem schmalen Roman des Guineers Tierno Monénembo über seine kubanischen Wurzeln.
Nichts ist jemals zufällig auf Kuba.
*
Schade, dass sie den Verkauf von Duty-Free-Artikeln im Flugzeug eingestellt haben, sie hätte gerne ein Fläschchen Hochprozentigen erworben! Natürlich gäbe es auch in Holguín Rum zu kaufen, man müsste nur wissen wo. Aber in knapp zwei Stunden will sie sich in der Casa de la Trova ja bereits mit Fermín treffen, da wird sich ein Einkaufsbummel schwerlich ausgehen.
Fermín vulgo Fidelito, der kleine Fidel, wie Frieda ihn insgeheim getauft hat. Weil er sich genau so gerne reden hört wie ein gewisser, um einen Kopf größerer, Revolutionsführer. Castro wusste immer, was das Schicksal – nein: das Rad der Geschichte! – für Kuba vorherbestimmt hatte. Unser Stolz hat uns vom Sklaventum befreit. Dieses Zitat ist tatsächlich auf Fermíns Mist gewachsen, aber es würde auch gut zu dem großen Bärtigen passen, der in seinen unzähligen Redemarathons zu ähnlichen Schlussfolgerungen kam. Aus seinem Munde wäre der Spruch sicher zum Klassiker geworden. Jedenfalls bei all den gläubigen Kommunisten, die jahrzehntelang kritiklos an seinen Lippen hingen.
Nun ja, Fidel Castro Ruz wird künftig keine Sprüche mehr von sich geben. In einer hölzernen, mit der kubanischen Fahne drapierten Kiste, kleiner als der Sarg eines Kleinkindes, wird seine Asche zurzeit in einem Konvoi durchs Land gefahren. Karawane der Freiheit, so nannte man 1959 den triumphalen Einzug der siegreichen Revolutionstruppen in Havanna. Siebenundfünfzig Jahre später rollen die Militärfahrzeuge in umgekehrter Richtung, also von der Hauptstadt über Santa Clara und Holguín nach Santiago de Cuba, um den toten Comandante en Jefe zu seiner letzten Ruhestätte zu geleiten.
In gewisser Weise ist diese Reise eine Folge von Rafaels Tod, davon ist Frieda überzeugt. Nie wäre Fillinger sonst auf die Idee gekommen, ausgerechnet sie, die Freelancerin, mit dem Auftrag zu betrauen. „Du warst als Einzige von uns schon zwei Mal in Kuba“, lautete sein Argument während der Themenkonferenz. Sie wusste, dass es sich dabei um einen Vorwand des Chefredakteurs handelte, der ihre Situation kannte und es gut mit ihr meinte. Zwei Tage rang sie mit sich, dann stimmte sie zu. Vielleicht war Fillingers Angebot ja tatsächlich eine Chance, die kalte, knöcherne Hand auf ihrer Brust abzuschütteln?
Alles war besser, als in Wien oder im Waldviertel vor sich hin zu brüten, ausgesetzt den mitleidigen Blicken der Kollegenschaft, der Freunde und Verwandten. Fillinger hörte kein Danke von ihr. Doch sie sah ihm an: Er verstand, dass sie verstanden hatte …
„Eine gediegene Hintergrundreportage für opinion über die derzeitige Situation auf Kuba, basierend auf persönlichen Eindrücken und Gesprächen mit einfachen Leuten. Und bloß keine Statements von Parteibonzen!“
Genau so lautete sein Auftrag.
„Am besten, du hältst dich fern von Havanna“, riet ihr Fillinger, „die Meinung der Wiener ist schließlich auch nicht repräsentativ für die der Österreicher!“
Dass eine tiefschürfende Recherche abseits ausgetretener Pfade für eine offiziell akkreditierte Journalistin schwieriger sein würde als für eine anonym Reisende, war sowohl Frieda als auch dem Chefredakteur klar.
Andererseits hat ein Presseausweis auch gewisse Vorteile.
„Letztlich musst du selbst entscheiden, ob du als Reporterin oder als Touristin unterwegs sein willst“, sagte Fillinger und schürzte die Lippen. „Solltest du auffliegen, können wir dir von hier aus kaum helfen.“
Die Entscheidung, auf eine Akkreditierung zu verzichten, fiel ihr dennoch leicht.
Es wäre nicht schwierig gewesen, anlässlich der Beisetzung von Fidel Castro auf die Schnelle ein provisorisches Visum zu bekommen, womit sie sich unmittelbar nach Einreise beim CPI, dem Centro de Prensa Internacional, hätte melden müssen, um einen Presseausweis zu erhalten. Es gibt auf Kuba nur dieses eine Pressezentrum, und es befindet sich in der Nähe des Hotels Nacional in Havanna. Das Einhalten des Amtswegs hätte bedeutet, dass ihr die umgekehrte Karawane der Freiheit mit Fidels Urne in jedem Fall entgangen wäre, war diese doch längst unterwegs zu ihrer finalen Destination.
Wichtiger noch: Einer offiziell registrierten Journalistin würde man viel genauer auf die Finger schauen als einer Touristin. Wenn sich die Situation seit ihrem letzten Kubabesuch auch deutlich entspannt hat, was die Überwachung von Ausländern betrifft, will sie sich gewiss nicht von irgendwelchen sogenannten Betreuern vorschreiben lassen, wie, wo und was sie zu recherchieren hat!
„Nachdem du eh keinen Presseausweis benötigst, habe ich dir einen Flug über Frankfurt nach Holguín gebucht. So sparst du dir den Inlandsflug und kommst locker zu Fidels Begräbnis zurecht.“
Sagte Chefredakteur Fillinger und verabschiedete sich mit einer Umarmung.
*
Sanft setzt die Maschine auf. Frieda atmet tief durch: ihre dritte Landung auf kubanischem Boden!
Diesmal wird sie nicht, wie 2009 bei ihrem ersten Besuch, das Spanischwörterbuch im Flugzeug vergessen. Und sie wird sich hüten, wie 2012 in jene Fallen zu tappen, die diverse Überlebenskünstler für allzu naive Touristen aufstellen.
Vor vier Jahren bereiste sie die Insel als Teil einer österreichischen Delegation, die hauptsächlich aus Kommunisten bestand, oder zumindest aus klaren Sympathisanten der kubanischen Revolution. Aus Leuten, die schon containerweise gesammelte Hilfsgüter nach Kuba geschickt hatten. Was den unschätzbaren Vorteil hatte, dass die Delegation Zutritt zu Fabriken, Schulen, Krankenhäusern und Gewerkschaftseinrichtungen hatte, in die man sonst schwerlich gekommen wäre. Ein gewisser Fermín Ochoa leistete ihnen damals als Übersetzer gute Dienste. Er übersetzte auch jene Fragen Friedas, die die anderen als ungehörig, weil zu kritisch, empfanden. Jedenfalls erhielt sie so Einblicke in die kubanische Infrastruktur, die ihr hoffentlich auch bei diesem Auftrag helfen würden.
Um flexibel zu sein, hat sie nur das Quartier für die erste Nacht in Holguín reserviert. Ihre Spanischkenntnisse sind mittlerweile solide genug, um sich alleine durchschlagen zu können. Abgesehen von einigen wenigen Fixpunkten möchte sie spontan entscheiden können, wohin der Weg sie führen soll. Dass die Reise in Holguín beginnt, passt gut, denn den Osten Kubas kennt sie kaum, so lernt sie neue Gegenden kennen. Auch der vage zeitliche Rahmen, den der Chefredakteur vorgab, hat zu ihrer Entspannung beigetragen: Zwei bis vier Wochen, Frieda, das kannst du selbst bestimmen. Hauptsache, wir bekommen ordentliches und originäres Material von dir.
Er sagte originär, nicht originell!
Sie legt den Gurt ab und streckt ihre Glieder. Kuba, ich komme, flüstert sie – aquí estoy de nuevo.
Als sie hinaustritt auf die Gangway, hüllt eine wohlige Wärme sie ein. Und das am 1. Dezember! Yes, we can!, kommt ihr in den Sinn, Obamas euphorischer Wahlslogan von 2008. Wenn auch dieses Wir-Gefühl sich am Ende als Illusion erweisen sollte.
Wie auch immer: Für ein paar Wochen wird sie der klirrenden Kälte des Waldviertels entkommen, ebenso wie dem graubraunen Matsch auf dem Wiener Gürtel …
*
Alle Passagiere haben die Maschine verlassen. In der Ankunftshalle warten sie in vier langen Reihen darauf, abgefertigt zu werden. Eine halbe Stunde steht Frieda nun schon am Ende von Schlange Nummer drei, doch sie scheint nicht kürzer zu werden. Ausgestattet mit einer provisorischen Einreiseerlaubnis für Journalisten wäre diese Prozedur in Havanna vermutlich kürzer ausgefallen. Was soll’s, denkt sie: Vielleicht dient dieses Prozedere ja weniger der Sicherheit als dazu, sich von Anfang an mit jener Eigenschaft vertraut zu machen, die hierzulande überlebenswichtig ist: widerspruchslos warten, ausharren zu können. Warum nicht die Wartezeit nutzen, um sich auf die Kontrolle vorzubereiten? Immer hübsch neutral dreinschauen, ermahnt sie sich, nicht lächeln oder gar auf ironisch machen, das vertragen Grenzbeamte nirgendwo. Erst recht nicht hier, wo jeder Einreisende den Behörden als potenzieller Spion gilt, der womöglich im Sold des amerikanischen imperio steht.
Endlich wird sie in den Verschlag gewunken, wo die Überprüfung der Personalien stattfindet. Dort wird sie erst einmal angeherrscht.
„Einen Schritt zurück!“
Der junge Mann hinter der Glasscheibe sieht eigentlich gut aus, seine Uniform sitzt, als wäre sie maßgeschneidert. Doch seine Augen sind kalt, abweisend. Sie begreift, dass man sie gerade fotografiert oder filmt und dass das Kameraobjektiv sie nur in einem bestimmten Winkel richtig erfassen kann. Der Zöllner hält ihren Pass in der ausgestreckten Hand, als wäre er weitsichtig, mit seinen Augen scannt er ihr Bild. Ein ums andere Mal geht sein Blick vom Dokument hoch zu ihren Augen und zurück. Vielleicht, weil sie auf dem Foto noch eine andere Frisur hat?
„¡Un momento!“
Er erhebt sich, verschwindet aus der Kabine. Scheiße, der wird doch jetzt nicht spinnen und sie hier rösten lassen, während er sich eine Zigarette genehmigt! Sie spürt, wie der Schweiß ihr die Bluse verklebt. Wenige Sekunden später kehrt der junge Beamte in Begleitung eines älteren Uniformierten in das Kabäuschen zurück.
„¿Es … Usted?“
Der Ältere, ein ziemlich voluminöser Afrokubaner, dessen Uniformjacke trotz der Hitze bis oben hin zugeknöpft ist, stellt die Frage schärfer als nötig.
„Sí, señor.“ Wie dünn, wie kleinlaut ihre Stimme klingt! Sie räuspert sich, um die Kehle frei zu kriegen.
„Pero su pelo …“
„Das Passfoto ist schon ein wenig älter. Aber hier, auf dem Visum, sehen Sie … Da trage ich die Haare wie jetzt.“
„Die Fotos in Visum und Pass müssen übereinstimmen. No están en orden! Sie verstehen mich doch, oder?“
Natürlich versteht sie ihn. So tadellos und scharf, wie er artikuliert.
„Nun, eine Frau ändert schon mal ihre Frisur oder die Haarfarbe. Das wird in Kuba nicht anders sein, oder?“
Verdammt, wollte sie nicht jede Ironie vermeiden! Doch wider Erwarten hellt sein Blick sich auf.
„Da haben Sie recht, señora, da haben Sie allerdings recht.“ Er flüstert seinem jungen Kollegen etwas ins Ohr, das sie nicht versteht. Wie auf Kommando lachen beide drauflos. Es ist ein derbes Männerlachen, das ebenso abrupt endet, wie es begonnen hat.
„¿Profesión?“, fragt er, nun wieder ganz der korrekte Beamte.
„Künstlerin“, sagt sie, „Malerin und Fotografin.“
„Okay. Und wohin soll Ihre Reise Sie führen?“ Wieder ist es der Ältere, der sie anredet. Offensichtlich hat er jetzt völlig das Kommando übernommen.
„Hauptsächlich in den Osten“, sagt sie wahrheitsgemäß. „El Oriente. Santiago, Guantánamo, Baracoa. Diese Ecke Ihres schönen Landes habe ich bei meiner letzten Reise vor vier Jahren nämlich nicht besuchen können.“
„Vor vier Jahren?“ Die Stirn des Uniformierten legt sich in Falten. „Wegen Sandy womöglich?“
„Genau, wegen des Hurrikans. Damals war es ja Touristen nicht erlaubt, Santiago zu besuchen.“
„Stimmt. Wir haben es nicht so gern, wenn uns die Leute beim Aufräumen im Weg stehen. Erst recht nicht, wenn ein Supersturm alles verwüstet hat.“
„Wobei Kuba, wie alle Welt weiß, bedeutend besser für solche Notfälle gerüstet ist als alle seine Nachbarn, inklusive der Vereinigten Staaten.“
Einen Augenblick lang fürchtet sie, mit ihrem Lob gar zu dick aufgetragen zu haben. Auch wenn sie tatsächlich denkt, dass Kuba in Sachen Hurrikan-Frühwarnung vorbildhaft ist. Doch ihre Angst ist unbegründet: Er wirft ihr einen Blick zu, als habe sie ihm gerade ein persönliches Kompliment gemacht. Dann bedeutet er seinem Kollegen, ihr den Pass zurückzugeben.
„¡Bienvenida a Cuba!“, sagt er in einem merklich wärmeren Tonfall. „Genießen Sie Ihren Aufenthalt und grüßen Sie mir Santiago. Ich bin nämlich selbst ein Santiaguero. Direkt aus der Wiege des Son und der Revolution.“
Sie atmet tief durch. Darf sie jetzt endlich raus aus dieser miefigen Kabine? Die Bluse klebt ihr an der Haut, es ist einfach ekelig hier drinnen.
„Oh, ist das da Ihre Kameratasche, señora?“
Sein fachkundiges Auge hat den kleinen roten Rucksack als das identifiziert, was er ist: eine Kameratasche, die nicht gleich jedem potenziellen Dieb ins Auge springt.
Sie nickt.
„Darf ich mal sehen?“
Sie reicht ihm den Rucksack. Vorsichtig, fast ehrfürchtig zieht er die schwere Nikon mit dem aufgesetzten Teleobjektiv heraus. Auch wenn sich opinion, wie die meisten Journale, längst keinen eigenen Fotografen mehr für die Bebilderung der Reportagen leistet – beim Equipment wenigstens lässt man sich nicht lumpen und setzt auf professionelle Modelle und Originalobjektive, die sich auch eine Freelancerin wie Frieda ausleihen darf.
„Sehr schön.“ Der Schwarze nickt anerkennend. „Und sehr teuer, wenn mich nicht alles täuscht.“
„Gebraucht gekauft“, lügt sie. „Aber man kann recht ordentliche Bilder damit schießen. Die Sonnenuntergänge am Strand von Siboney sollen ja traumhaft sein, nicht wahr?“
Seine Antwort ist ein abgründiges Lächeln.
„Ein Dreihunderter-Tele?“
„Ein Vierhunderter.“
„Besitzer solch großer Objektive interessieren sich oft für andere Motive als Sonnenuntergänge“, flüstert er. Direkt in ihr Ohr.
„Ich verstehe nicht ganz“, stellt sie sich dumm. Wie es jetzt wohl um ihren Teint bestellt ist? Doch er gibt ihr kommentarlos die Tasche zurück. Winkt sie durch, alles ist gut. Nur der Blick des jungen Beamten ist noch immer gleich dunkel, gleich abweisend. Offenbar muss er sich erst seine Sporen im Kampf gegen etwaige Feinde der Revolution verdienen.
„Und beachten Sie die Tafeln mit der durchgestrichenen Kamera darauf!“, ruft der Ältere ihr nach. „Wäre doch jammerschade, wenn ein compañero Ihre hübsche Ausrüstung kassieren würde.“
Frieda deutet mit ihrer freien Rechten ein Winken an. „Claro que sí“, sagt sie, mehr zu sich als für ihn bestimmt.
Die Sonne steht schon tief, die Menschen werfen lange Schatten auf dem orangefarbenen Linoleumboden. Frieda gesellt sich zur Masse der Wartenden entlang der quietschenden Förderbänder in der Gepäckausgabe. Übernächtig und müde harrt man der schweren Koffer, die einen, zusammen mit der Kreditkarte, als Vertreter einer anderen, reicheren Welt ausweisen.
Ich darf nicht vergessen, noch genügend Geld zu wechseln, bevor ich mir ein Taxi suche, denkt Frieda. Und, nicht zu vergessen, schleunigst eine Telefon- und Internetkarte zu besorgen. Ohne die läuft in Kuba gar nichts, sofern man sich nicht darauf versteht, illegal Leitungen anzuzapfen.
Aber auf so etwas würde sich eine inkognito reisende Journalistin ohnehin nicht einlassen.
*
Fidel siempre.
In knalligem Rot leuchten die beiden Worte auf dem überdimensionalen Plakat. Auf ewig Fidel. Darunter ein Porträt Castros. Der Fotograf hat sich nicht bemüht, den Verfall des ewigen Führers zu kaschieren. Die olivgrüne Militärkappe auf dem greisen Haupt: eine unfreiwillige Karikatur: Selbst im hohen Alter von neunzig darf er nicht lockerlassen. Muss den Agilen mimen, den Unerschütterlichen. Wobei er Letzteres vielleicht ja tatsächlich geblieben ist, bis zu seinem letzten Atemzug.
Aus heiterem Himmel fällt ihr die schreckliche Diskussion ein, die vor zwei Jahren in einem ayurvedischen Wellnessresort stattfand. Leo und sie beim Abendessen, ihnen gegenüber ein amerikanisches Pärchen, das nicht müde wird zu betonen, wie paradiesisch es hier doch sein könnte. Wenn man bloß etwas aufräumen würde. Die Scheiße vom Strand entfernen, zum Beispiel, oder die streunenden Hunde einfangen und irgendwo entsorgen, irgendwie. Der Garten Eden nach amerikanischer Vorstellung.
Sie und Leo sahen sich vielsagend an, schwiegen die längste Zeit. Jedenfalls so lange, bis der Reisschnaps, den sie vor dem Essen heimlich gekippt hatte, seine Wirkung zeigte und sie sich nicht mehr zurückhalten konnte.
„Sie meinen wohl so sauber wie in Kuba unter Batista oder wie in Panama unter Noriega oder in Nicaragua unter Somoza? Mit hygienisch einwandfreien Spielkasinos und Bordellen für die Reichen, beschützt von der CIA oder von Mafiabossen oder der United Fruit Company?“
Was eine längere, ziemlich sinnlose Debatte zur Folge hatte. Obwohl Leo sie vermutlich nur beruhigen wollte, gewann sie mehr und mehr den Eindruck, er würde die Amis verteidigen. Jedenfalls fühlte sie sich nicht wirklich unterstützt von ihm. Am Ende artete die Diskussion aus in einen bösen Streit zwischen Leo und ihr. Etwas begann – diffus, aber heftig – in ihr zu wüten, während er, mit seinen wie immer ruhig vorgetragenen Argumenten, zu verbergen suchte, wie er ihren Rückfall verabscheute. Besoffen während der Reinigungskur! Sie spürte, wie sie sich zunehmend von ihm entfernte, was aber beide nicht zu thematisieren wagten. Längst war das eigentliche Thema gegessen, das amerikanische Pärchen schmollend in seinem Apartment verschwunden. Es ging nur mehr um das lautstarke Ausleben der jeweiligen Frustration.
Am Ende war sie aus dem Wellnessresort geflüchtet und hatte sich in der Gartenlaube der benachbarten Anlage einem Yogalehrer an den Hals geworfen.
Der, ohne es jemals zu erfahren, neun Monate später zu Rafaels Vater werden sollte.
2
Er blickt aus dem Fenster, wie jeden Tag, wenn er frühstückt. Wenn es denn etwas zu beißen gibt.
Es ist ein Blick in eine unscharfe Ferne. Auf geborstenen Beton, auf die kläglichen Reste einer Mietskaserne. In der seine Eltern ihre letzten Tage verbracht hatten. Wo sie erschlagen wurden, erschlagen vom langen Arm der Vereinigten Staaten, wie der Santero es bei ihrer Beisetzung ausdrückte. Natürlich war damit die jahrzehntelange Handelsblockade Kubas durch die Yankees gemeint. Jenes Verbrechen, das die Kubaner entlastet von den eigenen Sünden. Wobei: auf die Schnelle erschlagen oder langsam erstickt im Staub der Armut – was macht es am Ende für einen Unterschied?
Für seine Eltern wie für Tausende andere auch …
Das Maß an Lebenserfahrung hängt davon ab, wie viele liebe Menschen man schon zu Grabe getragen hat.
Von wem, bitte, stammt dieser weise Spruch?
Es ärgert ihn zu sehen, wie die Tasse in seiner Rechten zittert – als wäre er ein Tattergreis! Ein bisschen etwas von der dünnen braunen Flüssigkeit schwappt über, verbrüht ihm den Handrücken. Ist das wirklich dieselbe Faust, mit der er es schaffte, Jugendmeister in seiner Provinz zu werden, an die Boxakademie in Holguín zu kommen? Die Tasse: ein Geschenk seines Vaters. Der behauptete, sie von Teófilo Stevenson höchstpersönlich erhalten zu haben; für irgendeinen Dienst, den er dem großen Champion einmal erwiesen hatte. Angeblich …
Trink nur recht oft aus dieser Tasse, hieß es immer, damit du wirst wie er: ein Großer, ein Held! Einer, der aus Niederlagen gestählt hervorgeht.
Elf Mal kubanischer Meister und dreifacher Olympiasieger – was mehr soll man dazu sagen? Höchstens dies: dass Stevenson trotz vieler Angebote nie sein Land verriet. Die Amerikaner boten ihm Millionen, eine Profikarriere. Er verzichtete darauf. Fidel hatte den Profisport auf Kuba nun einmal verboten, und Teófilo klagte nicht. Blieb der, der er war: ein Amateur mit professioneller Einstellung. Teófilo Stevenson wusste, was er, der Afrokubaner, der Nachfahre von Sklaven, Fidels Revolution verdankte.
Was ist eine Million Dollar gegen acht Millionen Kubaner, die mich lieben?, soll er gesagt haben. Das imponierte Vater.
„Siehst du, Sohn, so verhalten sich Helden!“
Gegen Ende, als Vater ein bisschen wunderlich wurde, verwendete er solche Phrasen immer öfter. Sein Sohn konnte das Geschwätz von den Helden der Revolution schon nicht mehr hören, von orgullo, Stolz, und patria o muerte, Vaterland oder Tod. Aber was willst du machen, wenn dein Vater sentimental wird, senil? Wenn er Sachen aufführt, für die er sich ein paar Jahre zuvor noch geschämt hätte?
Eines Tages besorgte sich Paco Rivera Santos, der alte Kommunist, doch tatsächlich eine Keramikstatue von Babalú Ayé, wie der heilige Lazarus bei den Anhängern der Santaría genannt wird. Zuvor hatte Vater mit orishas, den afrikanischen Göttern, nie etwas am Hut gehabt. Okay, hatte er wahrscheinlich auch dann nicht, jedenfalls nicht so, wie ein Christ sich das mit dem lieben Gott vorstellt. Babalú Ayé mit seiner farbenfrohen Kleidung wirkte einfach beruhigend auf sein Gemüt. Die Figur stand auf einem kleinen Altar in einer Ecke des einzigen Raums, wo gegessen, gearbeitet und geschlafen wurde, seit Neuestem auch gebetet. Babalú Ayé sei nicht nur für die Heilung von Krankheiten wie Pocken und Lepra zuständig, erzählte der Vater, sondern ebenso für Wunder im materiellen Bereich. Darum flehte der ehemalige Atheist ihn auf Knien an, doch bitteschön eine neue, angemessenere Wohnstätte aufzutreiben für einen verdienten Frontkämpfer wie ihn. Was Lazarus alias Babalú Ayé natürlich nicht fertigbrachte; oder auch verweigerte, wer will das schon wissen.
Also begann er sich nach einem neuen Quartier für die Eltern umzusehen, über Monate hin und am Ende sogar erfolgreich – scheinbar wenigstens. Ein Freund hatte ihm gesteckt, dass im sogenannten Roten Bunker auf der Nordseite der Stadt eine Wohnung seit über einem Jahr leer stehe. Es hätten sich in dem Block schon andere ohne Erlaubnis der Behörde einquartiert. In anderen, kapitalistischen Ländern werde so etwas als Hausbesetzung bezeichnet. Er fand das übertrieben: Mit Geduld und Spucke würde – das zeigte die Erfahrung – der Zustand schon irgendwann legalisiert werden. Es kam nur darauf an, den längeren Atem zu haben. Auf jeden Fall würde es dort besser sein als in der elenden Wellblechhütte, in der Vater und Mutter hausten wie Tiere. Die hatte nicht einmal einen Estrich, geschweige denn ein gemauertes Fundament, beim geringsten Regen wurde sie regelmäßig überschwemmt. Sandy, der Hurrikan von 2012, gab ihr den Rest. Der Staat investierte eine Menge in den Wiederaufbau Santiagos. Aber Blechhütten, die irgendwo am Stadtrand illegal errichtet worden waren, fielen natürlich nicht unter dieses Programm. Für sie wurden auch keine Arbeitsbrigaden organisiert, die andernorts mit sozialistischem Eifer dabei halfen, zerstörte Häuser wieder instand zu setzen, und das unbezahlt und in der Freizeit.
Im Grunde war der Rote Bunker abbruchreif, als seine Alten in die Wohnung Nummer 23 im dritten Stock einzogen. Ein Quartier, in dem keine Fensterscheibe mehr heil war und die Fußböden Löcher aufwiesen, größer als die im uralten Moskwitsch, den der Vater fuhr. Wenn man die billigen Fetzen wegzog, die sie verbargen, konnte man direkt in die Wohnung darunter schauen. Zu hören war das, was dort vor sich ging, ohnehin ständig, aber man war es ja gewohnt, über wenig Privatsphäre zu verfügen. Auch die Wände wiesen dreieckige Öffnungen auf, die man aber absichtlich eingebaut hatte; sie dienten dazu, Frischluft hereinzulassen, damit in der Regenzeit nicht alles verschimmelte. Es dauerte eine ganze Weile, bis er es schaffte, seinen Vater von den Vorteilen der betonierten Bleibe zu überzeugen. Strom für Licht und Kochen konnte man mit wenig technischem Know-how von einem nahen Verteiler abzweigen, so machten es alle im Viertel. Die Polizei schaute weg, was sonst hätte sie tun sollen. Der Vater nörgelte zwar noch eine Weile herum, weil er die Freunde in seinem barrio vermisste, mit denen er immer auf der Straße Domino gespielt hatte. Am Ende sah auch er ein, dass es keine Alternative gab. Und die Mutter war ohnehin überglücklich: Endlich verfügte sie, erstmals, über eine eigene, wenn auch winzige, Küche.
Er half den Eltern dabei, die Wände neu zu streichen, die Löcher im Fußboden zu stopfen und die Bude mit dem nötigsten Inventar auszustatten. Als sie endlich alles beisammenhatten, rumpelte die Erde. Nur ein kleines bisschen, nichts im Vergleich zu einem richtigen Beben. Aber es reichte, um die Wohnungsdecke von Nummer 23 zum Einsturz zu bringen. In der Parteizeitung Granma hieß es später, es sei nur der soliden sozialistischen Bauweise zu verdanken gewesen, dass nicht der gesamte Rote Bunker flachgelegt wurde.
Das bekamen seine Eltern wenigstens nicht mehr zu lesen.
3
Fermíns Anschrift hat Frieda gut versteckt, auf Fermíns ausdrücklichen Wunsch hin.
„Muss ja nicht ein jeder wissen, dass ich mich mit einer Ausländerin treffe“, hatte er im letzten Telefonat gemeint. „Wäre nicht so gut, wenn sie ein Foto von mir bei dir fänden. Und schon gar nicht die Adresse meiner Wohnung, die gebe ich dir nur für den Notfall. Am besten, wir treffen uns am Abend deiner Ankunft in der Casa de la Trova, die ist leicht zu finden. Dort fällt es auch nicht auf, wenn wir miteinander quatschen.“
Eine Stunde wartet sie nun schon auf ihren Fidelito, und wacker hat sie sich bisher jeglichen Alkohol verbeten. Was insbesondere in diesem Schuppen alles andere als leicht fällt, wo der Cuba Libre in annähernd derselben Dosis konsumiert wird wie Bier im Münchner Hofbräuhaus. Und ob im eisgekühlten Longdrinkglas der Rum oder die Cola die Oberhand hat, wissen die Götter. Jedenfalls scheinen nicht mehr viele im Publikum nüchtern zu sein. Insbesondere die älteren ausländischen Männer, die hier von den kubanischen Mädchen um Drinks angebettelt werden, fallen bereits deutlich durch ihre Lautstärke und dummen Sprüche auf.
Immer wieder wandert Friedas Blick zur offenen Tür des Lokals, durch die ständig Leute herein- und hinausströmen, doch von Fermín keine Spur. Ob er auf den Termin vergessen hat? Auf ihren Anruf vor einer halben Stunde hat er auch nicht reagiert. Andererseits: Wenn er gerade auf dem Weg war, konnte er, der nur über ein Festnetztelefon verfügt, natürlich nicht erreicht werden. Also ein bisschen Geduld, Frieda, ermahnt sie sich, tranquilo. Schließlich bist du hier in Kuba, da gehen die Uhren anders.
Gleich neben dem Eingang hängt ein vergilbtes Gemälde von Faustino Omara, genannt El Guyabero, nach dem dieser Club benannt ist. Am unvermeidlichen Panamahut und an seinen großen Brillengläsern ist der dürre Holguíner Musiker leicht zu erkennen. Ein wenig ähnelt er mit seinen vielen Falten Rubén Gonzales, dem Pianisten des legendären Buena Vista Social Club.
„Ein Frauenheld wie selten einer!“ Der Daumen des Wirts deutet auf das Porträt. „Seien Sie bloß froh, dass er schon tot ist. Selbst mit seinen fast hundert Jahren hätte er Sie noch angemacht, der alte Casanova.“
„Woran ist er denn gestorben? An Syphilis?“
„Ach wo, an Leberkrebs. Also ganz standesgemäß. Und Sie wollen wirklich keinen Schuss Rum in Ihre Cola? Es geht das Gerücht, dass wir in den nächsten Tagen keinen Alkohol mehr ausschenken dürfen, wegen Fidels Begräbnis. Könnte also für längere Zeit die letzte Gelegenheit sein …“
„Nein, danke, eine Limette reicht.“
Es ist nicht wegen dem Leberkrebs, dass sie auf die hochprozentige Zugabe verzichtet. Vorläufig jedenfalls. Sie will einfach ihrem Interviewpartner nüchtern gegenübertreten. Erst die Arbeit, dann der Lohn. Im Dos Estrellas, wo sie gleich nach der Landung eingecheckt hat, wartet auf ihrem Nachtkästchen das, was sie unmittelbar nach ihrer Ankunft erworben hat: eine Flasche Ron Santiago de Cuba Extra Añejo, zwölf Jahre lang in aller Ruhe in alten Eichenfässern gereift. Sie kaufte sie in einer schmuddeligen Bar gleich gegenüber der Pension und brachte sie, in neutrales Zeitungspapier gehüllt, schleunigst auf ihr Zimmer. Dieser Rum stelle, versicherte ihr der Verkäufer, den gleich alten und gleich teuren, aus unerfindlichen Gründen aber viel bekannteren Havana Club geschmacksmäßig in den Schatten. Der Preis für die braungoldene Kostbarkeit überraschte dann aber doch: Mit fünfunddreißig CUC entsprach er in etwa dem Monatslohn eines kubanischen Arbeiters.
Am Nachbartisch wird es plötzlich lebendig.
„Karl hoaß i, und des isch gnua! Jawoll!“
Der da unter Einsatz seines ganzen Körpers auf sein Gegenüber einredet, nein, einbrüllt, verfügt über einen alpinen Akzent. Frieda stellt überrascht fest, dass sie angesichts der österreichischen Mundart ein Hauch von Sentimentalität überkommt: ein waschechter Tiroler, mitten im tiefsten Oriente! Was solche Kontraste an Gefühlen in einem auslösen können! Der ungewohnt sentimentale Anflug ist allerdings schnell wieder vorüber, erweist sich der gut Siebzigjährige doch bereits nach wenigen Worten als ausgesprochener Schweinigel.
„Organisation, mein Junge, Organisation isch alles! Schau, bei mir schaut das so aus: im Sommer Thailand, Kuba im Winter. Wozu hab i denn meine nette kleine Wohnung in Kitz. Die lasst sich um gutes Geld vermieten, solang ich weg bin, an deine deutschen Landsleut’ vor allem. An die Deppen, die meinen, unbedingt beim Hahnenkammrennen dabei sein zu müssen, weil sie ja was Besonderes sind. Weil das ja das Höchschte isch, publicitymäßig. Oder, ah nit schlecht, beim Kitzbühler Generali Open. Für die Miete kann ich ma das ganze Jahr über frische Muschis leisten, verschtehsch, wo immer auf der Welt! Die in Phuket sind die jüngsten, also richtig saftig, haha. Aber: Die Nutten hier haben die bessere Technik. Werden leider a immer unverschämter, was den Preis angeht. Früher sind’s für ein Glasl Cuba Libre mit dir ins Bett g’stiegen, heute wollen’s zwanzig CUC dafür, die kleinen Kommunistinnen. Das nenne ich den Niedergang des Sozialismus.“
Frieda ist drauf und dran, dem Widerling ihre Meinung zu sagen, als die Tür aufschwingt und ein Mann eintritt, der sofort ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Liegt es an seinem langen lockigen Haar, das, wie früher bei den Hippies, mit einem bunten Stirnband zusammengehalten wird, oder einfach an seiner guten Figur? Der Mann flüstert dem Barkeeper etwas ins Ohr, dann lässt er seine Blicke durch den Raum schweifen, auf der Suche nach einem freien Tisch. Als er nicht fündig wird, nähert er sich ohne Umschweife Friedas Platz.
„Darf ich?“, fragt er auf Englisch.
Seine Stimme klingt angenehm, und sein Lächeln wirkt natürlich, sympathisch.
„Bitte sehr!“
Nachdem der Kellner das bestellte Getränk, eine Bierflasche Marke Bucanero, bringt, stoßen sie an.
„Ioannis Vazelios“, stellt er sich vor. „Aus den Staaten.“
„Frieda Prohaska“, sagt sie, „aus Österreich.“
„Angenehm. Von Beruf Journalist“, sagt er.
„Von Beruf Journalistin“, sagt sie. Plaudertasche, rügt sie sich im selben Augenblick. Hatte sie sich nicht vorgenommen, das für sich zu behalten? Und jetzt erzählt sie es dem erstbesten Fremden.
„Oh, welch eine Koinzidenz!“, flüstert er.
„In der Tat“, gibt sie in derselben Lautstärke zurück.
Beide lachen, lauter als beabsichtigt. Vergessen ist der idiotische Tiroler, vergessen auch Fermín, ihr absenter Informant. Die Hoffnung auf fetzige Musik macht sich in ihr breit. Letzteres spricht sie auch aus.
„Sie wissen aber schon, dass die angekündigte Gruppe heute nicht auftreten wird?“, sagt er.
Nein, das weiß sie nicht – woher auch? Und befindet man sich hier nicht in einem Lokal, das berühmt ist für seine allabendliche Livemusik?
„Grundsätzlich richtig“, klärt Ioannis sie auf. „Wegen Fidels Tod sind aber alle Lustbarkeiten bis auf Weiteres gestrichen. Die Trauer der Kubaner um ihren großen Führer darf durch nichts gestört werden.“
Sein Sarkasmus ist unüberhörbar.
„Eigentlich bin ich eh nicht wegen der Musik da, sondern weil ich jemanden treffen wollte“, sagt sie. „Aber anscheinend wurde ich versetzt.“
„Sie haben Freunde hier?“
„Freunde ist zu viel gesagt. Nur ein alter Bekannter, den ich von einem früheren Besuch her kenne. Wahrscheinlich hat er den Termin einfach verschwitzt. Na ja, Sie wissen schon …“
Er nickt verständnisvoll.
„Darf ich fragen, wo in Holguín Sie wohnen?“
„Im Dos Estrellas, einer kleinen Pension. Und Sie?“
„Im Islazul Pernik. Man fragt sich, wie dieses Hotel es schaffen konnte, auf dreieinhalb Sterne zu kommen. Es dürfte noch aus der Blütezeit des Kalten Kriegs stammen, vermutlich benannt nach der gleichnamigen bulgarischen Stadt.“
Sieh an, staunt Frieda. Ein Amerikaner, der sich in Osteuropa auskennt.
„Sie sind also nicht zufrieden mit Ihrer Bleibe?“
„Sagen wir so: Wenn man ein Faible für sozialistischen Plattenbau hat, kommt man im Pernik auf seine Rechnung. Es gibt sogar einen hübschen, blau gefärbten Swimmingpool dort, leider ohne Wasser. Muss man sich halt dazudenken, so wie manches in diesem Land. Und Sie, sind Sie mit Ihrer Unterkunft zufrieden?“
„Absolut. Die Besitzer, ein älteres Pärchen, sind dem allgemeinen Trend gefolgt und haben ihre halb verfallene Villa zu einer casa particular, einer kleinen Pension, umgebaut. Recht hübsch, muss ich sagen. Es hat sogar eine Dachterrasse, für romantische Nächte.“
Verdammt, das hätte sie sich jetzt verkneifen sollen! Aber er scheint die letzte Bemerkung ohnehin überhört zu haben.
„Außerdem“, beeilt sie sich hinzuzufügen, „sind meine beiden Gastgeber glühende fidelistas, die mich eingeladen haben, morgen dabei zu sein, wenn die sterblichen Überreste Fidels durch Holguín gefahren werden.“
„Woher wollen Sie wissen, dass sie Anhänger von Castro sind?“
„Als ich in ihrer Küche die Formulare ausfüllte, lief der Fernseher in voller Lautstärke. Sie brachten eine Doku über das Leben Castros, von den Anfängen bis zu seinem Tod. Laura Inés, meine Gastgeberin, hatte Tränen der Rührung in den Augen, als der junge Fidel zusammen mit Che zu sehen war.“
Ioannis blickt nachdenklich auf seine Bierflasche, auf deren Etikett der Kopf eines Freibeuters abgebildet ist.
„Woran denken Sie?“
„An eine andere Laura Inés, die, würde sie noch leben, jetzt vermutlich Tränen ganz anderer Art in den Augen hätte. Sie wissen nicht, wen ich meine?“
„Nein, sollte ich?“
„Las Damas de Blanco, die Damen in Weiß. Sie sind Ihnen sicher ein Begriff?“
„Natürlich. Die in weißen Kleidern gegen die Regierung demonstrieren.“
„Genau. Nun, eine gewisse Laura Inés Pollán war deren Sprecherin, in ihrer Wohnung in Havanna trafen sich einst die Dissidenten aus dem ganzen Land. In den hiesigen Medien wurde sie als gefährliche Staatsfeindin hingestellt. 2011 starb sie unter ungeklärten Umständen, weshalb manche die kubanische Regierung beschuldigen, mit ihrem Tod zu tun zu haben. Präsident Barack Obama kondolierte damals sogar ihrer Familie.“
„Sie kennen sich wirklich gut aus. Darf ich fragen, für welche Zeitung Sie arbeiten?“
„Für keine Zeitung – für ein Journal. Es nennt sich TIME Magazine. Vielleicht haben Sie ja schon davon gehört.“
Mein lieber Schwan! Da hockt sie jetzt wohl einem echten Profi gegenüber, womöglich einem Promi auf dem Gebiet des Journalismus! Immerhin handelt es sich bei TIME um die auflagenstärkste Wochenzeitschrift der Welt und die wichtigste in den USA.
Sie setzt ein breites Lächeln auf. „Ja, ich glaube, dieser Name ist in unserer Redaktion schon einmal gefallen. Ich bin freie Journalistin bei opinion, müssen Sie wissen. Ist ebenfalls ein Wochenmagazin, nur halt mit etwas … äh … anderen Dimensionen.“
„Und angesiedelt in Wien. Ich weiß.“
Für den Bruchteil einer Sekunde glaubt sie tatsächlich, er habe schon von opinion gehört. Aber natürlich hat er nur geraten, ins Blaue hinein.
Beide grinsen entspannt. Bei solch ungleichen Voraussetzungen kann man sich Revierkämpfe ersparen.
„Hätten Sie nicht auch Lust, dabei zu sein, wenn sie Fidel heim nach Santiago bringen?“, fragt sie. „Erlebt man ja nicht alle Tage, diesen Totenkult.“
„Klar, sehr gerne. Ich wusste gar nicht, dass die Karawane hier morgen vorbeizieht. In dieser Sache haben eindeutig Sie einen Informationsvorsprung, Frau Kollegin!“
„Das kommt vielleicht daher, dass ich nicht in einem Nobelhotel für Amerikaner abgestiegen bin, sondern dort, wo man noch Kontakt hat zur einheimischen Bevölkerung.“
„Sie meinen zu jenem Teil der Bevölkerung, der kritiklos nachbetet, was der Führer befiehlt …“
Das beiderseitige Flachsen geht noch eine Weile weiter, und Frieda genießt es, wie Vazelios locker und dennoch sachkundig mit ihr parliert, von Überheblichkeit keine Spur. Der Wechsel vom Sie zum Du geht ohne Aufhebens vonstatten. Sie merkt es daran, dass er sie ab einem gewissen Zeitpunkt mit dem Vornamen anspricht. Seine Aussprache von Frieda tönt überraschend vertraut, ohne das von Briten und Amerikanern sonst so gerne breitgequetschte R. Sie fragt ihn, ob er Deutsch spreche, er verneint. Dafür behauptet er, sich auf Spanisch, Französisch, Griechisch und sogar Arabisch ganz passabel ausdrücken zu können. Vor allem Letzteres gebe in seiner Heimat mitunter Anlass zu Stirnrunzeln.
„Wer sich bei uns für fremde Sprachen interessiert, gilt schon fast als unamerikanisch. Jedenfalls, wenn man die Stimme des einfachen Volkes als Maßstab nimmt.“
„Ioannis ist ja auch nicht eben ein typischer Vorname für einen Amerikaner, oder?“
„Nein, und Vazelios erst recht kein typisch amerikanischer Familienname. Aber welcher Name verdient schon das Attribut typisch? In den USA stammen wir doch alle von irgendeiner Sippe aus good old Europe ab, oder von Juden, Chinesen, Arabern … Meine Eltern kommen beide aus Kreta, in meinen Adern fließt also reinstes griechisches Blut. Und dennoch fühle ich mich so amerikanisch, wie man sich nur fühlen kann.“
Wie schön, denkt Frieda, so eindeutig und positiv empfände sie auch gerne. Sie hat mit ihrer nationalen Identität immer noch Probleme, obwohl ihre Vorfahren väterlicherseits schon vor vier oder fünf Generationen aus Böhmen in die K&K-Metropole ausgewandert waren.
Als die Müdigkeit sie übermannt, beschließt Frieda die angenehme Unterhaltung zu beenden. Ehe sie ins Dos Estrellas aufbricht, vereinbaren sie, sich am nächsten Tag um fünfzehn Uhr bei der Methodistenkirche an der Carretera Central zu treffen, um dort gemeinsam auf den Konvoi mit Fidels Urne zu warten. Ioannis vermutet, dass Fidel noch selbst angeordnet hat, wie seine Leiche von Havanna nach Santiago de Cuba überführt werden soll. Er war immer schon ein großer Meister der Inszenierung.
„Hasta pronto“, sagt sie zum Abschied.
„Hasta siempre“, lautet seine Antwort.
Die zwei auf die Wangen gehauchten Küsschen spürt sie noch, als sie längst im Taxi sitzt.
4
Sie erwacht und registriert: ein Wunder! Der Extra Añejo steht immer noch ungeöffnet auf ihrem Nachtkästchen. Hat sie es tatsächlich fertiggebracht, die Flasche Rum unangetastet zu lassen? Ehe sie mit Rafi schwanger war, wurde geschluckt, was immer ihr an Hochprozentigem in die Finger kam. Anlässe fanden sich zur Genüge: Erfolg, Misserfolg, Langeweile, Erregung … Anders gesagt: Es brauchte keinen speziellen Anlass, um zu trinken. Überraschenderweise hat ihre Leber das alles mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Eine Entziehungskur kam für sie nie in Frage. Dazu hätte sie sich ja eingestehen müssen, wie abhängig sie von dem Zeug längst war. Mit der Schwangerschaft erledigte sich das Problem wundersamerweise, vorübergehend jedenfalls ...
Gerade ist sie mit dem Duschen und Föhnen fertig, als es an der Tür klopft. Laura Inés, ihre Wirtin, eskortiert Frieda in den Frühstücksraum, ein quadratisches Zimmer im Dekor der kubanischen Neoromantik. Laura Inés scheint eine große Liebhaberin dieses Stils zu sein: an der Decke weiße Girlanden aus Stuck, die Wände in penetrantem Pink mit aufgemalten grüngelben Fantasiepflanzen, dazu gepolsterte Sitzmöbel, die aus der schwülstigen Hinterlassenschaft des Bayernkönigs Ludwig II. stammen könnten. In kitschig lackierten Rahmen hängen zahlreiche Porträts an der Wand; die meisten von ihnen zeigen lebende, ein paar auch bereits verstorbene Familienmitglieder, wie Laura Inés munter erklärt, während sie Kaffee und Spiegeleier mit Schinken serviert.
„Sieh mal! Ist er nicht ein hübscher Junge, unser José?“
Sie zeigt auf einen schlanken Mann in weißem, eng anliegendem Anzug.
„Und weißt du, wo das Foto aufgenommen wurde? In Wien, ja, in einer großen Tanzschule! Da staunst du, nicht wahr?“
„Allerdings!“, bestätigt Frieda. „Und was hat er da gemacht?“
Laura Inés’ Blick geht ganz nach innen, als sie das Bild von der Wand nimmt und Frieda stolz präsentiert.
„Oh, er lebt immer noch dort! Als Tanzlehrer. Unterrichtet lateinamerikanische Tänze, vor allem Rumba und Cha-Cha-Cha. Und natürlich den Son Cubano.“
Spontan geht ihre gedrungene Figur in Tanzposition: der linke Arm adrett erhoben, das Becken vorgewölbt, keck der Blick. Sekunden später verblasst sie wieder zur biederen Gastwirtin.
„Die Liebe zum Tanzen hat er von mir, sein Vater macht sich leider nichts daraus. Aber jetzt ist Ramón doch stolz darauf, dass einer aus unserer Familie es dank seiner Begabung ins Ausland geschafft hat. Ich meine, nicht nach Miami, wo der ganze Abschaum hingeht, sondern ins richtige Ausland.“
Sie hängt das Bild wieder an die Wand.
„Aber natürlich sind wir auch ein bisschen traurig, weil wir den Jungen höchstens zwei Wochen im Jahr sehen. Wenn er auf Besuch kommt, bringt er uns immer irgendwelche Süßigkeiten aus Österreich mit. Unser Josito ist wirklich ein guter Junge … Darf ich dir noch etwas Kaffee nachschenken?“
Gerne lässt Frieda sich zu einer zweiten Tasse verführen.
„Und José will auf Dauer in Österreich bleiben?“
Es ist Laura Inés anzusehen, wie sie mit sich ringt. Dass die Frage ihr Schmerzen bereitet. Dann gibt sie sich doch einen Ruck.
„Mein Sohn hat ja jetzt einen festen Freund in Wien, wenn du verstehst. Weshalb er, fürchte ich, nicht so schnell nach Kuba zurückkehren wird. Es wäre für die beiden hier sehr hart. In Havanna, ja, da denkt sich keiner mehr etwas dabei, wenn zwei Männer Händchen haltend im Park sitzen, aber in Holguín – unvorstellbar!“
„Hat sich diesbezüglich nicht schon manches zum Besseren verändert? Ich habe gehört, dass sich Raúl Castros Tochter Mariela höchstpersönlich für die Rechte der Homosexuellen starkmacht.“